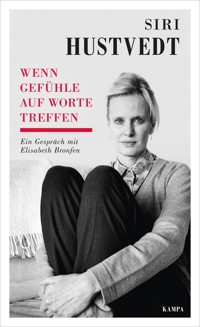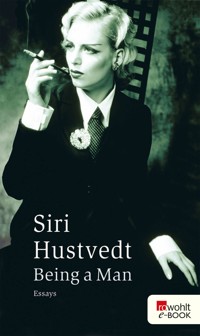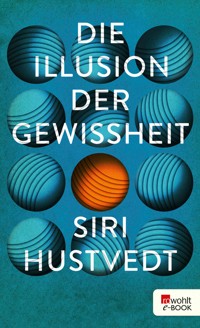9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In «Nicht hier, nicht dort» sind ihre frühen essayistischen Schriften versammelt. Der Titel ist programmatisch: Hustvedt bezieht ihn auf ihre geographische Herkunft als zwischen den Kulturen aufgewachsene Tochter norwegischer Einwanderer und auf ihren künstlerischen Standpunkt als Beobachterin und Bewahrerin: die Fiktion als Zwilling der Erinnerung, angesiedelt zwischen der realen Welt und der gedachten, gefühlten der Phantasie. Die Sprache als Mittlerin zwischen diesen Welten steht im Mittelpunkt dieser Betrachtungen zu Literatur und bildender Kunst: Sie erschließt, ob als Bildsprache des Malers oder als literarische des Schriftstellers, ein komplexes System von changierenden Zeichen und Symbolen, deren Struktur und Bedeutung in unserem Bewusstsein und zugleich außerhalb von uns angelegt sind. ln dieses Zwischenreich blickt man, wenn man in den leeren Spiegel von Vermeers «Annunziata» oder durch «Gatsbys Brille» bei F. Scott Fitzgerald schaut oder wenn man die sprechenden Figurennamen in Charles Dickens' «Unser gemeinsamer Freund» betrachtet. An diesen und anderen Beispielen erläutert Hustvedt, wie der künstlerische Schaffensprozess zu Erkenntnis führt. Ein Essay über den puritanischen Dirigismus, mit dem US-amerikanische Gerichte und Institutionen die Sexualität regulieren wollen, erforscht ebenfalls ein Zwischenreich: jenes wiederum stark durch Phantasie, Projektion und Experiment geprägte Feld der Annäherung, in dem jeder erotische Kontakt zwischen Menschen beginnt. Siri Hustvedt unterscheidet, wie in ihren Romanen, nicht streng zwischen ihrer privaten Biographie und ihrem öffentlichen Werk. Im Werk schwingt stets ein Widerhall des Lebens mit. Deshalb ist dieses Buch ein Glücksfall. Es gibt Einblick in ihre Arbeit und in ihr Leben und unterhält zudem auf hohem Niveau. «Siri Hustvedt schreibt im Wortsinn traumhaft – romantisch, gefühlvoll und zugleich verstörend unheimlich.» Salman Rushdie «Siri Hustvedt ist eine ebenso lebhafte wie sprachmächtige Schriftstellerin.» Don DeLillo
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Siri Hustvedt
Nicht hier, nicht dort
Essays
Über dieses Buch
In «Nicht hier, nicht dort» sind ihre frühen essayistischen Schriften versammelt. Der Titel ist programmatisch: Hustvedt bezieht ihn auf ihre geographische Herkunft als zwischen den Kulturen aufgewachsene Tochter norwegischer Einwanderer und auf ihren künstlerischen Standpunkt als Beobachterin und Bewahrerin: die Fiktion als Zwilling der Erinnerung, angesiedelt zwischen der realen Welt und der gedachten, gefühlten der Phantasie.
Die Sprache als Mittlerin zwischen diesen Welten steht im Mittelpunkt dieser Betrachtungen zu Literatur und bildender Kunst: Sie erschließt, ob als Bildsprache des Malers oder als literarische des Schriftstellers, ein komplexes System von changierenden Zeichen und Symbolen, deren Struktur und Bedeutung in unserem Bewusstsein und zugleich außerhalb von uns angelegt sind. ln dieses Zwischenreich blickt man, wenn man in den leeren Spiegel von Vermeers «Annunziata» oder durch «Gatsbys Brille» bei F. Scott Fitzgerald schaut oder wenn man die sprechenden Figurennamen in Charles Dickens’ «Unser gemeinsamer Freund» betrachtet. An diesen und anderen Beispielen erläutert Hustvedt, wie der künstlerische Schaffensprozess zu Erkenntnis führt. Ein Essay über den puritanischen Dirigismus, mit dem US-amerikanische Gerichte und Institutionen die Sexualität regulieren wollen, erforscht ebenfalls ein Zwischenreich: jenes wiederum stark durch Phantasie, Projektion und Experiment geprägte Feld der Annäherung, in dem jeder erotische Kontakt zwischen Menschen beginnt.
Siri Hustvedt unterscheidet, wie in ihren Romanen, nicht streng zwischen ihrer privaten Biographie und ihrem öffentlichen Werk. Im Werk schwingt stets ein Widerhall des Lebens mit. Deshalb ist dieses Buch ein Glücksfall. Es gibt Einblick in ihre Arbeit und in ihr Leben und unterhält zudem auf hohem Niveau.
«Siri Hustvedt schreibt im Wortsinn traumhaft – romantisch, gefühlvoll und zugleich verstörend unheimlich.»
Salman Rushdie
«Siri Hustvedt ist eine ebenso lebhafte wie sprachmächtige Schriftstellerin.»
Don DeLillo
Vita
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sechs Romane publiziert. Mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Der Sommer ohne Männer» und «Die gleißende Welt». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Nicht hier, nicht dort», «Leben, Denken, Schauen», «Being a Man» und «Die Illusion der Gewissheit» vor.
Uli Aumüller übersetzt neben Siri Hustvedt u.a. Jeffrey Eugenides, Jean Paul Sartre, Albert Camus und Milan Kundera. Für ihre Übersetzungen erhielt sie den Paul-Celan-Preis und den Jane-Scatcherd-Preis.
Impressum
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel «Yonder» 1998 bei Henry Holt and Company, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2024
Copyright © 2000 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Yonder» Copyright © 1998 by Siri Hustvedt
Redaktion Thomas Überhoff
Covergestaltung Walter Hellmann
Coverabbildung «Junge Dame mit Perlenhalsband» von Jan Vermeer van Delft. Staatliche Museen zu Berlin. bpk / Gemäldegalerie, SMB / Jörg P. Anders
ISBN 978-3-644-00479-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Nicht hier, nicht dort
1
2
3
4
5
Vermeers Annunziata
Gatsbys Brille
Ein Plädoyer für Eros
U. G. F. wieder gelesen
1. Metapher
2. Das Gerüst der Gesellschaft
3. Abfall
4. Wahnsinn
5. Ich und Es
6. Der Traum von einer gemeinsamen Sprache
Gespenster am Tisch
Für Ester Vegan Hustvedt und Lloyd Hustvedt
Nicht hier, nicht dort
1
Mein Vater fragte mich einmal, ob ich wüsste, wo yonder[a] ist. Ich sagte, meiner Ansicht nach sei yonder ein anderes Wort für «dort». Er lächelte und sagte: «Nein, yonder ist zwischen hier und dort.» Diese kleine Geschichte ist mir jahrelang als ein Beispiel für die Magie der Sprache in Erinnerung geblieben: Sie bestimmte einen neuen Raum – einen mittleren Bereich, nicht hier, nicht dort –, einen Ort, der für mich einfach nicht existiert hatte, bevor er einen Namen bekam. Während meines Vaters kurzer Erklärung und jedes Mal, wenn ich daran zurückdenke, erschien und erscheint vor meinem geistigen Auge eine Landschaft: Ich stehe auf der Kuppe eines kleinen Hügels, blicke hinunter in ein weites Tal mit einem einzelnen Baum, und jenseits davon liegt der Horizont, der sich als eine Reihe von niedrigen Bergen oder Hügeln abzeichnet. Dieses belanglose, aber brauchbare Bild kehrt jedes Malwieder, wenn ich an yonder denke, eines jener wunderbaren Wörter, die, wie ich später erfuhr, von den Linguisten «Unstete» genannt werden – Wörter, die anders sind als andere, weil sie vom Sprecher mit Bedeutung erfüllt werden und sich entsprechend bewegen. Linguistisch ausgedrückt bedeutet dies, dass man sich nie wirklich yonder befinden kann. Ist man bei dem Baum angekommen, wird yonder zum Hier und weicht immer weiter an den imaginären Horizont zurück. Wacklige Wörter ziehen mich an. Die Tatsache, dass hier und dort, je nachdem, wo ich bin, gleiten und sich verschieben, ist für mich irgendwie ergreifend, da sie sowohl die prekäre Beziehung zwischen Wörtern und Dingen als auch die wundersame Flexibilität der Sprache enthüllt.
Eigentlich fasziniert mich nicht so sehr, an einem Ort zu sein, als nicht dort zu sein: Wie Orte im Geist fortleben, sobald man sie verlassen hat, wie sie vorgestellt werden, ehe man ankommt, oder wie sie scheinbar aus dem Nichts hervorgerufen werden, um einen Gedanken oder eine Geschichte zu illustrieren, wie mein Baum dort unten. Diese mentalen Räume sind eine viel vollständigere Landkarte unseres Innenlebens als jede «wirkliche» Landkarte und bestimmen die Grenzen des Hier und Dort, die auch das formen, was wir im Augenblick sehen. Meine private Geographie schließt, wie die vieler Menschen, riesige Teile der Welt aus. Ich habe meine eigene Version von Saul Steinbergs Karte der Vereinigten Staaten, die ein alles überragendes Manhattan, einen geschrumpften Mittelwesten, Süden und Westen zeigt und in einem etwas deutlicher sichtbaren Kalifornien mit Los Angeles endet. In meinem Leben gab es nur drei wichtige Orte: Northfield in Minnesota, wo ich geboren bin und mit meinen Eltern und drei jüngeren Schwestern aufwuchs; Norwegen, das Geburtsland meiner Mutter und der Großeltern meines Vaters; und New York, wo ich seit siebzehn Jahren lebe.
Als Kind bestand die Landkarte für mich nur aus zwei Gebieten: Minnesota und Norwegen, meinem Hier und meinem Dort. Und obwohl jeder vom anderen getrennt blieb – Norwegen war weit weg jenseits des Ozeans, und Minnesota war unmittelbar, sichtbar und in die Tausende von Unterteilungen gegliedert, die unsere Alltagsgeographie ausmachen –, vermischten sich die beiden Orte in der Sprache. Ich sprach norwegisch, bevor ich englisch sprach. Buchstäblich meine Muttersprache, bleibt Norwegisch für mich eine Sprache der Kindheit, der Zärtlichkeit, des Essens und der Lieder. Ich spüre seinen Rhythmus oft unter meinen englischen Gedanken und meiner Prosa, und manchmal dringt sein Wortschatz in beide ein. Ich sprach zuerst norwegisch, weil meine Großmutter mütterlicherseits vor meinem ersten Geburtstag nach Northfield kam und neun Monate bei uns blieb. Aber nachdem sie nach Hause zurückgekehrt war, begann ich, Englisch zu lernen und vergaß das Norwegische. Ich kam wieder hinein, als ich 1959 mit meiner Mutter und meiner Schwester nach Norwegen reiste. Im Laufe jener Monate in Norwegen, als ich vier und meine Schwester Liv erst zweieinhalb Jahre alt war, vergaßen wir das Englische. Zurück in Minnesota, fiel es uns wieder ein, und prompt vergaßen wir das Norwegische. Obwohl wir die Sprache nicht mehr benutzten, lebte sie in unserem Haus weiter. Meine Eltern sprachen untereinander oft norwegisch, und es gab Wörter, die Liv, Astrid, Ingrid und ich gewohnheitsmäßig gebrauchten und für englische Wörter hielten, die es aber gar nicht waren. Zum Beispiel ersetzten die norwegischen Wörter für Lätzchen, Wurst, Pinkeln und Hintern ihre englischen Äquivalente. Liv und ich erinnern uns daran, dass wir diese Wörter Freunden gegenüber benutzten und wie überrascht wir über deren verwirrte Gesichter waren. Die zur Kindheit und zum Essen gehörigen Dinge und natürlich die Sprache der Toilette waren so eng mit unserer Mutter verbunden, dass sie nur auf Norwegisch existierten. Als ich zwölf Jahre alt war, verbrachte mein Vater, der Professor für norwegische Sprache und Literatur ist, ein Forschungsurlaubsjahr in Bergen, und das Norwegische fiel mir gleichsam blitzartig wieder ein. Danach blieb es haften. Die Geschwindigkeit, mit der wir vier Schwestern unser Leben ins Norwegische übertrugen, war schon recht bemerkenswert. In jenem Jahr spielten, dachten und träumten wir auf Norwegisch.
1972 kehrte ich nach Norwegen zurück und besuchte in Bergen ein Jahr lang das Gymnasium. Diesmal war meine Familie nicht bei mir. Ich lebte bei meiner Tante und meinem Onkel außerhalb der Stadt und fuhr mit dem Bus zur Schule. Irgendwann in den ersten Wochen meines Aufenthalts hatte ich einen Traum. An seinen Inhalt kann ich mich nicht erinnern, aber der Traum verlief norwegisch mit englischen Untertiteln. Ich werde an diesen Traum immer als an einen Schwebezustand denken. Sein filmischer Code drückte genau meine Stellung zwischen zwei Kulturen und zwei Sprachen aus. Aber die metaphorischen Untertitel unter meinem Leben verschwanden bald, und ich tauchte in die «Original»sprache meines Traums ein. Es ist jetzt dreiundzwanzig Jahre her, dass ich wirklich in der norwegischen Sprache gelebt habe. Es überrascht mich selbst, dass ich weniger als drei meiner vierzig Lebensjahre tatsächlich in Norwegen verbracht habe und fast jede Minute davon in Bergen. Ich spreche mit einem so breiten Bergener Akzent Norwegisch, dass meine Eltern es komisch finden. Dieser Dialekt ist das wahre Erbe meiner Jahre in Bergen, der Stempel einer bleibenden Erfahrung. Es bestehen gute Aussichten, dass nicht einmal die Senilität ihn mir nehmen wird, da Alte und Geistesschwache oft in die Sprache ihrer frühen Kindheit zurückverfallen. Doch das Norwegische überlebt in mir nicht nur als ein Zeichen von Bergen, sondern auch als eine Spur meines Elternhauses in Northfield. Nicht umsonst schließlich fragte mein Stiefsohn Daniel, als er klein war und sich darauf freute, Weihnachten mit seinem Vater und mir nach Minnesota zu fahren: «Wann fahren wir nach Norwegen?»
Wenn die Sprache das typischste Kennzeichen eines Ortes ist, und das glaube ich, dann stellt meine Kindheitsgeschichte des Vergessens und Erinnerns vielleicht im Kleinen die Dialektik jeder Einwanderererfahrung dar: Hier und Dort stehen in einer Beziehung ständiger Spannung zueinander, die hauptsächlich von der Erinnerung verursacht wird. Mein Vater, ein norwegischstämmiger Amerikaner der dritten Generation, spricht Englisch mit norwegischem Akzent, das Vermächtnis einer amerikanischen Kindheit, in der meistens Norwegisch gesprochen wurde. Obwohl meine Mutter und mein Vater durch einen Ozean getrennt waren, wuchsen sie mit derselben Sprache auf.
Meine Mutter war dreißig, als sie in die Vereinigten Staaten kam, um hier zu leben. Sie ist jetzt amerikanische Staatsbürgerin und behauptet jedes Mal, wenn sie wählen geht, sie sei froh darüber. Ihre Drohung, das erste Flugzeug zurück nach Norwegen zu nehmen, falls Goldwater zum Präsidenten gewählt würde, ist mir jedoch noch deutlich in Erinnerung. Norwegen war immer da, und sein Ruf war immer hörbar. Mein Vater kam mit einem Fulbrightstipendium an die Universität von Oslo, wo er meine Mutter kennen lernte. Einzelheiten darüber, wie die beiden sich kennen lernten, sind mir unbekannt. Was in manchen Familien mythologisiert wird, war in unserer vertraulich. Die Schwester meiner Mutter sprach bei der Beschreibung dieser Begegnung einmal von «Liebe auf den ersten Blick», aber ich habe nie einen Grund gesehen, meine Nase in etwas zu stecken, was allein ihre Sache ist. Oslo ist zwar nicht Paris, aber es ist viel größer als Northfield und viel weniger provinziell, und als meine Mutter von einem Ort zum anderen reiste, um meinen Vater zu heiraten, dessen Familie sie nie gesehen hatte, muss sie sich den vor ihr liegenden Ort ausgemalt haben. Im Geiste muss sie eine Welt gesehen haben, die mein Vater ihr zumindest teilweise beschrieben hatte, aber ob diese Welt mit der übereinstimmte, die sie tatsächlich vorfand, ist eine ganz und gar andere Sache. Sicher ist, dass sie eine Welt hinter sich ließ. Als Kind lebte sie in Mandal, der südlichsten Stadt Norwegens, und diese Jahre waren allen Berichten (nicht nur dem meiner Mutter) zufolge idyllisch. Ihre Erinnerungen an ihre ersten zehn Lebensjahre mit ihren Eltern, zwei Brüdern und einer Schwester in einem schönen Haus oberhalb der Stadt, in der ihr Vater Poststellenleiter war, sind so schmerzhaft glücklich, dass sie sagt, sie habe meinen Schwestern und mir ihre Erinnerungen manchmal vorenthalten, aus Angst, wir könnten uns im Vergleich dazu benachteiligt fühlen. Als sie zehn Jahre alt war, verlor ihr Vater sein Geld und sein Land. Er hatte für einen Verwandten einen Geschäftsvertrag unterschrieben, der platzte. Obwohl mein Großvater sich vor dem Ruin hätte retten können, zahlte er für den Rest seines Lebens diese Schulden ab, die eigentlich nicht seine waren. Ich glaube, dieses Ereignis war der größte Knick im Leben meiner Mutter. Plötzlich und unwiderruflich schnitt es sie von ihrem geliebten Heim ab und warf sie so unweigerlich in ein anderes, als hätte die Erde sich aufgetan und einen unüberwindlichen Abgrund zwischen beiden gebildet. Die Familie zog nach Askim, außerhalb von Oslo, und deshalb ist in der Stimme meiner Mutter sowohl ein südlicher wie ein östlicher Akzent hörbar: die vermischten Laute von beiden Seiten des Abgrunds. Ich habe das Glück der ersten zehn Lebensjahre meiner Mutter in Mandal nie angezweifelt. Sie hatte Eltern, die sie liebten, dazu Felsen und Berge und den Ozean direkt vor der Haustür. Es gab Dienstmädchen, die die Hausarbeit leichter machten, Geschwister und Verwandte in nächster Nähe und ausgiebige und lange Weihnachtsfeste zu Haus und bei Tante Andora und Onkel Andreas, Menschen, die ich mir immer wieder vorgestellt, aber nur auf Fotos gesehen habe, auf denen sie noch zu jung waren, um die Tante und der Onkel zu sein, die meine Mutter kannte. Aber mir scheint, dass der Verlust des Paradieses es umso leuchtender macht, eigenartigerweise nicht nur für meine Mutter, sondern auch für mich. Ein seltsamer, aber emotional bedeutsamer Zufall wollte, dass es, wenn ich in Mandal war, nie geregnet hat. Regen ist die Geißel aller Norweger; sie suchen Sonne mit einem Eifer, der jemandem, sagen wir mal aus Kalifornien, etwas verzweifelt anmuten muss. In Norwegen regnet es wirklich sehr oft. Doch als meine Mutter 1959 mit uns hinfuhr, war es ein legendär sonniger Sommer, und als ich 1991 mit meiner Mutter, meinen Schwestern und meiner eigenen Tochter zu einem Familientreffen zum letzten Mal in Mandal war, schien tagelang die Sonne, und die Stadt leuchtete im klaren, vollkommenen Licht des Himmels.
Meinen Großvater habe ich nie gekannt. Er starb, als meine Mutter neunzehn Jahre alt war. Es gibt Fotos von ihm. Auf einem steht er vor einem weißen Pferd mit drei kleinen Kindern auf dem Rücken. Er trägt einen Strohhut, der seine Augen schützt, und hat eine Zigarette im Mund. Das Bemerkenswerteste an diesem Bild ist seine Haltung: stolz und aufrecht, aber es ist noch etwas anderes darin, etwas fast, aber nicht ganz Übermütiges. Irgendwie merkt man, dass er sich nicht in Positur geworfen hat. Er hatte ein intelligentes Gesicht – vor allem seine Augen vermitteln einen Eindruck von Nachdenklichkeit. Meine Großmutter sagte, er habe (fast ausschließlich) kirchengeschichtliche Bücher und Kierkegaard gelesen. Sie liebte ihn über alles und hat nach seinem Tod nicht wieder geheiratet. Ich bin sicher, dass sie nie auch nur auf den Gedanken gekommen ist. Wenn ich an die Mutter meiner Mutter denke, erinnere ich mich an ihre Stimme, ihre Gesten und ihre Berührung. Sie alle waren sanft, kultiviert; zugleich war sie offen und leidenschaftlich gefühlvoll. Aus irgendeinem Grund erinnere ich mich mit ungeheurer Deutlichkeit daran, wie ich zwölfjährig mit meinen Schwestern und meinen Eltern ihr Haus betrat. Es war Winter, und meine Mutter hatte mir eine zu meinem braunen Mantel passende weiße Mütze und einen weißen Schal gestrickt. Als meine Großmutter mich begrüßte, legte sie die Hände um mein Gesicht und sagte: «Wie schön du bist in Weiß, mein Liebes.»
Als ich zum letzten Mal in Norwegen lebte, besuchte ich meine Großmutter jeden Tag nach der Schule. Sie wohnte in einer winzigen Wohnung über einem kleinen alten Friedhof in der Stadt. Sie freute sich immer, mich zu sehen. Ich fürchte, ich war in jenem Jahr eine entsetzlich ernsthafte Jugendliche, ein Mädchen, das mit der gleichen Ehrfurcht Faulkner und Baldwin, Keats und Marx las, und ich muss eine ziemlich humorlose Gesprächspartnerin gewesen sein. Aber ich war mit niemandem lieber zusammen als mit ihr, und das hat mich vielleicht lebhafter gemacht. Wir tranken Kaffee. Wir redeten. Sie liebte Dickens, den sie auf Norwegisch las. Jahre nach ihrem Tod schrieb ich eine Dissertation über Charles Dickens, und obwohl meine Studie sie wahrscheinlich erschreckt hätte, hatte ich das komische Gefühl, dass ich über die Beschäftigung mit dem englischen Romancier zu meinen norwegischen Wurzeln zurückkehrte.
Meine mormor (im Norwegischen werden die mütterliche und die väterliche Linie unterschieden: mor-mor bedeutet wörtlich «Mutter-Mutter») ist der Mittelpunkt meiner wahren Erfahrungen von Norwegen, Norwegen im Besonderen und im Alltag, Norwegen als Heimat. Sie war eine Lady im alten Sinn des Wortes – das weibliche Pendant zum Gentleman –, eine Frau, die ihr Erbe an Vornehmheit aus dem 19. Jahrhundert nie ablegte. Ich war tief in meiner selbstgerechten sozialistischen Phase und werde nie vergessen, wie sie mit ihrer sanften Stimme zu mir sagte: «Du bist bestimmt die Erste in der Familie, die bei einer Demonstration zum 1. Mai mitmarschiert.» Jedes Mal, wenn sie ausging, trug sie Hut und Handschuhe, sie staubte jeden Tag ihre blitzsaubere Wohnung ab, einschließlich jedes einzelnen Bilderrahmens, der an der Wand hing, und war schockiert, wenn ihre Putzfrau ihr gegenüber die vertrauliche Anrede du benutzte. Ich kann mich sehr gut an ihre kleine Wohnung erinnern – das elegante blaue Sofa, die Bilder an der Wand, den glatt polierten Tisch, den Vogelkäfig mit ihrem Sittich Bitte Liten, ein Name, den ich mit «kleines Etwas» übersetzen würde. Und ich erinnere mich mit glühender Zärtlichkeit an jeden Gegenstand. Hätte ich meine Großmutter nicht geliebt und hätte sie meine Mutter und mich nicht so geliebt, wären diese Gegenstände einfach nur Dinge. Als Mormor starb, ging ich mit meiner Mutter um unser Haus in Minnesota herum, und sie sagte, das Eigenartigste am Tod ihrer Mutter sei, dass ein Mensch, der nur ihr Bestes gewollt hatte, nicht mehr da war. Ich erinnere mich genau, wo wir im Garten standen, als sie das sagte. Ich erinnere mich an das sommerliche Wetter, das von der Hitze leicht vergilbte Gras und den Wald zu unserer Linken. Es ist, als hätte ich ihre Worte in diese Landschaft eingeschrieben, und das Komische ist, dass sie für mich noch immer darin eingeschrieben stehen. Nicht lange nach diesem Gespräch träumte ich, meine Großmutter lebe und spreche zu mir. Ich erinnere mich nicht an das, was sie im Traum sagte; es war einer jener Träume, in denen man sich dessen bewusst ist, dass der Mensch tot ist, aber plötzlich lebt er und ist bei einem. Obwohl mir alle anderen architektonischen Einzelheiten abhanden gekommen sind, weiß ich noch, dass ich in einem Zimmer saß und meine Großmutter zu mir hereinkam. Es war ein Schwellentraum, eine räumliche Umkehrung meiner Erinnerung daran, wie ich zu ihr hineinging und sie zu mir sagte, wie schön ich in Weiß sei. Ich erinnere mich, wie überglücklich ich war, sie zu sehen.
Meine Tochter Sophie hat meine Mutter von jeher «Mormor» genannt, und kein Name könnte deutlicher die mütterliche Linie wachrufen. Muttermutter ist für mich eine Beschwörung von Schwangerschaft und Geburt als solcher, davon, dass ein Mensch aus einem anderen kommt und dessen Wiederholung in der Zeit ist. Als ich Sophie erwartete, hatte ich das einzige Mal in meinem Leben das Gefühl, körperlich in der Mehrzahl zu sein – zwei in einer. Aber natürlich war es schon einmal vorgekommen, als ich selbst mich in jenem Urraum befand. Die Gebärmutter ist geheimnisvoll. Wir können uns nicht an ihre flüssige Welt erinnern, aber wir wissen heute, dass der Fötus Stimmen hört. Nach der Gewaltsamkeit der Geburt (kein Kurs, keine Atemübungen und kein Geburtskultquatsch der Welt macht das Ereignis gewaltlos) überbrückt das Erkennen der Stimme seiner Mutter durch das Neugeborene die erste, brutale Trennung.
2
Schon aufgrund ihrer Natur ist die Bezeichnung Urraum, mütterlicher Raum Unsinn; die menschliche Erfahrung darin ist undifferenziert und kann daher nicht in Worten ausgedrückt werden. Sie lebt jedoch in unserem Körper fort, wenn wir uns zum Schlafen zusammenrollen, wenn wir essen oder, bei manchen, wenn sie baden oder schwimmen. Und mit Sicherheit hinterlässt sie ihre Spuren in unserem körperlichen Verlangen nach einander. Väterlicher Raum im ideellen Sinn ist anders. Obwohl wir ebenso «von» unseren Vätern abstammen wie von unseren Müttern, sind wir nie «in» unseren Vätern. Ihr Getrenntsein ist offensichtlich. Im wirklichen Leben wirklicher Menschen kann diese Distanz verstärkt oder verringert werden. Viele Kinder meiner Generation wuchsen mit mehr oder weniger abwesenden Vätern auf. Ich nicht. Mein Vater war in meinem und im Leben meiner Schwestern sehr viel da, und wie meine Mutter war er zutiefst von dem Ort geprägt, an dem er aufwuchs.
Er wurde 1922 in einem Blockhaus nicht weit von Cannon Falls in Minnesota geboren. Das Haus brannte ab, und die Familie zog unweit davon in das Haus, in dem meine Großeltern noch während meiner ganzen Kindheit wohnten. Es gab kein fließend Wasser, aber im Vorgarten stand eine Pumpe. Meine Schwestern und ich liebten diese rostige Pumpe. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich so klein war, dass ich mich nach dem Schwengel strecken musste, ihn dann mit beiden Händen und meinem ganzen Gewicht mehrmals herunterzog und auf den Schwall Wasser wartete. Mein Vater erinnert sich an eine Welt des Scheunenbauens, der Quiltnähkränzchen, der fahrenden Hausierer, der Square Dances und Pferdeschlitten. Er besuchte eine Zwergschule, in der alle Klassen in einem Raum waren, und wurde auf Norwegisch in der Urland-Kirche konfirmiert, einer weißen Holzkirche mit Turm, die auf einer Erhebung stand. Für mich ist diese Kirche ein Zeichen für Nähe. Wenn wir in unserem Auto daran vorbeikamen, bedeutete das, dass wir das Haus meiner Großeltern sehen konnten. Die Kirche war das letzte einer Reihe von Wegzeichen, denen meine Schwestern und ich so originelle Namen wie «der große Hügel» gegeben hatten. Jedes Wegzeichen wurde von einem ebenso originellen Lied begrüßt: «Wir fahren den großen Hügel runter. Wir fahren den großen Hügel runter.» Das mussten meine Eltern jahrelang über sich ergehen lassen. Der Weg betrug ungefähr fünfundzwanzig Kilometer, und die Fahrt dauerte auf den schmalen Straßen etwa eine halbe Stunde. Wie die meisten Kinder hatten meine Schwestern und ich eine Vorliebe für Wiederholungen und Rituale. Öfter besuchte Orte bekamen etwas Heiliges und Verzaubertes. Ich gebrauche diese Wörter bewusst, weil etwas Liturgisches daran war, so viele Male über denselben Boden zu gehen. Von der lutherischen Sonntagsschule und von Märchen geprägt, erfüllten wir die Orte, an denen wir aufwuchsen, mit dem, was wir am besten kannten.
Trotz der Tatsache, dass meine Eltern eine gemeinsame Sprache sprachen, waren die Welten, in denen sie aufwuchsen, grundverschieden. Die norwegischen Einwanderergemeinden in den Vereinigten Staaten, die im 19. Jahrhundert im Mittelwesten entstanden, und die zurückgelassene Heimat waren nicht nur durch Meilen, sondern auch durch die Kultur getrennt. Jene «Little Norways» entwickelten sich sehr unterschiedlich vom Mutterland, auch sprachlich. Die Dialekte, die die Menschen mitbrachten, nahmen in der Prärie eine andere Richtung. Englische Wörter, für die es im Norwegischen kein Äquivalent gab, wurden in das gesprochene Norwegisch eingeführt und bekamen ein Geschlecht. Andererseits waren Norweger, die seit mehreren Generationen in Amerika lebende Verwandte besuchten, von deren veralteter Redeweise und Grammatik überrascht. Das Erbe der Siedler, des primitiven Lebens in der Prärie sowie die reale Entfernung zum Ursprungsland erhielten das 19. Jahrhundert in Amerika länger lebendig als in vielen Teilen Norwegens.
Die zu meiner Zeit auf zwanzig Morgen zusammengeschrumpfte kleine Farm meiner Großeltern war unser Spielplatz, doch sogar als Kind spürte ich das Gewicht der Vergangenheit nicht nur auf dem Hof, der nicht mehr bestellt wurde, sondern auf der Gemeinde insgesamt. Ich erlebte ihr Verschwinden mit. Heute sind die alten Leute tot. Viele der kleinen Farmen wurden von großen Landwirtschaftsbetrieben aufgekauft, und wenn man in einen Laden geht oder einen Nachbarn besucht, sprechen die Menschen nicht mehr norwegisch. Als meine Großmutter Tilly mit achtundneunzig Jahren starb, hielt mein Vater die Grabrede. Er nannte sie «die letzte Pionierin». Mein Vater scheut jedes Klischee und jede Sentimentalität. Er meinte, was er sagte. Sie war eine der Allerletzten, die sich an das Leben in der Prärie erinnerte. Meine Großmutter väterlicherseits, eine lebhafte, offene, aber besonders, wenn es um Politik, Banken und soziale Themen ging, nicht ganz rationale Frau, war eine gute Geschichtenerzählerin. Sie kam schnell und ohne Umstände ins Erzählen, das dennoch die treffenden, besonderen Einzelheiten enthielt. Heute wünsche ich mir oft, ich hätte diese Geschichten auf Band aufgenommen. Als Matilda Underdahl sechs Jahre alt war, verlor sie ihre Mutter. Die Geschichte, die in unserer Familie ein Mythos wurde, ging so: Als der Pastor zu Tilly sagte, der Tod ihrer Mutter sei «Gottes Wille», stampfte sie mit dem Fuß auf und schrie: «Nein, ist es nicht!» Ihr Leben lang blieb meine Großmutter solcher Pietät abhold. Sie erinnerte sich an die Polio-Epidemie, der viele Leute, die sie kannte, zum Opfer fielen, und veranschaulichte mir die Situation mit einer kurzen, aber lebendigen Geschichte. Sie saß mit ihrem Vater am Fenster und beobachtete, wie aus einem Nachbarhaus zwei Särge, ein kleiner und ein großer, herausgetragen wurden. Während sie zusahen, sprach ihr Vater leise zu ihr: «Wir müssen beten», sagte er, «und Zwiebeln essen.» Sie erinnerte sich an eine vollständige Sonnenfinsternis, vor deren Eintreten ihr gesagt wurde, die Welt ginge unter. Sie zogen ihre Sonntagskleider an, setzten sich ins Haus, falteten die Hände und warteten. Sie erinnerte sich daran, wie man ihr von dem nokken erzählte, einem Wasserungeheuer, das kleine Kinder in die Tiefe des Brunnens zog, wo es lebte und sie wahrscheinlich auffraß. Natürlich sollten mit der Geschichte Kinder davon abgehalten werden, zu nah an den Brunnen zu gehen und zu ertrinken; Matilda aber zog sie gerade zu ihm hin. Und dort forderte sie das Schicksal heraus. Sie legte den Kopf auf den Brunnenrand und ließ ihre langen roten Locken tief hineinhängen, während sie in eigensinnigem, stillem Entsetzen darauf wartete, dass der nokken kam.
Noch eine andere kleine Geschichte, die ich nur einmal hörte, ist mir in Erinnerung geblieben. Als sie klein war, lebte sie an einem See im Ottertail County in Minnesota. Im Winter, wenn dieser See zufror, gingen sie und andere Kinder mit ihren Schlitten auf das Eis und statteten sie mit Segeln aus. Ich weiß nicht mehr, was sie als Segel benutzten, aber wenn es windig war, füllten sich die Segel mit Luft und trieben die Schlitten, manchmal rasend schnell, über das Eis. Als sie mir davon erzählte, schwang in ihrer Stimme die Freude an dieser Erinnerung mit, und ich sah die Schlitten aus der Ferne vor mir, drei oder vier, wie sie lautlos über die weite Fläche des zugefrorenen Sees sausten. So stelle ich es mir immer noch vor. Die Kinder sehe und höre ich nicht. Das, woran sie sich erinnerte, ist zweifellos so radikal verschieden von dem Bild, das ich mir von ihrer Erinnerung machte, dass beide vielleicht unvereinbar sind. Mein Urgroßvater mütterlicherseits war Kapitän. Es gibt ein Gemälde von seinem Schiff, das jetzt bei meinem Onkel hängt. Das Schiff hieß Mars