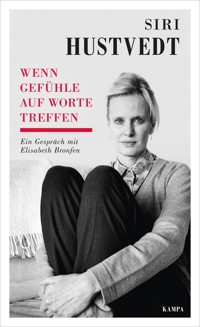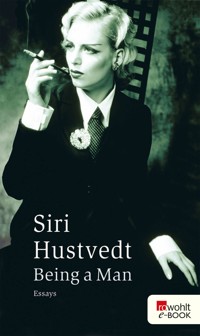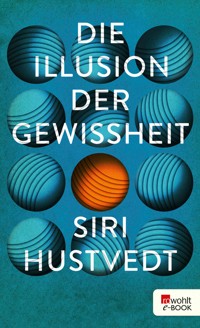9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Als Essayistin ist Siri Hustvedt unvergleichlich.» The Sunday Telegraph Wie sehen, erinnern und fühlen wir? Wie interagieren wir mit anderen Menschen? Was heißt es, zu schlafen, zu träumen oder zu sprechen? Was ist das Selbst? In diesem Buch sind 32 Essays versammelt, die thematisch das gesamte Spektrum von Hustvedts vielfältigen Interessen abdecken: von der Kunsttheorie über die Literatur und Philosophie, die Psychologie und Psychoanalyse bis hin zu den Neurowissenschaften. Und doch tauchen immer wieder ähnliche Fragen auf – die Grundfragen unseres Menschseins.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Siri Hustvedt
Leben, Denken, Schauen
Essays
Über dieses Buch
«Als Essayistin ist Siri Hustvedt unvergleichlich.» The Sunday Telegraph
Wie sehen, erinnern und fühlen wir? Wie interagieren wir mit anderen Menschen? Was heißt es, zu schlafen, zu träumen oder zu sprechen? Was ist das Selbst?
In diesem Buch sind 32 Essays versammelt, die thematisch das gesamte Spektrum von Hustvedts vielfältigen Interessen abdecken: von der Kunsttheorie über die Literatur und Philosophie, die Psychologie und Psychoanalyse bis hin zu den Neurowissenschaften. Und doch tauchen immer wieder ähnliche Fragen auf – die Grundfragen unseres Menschseins.
Vita
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sechs Romane publiziert. Mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Der Sommer ohne Männer» und «Die gleißende Welt». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Leben, Denken, Schauen», «Nicht hier, nicht dort», «Being a Man» und «Die Illusion der Gewissheit» vor.
Impressum
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel «Living, Thinking, Looking» 2010 bei Picador, New York.
Erica Fischer übersetzte «Mit dem Körper sehen»; alle anderen Übersetzungen stammen von Uli Aumüller.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2023
Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg «Living, Thinking, Looking» Copyright © 2012 by Siri Hustvedt
Erica Fischer übersetzte «Mit dem Körper sehen»; alle anderen Übersetzungen stammen von Uli Aumüller.
Covergestaltung any.way, Hamburg,
nach einem Entwurf von ANZINGER WÜSCHNER RASP, München
ISBN 978-3-644-00482-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Frances Coady
Vorwort der Autorin
Beim nochmaligen Lesen der in diesem Band gesammelten Essays wurde mir klar, dass sie, obwohl sie eine ganze Reihe von Themen behandeln, durch die beständige Neugier, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, miteinander verbunden sind. Wie sehen, erinnern, fühlen wir, wie gehen wir mit anderen um? Was bedeutet es, zu schlafen, zu träumen und zu sprechen? Wovon sprechen wir, wenn wir das Wort selbst gebrauchen? Jedes Zeitalter hatte seine eigenen Platituden, Binsenwahrheiten, Volksweisheiten und Dogmen der unterschiedlichsten Art, die vorgaben, solche Fragen zu beantworten. Das unsere ist da nicht anders. Tatsächlich ertrinken wir in Antworten. Angefangen bei grob vereinfachenden Selbsthilfefibeln, die in jeder Buchhandlung angeboten werden, über den Reißen-Sie-sich-zusammen-Ratschlag von Talkshow-Therapeuten zu den komplexeren Argumenten der evolutionären Soziobiologie, der analytischen und europäischen Philosophie, der Psychiatrie und der Neurowissenschaften sind Theorien in unserer Kultur reichlich vorhanden. Es ist wichtig, trotz des Überangebots von Lösungen im Kopf zu behalten, dass, wer wir sind und wie wir so geworden sind, nicht nur in den Geisteswissenschaften offene Fragen bleiben, sondern auch in den Naturwissenschaften.
Über einen Zeitraum von sechs Jahren geschrieben, reflektieren diese Essays meinen Wunsch, Erkenntnisse aus vielen Disziplinen zu verwenden, und zwar einfach deshalb, weil ich zu der Überzeugung gelangt bin, dass kein einzelnes theoretisches Modell die Komplexität der menschlichen Realität erfassen kann. Einige Denker tauchen mehrfach auf: Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, Martin Buber, Sigmund Freud, D.W. Winnicott, A.R. Lurija, Mary Douglas und Lev Vygotsky. Neurowissenschaftliche Forschungsergebnisse ziehen sich durch das ganze Buch, insbesondere aus Untersuchungen zur Wahrnehmung, Erinnerung, Emotion und zur Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen.
Ich bekenne mich zum Gebrauch der Alltagssprache in meinen Aufsätzen. Esoterische Fachsprachen entstehen jedoch nicht, weil die Eingeweihten Snobs wären. Spezialisierte Sprachen machen bestimmte Gespräche möglich, weil die Sprechenden ihre Definitionen ausdifferenziert haben und sich dann austauschen und damit arbeiten können. Das Problem ist, dass der Kreis der Sprechenden in sich geschlossen und die Fachkenntnis auf dem einen Feld der auf einem anderen nicht zugänglich ist, ganz zu schweigen von Laien, die gar nichts verstehen. Ich glaube, dass ein echter Dialog zwischen den Disziplinen, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad, möglich ist und dass unterschiedliche Diskurse durch eine transparente Darstellung von Ideen vereinheitlicht werden können. Gleichwohl muss redlicherweise darauf hingewiesen werden, dass diese Essays zuerst in einem breiten Spektrum von Printmedien veröffentlicht wurden, angefangen bei Literaturzeitschriften, wie Granta, Conjunctions, Salmagundi und The Yale Review, über Zeitungen und Magazine, wie den Londoner Guardian, die New York Times und den Nouvel Observateur, bis hin zu Fachzeitschriften, einschließlich der Contemporary Psychoanalysis und der referierten Neuropsychoanalysis. Daher haben einige der Aufsätze umfangreiche Anmerkungen, während andere ohne auskommen. Einige der Texte wurden ursprünglich als Vorträge gehalten. Der Essay über Morandi war für eine Vortragsreihe im Metropolitan Museum: Sunday Lectures at the Met. «Warum Goya?» wurde im Prado vorgetragen. «Mit dem Körper sehen: Was bedeutet es, ein Kunstwerk zu betrachten?» war die dritte Internationale Schelling-Vorlesung an der Akademie der Bildenden Künste München, und «Freuds Tummelplatz» wurde für die XXXVIII. jährlich stattfindende Sigmund-Freud-Vorlesung geschrieben, die ich im Mai 2011 in Wien hielt. In manchen Fällen konnte ich bei den Zuhörern bestimmte Kenntnisse voraussetzen, in anderen nicht. Gleichwohl ist jeder Text in diesem Band ein Essay – vom französischen Wort essayer, versuchen –, und alle sind in der ersten Person geschrieben.
Der persönliche Essay entstand im 16. Jahrhundert mit Montaigne; die Gattung wird auch heute noch oft und gern verwendet. Wie beim Roman ist seine Form elastisch und anpassungsfähig. Er macht Gebrauch von Geschichten wie von Argumenten. Er kann streng präzise vorgehen oder Abstecher auf überraschendes Terrain unternehmen. Seine Form wird ausschließlich von den Denkbewegungen des Schreibers bestimmt, und anders als in Beiträgen für wissenschaftliche Zeitschriften oder in Zeitungsartikeln ist die Ich-Perspektive nicht verpönt, sondern wird befürwortet. Für mich ist das mehr als eine Frage der Gattung. Mein Schreiben in der ersten Person stellt eine philosophische Position dar, der zufolge die Idee einer Dritte-Person-Objektivität bestenfalls eine Arbeitsfiktion ist. «Objektives» Forschen und Schreiben in der dritten Person ist das Resultat eines kollektiven Konsenses – eine Übereinkunft über die Methode sowie gemeinsame Grundannahmen dazu, wie die Welt funktioniert –, sei es in den Neurowissenschaften oder im Journalismus. Niemand kann seiner Subjektivität wirklich entgehen. Da ist immer ein Ich oder ein Wir, das sich irgendwo im Text verbirgt, selbst wenn es als Pronomen nicht in Erscheinung tritt.
Doch wer ist das Ich auf dem Papier? Warum gebrauche ich es? Einige der Essays in diesem Buch sind anekdotisch, handeln ausdrücklich von meinem eigenen Erleben; andere vertreten Argumente, die ich ohne weiteres herausarbeiten könnte, ohne selbst in den Text einzugehen. Ich will mich aber selbst einbringen. Ich will mich nicht hinter den Konventionen eines akademischen Beitrags verstecken, weil der Rückgriff auf meine subjektive Erfahrung die Probleme, die ich zu klären hoffe, erhellen kann und, denke ich, erhellen wird. In einer Zeit der Lebensbeichten ist es vielleicht nicht überraschend, dass es Leser gibt, die, immer wenn sie ein in der ersten Person geschriebenes Sachbuch aufschlagen, einen Strom von intimem Stoff erwarten. Ich fürchte, das ist mir charakterlich fremd. Meine Essays sind eine Form von geistigen Reisen, von einem Zugehen auf Antworten, wobei ich mir intensiv dessen bewusst bin, dass ich nie ans Ende der Straße gelangen werde. Ich benutze meine eigenen Erfahrungen auf dieselbe Art, wie ich die Erfahrungen anderer benutze – als Einblicke, um eine Idee weiterzuentwickeln. In den folgenden Essays komme ich als Person vor und nicht vor. Meine Präsenz beziehungsweise meine Abwesenheit hängen davon ab, womit ich mich jeweils auseinandersetze.
Eine derartige Herangehensweise ist nichts Neues. In den Bekenntnissen des Augustinus bringen wir viel über ihn in Erfahrung, doch was er uns über die quälenden Kämpfe erzählt, die er mit sich selbst führt, ist nie überflüssig. Es veranschaulicht eine tiefgehende philosophische Erkundung, mit der der Leser zu seinem eigenen spirituellen Erwachen gebracht werden soll. Ein modernes und viel zurückhaltenderes Beispiel des Selbst als Vehikel für Ideen findet sich in Freuds Traumdeutung. Bei der Analyse seiner eigenen Träume offenbart der Neurologe genug von sich selbst, um mit seinen Argumenten durchzudringen und den Leser von seiner neuen Theorie über Schlaf und Träume zu überzeugen. Zugegebenermaßen Geistesgrößen, sind diese zwei Autoren dennoch exemplarisch.
1986 habe ich an der Columbia University in Anglistik promoviert, aber ich wurde nicht Professorin. Ich hatte die Freiheit, meine Ausbildung so weiterzuführen, wie ich es für angebracht hielt, und ich schätze mich glücklich, dass ich mich in meinem Fach nicht «auf dem Laufenden halten» muss. Weil mein Schreiben selbstbestimmt ist, konnte ich zahllose Stunden mit dem Studium von neurowissenschaftlichen Veröffentlichungen, von Ästhetik, Psychoanalyse, Medizingeschichte und Philosophie verbringen, neben weiteren Fächern, die mich interessieren. Ich war in vielen Vorlesungen und auf vielen Kongressen und habe in den letzten Jahren auch selbst Vorlesungen gehalten und auf Kongressen gesprochen. Es besteht kein Zweifel, dass ich eine Außenseiterin, eine nicht zugehörige intellektuelle Vagabundin bin, die, ihrer Nase folgend, plötzlich auf unerwartetem Terrain gelandet ist und über Landschaften blickt, von denen sie sehr wenig wusste, ehe sie vor Ort ankam. Diese geistigen Reisen waren eine Freude für mich, genauso wie meine Begegnungen mit den Bewohnern dieser einst fremden Welten, den Wissenschaftlern, Ärzten und Denkern unterschiedlicher Art, die ich bei meinen Abenteuern getroffen habe.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert: Leben, Denken, Schauen. Wie alle Kategorien dieser Welt sind sie nicht absolut, aber sie sind auch nicht willkürlich gewählt. Es wäre zum Beispiel schwierig, viel zu denken oder zu schauen, wenn wir nicht lebten. Trotzdem habe ich «Leben» für die persönlichsten Essays gewählt, diejenigen, die auf die eine oder andere Weise unmittelbar aus meinem Leben hervorgegangen sind. Die Texte im Teil «Denken» dagegen waren alle von einem intellektuellen Rätsel angetrieben. Worin besteht der Unterschied zwischen dem Schreiben von erzählender Literatur und dem Schreiben von Lebenserinnerungen? Welche Rolle spielt Erinnerung für die Phantasie? Sind sie ein und dieselbe Fähigkeit oder zwei verschiedene? Wie können wir gestalten, was zwischen einer Person und einer anderen vor sich geht? Erschaffen zwei Personen zwischen sich eine dritte Realität? Die Essays im Teil «Schauen» handeln alle von Kunst und Künstlern. Ich schreibe seit nahezu zwanzig Jahren über Bildende Kunst. Immer wieder werde ich von irgendeinem geheimnisvollen oder verstörenden Werk geködert, über das ich unbedingt eine Weile nachdenken möchte, und fühle mich angeregt, etwas darüber zu sagen. Seit 2005 mein letztes Buch über Malerei, Mysteries of the Rectangle, erschien, habe ich weiter versucht, über Kunstwerke in einer Sprache zu schreiben, die das Wahrnehmungserleben nicht verletzt, herabsetzt oder verrät. Das ist nicht einfach. Ein Bild ist kein Text. Die Schwierigkeiten, die das Vorhaben mit sich bringt, haben mich dazu gedrängt, genauer zu untersuchen, was es bedeutet, Kunstwerke zu betrachten, und eine verkörperte, intersubjektive Herangehensweise an die Frage zu entwickeln, eine Herangehensweise, die im letzten Essay dieser Sammlung am ausgeprägtesten ist.
Jedes Buch ist für jemanden. Der Akt des Schreibens mag einsam sein, er ist aber immer eine Hinwendung zu einer anderen Person – einer Einzelperson –, da jedes Buch allein gelesen wird. Die Schriftstellerin weiß nicht, für wen sie schreibt. Das Gesicht des Lesers oder der Leserin ist unsichtbar, und doch stellt jeder zu Papier gebrachte Satz ein Angebot dar, Kontakt aufzunehmen, und eine Hoffnung darauf, verstanden zu werden. Die Essays in Leben, Denken, Schauen wurden in diesem Geist geschrieben. Sie wurden für Sie geschrieben.
Siri Hustvedt
Leben
Variationen über das Begehren: eine Maus, ein Hund, Buber und Bovary
Begehren tritt als Gefühl, als Flackern oder als Bombe im Körper auf, aber es ist immer ein Hunger nach etwas, und es treibt uns immer anderswohin, zu der Sache, die fehlt. Selbst wenn diese Bewegung in der Innerlichkeit der Phantasie stattfindet, hat sie eine stimulierende Wirkung auf den Tagträumer. Das Objekt des Begehrens – ein gutes Essen, ein schönes Kleid oder Auto, ein anderer Mensch oder etwas Abstraktes wie Ruhm, Bildung oder Glück – existiert außerhalb und entfernt von uns. Was es auch ist, wir haben es jetzt nicht. Obwohl Begehren und Bedürfnisse sich oft überschneiden, unterscheiden sie sich semantisch. Ich bedarf des Essens, aber ich werde womöglich kein großes Verlangen nach dem haben, was mir vorgesetzt wird. Während ein Bedürfnis zwingend für körperliches Wohlbefinden oder gar das Überleben ist, existiert das Begehren auf einer anderen Ebene des Erlebens. Es mag vernünftig oder irrational, gesund oder gefährlich, flüchtig oder obsessiv, schwach oder stark sein, aber es ist für Leib und Leben nicht notwendig. Der Unterschied zwischen Bedürfnis und Begehren mag dahinter stecken, dass ich noch nie jemanden vom «Begehren» einer Ratte habe sprechen hören – Instinkte, Triebe, Verhaltensweisen, ja, aber nie Begehren. Das Wort scheint ein phantasiebegabtes Subjekt vorauszusetzen, eines, das denkt und spricht. Im Webster’s lautet die zweite Definition für das Nomen Begehren: «Wunsch, Verlangen». Man könnte darüber streiten, ob Tiere «Wünsche» haben. Mit Sicherheit haben sie Vorlieben. Hunde bellen, um zu erkennen zu geben, dass sie nach draußen wollen, sie verschlingen eine Sorte Futter, rühren eine andere aber nicht an und tun kund, dass ihnen die Eingangstür des Tierarztes ein Gräuel ist. Affen drücken ihre Wünsche in so ausgeklügelten Formen aus, dass sie mit denen ihres Cousins, des Homo sapiens, konkurrieren könnten. Gleichwohl wird menschliches Begehren in symbolischen Begriffen formuliert und ausgedrückt, die Tieren nicht zur Verfügung stehen.
Als meine Schwester Asti drei war, war ihr wiederholt geäußerter Herzenswunsch ein Micky-Maus-Telefon – ein Weihnachtswunsch, der meine Eltern auf der Suche nach einem überall ausverkauften Spielzeug in mehrere Städte fahren ließ. Je näher die Feiertage rückten, umso mehr stieg die Spannung in der Familie. Meine Schwester Liv, damals sieben, und ich, neun, waren in das Gefühlsdrama des schwer auffindbaren Spielzeugs einbezogen und befürchteten allmählich, dass das Objekt, nach dem sich unsere jüngere Schwester sehnte, nicht gefunden werden würde. Soweit ich mich erinnere, spürte mein Vater das Ding am späten Nachmittag jenes Weihnachtsabends in der Nachbarstadt Fairbault auf, nur wenige Stunden bevor die Geschenke ausgepackt werden sollten. Ich entsinne mich seiner triumphalen Ankunft durch die Tür zur Garage, Schnee von seinen Stiefeln abtretend, mit einer großen, grellbunten Schachtel in der Hand – und an unsere Freude. Meine jüngste Schwester Ingrid fehlt in dem Erinnerungsbild, vermutlich weil sie zu klein war, um sich wie wir anderen mitzufreuen. Asti kennt die Geschichte, weil diese in der Familie mystische Dimensionen angenommen hat, und sie erinnert sich an das Telefon, das eine Zeitlang in der Spielzeugsammlung war, aber das Auspacken auf dem Fußboden des Wohnzimmers, das ich mit atemloser Vorfreude beobachtete, hat sie nicht in Erinnerung.
Diese kleine Geschichte vom Micky-Maus-Telefon eröffnet den Zugang zu den Eigentümlichkeiten menschlichen Begehrens. Mit Sicherheit weckte das leuchtende und zweifellos vergrößerte Bild des Telefons auf dem Fernsehbildschirm Astis Begehren und löste Besitzphantasien aus. Das Disney-Nagetier selbst muss eine Rolle gespielt haben. Vielleicht hat sie sich vorgestellt, mit der wirklichen Maus Gespräche zu führen. Ich weiß es nicht, aber der Gegenstand bekam einen glamourösen Glanz, zuerst für sie, dann für uns andere, weil er schwer zu finden war. Es musste dafür gekämpft werden – immer ein das Begehren vergrößernder Faktor. Denken Sie nur an die Minnesänger. Denken Sie an Gatsby. Denken Sie an den großen, geistig verwirrten fahrenden Ritter der Literatur auf seiner Rosinante. Das Begehren einer Dreijährigen infizierte vier andere sie liebende Familienmitglieder, weil über eine intensive Identifikation ihr Wunsch unser eigener wurde, ähnlich wie bei der Hoffnung des Sportfans, seine Mannschaft möge gewinnen. Begehren kann ansteckend sein. Tatsächlich treibt es die pausenlos laufenden Räder des Kapitalismus an.
Astis «Micky-Maus»-Wunsch setzt die Fähigkeit voraus, ein Objekt im Kopf zu behalten und dann irgendwann einmal seine Aneignung zu imaginieren – ein Trick, den der große russische Neurologe A.R. Lurija ausdrücklich mit der Sprache und ihrem umherschweifenden Ich sowie der Unbeständigkeit linguistischer Zeitformen – war, ist, wird sein – verknüpfte. Erzählen ist eine geistige Bewegung in der Zeit, und die Sehnsucht nach einem Objekt nimmt sehr häufig eine zumindest rohe Erzählform an: P. ist einsam und sehnt sich nach Gesellschaft. Er träumt davon, Q. zu treffen. Er stellt sich vor, mit Q. in einer Bar zu sprechen, ihr Kopf ist an seine Schulter geschmiegt. Sie lächelt. Er lächelt. Sie stehen auf. Er stellt sich vor, dass sie nackt in seinem Bett liegt, und so weiter. Ich habe schon immer intuitiv angenommen, bewusstes Erinnern und Vorstellen seien stark miteinander verbunden, seien sich in der Tat so ähnlich, dass sie manchmal schwer zu entwirren sind, und beide seien an Orte gebunden. Es ist wichtig, die Menschen oder Objekte, die man erinnert oder imaginiert, in einem geistigen Raum zu verankern – sonst beginnen sie davonzudriften oder, noch schlimmer, zu verschwinden. Die Vorstellung, Erinnerung sei in Örtlichkeiten verwurzelt, geht auf die Griechen zurück und übte einen starken Einfluss auf das mittelalterliche Denken aus. Der scholastische Philosoph Albertus Magnus schrieb:
«Der Ort ist etwas, was die Seele selbst macht, um Bilder abzulegen.»[1]
In einer Studie über Amnesiepatienten mit bilateraler Schädigung des Hippocampus haben Naturwissenschaftler diese alte Erkenntnis unlängst neu belebt. Der Hippocampus in Verbindung mit anderen medialen Schläfenlappenregionen des Gehirns ist bekanntermaßen wichtig für die Verarbeitung und Speicherung von Erinnerungen, aber er scheint auch für das Imaginieren wesentlich zu sein. Aufgefordert, eine bestimmte Szene bildlich darzustellen, fiel es Hirngeschädigten schwer, einen kohärenten räumlichen Rahmen für ihre Phantasien zu liefern. Ihre Berichte waren viel bruchstückhafter als die ihrer gesunden Mitprobanden (oder «Kontrollpersonen», wie Wissenschaftler sie gern nennen). Diese Erkenntnis betrifft das Begehren selbst natürlich nicht. Menschen mit einer Schädigung des Hippocampus fehlt es nicht an Begehren – aber das vollständige Imaginieren dessen, wonach sie sich sehnen, ist beeinträchtigt. Andere Formen von Amnesie würden es unmöglich machen, das Bild eines Micky-Maus-Telefons oder die Traumgestalt Q. länger als einige Sekunden im Kopf zu behalten. Diese Form des Begehrens lebt nur im Moment, außerhalb der Erzählform, ein Gefühlsausbruch ohne Spuren, dem entsprechend nur gehandelt werden könnte, wenn ein begehrenswertes Objekt im selben Augenblick aufkreuzen und der Amnesiekranke die Hände danach ausstrecken und es sich schnappen würde.
Aber Begehren kann auch ziellos sein. Ab und zu kommt es vor, dass ich mich frage, was ich eigentlich will. Ein unbestimmtes Begehren macht sich bemerkbar, bevor ich das Objekt benennen kann – eine Ruhelosigkeit in meinem Körper, womöglich Hunger, womöglich eine leise Regung erotischen Begehrens, womöglich ein Bedürfnis, etwas noch einmal zu schreiben oder zu lesen oder etwas anderes zu lesen, aber vorhanden ist es jedenfalls: ein Drang in mir, hin zu einer Befriedigung, die ich nicht identifizieren kann. Was ist das? Jaak Pankseep, ein Neurowissenschaftler, schreibt in seinem Buch Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions über das von ihm so genannte «SUCHE-System». Andere Wissenschaftler haben demselben Schaltkreis farblosere Namen gegeben: «Behavioral Activation System» oder «Behavioral Facilitation System». Bei Panksepp heißt es:
«Obwohl menschliche Hoffnungen im Einzelnen sicherlich die Vorstellungskraft anderer Geschöpfe übersteigen, deuten Befunde nun eindeutig darauf hin, dass bestimmte spezifische Bestrebungen aller Säugetiergemüter, von Mäusen ebenso wie von Menschen, von den gleichen uralten neurochemischen Reaktionen gesteuert werden. Diese chemischen Reaktionen veranlassen unsere Mitgeschöpfe dazu, voller Tatendrang aufzubrechen, um ihre Welt zu erkunden und zu erforschen, verfügbare Ressourcen zu suchen und aus den Möglichkeiten ihrer Umwelt schlau zu werden. Die gleichen Systeme geben uns den Impuls, uns aktiv mit der Welt auseinanderzusetzen und aus unseren unterschiedlichen Lebensumständen Sinn zu beziehen.»[2]
Neugier, das Bedürfnis, in die Welt hinauszugehen, scheint allen Säugetieren als Veranlagung angeboren zu sein. Wie Panksepp es ausdrückt, ist es «ein Antrieb ohne Ziel»[3]. Das «Beziehen von Sinn» aus diesen Erkundungen setzt jedoch höher entwickelte kortikale Areale im Gehirn voraus, wie sie nur Menschen eigen sind. Mein lieber verstorbener Hund Jack pflegte im ländlichen Minnesota mit bebenden Nüstern gespannt vom Baumstumpf zur Distel zum Kuhfladen zu laufen, an jedem Wunder der Natur zu schnüffeln, und dann, sobald er die Beschaffenheit des Geländes auf der Reihe hatte, rannte er los und raste wie ein irrer siegreicher Held kreuz und quer durch das Revier. Mit seiner hervorragenden Nase erinnerte er den Ort und erkannte ihn wieder, aber ich glaube nicht, dass er, zurück in Brooklyn, ein geistiges Bild des weiten flachen Landes in sich trug, wo er sich austoben konnte, oder dass er sich aktiv danach sehnte. Ich glaube auch nicht, dass er auf seinem Hundekissen lag und sich einen idealen Tummelplatz mit Myriaden von Gerüchen ausmalte. Und doch vermisste er seine Menschen, wenn wir nicht da waren. Er trauerte sogar. Anhänglichkeit und Trennungsangst sind allen Säugetieren gemeinsame primitive Entwicklungsmechanismen. Einmal, als sich meine Schwester Ingrid während unserer Abwesenheit um Jack kümmerte, saß sie in einem Zimmer unseres Hauses; da ihr kalt wurde, ging sie an einen Schrank und zog einen Pulli von mir über. Als sie zurückkam, wurde der arme Hund von einem Freudentaumel erfasst, sprang an ihr hoch, drehte sich in der Luft und leckte sie ab, wo immer er an sie herankam. Mit Jacks Nase stimmte alles; was ihm fehlte, war ein menschlicher Sinn für Zeit und Kontext, der verhindert haben dürfte, dass er an meine plötzliche Materialisierung aus dem Nichts glaubte.
Es gibt eine wunderbare Passage in Martin Bubers Buch Zwiesprache, worin er beschreibt, wie er als Elfjähriger ein geliebtes Pferd auf dem Gut seiner Großeltern streichelte. Er berichtet von der ungeheuren Freude, die er an ihm hatte, von seinem taktilen Erleben der Lebendigkeit des Tieres unter der Haut und von seinem Glücksgefühl, wenn das Pferd ihn mit einem Kopfheben begrüßte.
«Einmal aber – ich weiß nicht, was den Knaben anwandelte, jedenfalls war es kindlich genug – fiel mir über dem Streicheln ein, was für einen Spaß es mir doch mache, und ich fühlte plötzlich meine Hand. Das Spiel ging weiter wie sonst, aber etwas hatte sich geändert, es war nicht mehr Das. Und als ich tags darauf, nach einer reichen Futtergabe, meinem Freund den Nacken kraulte, hob er den Kopf nicht. Schon wenige Jahre später, wenn ich an den Vorfall zurückdachte, meinte ich nicht mehr, das Tier habe meinen Abfall gemerkt; damals aber erschien ich mir verurteilt.»[4]
Mit dieser Geschichte will Buber den Ausstieg aus einem Leben des Dialogs mit dem Anderen in ein Leben des Monologs oder der «Reflexion» veranschaulichen. Für Buber behindert dieses Selbstreflexive oder Spiegeln die wahre Kenntnis des Anderen, weil dieser dann «nur als eine Meinheit» existiert. Auffallend ist, dass Buber mitten im Satz in die dritte Person wechselt und dann in der ersten Person fortfährt, weil er die Erfahrung eines plötzlichen, intrusiven Selbstbewusstseins gemacht hat, das den Charakter seines Begehrens verändert. Er ist sich selbst ein Anderer geworden, eine dritte Person, die er vor seinem geistigen Auge das Pferd streicheln und sich daran freuen sieht, statt eines aktiven «Ichs» mit einem «Du». Dieses Selbst-Theater der dritten Person kommt, denke ich, nur beim Menschen vor und greift immer in unser Begehren und unsere Phantasien ein. Der Promikult demonstriert die extremen Möglichkeiten dieser Position, funktioniert er doch nach der Idee einer von außen als Spektakel gesehenen Person und der Möglichkeit für geringere Sterbliche, mit etwas Glück in die Reihen der ständig Fotografierten und Gefilmten aufsteigen zu können. Mit dem Internet und Websites wie Myspace scheint die starke Sehnsucht, ein Leben in der dritten Person zu leben, ihre vollkommene Verwirklichung gefunden zu haben. Aber wir alle, ob Internetvoyeure unserer eigenen Dramen oder nicht, sind infiziert von Bubers «Reflexion», von seiner Beschreibung des Narzissmus, worin das Selbst in einem luftlosen Spiegelsaal gefangen ist.
Bubers Verurteilung der monologischen Position ist wohldurchdacht, und doch entsteht Selbstbewusstsein als solches aus dem «Spiegeln» und dem Erwerb von Symbolen, die uns befähigen, uns selbst als ein «Ich», ein «Er» oder eine «Sie» darzustellen. Erst diese Distanz zum Selbst macht eine narrative Bewegung und ein autobiographisches Erinnern möglich. Ohne sie könnten wir uns unsere Geschichte nicht erzählen. Nur in der Reflexion zu leben schafft jedoch einen furchtbaren Mechanismus unersättlichen Verlangens, das endlose Verfolgen der Sache, die die Leere füllen und ein ausgehungertes Selbstbild nähren soll. Emma Bovary träumt von Paris: «Sie kannte die neuesten Moden, die Anschriften der guten Schneider, die Trefftage der vornehmen Gesellschaft im Bois und in der Oper. Sie studierte bei Eugène Sue die Schilderungen von Wohnungseinrichtungen; sie las Balzac und George Sand und suchte bei ihnen imaginäre Befriedigung ihrer persönlichen Lebensbegierden.»[5]
Es ist kein Geheimnis, dass die Objekte des Begehrens, sobald sie erlangt sind, oft ihre Süße verlieren. Das wirkliche Paris kann es mit der Traumstadt nicht aufnehmen. Die hochhackigen Pumps in einem Schaufenster, die wie eine Verheißung von Schönheit, Urbanität und Reichtum leuchten, sind einfach bloß Schuhe, sobald sie ihren Weg in den Kleiderschrank finden. Nach einer großen Hochzeit, die in all ihrem Glanz und Glamour eine Ehe als das Nonplusultra des Erreichbaren ankündigt, folgt ein Leben mit einem wirklichen Menschen, der unweigerlich kurzsichtig, schwach und eigenartig ist. Der Revolutionär treibt die Revolution, den großen reinigenden Augenblick, da eine neue Ordnung triumphieren wird, beim Essen und im Schlaf voran, und dann, sobald sie geschehen ist, findet er sich zwischen Leichen und Ruinen umherirrend wieder. Nur Menschen zerstören sich selbst durch Ideen. Emma Bovary verzweifelt am Ende: «Da tat sich ihre ganze Lage wie ein Abgrund vor ihr auf. Ihr Atem ging, als wenn er ihr die Brust zersprengen wollte. Dann, in einem heroischen Aufschwung, der sie fast freudig durchdrang, lief sie den Abhang hinunter, über die Planke, die für die Kühe über den Bach gelegt war, den Fußweg entlang, durch die Allee, an der Markthalle vorbei, bis sie vor der Apotheke stand.»[6] Es ist der Ausdruck «in einem heroischen Aufschwung», der mich am meisten rührt, der absurde, aber allzu menschliche Wunsch, die eigene Geschichte aufzublasen, sie als heroisch, schön oder märtyrerhaft widergespiegelt zu sehen.
Das Begehren ist der Motor des Lebens, die Sehnsucht, die uns, mit Zwischenhalten, vorwärtstreibt, aber sie hat kein Ziel, keine Endstation, außer dem Tod. Das wundersame Gefühl der Fülle nach einer Mahlzeit oder nach Sex oder nach einem bedeutsamen Buch oder Gespräch ist unweigerlich von kurzer Dauer. Von Natur aus wollen und wünschen wir uns Gehalt für diese Leere und versehen sie damit, während wir unser Innenleben erzählen. Im Guten wie im Schlechten geben wir ihr einen Sinn, einen Sinn, der zwangsläufig von der Sprache und der Kultur geprägt ist, in der wir leben. Sinn mag die äußerste menschliche Verführung sein. Hunde brauchen ihn nicht, aber für uns ist er wesentlich, damit wir weitermachen, und das stimmt, obwohl das meiste, was uns geschieht, unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle angesiedelt ist. Die bezeichnenden, Sprache formenden, willentlichen, bewusst wahrnehmenden Schaltungen in unserem Gehirn sind winzig, verglichen mit den riesigen Mengen darunter stattfindender unbewusster Vorgänge.
Vor fast zwanzig Jahren gebar ich meine Tochter. Eigentlich tat «ich» gar nichts. Das Fruchtwasser ging ab. Die Wehen setzten ein. Nach dreizehn Stunden Wehen presste ich. Diese Pressphase gefiel mir. Sie war aktiv, nicht passiv, und schließlich stieß ich zwischen meinen Beinen eine blutverschmierte, feuchte, furchteinflößende Fremde hervor. Mein Mann hielt sie im Arm, und ich wohl auch, aber ich erinnere mich nur, sie erst viel später in den Armen gehalten zu haben. Woran ich mich erinnere, ist, dass ich, sobald ich wusste, dass das Baby gesund war, in einen Zustand nie dagewesener Erfüllung verfiel. Eine paradiesische Schlaffheit durchflutete meinen Körper, und ich wurde schlaff und still. Man schob mich in einen halbdunklen Raum, und nach einigen Minuten kam die Hebamme, beugte sich über mich und sagte: «Ich wollte nur mal nach Ihnen schauen. Wie fühlen Sie sich?» Es kostete mich Anstrengung zu sprechen, nicht weil ich irgendwelche Schmerzen hatte oder auch nur erschöpft war, sondern weil Sprechen unnötig erschien. Ich schaffte es, die meinen Zustand beschreibenden Worte zu hauchen: «Mir geht’s gut, einfach gut. So habe ich mich noch nie gefühlt. Es verlangt mich nach nichts, nach gar nichts.» Ich erinnere mich, dass sie schmunzelte und meinen Arm tätschelte, doch nachdem sie weg war, lag ich eine Zeitlang da und schwelgte im satten Frieden meines Körpers, nur begleitet von der ehrfürchtigen Wiederholung derselben Worte: «Es verlangt mich nach nichts, nach gar nichts.» Wahrscheinlich stand ich unter dem Einfluss des Hormons Oxytocin, das in solchen Mengen ausgeschüttet worden war, wie ich es noch nie erlebt hatte, und das mich in einen glücklichen Fleischkloß verwandelte. Gebären war eine ganz und gar animalische Erfahrung; seine brutalen körperlichen Paroxysmen ließen die Reflexion hinter sich. Das ausführende, denkende, erzählende «Ich» ging völlig in dem höchsten kreativen Schauspiel auf: ein von einem anderen Körper geborener Körper. Nach dem Gebären kehrte es als überwältigter Kommentator zurück, einem Hintergrundkommentar im Film ähnlich, der ein Einmannpublikum, nämlich mich, auf das Neuartige meiner Situation aufmerksam machte. Natürlich hielt die Benommenheit nicht an. Sie konnte nicht anhalten. Ich musste ja mein Kind versorgen, musste es in den Arm nehmen, füttern, ansehen, es mit aller Kraft wollen. Es gibt nichts Gewöhnlicheres als dieses Verlangen, und doch fühlt es sich wie ein Wunder an, von ihm gepackt zu werden.
In Martin Bubers Ich-Du-Dialektik werden Mütter und Kleinkinder nicht behandelt, aber der von ihm beschriebene ideale Dialog der Offenheit für den Anderen, die Kommunikation, die sich nicht auf Sprache stützt, sondern schweigend «sakramental» stattfinden kann, wird im Mutter-Kind-Paar vielleicht am vollkommensten verwirklicht. Vor allem im ersten Jahr öffnet sich eine Mutter ihrem Baby. Wie D.W. Winnicott in Familie und individuelle Entwicklung schreibt, ist sie imstande, «Interesse von ihrem eigenen Selbst abzuziehen und es dem Baby zuzuwenden». Eine Mutter, fügt er in seiner charakteristischen einleuchtenden Art hinzu, hat «eine besondere Fähigkeit, das Richtige zu tun. Sie weiß, wie sich das Kind fühlen könnte. Niemand sonst weiß es. Ärzte und Schwestern mögen eine Menge von Psychologie verstehen, und natürlich wissen sie alles über körperliche Gesundheit und Krankheit. Aber sie wissen nicht, wie sich ein Baby von einer Minute zur anderen fühlt, weil sie außerhalb dieses Erfahrungsbereichs sind.»[7] Sich vorzustellen, wie ihr Baby sich fühlt, indem sie es sorgfältig studiert und auf es eingeht, ist die Arbeit einer Mutter; es ist eine Angelegenheit zwischen erster und zweiter Person und bringt eine fortlaufende Befriedigung für beide Seiten der Dyade mit sich. Es ist auch, wie Allan Schore in seinem Buch Affektregulation und die Reorganisation des Selbst verdeutlicht, wesentlich für die neurobiologische Entwicklung des Kleinkindes.
Mütterliches Verlangen ist ein ideologisch überfrachtetes Thema. Von den schreienden Befürwortern von «Familienwerten» bis zu denen, deren Programm es unumgänglich macht, bei jeder Gelegenheit das Wort «Mutter» durch «Bezugsperson» zu ersetzen, posaunt die Alltagskultur ihre konkurrierenden Erzählungen heraus. In einem Land, in dem menschliche Beziehungen als Entitäten gesehen werden, an denen man «arbeiten» muss, als wären sie Puzzles aus 1000 Teilen, die nur Zeit brauchen, um vervollständigt zu werden, bleiben die Freude, die man an seinen Kindern finden kann, und das Verlangen, das wir nach ihnen haben, in der Diskussion außen vor. Ich habe nicht die Absicht, romantisch zu werden. Elternschaft kann aufreibend, langweilig und schmerzlich sein, aber die meisten Menschen wollen ihre Kinder und lieben sie. Als Eltern sind sie, wie Winnicott über Mütter sagte, «ausreichend gut». Dieses «ausreichend gut» bedeutet nicht Perfektion, sondern eine Form von Dialog, eine Aufgeschlossenheit, die dem Kind nicht die monologischen Wünsche der Eltern aufdrängt, sondern seine Autonomie, sein reales Getrenntsein anerkennt.
Einmal in der Woche gebe ich in der psychiatrischen Payne-Whitney-Klinik Patienten Unterricht im Schreiben. Meine Schüler sind lauter Menschen, die im Krankenhaus landeten, weil das Leben draußen unerträglich geworden war, entweder für sie selbst oder für andere. Dort habe ich erlebt, wie es ist, wenn man kein oder nur noch sehr wenig Verlangen nach irgendetwas hat. Psychotische Patienten können elektrisierend und von manischer kreativer Energie erfüllt sein, aber schwer depressive Patienten sind seltsam regungslos. Die Menschen, die in meinen Kurs kommen, haben schon einen Fuß vor den anderen gesetzt und den Weg auf einen Stuhl gefunden – das ist viel mehr als das, was einige der anderen können, diejenigen, die in ihrem Zimmer reglos auf dem Bett liegen wie lebende Tote. Einige kommen in den Kurs, sprechen aber nicht. Einige kommen, schreiben aber nicht. Sie blicken auf das Papier und den Stift und sind imstande zu sagen, dass sie es nicht können, dass sie aber bleiben und zuhören wollen. Eine Frau, die starr auf ihrem Stuhl saß, sich kaum bewegte, außer der Hand, die ihren Text niederschrieb, in dem es um eine Morgue ging, wo Leichen auf Steinplatten aufgebahrt lagen; ihre offenen Münder gaben den Blick frei auf schwarze, brandige Zungen. «Deshalb sind wir hier», sagte sie, nachdem sie ihn vorgelesen hatte, «weil wir tot sind. Wir sind alle tot.» Während ich ihr zuhörte, fühlte ich mich getroffen und verletzt. Dies war mehr als Traurigkeit, mehr als Trauer. Trauer ist im Grunde Verlangen nach dem Toten oder nach dem Verlorenen, das nie wiederkommen kann. Trauer ist Sehnsucht. Dies war Stillstand ohne Erfüllung. Dies war die angehaltene, das heißt ausgelöschte Welt. Und doch hatte sie es geschrieben, hatte sich die Mühe gemacht, dieses trostlose Bild festzuhalten, das mir, wie ich ihr sagte, Angst einflößte. Ich sagte ihr, ich hätte es mir im Geiste bildlich vorgestellt, so wie ich mich an irgendein entsetzliches Bild aus einem Film erinnern mochte, wobei ich versuchte, sie mit meinem Blick zu fixieren, damit sie mich weiter ansah, was mir für einige Sekunden gelang. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, war es womöglich reiner Selbstschutz von mir, den Film heranzuziehen und so ein wenig Distanz zwischen mich und dieses Leichenschauhaus (in dem ich früher oder später enden werde) zu bringen. Dennoch habe ich schließlich begriffen, dass das, was ich sage, für die Schüler oft weniger wichtig ist als meine verkörperte Aufmerksamkeit, mein gespanntes Interesse daran, was zwischen uns vorgeht, dass sie wissen, ich höre konzentriert und offen zu. Ich muss mir vorstellen, wie es sich anfühlt, in so einem Zustand zu sein, ohne selbst aus den Fugen zu geraten.
Ich kenne die spezielle Geschichte dieser Frau nicht und weiß auch nicht, warum sie im Krankenhaus gelandet war. Manche Patienten kommen mit einem Verband, der auf einen Selbstmordversuch hindeutet, sie aber nicht. Jeder hat eine Geschichte, und jede ist einzigartig, und doch habe ich, nachdem ich nun seit einem Jahr im Krankenhaus arbeite, viele Variationen einer einzigen Erzählung gesehen. Ein Mann ließ sie sehr schön in ein kurzes Gedicht einfließen. Ich kann mich nicht an dessen genauen Wortlaut erinnern, aber ich habe das Bild behalten, das es wachrief. Er ist wieder ein Kind, das allein in einer Wohnung umherirrt und sich danach sehnt, dass «jemand» da wäre. Er findet eine Tür. Sie geht auf, und das Zimmer ist leer. Ich kann mir keine bessere Metapher für unerwiderte Sehnsucht vorstellen als diesen leeren Raum. Mein Schüler begriff den Kern dessen, was ihm fehlte: die ihm zugewandte Präsenz eines Anderen, und er wusste, dass deren Fehlen ihn sowohl geformt als auch beschädigt hatte.
Es mag so aussehen, als hätte ich mich weit von dem Micky-Maus-Telefon entfernt, aber wie so viele Objekte des Begehrens war das Telefon mehr als ein Telefon, und die Geschichte, wie es gesucht und schließlich gefunden wurde, um den Wunsch eines Kindes zu erfüllen, ist eine kleine Parabel über echten Dialog: Ich habe dich gehört, und ich komme mit meiner Antwort.
2007
Meine Mutter, Phineas, Moral und Gefühl
«Tu nichts, was du nicht wirklich tun willst», sagte meine Mutter zu mir, während sie mich von irgendeinem längst vergessenen Klassentreffen oder Haus eines Freundes nach Hause fuhr. Sonst erinnere ich mich an nichts, was meine Mutter in unserem Gespräch sagte, und ich kann auch nicht sagen, warum sie mir diesen Rat gerade damals gab. Hingegen erinnere ich mich an die Strecke auf dem Highway 19 außerhalb meiner Heimatstadt Northfield in Minnesota, die jetzt für immer mit diesen Worten verbunden ist. Es muss Sommer gewesen sein, denn das Gras war grün, und die Bäume waren belaubt. Ich erinnere mich auch genau, dass ich mich, sobald sie das gesagt hatte, schuldig fühlte. Tat ich Dinge, die ich nicht wirklich tun wollte? Ich war fünfzehn, mitten in der Pubertät, ein junger Mensch mit eigenen Sehnsüchten, Verwirrungen und Qualen. Die Worte meiner Mutter regten mich zum Nachdenken an, und seither habe ich nie aufgehört, darüber nachzudenken.
Genau betrachtet ist ihr Satz komisch, mit seinen zwei Verneinungen in Verbindung mit dem hochgradig positiven «was du wirklich tun willst». Ich wusste, dass meine Mutter mir kein Rezept für Hedonismus oder Selbstsucht anbot, und ich nahm diese kleine Weisheit als moralischen Imperativ zum Begehren auf. Die Verneinungen in ihrem Satz waren eine Warnung vor Nötigung, vermutlich sexueller Nötigung. Wohlgemerkt sagte meine Mutter ja nicht: «Hab keinen Sex, nimm keine Drogen, tob dich nicht aus!» Sie ermahnte mich dazu, auf meine moralischen Gefühle zu hören – aber was genau ist das? Gefühl, vor allem Mitgefühl, spielt eine ausschlaggebende Rolle in unserem moralischen Verhalten.
An jenem Tag sprach sie mit mir, als wäre ich erwachsen, jemand, der nicht mehr auf die Anleitung durch seine Eltern angewiesen ist. Das schmeichelte mir und machte mir gleichzeitig ein bisschen Angst. Hinter dem Satz versteckte sich unausgesprochen die klare Botschaft, dass sie mir nicht mehr sagen würde, was ich tun sollte. Da meine eigene Tochter jetzt zwanzig ist, verstehe ich die Haltung meiner Mutter deutlicher. Als Kleinkind wollte Sophie ihre Finger in Steckdosen stecken, anderen Kindern ihr Spielzeug wegnehmen und sich bei jeder Gelegenheit ausziehen. Wenn ihr Vater und ich diese Wünsche durchkreuzten, brüllte sie, doch als Sechsjährige war sie ein völlig anderer Mensch. Beim leisesten Tadel vonseiten ihres Vaters oder meinerseits kamen ihr die Tränen. Schuldgefühl, eine wesentliche soziale Emotion, hatte sich in ihr herausgebildet und war Teil einer kodifizierten moralischen Welt mit richtigen und falschen Taten, Geboten und Verboten geworden.
Der Weg von der nackten Wilden über die bescheidene, einfühlsame kleine Person bis zur unabhängigen Erwachsenen ist auch eine Geschichte der Gehirnentwicklung. Von der Geburt bis zum Alter von etwa sechs Jahren entwickelt sich der präfrontale Kortex eines Kindes enorm, und wie er sich entwickelt, hängt von seiner Umgebung ab – worin alles, von Giften in der Atmosphäre bis zu der Art und Weise, wie seine Eltern für es sorgen, enthalten ist. Inzwischen ist wissenschaftlich erwiesen, dass auch das Gehirn eines Adoleszenten wesentliche Veränderungen durchmacht und dass emotionale Traumata und Deprivation, besonders wenn sie wiederholt stattfinden, dauerhafte nachteilige Prägungen im sich entwickelnden Gehirn hinterlassen können. Der präfrontale Kortex ist beim Menschen sehr viel entwickelter als bei anderen Tieren und wird oft als oberstes «Kontrollzentrum» bezeichnet, eine Region, die an der Bewertung und Überprüfung unserer Gefühle und unseres Verhaltens beteiligt ist.
Vor zwanzig Jahren stieß ich in einem Neurologielehrbuch auf die Geschichte des Phineas Gage. Im Jahr 1849 erlitt der Vorarbeiter bei der Eisenbahn einen kuriosen Unfall. Eine 1,10 Meter lange Eisenstange schoss durch seine linke Wange in seinen Schädel und trat oben am Kopf wieder aus. Wie durch ein Wunder wurde Gage wiederhergestellt. Er konnte gehen, sprechen und denken, aber er hatte zusammen mit einigen Kubikzentimetern der ventromedialen Region seines Frontallappens sein altes Selbst eingebüßt. Der einstmals freundliche, überaus tüchtige Vorarbeiter wurde impulsiv, anderen gegenüber aggressiv und gefühllos. Er schmiedete Pläne, konnte sie aber nie ausführen. Aus einem Job nach dem anderen hinausgeworfen, ging sein Leben den Bach hinunter, und er zog ziellos umher, bis er 1860 in San Francisco starb. Diese Geschichte verfolgte mich, weil sie auf etwas Schreckliches hindeutete: Moralisches Leben kann auf einen Klumpen Hirngewebe reduziert werden.
Ich erinnere mich, dass ich, nicht lange nachdem ich diese Geschichte gelesen hatte, die Frage einer Psychoanalytikerin stellte. Sie schüttelte den Kopf: Es war unmöglich. Aus ihrer Sicht hatte die Psyche nichts mit dem Gehirn zu tun – Moral verschwindet nicht einfach mit grauer Masse. Aber ich denke jetzt anders über die Phineas-Geschichte. Gage verlor, was er früher in seinem Leben erworben hatte – die Fähigkeit, die höheren Emotionen Empathie und Schuldgefühl zu empfinden, die beide unsere Handlungen in der Welt bremsen. Nach seiner Verletzung wurde er zu einer Art moralischem Kleinkind. Er konnte nicht mehr ermessen, inwieweit seine Handlungen anderen oder ihm selbst schaden würden, konnte kein Mitgefühl mehr empfinden, und ohne dieses Gefühl war er grundlegend behindert, obwohl seine kognitiven Fähigkeiten davon unberührt blieben. Er verhielt sich wie ein klassischer Psychopath, der im Affekt handelt und keine Reue empfindet.
In Descartes’ Irrtum: Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn erzählt der Neurologe Antonio Damasio Phineas Gages Geschichte nach und vergleicht dessen Fall mit dem eines seiner Patienten namens Elliot, dessen Frontallappen bei der operativen Entfernung eines bösartigen Hirntumors beschädigt wurden. Wie vor ihm Gage konnte Elliot nicht mehr vorausplanen, und sein Leben ging in die Binsen. Er wurde ebenfalls seltsam kalt. Obwohl seine intellektuellen Fähigkeiten gut zu funktionieren schienen, fehlte ihm Gefühl, für sich wie für andere. Damasio schreibt dazu: «Ich bemerkte, dass ich beim Anhören von Elliots Geschichten selbst mehr litt, als Elliot selbst zu leiden schien.»[8] Nach einer Reihe von Experimenten an seinem Patienten theoretisiert Damasio über etwas, was für meine Mutter selbstverständlich war: Gefühl hilft beim Treffen von Entscheidungen im Leben nicht nur, es ist wesentlich dafür.
Manchmal weiß ich allerdings nicht, was ich wirklich will. Ich muss in mir selbst suchen, und diese Suche erfordert sowohl ein intuitives Gespür für das, was ich fühle, als auch ein Projizieren meiner selbst in die Zukunft. Wird es mir leidtun, dass ich diese Einladung angenommen habe? Gebe ich dem Druck vonseiten eines anderen nach, worüber ich mich nachher ärgern werde? Ich verspüre Wut, nachdem ich jetzt diese E-Mail gelesen habe, aber habe ich nicht gelernt, dass es viel vernünftiger ist, ein paar Tage zu warten, ehe ich antworte, als jetzt gleich eine unwirsche Erwiderung loszuschicken? Die Zukunft ist natürlich erfunden – ein unwirklicher Ort, den ich nach meinen Erwartungen erschaffe, die aus meinen erinnerten Erfahrungen entstanden sind, insbesondere wiederholten Erfahrungen. Patienten mit präfrontalen Verletzungen zeigen identische eigentümliche Defizite. Sie bestehen alle möglichen Tests ihrer Kognition, aber etwas Wesentliches fehlt. Wie A.R. Lurija (1902–1977) in Die höheren kortikalen Funktionen des Menschen und ihre Störungen bei örtlichen Hirnstörungen anmerkt, «betonten die Kliniker bei relativ leichten Schädigungen der präfrontalen Hirnabschnitte immer wieder [ …], dass trotz intaktem ‹formalem Intellekt› bei den Patienten merkliche Verhaltensänderungen auftreten».[9] Sie büßen die kritische Fähigkeit ein, ihr eigenes Verhalten zu beurteilen, und verfallen in eine seltsame Indifferenz sich selbst und anderen gegenüber. Ich würde behaupten, dass mit ihrem emotionalen Vorstellungsvermögen etwas schiefgegangen ist.
Einige Jahre nach dem Gespräch mit meiner Mutter im Auto war ich mit meiner Cousine zum Skifahren in Aspen, Colorado. Eines frühen Abends fand ich mich allein oben an einem steilen Abhang, der durch die Buckel auf der Piste noch beängstigender wirkte. Ich konnte für diese Abfahrt nicht gut genug Ski fahren, war aber in den falschen Sessellift gestiegen. Es gab nur einen Rückweg für mich, und der ging hinunter. Als ich dort oben stand und sehnsüchtig zu dem Chalet weit unten blickte, hatte ich eine Offenbarung: An Ort und Stelle begriff ich, dass ich das Skifahren nicht mochte. Es war zu schnell, zu kalt. Es machte mir Angst. Es hatte mir immer Angst gemacht. Man mag sich wundern, wie es möglich ist, dass eine siebzehnjährige junge Frau diese schlichte Tatsache über ihr Leben erst angesichts einer Krise erkannte. Ich stamme aus einer norwegischen Familie. Meine Mutter ist in diesem nordischen Land geboren und aufgewachsen, und die Großeltern meines Vaters wanderten aus Norwegen aus. In Norwegen heißt es, Kinder fahren Ski, bevor sie laufen können, eine Übertreibung, die dennoch den Nagel auf den Kopf trifft. Auf die Idee, dass Skifahren keinen Spaß macht, nicht für jeden etwas ist, war ich nie gekommen. Dort, wo ich herstamme, steht die Sportart für Spaß, Natur, Familienglück. Während mir diese Gedanken durch den Kopf gingen, bemerkte ich, dass der Lift dichtmachte und der Himmel dunkel wurde. Ich holte tief Luft, stieß mich mit den Stöcken ab und stürzte mich in die Tiefe. Etwa eine halbe Stunde später fand mich eine Patrouille auf einem Motorschlitten mit nur einem Ski, sonst aber unversehrt, unter einem Buckel zusammengerollt.
So lächerlich die Geschichte ist, so weitreichend sind ihre Folgen. Wir bilden uns manchmal ein, wir wollten etwas, was wir eigentlich nicht wollen. Eine Meinung über etwas kann so in Fleisch und Blut übergehen, dass wir unfähig sind, sie zu hinterfragen, und diese Unfähigkeit kann womöglich mehr nach sich ziehen als einen Sturz auf der Skipiste. Die Freundin, die immer wieder zu einem Mann zurückgeht, der sie misshandelt, ist im Griff einer vertrauten, kontraproduktiven Lust, wodurch die vorgestellte Zukunft vergessen worden ist. Als arme Doktorandin gab ich manchmal zwanzig oder dreißig Dollar für ein T-Shirt oder ein Accessoire aus, das ich weder brauchte noch besonders gern besitzen wollte. Versessen war ich auf den Kauf, nicht auf die Sache als solche. Natürlich kann das Gefühl, nicht benachteiligt zu sein, eine emotionale Leere füllen, ohne verheerende Folgen zu haben. Andererseits ist man aufgeschmissen, wenn man danach seine Stromrechnung nicht bezahlen kann. Ich war auf der Skipiste fehl am Platz, weil ich etwas machte, was ich eigentlich nicht wollte. Mein schlechtes Urteilsvermögen war sowohl das Ergebnis einer Entfremdung von meinen Gefühlen als auch mangelnden Verständnisses für mich selbst. Die zweite Feststellung ist lebenswichtig. Weil ich mich wie alle Menschen objektivieren kann – mich als eine Person unter anderen in der Gesellschaft sehe –, bin ich nicht nur imstande, vorauszuplanen, indem ich mir vorstelle, wie das, was ich gerade tue, Auswirkungen auf das haben wird, was später mit mir passiert; ich komme auch auf den nötigen Abstand von mir, um mich als ein Wesen zu erkennen, das Mitgefühl verdient.
Im ersten Jahr meiner Ehe war ich nervös. Ich machte mir recht abstrakte Sorgen darüber, meine Freiheit zu verlieren, über das Familienleben im Allgemeinen, darüber, wie eine «Ehefrau» zu sein hat. Als ich meinen frischgebackenen Ehemann auf diese Sorgen ansprach, sah er mich an und sagte: «Nanu, Siri, tu doch einfach, was immer du tun willst.» Ich hatte meinem Mann nicht erzählt, was meine Mutter mir zwölf Jahre zuvor auf dem Highway 19 gesagt hatte, aber seine Worte erzeugten ein unabweisbares Echo. Ich begriff, dass er mir damit keinen Freibrief ausstellte, mich in die Arme eines anderen Mannes zu stürzen. Er gab mir jedoch die Freiheit, meinen Wünschen nachzugehen, weil er, wie meine Mutter, meinem moralischen Empfinden vertraute. Das bewirkte eine augenblickliche Befreiung. Mir fiel eine Last von den Schultern, und ich machte mich daran, zu tun, was ich tun wollte, was das Verheiratetsein mit jenem Mann, den ich liebte, einschloss.
Mein Denken über die Ehe unterschied sich gar nicht so sehr von dem über das Skifahren. Bei beidem nahm ich eine strenge, herzlose Außensicht ein: Skifahren soll Spaß machen, und die Ehe ist eine einengende Institution. Ich fragte mich erst gar nicht, was ich wirklich wollte, weil ich einer vorgefassten Meinung verhaftet war, die ich für mich selbst hinterfragen und für die ich ein Gefühl bekommen musste, bevor ich sie verwarf oder akzeptierte. Anders als bei Phineas und Elliot sind meine Frontallappen unversehrt. Ich weiß jedoch, dass die Mysterien meiner persönlichen Neurologie, wie die jedes anderen, eine Synthese aus meinem ureigenen genetischen Temperament und meiner im Lauf der Zeit gesammelten Lebenserfahrung sind, ein Gedanke, der mich wieder auf meine Mutter bringt, eine für diese Geschichte zentrale Person. Als ich ihr sagte, dass ich über den Rat schrieb, den sie mir vor Jahren gegeben hatte, sagte sie: «Du weißt ja, dass ich das nicht jedem einfach hätte sagen können.» Anders als irgendeine abgedroschene Phrase aus einem Erziehungsratgeber war der Satz meiner Mutter direkt an mich gerichtet und mit Kenntnis, Empathie und Liebe gesprochen worden. Ohne Zweifel sind mir ihre Worte deswegen in Erinnerung geblieben. Ich spürte sie.
2007
Suche nach einer Definition
Zweideutigkeit: nicht ganz das eine, nicht ganz das andere. Zweideutigkeit widersetzt sich einer Kategorisierung. Sie passt in keine Schublade, keine ordentliche Schachtel, keine Abteilung, keine Enzyklopädie. Sie ist ein formloses Objekt oder ein Gefühl, das nicht eingeordnet werden kann. Und es gibt kein Schema für Zweideutigkeit, kein beständiges Alphabet, keine Arithmetik. Zweideutigkeit fragt: Wo ist die Grenze zwischen diesem und jenem?
Es ist ein Trost, das Wort Stuhl zu sagen und in den Raum zu zeigen, wo der Stuhl steht. Es ist ein Trost, den Stuhl zu sehen und bei sich selbst leise das Wort Stuhl zu sagen, als wäre damit alles geklärt, als stimmten die Welt und das Wort überein. Naiver Realismus. Im Englischen kann ich einen einzigen Buchstaben zu word, Wort, hinzufügen und bekomme world, Welt. Ich setze ein kleines l zwischen das r und das d und schließe die Kluft zwischen beiden, und das Spiel erfüllt mich mit einiger Befriedigung.
Zweideutigkeit gehorcht keiner Logik. Der Logiker sagt: «Widersprüche dulden heißt gleichgültig für die Wahrheit sein.» Diese speziellen Philosophen spielen gern mit den Begriffen wahr und falsch. Es ist entweder das eine oder das andere, nie beides. Aber Zweideutigkeit ist von Hause aus widersprüchlich und unlösbar, eine verwirrende Wahrheit aus Nebel und Dunst und die nicht erkennbare Gestalt oder Erscheinung oder Erinnerung oder der Traum, den ich nicht festhalten kann, weil er sich immer wieder verflüchtigt, und ich kann weder sagen, was sie ist, noch, ob sie überhaupt etwas ist. Ich jage sie mit Wörtern, obwohl sie nicht gefangen werden kann, und ab und zu komme ich ihr nahe.
Dieses Gefühl der Nähe zu dem formlosen Gespenst Zweideutigkeit ist das, was ich am intensivsten will, was ich in ein Buch einbauen will und wovon ich mir wünsche, dass der Leser es spürt. Und weil es zugleich ein Ding und ein Nicht-Ding ist, muss der Leser es finden, nicht nur in dem, was ich geschrieben habe, sondern auch in dem, was ich nicht geschrieben habe.
2009
Mein seltsamer Kopf: Anmerkungen zur Migräne
1.Arme in Ruhestellung
Ich bin eine Migränikerin. Ich gebrauche das Substantiv mit Bedacht, denn nach lebenslangen Kopfschmerzen halte ich Migränen schließlich und endlich für einen Teil von mir, nicht für eine Macht oder Plage, die meinen Körper infiziert. Chronische Kopfschmerzen sind mein Schicksal, und ich habe eine Einstellung philosophischer Resignation dazu angenommen. Mir ist bewusst, dass so eine Auffassung schreiend unamerikanisch ist. Unsere Kultur ermutigt niemanden, Ungemach hinzunehmen. Im Gegenteil, gewöhnlich erklären wir Dingen, die uns zusetzen, den Krieg, seien es Drogen, Terrorismus oder Krebs. Unsere Medien fetischisieren die herzerwärmenden Geschichten jener, die allen Widrigkeiten zum Trotz nie die Hoffnung verlieren und über Armut, Abhängigkeit und Krankheit triumphieren. Wer sich zurücklehnt und sagt: «Das ist mein Los. So sei es», gilt als Versager, als passiver, pessimistischer Verlierer ohne Rückgrat, der nur Verachtung von uns verdient. Und doch kriegte ich genau in dem Moment die Kurve, als ich aufhörte, meine Krankheit als «Feind» zu betrachten, und es wurde allmählich besser. Ich war nicht geheilt, es ging mir nicht immer gut, aber besser. Metaphern spielen eine Rolle.
Obwohl Migräne erst bei mir festgestellt wurde, als ich zwanzig war, kann ich mich an keine Zeit erinnern, in der ich nicht unter Kopfschmerzen litt. Klaus Podoll, ein deutscher Neurologe, der sich mit Migräneauren und Künstlern beschäftigt hat, nahm vor einigen Jahren Kontakt zu mir auf, nachdem er ein Interview gelesen hatte, in dem ich eine Halluzination erwähnte, die einer meiner Kopfschmerzattacken vorausging. In einem E-Mail-Dialog befragte er mich eingehend zu meiner Geschichte und schloss, dass die alljährlichen Anfälle, die meine Mutter und ich für Magengrippe hielten, vermutlich Migräneanfälle waren. Ich stimmte ihm schließlich zu. Meine «Grippe» ging immer mit starken Kopfschmerzen und heftigem Erbrechen einher. Sie trat nicht während der Grippesaison auf und nahm stets denselben Verlauf. Zwei Tage Brechreiz und Schmerzen, die am dritten Tag nachließen. Meine ganze Kindheit hindurch kamen die Anfälle mit ritueller Regelmäßigkeit. Auf der Highschool hatte ich nicht so oft «Grippe», aber nachdem ich im dritten Studienjahr am College von einem äußerst aufregenden Auslandssemester zurückkehrte, das ich größtenteils in Thailand verbracht hatte, erkrankte ich an etwas, was ich wieder für Grippe hielt, einem sechs Tage anhaltenden Leiden mit qualvollen Kopfschmerzen und Würgen. Am siebten Tag ließ der Schmerz etwas nach, aber er ging nicht weg. Er ging ein Jahr lang nicht weg. Mal war es besser, mal schlimmer, aber mein Kopf tat mir immer weh, und mir war immer übel. Ich weigerte mich, klein beizugeben. Wie ein pflichtbewusster Roboter studierte ich, schrieb, bekam die erwünschten Bestnoten und litt allein, bis ich zu meinem Hausarzt ging, in seinen Armen schluchzte und Migräne diagnostiziert wurde.
Meine frühe Jugend war immer wieder von den Kopfschmerzen mit ihren Auren und Magensymptomen begleitet, nervöse Störungen, die kamen und gingen. Und dann, mit siebenundzwanzig, nachdem ich den Mann geheiratet hatte, den ich zutiefst liebte, ging ich mit ihm auf Hochzeitsreise nach Paris und wurde wieder krank. Es begann mit einem Krampfanfall: Mein linker Arm schoss plötzlich nach oben, und ich wurde rückwärts gegen die Wand der Kunstgalerie geschleudert, die ich gerade besuchte. Der Krampf ging vor über. Der danach einsetzende Kopfschmerz hielt monatelang an. Dieses Mal suchte ich nach einem Heilmittel. Ich war entschlossen, meine Symptome zu bekämpfen. Ich konsultierte einen Neurologen nach dem anderen, nahm unzählige Medikamente: Cafergot, Inderal, Mellaril, Tofranil, Elavil und andere, die ich vergessen habe. Nichts half. Mein letzter Neurologe, bekannt als der Kopfschmerzpapst von New York, wies mich ins Krankenhaus ein und verschrieb Megaphen, ein starkes Antipsychotikum. Nach acht Tagen stumpfer Sedierung und anhaltender Kopfschmerzen entließ ich mich selbst aus der Klinik. In panischer Verzweiflung glaubte ich inzwischen, nie wieder gesund zu werden. Als letztes Mittel schickte der Papst Unheilbare wie mich zu einem Biofeedback-Fachmann. Dr. E. schloss mich über Elektroden an eine Maschine an und brachte mir bei, wie man entspannt. Die Technik war simpel. Je verkrampfter ich war, desto lauter und schneller piepte die Maschine. Je mehr ich entspannte, desto langsamer kam das Piepen, bis es schließlich aufhörte. Acht Monate lang ging ich einmal in der Woche zu ihm und übte, mich gehenzulassen. Zu Hause übte ich jeden Tag ohne die Maschine. Ich lernte, meine kalten Hände und Füße zu wärmen, meinen Kreislauf zu verbessern, den Schmerz zu verringern. Ich lernte, mit dem Kämpfen aufzuhören.
Migräne ist nach wie vor eine mangelhaft verstandene Krankheit. Obwohl neue Techniken, wie Neuroimaging, dazu beigetragen haben, einige der beteiligten neuronalen Schaltkreise zu isolieren, liefern Bilder vom Gehirn keine Lösung. Das Syndrom ist zu vielfältig, zu komplex, zu sehr mit Außenreizen und der Persönlichkeit des Kranken verquickt – Anzeichen von Migräne sind auf MRTs oder PET-Scans mit ihren farbigen Markierungen nicht sichtbar. Mir ist inzwischen klargeworden, dass meine Kopfschmerzen zyklisch sind und eine Rolle in meinem Gefühlshaushalt spielen. Als Kind war das Leben mit meinen Mitschülern immer hart für mich, und meine alljährlichen Entschlackungen dienten wahrscheinlich einem Zweck. An zwei Tagen im Jahr erlitt ich eine kathartische Auflösung, in deren Verlauf ich zu Hause und nah bei meiner Mutter bleiben konnte. Aber auch in Zeiten großen Glücks kann ich durchdrehen – siehe das Abenteuer in Thailand und das Verliebtsein und Heiraten. Beidem folgte ein Absturz in den Schmerz, so als hätte die Freude meinen Körper bis an die Grenze seiner Belastbarkeit angestrengt. Dann erneuerte sich die Migräne von selbst. Ich bin davon überzeugt, dass ein Zustand von Furcht und Angst und eine ständige Bereitschaft, gegen das Ungeheuer Kopfschmerz anzukämpfen, mein zentrales Nervensystem in einen permanenten Alarmzustand versetzten, der nur mit einer ausgiebigen Ruhepause beendet werden konnte. Ich befinde mich immer noch in diesem Zyklus. Perioden obsessiven und hochproduktiven Schreibens und Lesens, die mir enorm viel Freude bereiten, werden oft von einem neurologischen Zusammenbruch abgelöst – Kopfschmerzen. Meine Schwankungen zwischen Hoch und Tief haben Ähnlichkeit mit dem Rhythmus manisch-depressiver oder bipolarer Störungen, außer dass ich nicht in eine Depression, sondern in eine Migräne abstürze und meine Manien weniger extrem sind als die von Menschen, die an der psychischen Erkrankung leiden. In Wirklichkeit ist die Trennung neurologischer und psychischer Störungen oft künstlich, genauso wie die hartnäckige alte Unterscheidung zwischen Psyche und Soma. Alle menschlichen Zustände, einschließlich Wut, Angst, Traurigkeit und Freude, sind körperlich. Sie haben neurobiologische Korrelate, wie auf dem Gebiet Forschende sagen würden. Was wir häufig als rein psychologisch betrachten, zum Beispiel wofür wir eine Krankheit halten, ist wichtig. Unsere Gedanken, Einstellungen, sogar unsere Metaphern bewirken physiologische Veränderungen in uns, was im Falle von Kopfschmerzen den Unterschied zwischen Leiden und Zurechtkommen bedeuten kann. Die Forschung hat nachgewiesen, dass Psychotherapie therapeutische Veränderungen im Gehirn erzeugen kann, eine Steigerung der Aktivität im präfrontalen Kortex, der «Kontrollzentrale» unseres Geistesorgans. Ja, man kann sich durch bloßes Reden und Zuhören verbessern.
Es ist noch niemand an Migräne gestorben. Es ist kein Krebs, keine Herzkrankheit, kein Schlaganfall. Bei einer lebensbedrohlichen Krankheit kann einen die eigene Einstellung – egal, ob kämpferisch oder buddhistisch – nicht am Leben erhalten. Sie kann lediglich verändern, wie man stirbt. Aber bei meinen Migränen, die weiterhin kommen und das zweifellos immer tun werden, habe ich herausgefunden, dass Kapitulation dem Kämpfen vorzuziehen ist. Wenn ich eine kommen fühle, gehe ich ins Bett und mache, jetzt ohne Maschine, meine Entspannungsübungen. Meine Meditationen haben keine magische Wirkung, aber sie halten den schlimmsten Schmerz und Brechreiz in Schach. Ich heiße meine Kopfschmerzen nicht willkommen, aber ich betrachte sie auch nicht als etwas Fremdes. Womöglich dienen sie sogar einer notwendigen regulierenden Funktion, indem sie mich zwingen kurzzutreten, eine Art Buße, wenn Sie so wollen, für die anderen hochfliegenden Tage.
2.«Kurioser und kurioser»
«‹Wer in aller Welt bin ich?› Ja, DAS ist das große Rätsel!», sagt Lewis Carrolls Alice, nachdem sie einen plötzlichen verwirrenden Wachstumsschub durchgemacht hat. Während sie über diese schwierige philosophische Frage nachdenkt, verändert sich ihr Körper wieder. Das Mädchen schrumpft. Ich habe mir viele Male dieselbe Frage gestellt, oft im Zusammenhang mit den Wahrnehmungsveränderungen, eigenartigen Gefühlen und erlesenen Empfindlichkeiten des Migränezustands. Wer in aller Welt bin ich? Bin «ich» lediglich schlecht funktionierende graue Substanz? In seinem Buch Was die Seele wirklich ist schrieb Francis Crick (berühmt für die Entdeckung der Doppelhelix-Struktur der DNA zusammen mit James Watson): «Sie, Ihre Freuden und Leiden, Ihre Erinnerungen, Ihre Ziele, Ihr Sinn für Ihre eigene Identität und Willensfreiheit – bei alldem handelt es sich in Wirklichkeit nur um das Verhalten einer riesigen Ansammlung von Molekülen.»[10] Seele ist Materie, behauptete Crick. Alles menschliche Leben kann auf Neuronen reduziert werden.
Es gibt ein Migräneauraphänomen, das nach Charles Lutwidge Dodgsons (Lewis Carrolls) Geschichte der unzähligen Verwandlungen benannt ist: Alice-im-Wunderland-Syndrom. Der Betroffene fühlt, dass er und Teile von ihm sich aufblähen oder an Größe abnehmen. Die neurologischen Begriffe für diese seltsamen Gefühle des Wachsens oder Schrumpfens lauten Makroskopie und Mikroskopie. Dodgson war Migräniker. Man weiß auch, dass er Laudanum nahm. Es erscheint mehr als möglich, dass er zumindest einige der seltsamen somatischen Erfahrungen gemacht hat, von denen seine junge Heldin heimgesucht wird. Diese Erfahrungen gibt es nicht nur bei Migräne. Sie kommen auch bei Menschen vor, die einen neurologischen Schaden erlitten haben. In Der Mann, dessen Welt in Scherben ging berichtet A.R. Lurija vom Fall seines Patienten Sassetzki, der im Zweiten Weltkrieg eine schreckliche Hirnverletzung davontrug. «Manchmal sitze ich da und fühle plötzlich, daß mein Kopf so groß ist wie ein Tisch, mindestens so groß. Arme, Beine und Rumpf aber sind winzig klein geworden»[11], schreibt Sassetzki. Das Körperbild ist ein komplexes, labiles Phänomen. Die durch nahende Kopfschmerzen angerichteten Veränderungen im Nervensystem, die durch einen Schlaganfall oder eine Kugel verursachten Verletzungen können die innere Körperkarte des Gehirns beeinträchtigen, und dann verwandeln wir uns.
Ist Alice im Wunderland ein pathologisches Produkt, das Ergebnis des Amoklaufs der «Nervenzellen und zugehörigen Moleküle» eines Junggesellen? Die Tendenz, künstlerische, religiöse oder philosophische Leistungen auf körperliche Leiden zurückzuführen, wird von William James in Die Vielfalt religiöser Erfahrung: eine Studie über die menschliche Natur treffend benannt: «Medizinischer Materialismus», schreibt er, «schließt mit dem heiligen Paulus ab, indem er seine Vision auf der Straße nach Damaskus eine Entladung aufgrund einer Läsion des Sehzentrums nennt: Paulus sei Epileptiker gewesen. Er erledigt die heilige Theresa als Hysterikerin, den heiligen Franz von Assisi als erbgeschädigt.»[12] Und, könnte ich hinzufügen, Lewis Carroll als Drogenabhängigen oder Migräniker. Wir leben immer noch in einer Welt des medizinischen Materialismus. Menschen bezahlen Tausende, um