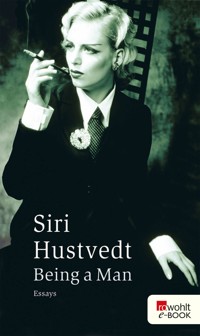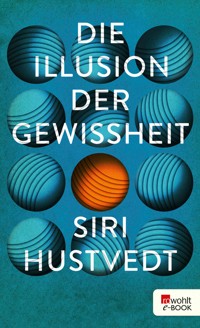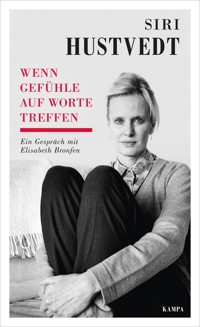
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Kampa Salon
- Sprache: Deutsch
Alles beginnt in einem Sommer in Island. Die Nächte sind lang und hell. Siri Hustvedt, 13, liest David Copperfield und weiß, dass sie Schriftstellerin werden will. Mit 14 liest sie Simone de Beauvoir und wird Feministin. Ihre Wissbegier ist schon früh enorm. Mit Anfang zwanzig flieht sie aus der amerikanischen Provinz zum Studium nach New York, wo sie noch heute lebt. Das Bewegliche, Offene dieser Stadt habe sie immer fasziniert, erzählt Hustvedt der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen im Sommer 2018. Alles Starre, jedes Dogma hingegen ist ihr fremd - kulturelle Stereotype, patriarchale, sexistische Denkmuster, wie sie im Amerika unter Donald Trump wieder an Popularität gewinnen. Siri Hustvedt sucht das Verbindende, nicht das Trennende, eine Vielfalt der Perspektiven. Das Spiel mit Identitäten, auch mit Geschlechteridentitäten bestimmt ihre Romane, das Zusammenwirken verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen ihre essayistischen Texte. Luzide legt Siri Hustvedt dar, dass wahre Denkräume Zwischenräume sind, in denen nicht die Gewissheit regiert, sondern das Sowohl-als-auch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Siri Hustvedt
Wenn Gefühle auf Worte treffen
Ein Gespräch mit Elisabeth Bronfen
Kampa
Teil 1Sommer 2018
1Anfänge
Jeder wird an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit geboren. Sie haben in Essays wie »Nicht hier, nicht dort« über Ihre Kindheit und Jugend geschrieben, und es erscheint mir sinnvoll, zuerst darüber zu sprechen, wo Ihr Leben angefangen hat, etwas über Ihre Familie zu erfahren, und wie all das Ihre Entscheidung beeinflusst hat, Schriftstellerin zu werden.
Mein Leben begann am 19. Februar 1955 in Northfield, Minnesota. Zu der Zeit bestand die Bevölkerung aus rund 6000 Einwohnern plus 3000 Collegestudenten. Mein Vater lehrte an einem der beiden Colleges, St. Olaf, das 1874 von norwegischen Einwanderern gegründet worden war. Er selbst war kein Einwanderer, auch seine Eltern nicht, aber seine Großeltern. Er wuchs auf einer kleinen Farm außerhalb von Cannon Falls in Minnesota auf, wo er während der Weltwirtschaftskrise mit seinen Eltern und drei Geschwistern lebte. Die Krise hat ihn nachhaltig geprägt. Meine Großeltern waren nie reich gewesen, aber die Farm bot ihnen ein Auskommen. Die Weltwirtschaftkrise traf sie hart, mit verheerenden Folgen. Sie verloren den größten Teil ihres Grund und Bodens und mussten die Landwirtschaft schließlich einstellen.
Als Kind bin ich nie auf den Gedanken gekommen, dass Grandma und Grandpa arm wären. Meine Schwester Liv und ich wussten, was »arm« bedeutete, aber das war ein Wort, das in Märchen gebraucht wurde oder in den Zeitungen, die unsere Eltern lasen, ein Wort für ferne Verhältnisse in Städten mit »Slums«, die wir nie gesehen hatten. Meine Großeltern hatten kein fließend Wasser in ihrem kleinen Haus, und Strom gab es erst, nachdem mein Vater aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt war. Er legte 1949 die Leitungen. Allmählich, ganz allmählich begriff ich, was meinen Großeltern zugestoßen war. Ihre Farm, unser Kinderspielplatz mit dem stillgelegten Traktor, einer zerfallenen Scheune, der rostigen Pumpe, sprießenden Weinreben, dem Birnen- und Apfelgarten und der riesigen Eiche, war seit der Weltwirtschaftskrise erstarrt: eine Art Denkmal dessen, was einmal eine Farm gewesen war.
Das war eine schreckliche Zeit in der Geschichte des ländlichen Amerikas. Man konnte sich zu Tode schuften, und es brachte nichts – man steckte einfach fest. Ich begriff auch nur allmählich, dass die schlimmen Entbehrungen infolge der Weltwirtschaftskrise und dann, im Zweiten Weltkrieg, der Kampfeinsatz in Neuguinea und auf den Philippinen meinen Vater nie mehr losgelassen haben. Diese Ereignisse waren entscheidend für seine Persönlichkeit.
Ich stelle mir Ihre Großeltern und Ihr Leben auf dieser Farm im Mittleren Westen wie eine Szene aus Willa Cathers Meine Antonia vor.
Das wäre Nebraska, ja, gar nicht so weit von Minnesota entfernt, aber Nebraska ist großflächiger und ebener. Antonia und ihre Familie sind Einwanderer, die ihren ersten Winter in der Prärie unter der Erde verbringen. Sie graben ein Loch und verkriechen sich darin, um sich gegen die brutale Witterung der Jahreszeit zu schützen, ehe sie ein Haus bauen. Ich glaube nicht, dass meine Urgroßeltern je in einem Erdloch lebten, aber es gab unzählige Geschichten über die physischen und emotionalen Härten des Schicksals derer, die von Europa in den Mittleren Westen kamen. Ich habe eine Menge Geschichten über Einwanderer gehört, die draußen in der Prärie verrückt geworden sind. Wie es scheint, war das keine Übertreibung. Erst kürzlich las ich eine auf Krankenhausbefunde gestützte Untersuchung, aus der hervorging, dass norwegische Einwanderer der ersten Generation häufiger unter Geisteskrankheiten litten als diejenigen ihrer Landsleute, die zu Hause geblieben waren, häufiger auch als ihre in den USA geborenen Kinder. Das geteilte Selbst fordert seinen Tribut.
Die Lieblingsgeschichte meiner Mutter war die eines Farmers, der die norwegischen Berge so sehr vermisste, dass er Felsbrocken ausgrub, sie aufhäufte und sich seinen eigenen Berg baute. Als ich acht oder neun war, stieß mein Vater bei Arbeiten auf unserem Grundstück auf irgendeinen Stein und begann ihn auszugraben. Er grub und grub, und es stellte sich heraus, dass das Ding viel größer war, als er vermutet hatte. Schließlich zog er mithilfe eines Seils und der Zugkraft unseres Autos einen riesigen Findling aus der Erde. Meine Mutter liebte ihn. Er lag bei uns im Vorgarten, und sie nannte ihn ihren »norwegischen Berg«.
Deshalb hat mich Ihre Schilderung an die Romane des späten amerikanischen Realismus erinnert, daran, wie Armut und Mühsal dort in den Mittelpunkt gerückt werden. Bedeutet das, so etwas wie Wohlstand zog erst mit der Generation Ihrer Eltern in Ihre Familie ein?
Nein, das nicht, meine Großmutter hatte von ihrem Vater einiges Geld geerbt, Geld, das aber eigentlich von der mütterlichen Seite stammte. Die Ehe mit meinem Großvater war finanziell gesehen ein Abstieg für sie, und ich glaube, sie hat sich nie ganz an diese Veränderung gewöhnt. Sie war eine stolze, eigensinnige Frau, die zu Wutausbrüchen wie zu Lachanfällen neigte. Sie brach alle Rekorde im Kartoffelschälen, schleppte schwere Eimer von der Pumpe herbei und schob dicke Holzscheite in den Bollerofen. Sie war eine imposante Erscheinung, massig, stark, das Gesicht von Falten schraffiert. Sie hatte nur zwei Jahre die Schule besucht. Sie konnte lesen und schreiben, hatte aber nie eine Chance gehabt, sich weiterzubilden.
Mein Großvater war vier Jahre zur Schule gegangen. Er war Autodidakt. Er las Bücher und Zeitungen, kaute eine Menge Tabak, spuckte den Saft in eine Kaffedose, die neben seinem Sessel auf dem Boden stand, und sagte alles in allem sehr wenig. Ich mochte ihn trotzdem. Er hatte ein sanftes Wesen und ein freundliches, weiches, schönes Gesicht.
Mein Vater war weitaus besser dran als seine Eltern, aber wir lebten zu sechst von dem, was auch damals ein mageres akademisches Gehalt war.
Viele norwegische Einwanderer haben sich in Teilen des Mittleren Westens niedergelassen, wo es viele andere Immigranten aus Skandinavien gab. Wie wichtig war die Erinnerung an die alte Heimat für sie? Wie wichtig war das Festhalten an Traditionen, und wie wirkte sich das auf ihr Amerikanischwerden aus?
Ich weiß von einem Ritual der kulturellen Integration, das im Zuge der großen Einwanderungswellen aus Europa praktiziert wurde und mich immer fasziniert hat. Nach meiner Erinnerung wurden die Einwanderer aufgefordert, in ihren traditionellen Trachten eine Scheune zu betreten. Dann, nachdem sie ihre alte Kleidung abgelegt und typisch amerikanische angezogen hatten, kamen sie auf der anderen Seite verwandelt wieder heraus. Dadurch sollte die Idee der Aufgabe des alten Landes, das sie verlassen hatten, um sich als Bürger in dem neuen anzusiedeln, zur Schau gestellt werden. Zur Abschlussfeier der Ford English School am 4. Juli 1917 wurde eine Zeremonie veranstaltet, bei der die Absolventen in der Kleidung ihrer Herkunftsländer in einen großen »Tiegel« mit der Aufschrift The American Melting Pot steigen mussten. Dahinter stand der Gedanke, ihre Einwandereridentität müsse symbolisch weggeschmolzen werden, damit sie als neue Bürger in amerikanischer Kleidung und die amerikanische Fahne schwingend wieder herauskämen.
Ich glaube nicht, dass meine Urgroßeltern ihren Bunad – das norwegische Wort für die traditionelle Nationaltracht – je in einem Ritual aufgegeben haben, aber Ihre Geschichte bringt das große Einwanderungsdilemma auf den Punkt: Wie sehr sollten wir uns der neuen Welt anpassen und wie viel von der alten bewahren? Meine Großeltern väterlicher- wie mütterlicherseits, die selbst keine Einwanderer waren, sprachen Englisch mit starkem norwegischen Akzent, wie übrigens auch mein Vater. Sie nannten das »Mundart«, die Mundart ihrer kleinen Gemeinde: eine Art dialektal gefärbte Sprechweise, ähnlich dem, was sich damals auch in anderen Teilen des Landes, einschließlich Brooklyn, entwickelte, von Einwanderern geprägte Sprachklänge, wie es sie in vielen Sprachen gibt. Meine Großeltern und mein Vater hatten eine spezielle Art, Englisch im Rhythmus westnorwegischer Musik zu sprechen. Interessanterweise hat mein Vater diese Sprechweise nie abgelegt. Er bewahrte sie bis zum Tag seines Todes. Er klang nicht »amerikanisch« oder jedenfalls nicht so, dass irgendjemand es für amerikanisch gehalten hätte, aber das war er eben – ein »Norwegisch-Amerikaner« der dritten Generation.
War das vielleicht seine Art, an jener alten Welt festzuhalten, die er vorwiegend aus Erzählungen seiner Eltern und Verwandten kannte? Oder gar ein bisschen Nostalgie?
Ich glaube schon. Sich in seiner Aussprache zu mäßigen, hätte für ihn bedeutet, seine Wurzeln hinter sich zu lassen. Er hätte jeden Versuch, anders zu klingen, als Getue und als Verrat an seiner Familie betrachtet. Er wurde zum Gelehrten seines eigenen Volkes. Nach dem Krieg nahm er die G.I. Bill – das Recht aller Kriegsteilnehmer auf Universitätszugang – für den Collegebesuch in Anspruch und wurde schließlich an der University of Wisconsin in Skandinavistik promoviert. Das war damals eine neue Disziplin, eine Kombination von Literatur und Geschichte. Er hatte das Temperament eines Historikers, der tief in die Detailfülle der Vergangenheit eintaucht, aber er liebte Ibsen, kannte dessen Stücke in- und auswendig. Später, als Professor, hielt er einen Kurs über Ibsen – sein Lieblingskurs, der auch bei den Studenten großen Anklang fand und ihm erlaubte, seine darstellerische Begabung auszuleben. Mein Vater war ein hervorragender Redner und konnte sehr witzig sein. Seine größte Leidenschaft aber war die Einwanderungsgeschichte, und er verbrachte viele Jahre seines Lebens damit, das Archiv der NAHA, der Norwegian-American Historical Association, zu organisieren, ohne den geringsten Lohn, ganz ohne Bezahlung.
Später, als ich erwachsen war, wurde mir klar, dass diese Arbeit im Archiv ihm ermöglichte, die Vergangenheit wiederherzustellen, einen Ausgleich für das Leiden zu schaffen, das er als Kind mit seinen Eltern und Geschwistern draußen auf der Farm erfahren hatte. Es war eine Art, zu würdigen, was oft erniedrigend gewesen war, persönlich erniedrigend für seine Eltern wie für ihn. Sie hatten darunter gelitten, so arm zu sein, dass andere Leute auf sie herabblickten. Solche Gefühle bleiben haften. Er identifizierte sich zutiefst mit seinem Einwanderervermächtnis, obwohl er nicht in Norwegen geboren war. Um 1950 kam er mit einem Fulbright-Stipendium nach Oslo, wo er meine Mutter kennenlernte. Danach ist er häufig nach Norwegen gefahren. Irgendwann grub er Dokumente über seinen Großvater, Urgroßvater und Ururgroßvater aus, die auf einem abgelegenen Hof namens Hustveit, hoch in den Bergen außerhalb von Voss, einer Stadt in Westnorwegen, gelebt hatten.
Er zeigte nie großes Interesse an der Familie seiner Mutter. Ich weiß wenig über sie. Sein Augenmerk galt ausschließlich der väterlichen Seite – ein Detail, das ich heute faszinierend finde. Er fühlte sich seinem Vater viel näher als seiner Mutter. Wichtiger ist hier jedoch, dass er selbst sein Zuhause nie verlassen hatte. Sein Leben war der Erinnerung gewidmet, der Wiederherstellung jener verlorenen Welt, die ihn geformt hatte, die er aber studieren musste, um sie zu verstehen.
Man könnte sagen, dass seine Sorge um die norwegische Kultur etwas mit transgenerationaler Erinnerung zu tun hatte, vielleicht sogar mit transgenerationaler Heimsuchung. So wie Sie es beschreiben, versuchte er offenbar, ein europäisches Zuhause wiederherzustellen und zu bewahren, das nie sein tatsächliches Zuhause gewesen war, ein Zuhause, das er nur aus den Geschichten und Erzählungen derer kannte, die Norwegen verlassen hatten.
Ja, die Geschichten der Einwanderer bedeuteten ihm viel, aber es war auch Schmerz in diesen Erinnerungen. Vielleicht hat ihm die Beschäftigung mit der Einwanderungsgeschichte dazu gedient, diesen Schmerz zu verstehen, der als Heimsuchung von früheren Generationen kam. Das Archiv der NAHA ist voller Tagebücher, Briefe, Kochrezepte, Bücher und Zeitungen, auf Norwegisch wie auch auf Englisch. Alles wurde sorgfältig gesammelt und mit Anmerkungen versehen. Es ist ein riesiges Archiv, das die Übersiedlung von rund einer Million Menschen aus einem kleinen nordischen Land in die Vereinigten Staaten zwischen 1840 und 1920 dokumentiert.
Man muss sich dabei vor Augen führen, dass viele Kinder dieser Einwanderer »das alte Land« nie kennengelernt haben. Meine Großmutter väterlicherseits war nie in Norwegen, und ich bin mir nicht sicher, ob sie sich überhaupt danach gesehnt hat. Nachdem ihr Mann, Lars Hustvedt, unerwartet etwas Geld von einer Verwandten geerbt hatte, machte er sich mit siebzig Jahren allein auf seine erste Reise nach Norwegen. Er fuhr nach Voss, besuchte Hustveit und verblüffte die norwegischen Verwandten mit seiner genauen Kenntnis des Hofs. Meinem Vater zufolge sagten sie, Lars kenne jeden Stein dort. Dieses Wissen muss durch Geschichten überliefert worden sein. Durch die Erzählungen meines Urgroßvaters war Hustveit für meinen Großvater ein imaginärer Ort geworden, den er über Jahrzehnte mit sich herumtrug, ehe er ihn zum ersten Mal mit eigenen Augen sah. Ja, das ist eine Form von transgenerationaler Heimsuchung, die sich wohl kaum auf Norweger beschränkt.
Mein Mann und ich haben eine Freundin, die aus einer philippinisch-amerikanischen Familie kommt. Als Wissenschaftlerin hat sie jahrelang über die Geschichte der philippinischen Einwanderer gearbeitet. Als ich bei einem Abendessen in unserem Haus in Brooklyn die Norwegian-American Historical Association erwähnte, sagte sie: »Das ist ein berühmtes Archiv, ein Vorbild für andere, neuere Einwanderungsarchive, die jetzt auf die Beine gestellt werden.« Das hat mich so gefreut! Es ist ein wunderbarer Gedanke, dass ein norwegisches Archiv als Vorbild für Einwanderer dienen kann, die später von den Philippinen in die USA kamen. So verschieden die beiden Kulturen auch sein mögen, teilen sie doch Geschichten der Assimilation und des Widerstands dagegen, Geschichten von Anpassung und einer Unfähigkeit zur Anpassung. Der einzige wirklich große Unterschied besteht darin, dass die Norweger nicht dem Rassismus ausgesetzt waren, der allen farbigen Einwanderern in den Vereinigten Staaten entgegenschlug und heute noch entgegenschlägt. Die Norweger bekamen es mit Klassenvorurteilen, zweifellos auch mit Fremdenfeindlichkeit zu tun, aber nicht mit Rassismus.
Inzwischen ist diese Welt im ländlichen Minnesota, die ich als Kind kannte, vom Erdboden verschwunden. Die alten Leute, die dort draußen in ihren Farmhäusern lebten und alle Norwegisch sprachen, sind gestorben. Ihre Kinder sind fort. Sie sprechen die Sprache nicht mehr. Diese Welt ist tot.
Aber sicher ist die Verbindung zu Europa nicht vollständig abgerissen. Wie fügt sich eigentlich Ihre Mutter in das Bild?
Meine Mutter ist bis heute durch und durch Norwegerin, obwohl sie schon seit langer Zeit amerikanische Staatsbürgerin ist. Sie hat die ersten dreißig Jahre ihres Lebens, einschließlich der fünf Jahre Nazi-Besatzung während des Zweiten Weltkriegs, in Norwegen verbracht. Ihre Kindheit und ihr frühes Erwachsenenleben waren norwegisch, und das nahm sie mit in die Vereinigten Staaten. Die vielen Geschichten über ihre gutbürgerliche Kindheit in Mandal, der südlichsten Stadt Norwegens, wo sie mit ihrem geliebten Postmeister-und-Gutsbesitzer-Vater und ihrer gleichermaßen, wenn nicht noch inniger geliebten Mutter, ihren drei älteren Geschwistern, einer Kuh, einem Pferd, Hühnern und zwei Dienstmädchen ganz oben auf einem Berg mit Aussicht aufs Meer lebte, haben auch mich geprägt. Nach ihren Schilderungen waren die ersten zehn Lebensjahre meiner Mutter paradiesisch. Als sie zehn war, verlor ihr Vater sein ganzes Hab und Gut, weil er für einen seiner Cousins einen faulen Geschäftsvertrag unterschrieben hatte. Sie zogen in eine kleine Stadt bei Oslo, und ihre Lebensumstände änderten sich. Dann kam der Krieg, eine trostlose Zeit für die gesamte Familie. Der Vater meines Vaters starb 1943, während der Besatzung, an einem Herzleiden. Das waren düstere Zeiten. Trotzdem erzählte sie uns Kindern viele aufregende Geschichten.
Einmal, zu Beginn der Okkupation, wurde sie neun Tage ins Gefängnis gesteckt, weil sie zusammen mit anderen Schülern ihres Gymnasiums gegen die Nazis protestiert hatte und die Strafe lieber absitzen wollte, als ein Bußgeld zu bezahlten. Ihr Bruder, der als einer der Rädelsführer ausgemacht worden war, hatte keine Wahl, er musste für drei Monate in ein Osloer Gefängnis. Von den Übrigen aber war sie, ein siebzehnjähriges Mädchen, die Einzige, die sich weigerte, die Geldstrafe zu bezahlen. Ich glaube ganz ehrlich, dass die Deutschen nicht wussten, was sie mit ihr machen sollten. Sie öffneten ein altes Gefängnis im nahe gelegenen Mysen, wo sie ihre Strafe in einer winzigen Zelle mit einem hohen, vergitterten Fenster und einem kleinen Nachttopf bei Wasser und vergammelten grünen Kartoffeln verbüßte. Am Ende, sagte sie, sei ihr Bauch furchtbar aufgebläht gewesen, aber sie machte sehr deutlich, dass sie nicht verzweifelt war. »Ich wusste, sie würden mich wieder rauslassen«, sagte sie. Sie erinnert sich auch, im Gefängnis So grün war mein Tal gelesen und den Roman geliebt zu haben. Ihr ganzes Wesen hatte immer etwas fröhlich Optimistisches.
Mit vier Jahren habe ich meine Mutter angeblich gefragt, warum in Norwegen alles besser sei. Sie sagte, sie sei schockiert gewesen und habe sich gedacht: »O mein Gott, was habe ich dem Kind denn nur erzählt?« Dann strengte sie sich sehr an, nicht mehr offen nach ihrer Heimat zu schmachten. Arme Mama, meine Frage machte ihr bewusst, was sie gesagt haben musste, ohne es zu merken – sie hatte ihr Heimweh mitgeteilt. Als sie mir Jahre später davon erzählte, wurden mir die Folgen ihrer Umsiedlung erst wirklich klar. Ihre Schwester, zwei Brüder und ihre geliebte Mutter lebten noch, aber während unserer Kindheit hatte sie kaum Gelegenheit, sie zu sehen. Wir konnten uns das Flugzeug nicht leisten. Erst viel später, als wir mehr Geld hatten, war sie in der Lage, fast jeden Sommer nach Norwegen zu reisen. Ich glaube, die Jahre der Trennung von denen, die sie liebte, und der Kultur, in der sie sich zu Hause fühlte, waren schwierig für sie, wenngleich sie selbst ihre Lebensgeschichte nicht als schwierig bezeichnen würde, selbst heute nicht.
Geographisch betrachtet, war es bei mir genau umgekehrt. Meine Großeltern, jüdische Einwanderer aus Litauen, lebten in Queens, während ich in Deutschland aufwuchs, und ich konnte sie nur ein einziges Mal sehen, bevor sie starben, weil es damals so teuer war, über den Atlantik zu fliegen. Obwohl mein Vater ein ziemlich erfolgreicher Anwalt war, hatte auch er nicht das Geld, um mit der ganzen Familie seine Heimat und Verwandtschaft zu besuchen. Wie war es denn für Sie, in einer amerikanischen, aber stark norwegisch beeinflussten Gemeinde aufzuwachsen?
In Northfield lebten auch Menschen anderer Herkunft, vor allem Deutsche, Polen und Tschechen, aber es gab viele, insbesondere im Umkreis von St. Olaf, die sich mit ihrem norwegischen Erbe identifizierten. Zu Weihnachten aßen sie Lefse, dünne Kartoffelfladen, und Lutefisk, eine grässliche Sorte von getrocknetem und in einer Lauge gewässertem Dorsch (den meine Mutter nie probiert hatte, bis sie in die USA kam), und wenn es kalt war, trugen sie Norwegerpullover, aber nur wenige sprachen mehr als ein paar Worte Norwegisch. Unser Haus dagegen war durch und durch norwegisch. Wir hatten moderne norwegische Möbel. Auf den Regalen standen norwegische Bücher: Hamsun, Ibsen, Bjørnson, Vesaas, Undset, Skram. Edvard Munch war der erste Künstler, über den ich oft nachdachte, weil wir mehrere Kunstbände mit Reproduktionen seiner Bilder hatten.
Meine erste Sprache war Norwegisch, da die Mutter meiner Mutter in der Zeit, als ich sprechen lernte, ein ganzes Jahr bei uns blieb und im Haus nur Norwegisch gesprochen wurde, aber nachdem sie fort war, wechselten wir zum Englischen, und ich vergaß Norwegisch. Als ich vier war, verbrachte ich mit meiner Mutter und meiner Schwester Liv, die damals zweieinhalb war, fünf Monate in Norwegen. Wir Kinder vergaßen das Englische. Zurück in den USA war wieder Englisch dran, und wir vergaßen Norwegisch. Als ich zwölf war, zogen wir mit der ganzen Familie nach Bergen – mein Vater hatte dort einen Forschungsaufenthalt –, und es kam mir vor, als flöge mir das Norwegische nur so zu. Alles, was ich als Vierjährige gekonnt hatte, schien sofort wieder da zu sein. Meine drei Schwestern und ich fanden uns so schnell ins Norwegische ein, dass wir nach einer Weile nicht mehr Englisch miteinander sprachen, sondern nur noch Norwegisch. Danach blieb beides haften.
In Ihren Romanen werden Orte sehr sorgfältig beschrieben. Ich frage mich daher, was für ein Ort das Zuhause war, dem Ihre Mutter vorstand.
Sauber, ordentlich und sicher. Meine Mutter blieb mit uns daheim, typisch für die Frauen der amerikanischen Mittelschicht in den fünfziger und sechziger Jahren. In meinem neuesten Roman Damals habe ich meiner Kindheit einigen Stoff über väterliche und mütterliche Einflussbereiche entlehnt. Alles innerhalb des Hauses war das Reich meiner Mutter und alles außerhalb, einschließlich der Garage, die ja eine Art Zwischending ist, unterstand meinem Vater, mit Ausnahme der Blumenbeete direkt am Haus. Die gehörten meiner Mutter. Ich bin mit der klassischen geographischen Trennung von Männlich und Weiblich aufgewachsen. Wenn wir vier Mädchen von der Schule nach Hause kamen, war meine Mutter immer da und erwartete uns. Nachdem wir aus dem Schulbus geklettert, die Einfahrt hinuntergegangen waren und das Haus betreten hatten, folgte immer der gleiche Ablauf: Wir setzten uns auf die vier Hocker am Küchentresen, eine neben der anderen, aßen die Leckereien, meistens Kekse oder Rosinenstangen, die meine Mutter für uns gebacken hatte, und dann erzählte ihr jedes Kind von seinem Tag. Sie strahlte so viel Interesse und Liebe aus. Ich will nicht sagen, dass sie nie gereizt oder ärgerlich gewesen wäre, sondern nur, dass sie eine außerordentliche Gabe hatte, eine Welt der Geborgenheit und Ordnung zu schaffen, die, zumindest für mich, eine Zuflucht vor der eher verwirrenden und turbulenten Welt all der Kinder und Lehrer in der Schule bot. Ich habe Erinnerungen an Gefühle verzückter Bewunderung für meine Mutter. Sie war eine Lichtgestalt für mich, eine Quelle des Friedens und der bedingungslosen Liebe. Das trägt man in sich, für immer.
Ich bin gerührt von dem, was Sie erzählen. Die Filme und insbesondere die Literatur der fünfziger Jahre über die amerikanische Familie – ich denke an John Updike, Mary McCarthy und natürlich an Salingers Fänger im Roggen – hinterfragen häusliches Glück, ja kritisieren es sogar. Trotzdem beschreiben Sie eine fast idyllische Situation. Welchen Platz nimmt Ihr Vater ein?
Gegen meine Mutter war er eine ferne Erscheinung. Ich erinnere mich, als wir noch kleine Mädchen waren und er von der Arbeit im College nach Hause kam, rannten wir alle schreiend an die Tür: »Daddy ist zu Hause! Daddy ist zu Hause!« Er war unser Hausgott. Ja, es hatte ein bisschen was von Leave It To Beaver – Erwachsen müsste man sein –, um eine Sitcom über das idealisierte, sexistische weiße Mittelschichtleben in Erinnerung zu rufen, die damals Horden von Amerikanern vor den Fernseher lockte. Aber abgesehen davon, gab es bei uns zu Hause ein starkes Bedürfnis, Streitigkeiten und Konflikte zu besänftigen. Wir Kinder rauften uns natürlich, aber hart zuschlagen war verboten. Wir hatten Freunde, die regelrechte Geschwisterkriege führten, physische Kämpfe austrugen, aber das war nicht Teil unserer häuslichen Realität. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass sich meine Eltern schwer bemühten, keine Schwierigkeiten zwischen ihnen durchblicken zu lassen. Dieses Harmoniebedürfnis war manchmal lähmend. Ich lernte alle meine feindseligen und aggressiven Impulse zu unterdrücken. Sie machten mir schreckliche Angst, eine Angst, die von der Atmosphäre zu Hause, von der Intoleranz gegenüber negativen Gefühlen herrühren musste.
Ich glaube, dass ich, auch wenn man so etwas als Kind nicht richtig begreift, immer eine Distanz zwischen meinem Vater und mir gespürt habe und darunter litt. Ich bin nicht sicher, ob meine Schwestern genauso empfanden. Jede hatte eine andere Beziehung zu unserem Vater. Ich jedenfalls sehnte mich immer nach mehr, mehr Aufmerksamkeit, mehr Liebe, mehr Interesse. Seine Ferne hatte sowohl mit seiner Persönlichkeit als auch mit dem sozialen Klima zu tun. Ich war sicher nicht allein mit dem Gefühl, einen unerkennbaren Vater zu haben. Aber ich glaube, er hatte auch etwas Abgelöstes an sich. Er war oft in sich selbst verloren, zerstreut, weit weg.
Dann war Ihre Mutter also diejenige, die die Familie emotional zusammenhielt?
Meine Schwestern würden Ihnen vielleicht andere Geschichten erzählen, aber ich glaube, unsere Mutter war für uns alle das Herz der häuslichen Realität. Als wir Kinder älter waren, studierte sie Französisch am St. Olaf College. Sie arbeitete hart, belegte jeden Französischkurs, der zu haben war, und bekam gute Noten. Ich erinnere mich lebhaft an ihre sorgfältigen Kommentare an den Seitenrändern von Madame Bovary, und wie sie einmal sagte, auf Französisch müsse es hundert verschiedene Wörter für »Kutsche« geben. Eine Zeit lang war sie Französischlehrerin an einer katholischen Schule. Sie liebte ihre Kolleginnen, die Nonnen, und die Arbeit machte ihr Spaß, aber die Stelle war befristet, und ein paar Jahre später wechselte sie in die Zeitschriftenabteilung der Bibliothek von St. Olaf, eine Arbeit, die ihr ebenfalls gefiel. Zum ersten Mal seit sie geheiratet hatte, verdiente sie eigenes Geld. Nicht, dass sie es für sich behalten hätte, meine Eltern taten alles in einen Topf, aber ich glaube, das Gefühl, etwas zum finanziellen Wohlergehen der Familie beizutragen, war sehr wichtig für sie. Bevor mein Vater starb, hatte sie noch nie einen Scheck geschrieben. Sie wusste wenig von den Familienfinanzen, verließ sich in vielem auf meinen Vater. Die Formen ihrer Selbstentfaltung waren häuslicher Natur. Als wir klein waren, nähte sie mindestens drei Mal im Jahr vier Kleider aus demselben Stoff für uns. Wir bekamen diese abgestimmte Tracht zum ersten Schultag, zu Weihnachten und zu Ostern. Sie machte auch wunderschöne Puppenkleider, manche davon winzig, die als Weihnachtsgeschenke dienten. Sie strickte Pullover, Mützen, Schals und Fäustlinge. Sie liebte es, Blumen zu arrangieren und elegante Abendessen zu gestalten. Meine Mutter besaß einen Butterroller. Seit ich von zu Hause fort bin, habe ich so ein Ding nicht mehr gesehen. Wenn sie den Tisch eindeckte, benutzte sie ein Maßband, damit der Abstand zwischen den Tellern genau gleich war. Die Tischtücher waren perfekt gebügelt. Das Silber glänzte. Die Gläser funkelten. Bevor die Gäste kamen, schwärzte sie die Dochte der neuen Tafelkerzen ein und blies sie wieder aus, um sie dann, wenn die Gäste Platz nahmen, erneut anzuzünden. Als ich sie einmal fragte, warum sie das tat, sagte sie, das wisse sie nicht. So mache man es eben. Ihre Tafeln waren Kunstwerke. Obwohl sie eine große Leserin war und Romane viel leidenschaftlicher las als mein Vater, war sie kein intellektuelles Vorbild für mich. Sie hat mir oft gesagt, sie habe felsenfest daran geglaubt, dass sie weiterstudieren und wenigstens noch ihren Master machen würde – sie hatte einen Bachelor und einen Hochschulgrad aus Norwegen –, aber daraus wurde nichts. Das Nachkriegsamerika war kein gastlicher Ort für weibliche Ambitionen außerhalb des Hauses. Mein Vater war der Brotverdiener, der Intellektuelle, die Autorität in der Familie. Sie nahmen getrennte Bereiche ein, MÄNNLICH und WEIBLICH, in fetten Großbuchstaben.
Mich interessiert auch der spezifische historische Moment, von dem wir gerade reden. Die sechziger Jahre mit der Bürgerrechtsbewegung und den Protestmärschen gegen den Vietnamkrieg bedeuteten ja wirklich einen radikalen kulturellen Bruch gegenüber den Fünfzigern. Die Lebensweisen änderten sich. Die Frauenemanzipation wurde zum Thema, ebenso die Frage der Rassengleichheit. War das wichtig für Sie? Haben Sie geahnt, dass sich die Welt um Sie her veränderte?
Im turbulenten akademischen Jahr 1967/68 befand ich mich in Norwegen und war zwölf, dreizehn Jahre alt, kein Alter großer Reife, trotzdem hatte die Bürgerrechtsbewegung schon lange vor unserem Aufenthalt in Bergen tiefen Eindruck auf mich gemacht. Meine Eltern waren linksgerichtete Weiße. Mein Vater hatte starke Sympathien für die alte amerikanische Linke, die Arbeiterbewegung und sozialistische Farmer, aber auch eine sentimentale Schwäche für radikalere Gruppen, Wobblies und Kommunisten, mit denen er politisch nicht übereinstimmte. Einmal sagte er zu mir: »Siri, es gibt zwei Sorten Menschen auf der Welt, solche, die für ihr Geld arbeiten, und solche, die ihr Geld für sich arbeiten lassen.« Das stimmt noch immer. Martin Luther King war in meiner Familie ein Held, als er für die meisten weißen Amerikaner nichts dergleichen war. Wir verfolgten die Ereignisse der Bürgerrechtsbewegung im Fernsehen. In meiner Kindheit gab es in unserem Städtchen keine Schwarzen, aber ich war empört über den Rassismus und entsetzt über die Bilder von ruhigen, mutigen, würdevollen, friedfertigen Demonstranten, die mit Hunden und Wasserschläuchen angegriffen, unter Knüppelschlägen von der Polizei in Fahrzeuge geschleppt und ins Gefängnis abtransportiert wurden. Die rohe Gewalt auf der Edmund Pettus Bridge beim Marsch von Selma nach Montgomery hat sich in mein Gehirn gebrannt.
In der fünften Klasse verbohrte ich mich in den Abolitionismus, offensichtlich als Reaktion auf die anhaltenden Bürgerrechtskämpfe, die ich aus einiger Entfernung mitbekam. Ich suchte sämtliche Bücher heraus, die ich in der Bibliothek zu dem Thema finden konnte. Von Harriet Tubman war ich geradezu besessen. Es gab da diese Reihe mit Biographien berühmter Leute für Kinder, die ich in kürzester Zeit verschlang.
Ja, mit einem blauen Umschlag für berühmte Männer und einem roten für berühmte Frauen. Ich erinnere mich noch genau, denn als ich die roten alle durchgelesen hatte, verlor ich das Interesse an Biographien. Ich wollte nichts über berühmte Männer lesen. Ich verlegte mich auf Romane.
Ich mochte sie beide, die roten wie die blauen, und Harriet Tubman war zweifellos unter den roten. Ich stellte mir vor, ich wäre Harriet Tubman auf der »Underground Railroad« und würde Sklaven in die Freiheit führen. Sie war meine Heldin. Ich las Onkel Toms Hütte, obwohl ich die geschraubte Sprache ziemlich schwierig fand. Ich las Booker T. Washingtons Vom Sklaven empor, verstand es aber nicht wirklich. Ich weiß noch, dass ich es trotzdem mit aller Entschlossenheit las, Washington aber, nachdem ich ein paar Jahre später W.E.B. Du Bois entdeckt hatte, seinen Glanz für mich verlor und ich nie mehr auf ihn zurückkam. Ich erinnere mich an quälend lange Passagen über Berufsfachschulen, die er für befreite Sklaven einrichten wollte. Ich reagierte auf das, was ich im Fernsehen über die Bürgerrechtsbewegung sah, indem ich Bücher über die Abolitionisten las.
Es gibt ein Ereignis, bei dem ich direkter mit der Bewegung in Berührung kam. Mein Vater hatte im College einen Freund gehabt, den er bewunderte, James Reeb. Beide waren Kriegsveteranen, nur dass Reeb, anders als mein Vater, nicht im Kampfeinsatz gewesen war. Ich glaube, sie haben im selben Jahr ihren Abschluss gemacht, 1950. Reeb wurde presbyterianischer Pastor, konvertierte aber später zu den universalistischen Unitariern und engagierte sich als Bürgerrechtsaktivist. 1965 fuhr er nach Selma, um an dem Marsch nach Montgomery teilzunehmen. Am 9. März aß er mit zwei anderen Geistlichen in einem für jedermann geöffneten Restaurant zu Abend, und als sie das Lokal verließen, wurden sie von weißen Anhängern der Rassentrennung angegriffen. Reeb wurde schwer verletzt. Das örtliche schwarze Krankenhaus verfügte nicht über die Ausrüstung, um ihn zu behandeln. Das weiße Krankenhaus weigerte sich, ihn aufzunehmen. Als er ein paar Stunden später in Birmingham ankam, hatte sich sein Zustand verschlechtert. Er starb zwei Tage später an seinen Kopfverletzungen. Mein Vater hörte in den Fernsehnachrichten vom Tod seines Freundes. Ich war im Zimmer. Er bedeckte sein Gesicht, und ihm entfuhr ein schreckliches leises Stöhnen. Dann stand er auf und tigerte hin und her, erregt und außer sich. Die Tatsache, dass ich mich noch immer an die Gemütsaufwallung meines Vaters erinnere, spricht für sich. Sie brachte die Hässlichkeit von rassistischem Hass nach Hause.
Meine Eltern schirmten uns gegen alle Filme ab, die sie für nicht kindgerecht hielten, aber sie schützten uns nicht vor den schockierenden Bildern der Gewalt gegen die Bürgerrechtsmarschierer. Ich erinnere mich auch an den Tod der vier kleinen Mädchen, die im September 1963 in der 16th Street Baptist Church in Birmingham getötet wurden. Der Name der jüngsten von ihnen ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, Carole Denise McNair. Sie war elf. Die drei anderen Mädchen waren älter, aber Carole Denise wäre in der Schule nur zwei oder drei Klassen über mir gewesen. Ich dachte über sie nach. Ich stellte mir vor, sie zu sein. Ich dachte viel darüber nach, wie mein Leben sein würde, wenn ich schwarz oder jüdisch oder ein weißes Mädchen mit Ku-Klux-Klan-Eltern wäre. Wie würde das sein? Würde ich ihnen nicht glauben, wenn ich sie liebte? Diese Fragen quälten mich. Ich lag wach und grübelte darüber nach. Später im selben Herbst wurde Kennedy ermordet. Unsere Lehrerin, Miss Lukey, weinte vor uns Drittklässlern. Das steht mir noch lebhaft vor Augen. Meine Eltern waren bestürzt. Als ich mit dreizehn aus Norwegen zurückkehrte und in die achte Klasse kam, geriet Amerika aus den Fugen. Die Attentate auf Martin Luther King und Bobby Kennedy hatten bereits stattgefunden. Der Vietnamkrieg tobte. Wieder war Lesen meine Reaktion. Ich politisierte mich durchs Lesen. Als ich vierzehn wurde, lehnte ich den Vietnamkrieg entschieden ab und war zur Feministin geworden.
Und was lasen Sie in dieser Zeit Ihres frühen politischen Heranreifens?
Ich kann mich nicht mehr an alle Bücher erinnern. In der Bibliothek von St. Olaf las ich eine Menge Historisches über die französischen Kolonialverstrickungen in Indochina, Ho Chi Minhs Nationalismus und das korrupte Diem-Regime. Aber einige der Bücher, die mich politisch geprägt haben, sind mir lebhaft in Erinnerung geblieben. Ich las Franz Fanons Schwarze Haut, weiße Masken, Eldridge Cleavers Seele auf Eis, W.E.B. Du Bois’ Die Seelen der Schwarzen und die Autobiographie von Frederick Douglass. Ich las die von Robin Morgan herausgegebene Anthologie Sisterhood is Powerful. Ich las Kate Milletts Sexus und Herrschaft wie auch Germaine Greers Der weibliche Eunuch, die beide 1970 erschienen waren. Und ich las Simone de Beauvoirs Das andere Geschlecht. Das war wirklich ein schweres Buch für mich, zumal in der schlechten Erstübersetzung des Zoologen H.M. Parshley. Aber ich las es trotzdem.
Dann haben Sie sicher auch Betty Friedans Der Weiblichkeitswahn gelesen. Ich finde das alles schon ungewöhnlich für eine Highschool-Schülerin. Normalerweise liest man solche Bücher erst im College.
Ja, Friedan habe ich auch gelesen, aber davon war ich weniger beeindruckt, vielleicht weil ich keine gelangweilte Hausfrau war. Jedenfalls kam ich an all diese Bücher leicht heran und hatte mich den Bewegungen sozusagen angeschlossen.
Welchen Platz nahmen denn Romane in Ihrer emotionalen und politischen Bildung als Jugendliche ein?
Ich war von klein auf eine Leseratte. Ich liebte die Bibliothek, den Geruch, die Ruhe, die Karten, auf denen man beim Ausleihen eines Buchs seinen Namen eintrug und die Namen der Vorgänger sehen konnte. Ich liebe Bibliotheken noch immer.
Im Lauf jenes Jahres in Norwegen entdeckte ich, dass es mir leichtfiel, Kleingedrucktes zu lesen. Was natürlich nichts mit der Schriftgröße zu tun hatte, sondern daran lag, dass ich plötzlich viel besser verstand, was ich las. In mir hatte sich etwas verändert. Die Bücher, mit denen ich mich in der fünften und sechsten Klasse abgemüht hatte, wurden einfach viel verständlicher, als ich in die siebte kam, und da begann ich, Romane zu lesen, nicht für Kinder, sondern für Erwachsene, einen nach dem anderen. Wir verbrachten den Sommer 1968 in Island, und da ich nicht zur Schule musste, las ich eben Romane.
Lasen Sie lieber Romane von Frauen oder Romane von Männern, oder war das egal?
Das war eigentlich egal. In dem Sommer las ich Jane Austen, Stolz und Vorurteil und Gefühl und Vernunft, eine gekürzte Fassung von Dumas’ Der Graf von Monte Christo, Mark Twains Ein Yankee am Hofe des König Artus, ein Buch, das ich zutiefst verstörend fand. Ich las Dickens’ David Copperfield und Jane Eyre von Charlotte Brontë, beides tiefgreifende Erfahrungen. Ich las Sturmhöhe, obwohl dieses großartige Buch ein bisschen zu hoch für mich war. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich auch das offen rassistische Vom Winde verweht las, ebenso wie Hawaii von James Michener. Ich las ununterbrochen. Das war der Sommer, in dem ich beschloss, Schriftstellerin zu werden.
Heißt das, Sie erinnern sich genau an den Moment, als Ihnen mit dreizehn in Island bewusst wurde, dass Sie sich zum Schreiben berufen fühlten? In meiner Vorstellung sitzen Sie allein unter einem Baum, ein aufgeschlagenes Buch in der Hand, während das Sommerlicht dem Gras und den Blumen um sie her einen magischen Glanz verleiht.
Keine Bäume und Blumen, dafür aber Sommerlicht im Überfluss. Ich konnte nicht schlafen. Dass ich es fertigbrachte, die tausend Seiten von Micheners mittelmäßigem Roman zu lesen, lag auch daran, dass es im isländischen Sommer nachts nie richtig dunkel wurde. Zum ersten Mal im Leben funktionierte meine innere Uhr nicht mehr, und Schlaflosigkeit war die Folge. Ich blieb wach und las. Eines Nachts, alle anderen schliefen tief und fest, war ich mitten in David Copperfield. In meiner Erinnerung sticht Davids Stiefvater Mr. Murdstone hervor. Dieser sadistische, brutale Kerl versetzte mich in Angst und Schrecken. Ich litt auf jene exquisite Weise, wie sie nur durch Lesen erzeugt werden kann. Eine Art lustvolles Leiden. Ich erinnere mich, dass ich das Buch beiseite legte, ans Fenster trat, auf das schlafende, von der gespenstischen Mitternachtssonne erleuchtete Reykjavík hinausschaute, und das tiefe Gefühl einer Verwandlung empfand. Ich dachte: »Wenn es das ist, was Bücher machen können, dann ist es das, was ich machen will.« Und danach erzählte ich allen davon.
»Ich will Schriftstellerin werden«?
Ja, ich sagte ihnen, ich wolle Autorin werden. Das klang noch bedeutender. Die Leute müssen mich für den größten Dummkopf gehalten haben, sei’s drum. Ich begann zu schreiben.
Und wie war das, Ihre ersten Erfahrungen als Autorin? Wie haben Sie angefangen? Mit Gedichten? Bei mir waren es übrigens Kinderbücher, eine Nachahmung derer, die meine Lieblingsbücher gewesen waren.
Mein erster Versuch, nach kindischen Gedichten, in denen sich »Regen« auf »Segen« und »wahr« auf »klar« reimten, war ein Roman, den ich in der fünften Klasse schrieb. Vielleicht habe ich ihn noch irgendwo, meine Eltern wollten ihn aufbewahren. Er war reich illustriert. Ich war ungeheuer stolz darauf, weil er fünfundvierzig Seiten lang war, aber das waren nicht wirklich fünfundvierzig Seiten. Die Buchstaben waren riesig. Er hieß Carrie in Baxter Manor, und wie bei Ihnen beruhte er auf Geschichten, die ich als Kind gern gelesen hatte. Er spielte im 19. Jahrhundert, und die Heldin war ein Waisenkind. Ich liebte Waisenkinder, verlassene, verzweifelte Waisenkinder, denen Unrecht widerfahren war. Ein Kapitel hieß »Gefahr«, das weiß ich noch. Meine Heldin musste einen Fluss mit gefährlichen Stromschnellen überqueren. Natürlich schafft sie es ans andere Ufer. Das Buch, wenn man es so nennen kann, war lauter zusammengeklaubtes dummes Zeug, aber das Schreiben machte mir einen Heidenspaß. Dann, in der achten Klasse, schrieb ich etwas anderes, worauf ich stolz war, eine seltsame Geschichte. Die Erzählerin wandert durch die Stadt und denkt über dies und jenes nach, untersucht vertrocknete Wurmleichen, die Schrägen des einfallenden Lichts, die Bedeutung der Dinge. Damals fand ich das extrem tiefsinnig. Soweit ich mich erinnere, passiert nicht viel außer ihren Grübeleien, und dann kommt sie an einem Schaufenster mit Ankleidepuppen vorbei. Es könnte eine ohne Arm dabei gewesen sein, denn das Fenster wird gerade umdekoriert, und als sie genauer hinschaut, sieht sie die Puppe plötzlich als ihr eigenes Spielgelbild. Dieser unheimliche Moment ist der Höhepunkt der Geschichte. Nun, jedenfalls las ich dieses Meisterwerk eines Abends meinen Eltern vor, nachdem die es sich mit ihren Kaffeetassen im Bett gemütlich gemacht hatten. Ich werde es nie vergessen: Ich las die Geschichte, beendete sie, und sie sagten kein Wort. Ich erinnere mich, dass sie einen Blick wechselten, wie um zu sagen, Großer Gott, was haben wir angerichtet? Damit hatte es sich. Ich glaube nicht, dass sie »gut gemacht« oder sonst etwas sagten.
Vielleicht waren sie bloß verblüfft. Vielleicht haben sie sich gefragt: Wo kommt das denn her? Warum erfindet sie so eine Geschichte?
Oder: Wer ist diese Person? Ist das unser Kind? Mag sein, dass ich in diese Szene etwas hineinlese, aber ich erinnere mich deutlich an den Blick meiner Eltern. Für mich signalisierte er Erstaunen, »Oh, mein Gott«, aber auch den Wunsch, ihr Erstaunen zu verbergen, um mich nicht zu beunruhigen. Ich bin mir sicher, sie nickten, und damit hatte es sich.
Sie haben also aus eigenem Antrieb mit dem Schreiben begonnen. Was mich interessieren würde, haben Sie auch Pastiches gemacht, von Büchern, die Sie gelesen hatten, so wie junge Maler zeichnen lernen, indem sie die großen Meister in den Museen imitieren? Haben Sie sich Aufgaben gestellt, wie etwa eine Person oder eine Szene zu beschreiben oder Dialoge zu verfassen? Gab es Übungen in der Schule, die Ihnen weitergeholfen haben?
Bei Schreibprojekten in der Schule war ich immer sehr engagiert. Etwa in der neunten Klasse begann ich, zeitgenössische Lyrik zu lesen und Gedichte zu schreiben. Zu dieser Zeit bekam man in jedem Buchladen die Werke zahlreicher Dichter und vor allem Dichterinnen. Ich las Denise Levertov, Diane Wakoski und natürlich Sylvia Plath. Lyrik war äußerst populär, sie gehörte zum Zeitgeist. Etwas später begann ich, alte Versformen nachzuahmen, zunächst Heroic couplets und Sonette, aber auch Ottava rima, Spenserstanzen und Villanellen. Das war eine Art Lehrzeit. Ich bin überzeugt, dass diese Übungen mir geholfen haben, mein Gehör zu schulen und meine Prosa zu disziplinieren.
Vielleicht ist die Frage zu intim – aber was genau brachte Sie zum Schreiben? Waren es die Qualen, das Unglück der Jugend, die Unsicherheit und Ungewissheiten, die mit dem Heranwachsen eines jungen Mädchens einhergehen? Oder wussten Sie sofort, als Sie sich in Ihre frühen Schreibübungen vertieften, dass Übung dazugehörte, wenn man Autorin werden wollte? Waren Sie von Anfang an daran interessiert, zu erforschen, was Phantasie und Vorstellungskraft vollbringen können? Oder war es ein bisschen von beidem?
Ich denke, es war beides. Ich glaube, ich war noch auf dem College, als ich im Haus meiner Eltern das ganze Zeug entdeckte, das ich in der Highschool-Zeit geschrieben hatte, und es schrecklich fand. Ich verbrannte es. Heute wünschte ich, ich hätte es nicht getan. Es war eine dumme romantische Geste, aber dahinter verbarg sich der Gedanke, andere Leute – Fremde – könnten meine frühen Schreibversuche sehen. Ich muss also ziemlich arrogant gewesen sein, schon damals. Dass ich meinte, meine Juvenilia loswerden zu müssen, weil sie eines Tages entdeckt werden könnten, spricht für eine gewisse Arroganz.
Aber bedeutet das nicht auch, dass Sie in dem, was Sie sehr früh geschrieben hatten, offener, ungehemmter waren, vielleicht weniger geschützt? Ich finde es einleuchtend, dass eine so junge Autorin ihr Über-Ich noch nicht voll ausgebildet hat, sich noch keine Sorgen darum macht, ob das, was sie schreibt, gut genug ist, um von anderen gelesen zu werden. Wenn man reifer wird, entwickelt man doch zunehmend stilistische Distanz, achtet mehr auf formale Aspekte, oder?
Ja, das stimmt, aber ich glaube, dass beim jugendlichen Schreiben auch die Vorstellung, die man sich davon macht, wie ein Gedicht oder eine Geschichte sein sollte, eine wesentliche Rolle spielt. Einige meiner Texte waren zweifellos unkontrolliert und bekenntnishaft, aber ich erinnere mich, dass der Stil mich schon als Jugendliche sehr beschäftigt hat. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich in meinen frühen Texten eine ganze Menge romantischen Sirup geduldet, prätentiöse jugendliche Ergüsse, die auf irgendeiner Idee von Literatur beruhten. Hätte ich genauer hingeschaut, wäre manches vielleicht gar nicht so schlecht gewesen …
Aber die Geschichte, auf die Sie so stolz waren, haben Sie die wenigstens aufbewahrt?
Ich glaube nicht. Ich wünschte, ich hätte es. Ich mochte diese Geschichte. Auch sie war sicher schlecht, aber ich muss begriffen haben, dass der unheimliche Moment des Erkennens zwischen der Erzählerin und der Schaufensterpuppe etwas hatte, etwas emotional Wahres. Es gab eine andere Geschichte im gleichen Stil, die ich für den Englischunterricht schrieb, und für die der Lehrer nicht gerade lobende Worte fand. Nicht, dass er sie schlecht geschrieben gefunden hätte, ich glaube, sie schockierte ihn. Er fand sie verstörend. Das Gefühl, das er mir vermittelte, war: »Das sollte man nicht tun.« Oder: »So was schreiben nette Mädchen nicht.« Ich weiß noch, wie wütend ich war. Ich artikulierte meine Wut natürlich nicht, aber etwas Hartes setzte sich in mir fest. Ich finde es interessant, zurückzublicken und mich daran zu erinnern, wie ich die Reaktionen anderer auf mein Schreiben empfand. Einmal, noch früher, in der fünften Klasse vielleicht, gab ich meinem Vater einen Aufsatz. Er nahm ihn, korrigierte ihn, schrieb ihn komplett um und gab ihn mir zurück. Ich zeigte ihm nie wieder einen Aufsatz. Im Lauf der Zeit lernte ich meinen Vater besser kennen, es war nicht bösartig …
Nein, vielleicht hat er es gut gemeint. Vielleicht war es eine Art Abwehr, weil ihm das, was Sie geschrieben hatten, unter die Haut ging, ihn als etwas zu Persönliches erschreckte? Vielleicht war es auch eine Art déformation professionelle? Als Collegeprofessor für Skandinavistik musste er ja ständig Aufsätze und Examensarbeiten korrigieren.
Ich weiß es wirklich nicht. Manches ist mir immer noch ein Rätsel. War etwas Feindseliges an dieser Geste? Eine Art Besitzanspruch? Möglich. Ich war jung. War es eine Form von unbewusster Aggression oder, wie Sie sagen, bloß der Lehrer in ihm, der tat, was er immer tat, ohne weiter darüber nachzudenken? Ich weiß es nicht. Es wäre mir nicht im Traum eingefallen, zu sagen: »Wie wagst du es, das mit meiner Arbeit zu machen? Wie wagst du es, alles zu verändern? Da ist ja nichts mehr von mir übrig.« Ich hätte solche Worte nie denken oder sagen können. Die unausgesprochene Autorität meines Vaters war mächtig. Was mich im Rückblick interessiert, ist nicht die Tatsache, dass ich nichts zu ihm sagte, obwohl ich jahrelang über meine vollkommen fehlende direkte Rebellion gegen ihn nachgedacht habe, sondern dass meine Rebellion darin bestand, mein Geschriebenes zurückzuhalten und ihm nie wieder etwas von mir zu zeigen.
Mich interessiert der Widerspruch, den ich dieser Geschichte entnehme. Sie sagen, Ihre Eltern hätten sich, zumindest emotional und intellektuell, sehr für die Bürgerrechtsbewegung engagiert, und das deutet doch auf recht antiautoritäre Züge hin, nicht wahr? Trotzdem sprechen Sie ein Gefühl von Überschreitung im Zusammenhang mit Ihrem Schreiben an und dass Ihre Eltern Sie, ohne Sie direkt zu kritisieren, durch Gesten in die Schranken wiesen.
Sie brauchten nichts zu sagen. Es gab wenig Geschrei. Wir hatten als Kinder keine häuslichen Pflichten, wir standen nicht unter der Knute eines Reglements, obwohl wir oft halfen, im Garten Unkraut zu jäten. Mein Vater liebte das, Unkrautjäten mit der ganzen Familie. Das war seine sozialistische Phantasie, kollektive Teamarbeit. Wir gingen sehr früh und zu einer festgelegten Zeit ins Bett, daran wurde nicht gerüttelt. Es gab keine Zeichen von Autoritarismus, nichts, was hätte entdeckt werden können. Es war etwas anderes, eine unausgesprochene Macht.
Ich würde behaupten, dass elterliche Autorität, wenn sie stillschweigend ausgeübt wird, weitaus stärker ist, als wenn sie explizit zur Sprache kommt.
Das ist wahr. Da wir Schwestern unsere Eltern verehrten und sie nicht grausam oder unfreundlich oder als gnadenlose Zuchtmeister daherkamen, waren wir gehorsame Kinder. Meine Mutter erhob manchmal die Stimme, schimpfte mit uns, aber nur um zu sagen: »Räum sofort dein Zimmer auf!« Und das tat nie weh.
Würden Sie trotzdem sagen, dass Ihre Juvenilia eine Art Flucht waren? Empfanden Sie Ihr frühes Schreiben als ein Abenteuer, einen Ausflug in andere Welten, ins Reich des Möglichen, aber noch nicht Verwirklichten? Oder haben Sie sich einfach gesagt: »Ich muss das machen«?
Ich glaube, es war das Letztere. Ich hatte ein ungeheures Bedürfnis nach Einsamkeit, und Schreiben war eine Möglichkeit, allein und gleichzeitig aktiv zu sein, aktiv in Einsamkeit. Ich hatte drei Schwestern, sodass zu Hause immer etwas los war. In der dritten Klasse zogen wir in ein Haus, das meine Eltern außerhalb der Stadt gebaut hatten, mit einem Bach und einem Wald dahinter, und ich weiß noch, dass ich es liebte, in den Wald zu gehen, mich an den Bach zu setzen und allein zu sein, zu träumen und zu denken. Ich brauchte einen Rückzugsort. Nicht, dass ich die Grundschule gehasst hätte. Ich mochte den Englisch- und Kunstunterricht, aber ich hatte wohl immer ein bisschen Angst vor den anderen Kindern. Ich habe eine Mirror-Touch-Synästhesie, was ich allerdings erst sehr viel später erfahren habe. Die diagnostische Benennung gibt es erst seit 2005