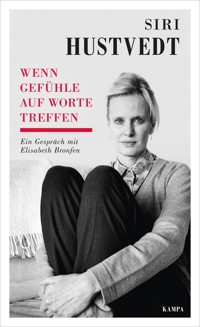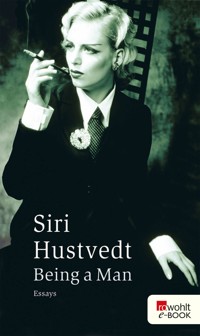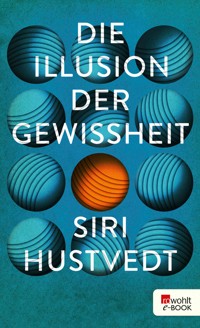9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Siri Hustvedt kehrt in diesem Roman in die New Yorker Kunstwelt aus ihrem berühmtesten Buch «Was ich liebte» zurück. «Die gleißende Welt» ist der Titel eines utopischen Romans von Margaret Cavendish, die im 17. Jahrhundert als eine der ersten Frauen überhaupt unter ihrem eigenen Namen publizierte. Als frühe Universalgelehrte ist sie Vorbild und Idol von Harriett Burden, der Witwe eines einflussreichen New Yorker Galeristen. Nach dessen vorzeitigem Tod in den siebziger Jahren beginnt Harriett – in der öffentlichen Wahrnehmung nichts als die Frau an der Seite des berühmten Mannes, aber in Wahrheit hochtalentiert – ein heimliches Experiment: eine Karriere als Installationskünstlerin, die sich hinter dem angeblichen Werk dreier männlicher «Masken» verbirgt, das in Wahrheit sie selbst erschaffen hat. Doch der faustische Handel schlägt fehl - einer dieser Maskenmänner, selbst ein bekannter Künstler, durchkreuzt ihr Rollenspiel und setzt sein eigenes dagegen, und es kommt zum Kampf zweier großer Geister. Das Buch ist ein Konzert widerstreitender Stimmen, eine polyphone Tour de Force über die Macht von Vorurteilen, Begierde, Geld und Ruhm. Es versammelt alle großen Themen Siri Hustvedts aus Literatur, Kunst, Psychologie und Naturwissenschaften. Ein mutiges, schillerndes Meisterstück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Siri Hustvedt
Die gleißende Welt
Roman
Über dieses Buch
Siri Hustvedt kehrt in diesem Roman in die New Yorker Kunstwelt aus ihrem berühmtesten Buch «Was ich liebte» zurück.
«Die gleißende Welt» ist der Titel eines utopischen Romans von Margaret Cavendish, die im 17. Jahrhundert als eine der ersten Frauen überhaupt unter ihrem eigenen Namen publizierte. Als frühe Universalgelehrte ist sie Vorbild und Idol von Harriett Burden, der Witwe eines einflussreichen New Yorker Galeristen. Nach dessen vorzeitigem Tod in den siebziger Jahren beginnt Harriett – in der öffentlichen Wahrnehmung nichts als die Frau an der Seite des berühmten Mannes, aber in Wahrheit hochtalentiert – ein heimliches Experiment: eine Karriere als Installationskünstlerin, die sich hinter dem angeblichen Werk dreier männlicher «Masken» verbirgt, das in Wahrheit sie selbst erschaffen hat. Doch der faustische Handel schlägt fehl – einer dieser Maskenmänner, selbst ein bekannter Künstler, durchkreuzt ihr Rollenspiel und setzt sein eigenes dagegen, und es kommt zum Kampf zweier großer Geister.
Das Buch ist ein Konzert widerstreitender Stimmen, eine polyphone Tour de Force über die Macht von Vorurteilen, Begierde, Geld und Ruhm. Es versammelt alle großen Themen Siri Hustvedts aus Literatur, Kunst, Psychologie und Naturwissenschaften. Ein mutiges, schillerndes Meisterstück.
Vita
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Sie lebt in Brooklyn. Bislang hat sie sechs Romane publiziert, mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Die Leiden eines Amerikaners» und «Der Sommer ohne Männer». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Leben, Denken, Schauen», «Nicht hier, nicht dort» und «Being a Man» vor.
Impressum
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel «The Blazing World» 2014 bei Simon & Schuster, New York
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Mai 2015
Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Blazing World» Copyright © 2014 by Siri Hustvedt
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München, nach der Originalausgabe von Simon & Schuster, New York (Gestaltung Christopher Lin)
ISBN 978-3-644-51901-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Einführung
Harriet Burden
Cynthia Clark
Maisie Lord
Harriet Burden
Oswald Case
Rachel Briefman
Ein Kompendium von dreizehn
Harriet Burden
Rosemary Lerner
Bruno Kleinfeld
Maisie Lord
Sweet Autumn Pinkney
Anton Tish
Rachel Briefman
Phineas Q. Eldridge
Ein ABC zu verschiedenen Bedeutungen von Kunst und Genese
Harriet Burden
Bruno Kleinfeld
Oswald Case
Das Barometer
Maisie Lord
Patrick Donan
Zachary Dortmund
Harriet Burden
Harriet Burden
Harriet Burden
Harriet Burden
Harriet Burden
Rachel Briefman
Phineas Q. Eldridge
Richard Brickman
William Burridge
Ein Bericht von Anderswo
Harriet Burden
Harriet Burden
Maisie Lord
Bruno Kleinfeld
Timothy Hardwick
Kirsten Larsen Smith
Harriet Burden
Harriet Burden
Harriet Burden
Harriet Burden
Sweet Autumn Pinkney
Einführung
«Alle intellektuellen und künstlerischen Unterfangen, sogar Witze, ironische Bemerkungen und Parodien, schneiden in der Meinung der Menge besser ab, wenn die Menge weiß, dass sie hinter dem großen Werk oder dem großen Schwindel einen Schwanz und ein Paar Eier ausmachen kann.» Auf diesen provozierenden Satz stieß ich 2003 in einem Leserbrief an den Herausgeber von The Open Eye, einer interdisziplinären Zeitschrift, die ich seit einigen Jahren regelmäßig las. Der Satz stammte nicht vom Verfasser des Briefes, Richard Brickman. Er zitierte eine Künstlerin, deren Namen ich noch nie irgendwo gedruckt gesehen hatte: Harriet Burden. Brickman behauptete, Burden habe ihm einen langen Brief über ein Projekt geschrieben, den er veröffentlichen sollte. Obwohl Burden in den siebziger und achtziger Jahren in New York ausgestellt hatte, war sie von der Rezeption enttäuscht gewesen und hatte sich ganz aus der Kunstwelt zurückgezogen. Irgendwann in den späten neunziger Jahren begann sie ein Experiment, für dessen Beendigung sie fünf Jahre brauchte. Brinkman zufolge beauftragte sie drei Männer, als Strohmann für ihre eigene schöpferische Arbeit aufzutreten. Drei Einzelausstellungen in verschiedenen New Yorker Galerien, die Anton Tish (1999), Phineas Q. Eldridge (2002) und dem nur als Rune bekannten Künstler (2003) zugeschrieben wurden, waren eigentlich von Burden. Sie gab dem Gesamtprojekt den Titel Maskierungenund erklärte, es solle nicht nur die frauenfeindliche Tendenz der Kunstwelt entlarven, sondern das komplexe Funktionieren der menschlichen Wahrnehmung sichtbar machen und zeigen, wie unbewusste Vorstellungen von Gender, Rasse und Berühmtheit Einfluss auf das Verständnis derer haben, die ein bestimmtes Kunstwerk betrachten.
Aber Brickman ging noch weiter. Er behauptete, Burden habe darauf bestanden, das von ihr angenommene Pseudonym verändere den Charakter ihrer Kunst. Anders gesagt, der Mann, den sie als Maske benutzte, spiele eine Rolle in der Art von Kunst, die sie schuf: «Jede Künstlermaske wurde für Burden zu einer ‹poetisierten Persönlichkeit›, einer visuellen Ausgestaltung eines ‹hermaphroditischen Selbst›, von dem man nicht sagen konnte, dass es zu ihr oder der Maske gehörte, sondern zu ‹einer zwischen ihnen entstandenen gemischten Realität›.» Schon aufgrund meiner Professur für Ästhetik war ich sofort fasziniert von dem Projekt, wegen seiner Ambition, aber auch wegen seiner philosophischen Komplexität und Differenziertheit.
Gleichzeitig fand ich Brickmans Brief verwirrend. Warum hatte Burden ihre Erklärung nicht selbst veröffentlicht? Warum sollte sie es Brickman überlassen, für sie zu sprechen? Brickman behauptete, der «Botschaft aus dem Reich des fiktionalen Seins» genannte sechzigseitige Brief sei unangemeldet in seinem Briefkasten eingegangen, und er habe vorher nichts von der Künstlerin gewusst. Auch der Ton von Brickmans Brief ist seltsam: Er wechselt zwischen Herablassung und Bewunderung. Brickman kritisiert Burdens Brief als übertreibend und für eine Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift ungeeignet, doch andererseits zitiert er weitere Passagen, die er ihr zuschreibt, sichtlich mit Beifall. Ich behielt einen verworrenen Eindruck von dem Brief und eine gewisse Verärgerung über Brickman zurück, dessen Kommentar Burdens Originaltext im Grunde unterdrückt. Gleich machte ich mich über die drei Ausstellungen kundig, Die Geschichte der Kunst des Westens von Tish, Die Erstickungsräume von Eldridge und Darunter von Rune, die sich jeweils stark voneinander unterschieden. Dennoch machte ich zwischen den dreien etwas ausfindig, was ich als «Familienähnlichkeit» bezeichnen würde. Die Ausstellungen von Tish, Eldridge und Rune, die Burden sich angeblich ausgedacht hatte, waren als Kunst allesamt bezwingend, aber besonders fasziniert war ich von Burdens Experiment, weil es meine eigenen intellektuellen Interessen berührte.
In jenem Jahr beanspruchten mich meine Lehrverpflichtungen stark. Mit der zeitweiligen Leitung des Instituts waren viele Aufgaben verbunden, und so konnte ich meiner Neugier über die Maskierungen erst drei Jahre später nachgehen, als ich ein Forschungssemester nahm, um an meinem Buch Plurale Stimmen und multiple Visionen zu arbeiten, worin ich das Werk Sören Kierkegaards, Michail Michailowitsch Bachtins und des Kunsthistorikers Aby Warburg diskutiere. Brickmans Beschreibung von Burdens Projekt und ihren poetisierten Persönlichkeiten (der Ausdruck stammt von Kierkegaard) passte perfekt zu meinen eigenen Gedanken, daher beschloss ich, Brickman über The Open Eye ausfindig zu machen und mir anzuhören, was er selbst zu sagen hatte.
Peter Wentworth, der Herausgeber der Zeitschrift, rief E-Mails von Brickman an ihn auf – einige trockene, geschäftsmäßige Mitteilungen. Als ich jedoch versuchte, Kontakt mit Brickman aufzunehmen, stellte ich fest, dass die Adresse nicht mehr bestand. Wentworth holte einen Essay hervor, den Brickman zwei Jahre vor seinem Brief an The Open Eye in der Zeitschrift veröffentlicht hatte und den ich, wie ich mich nachträglich erinnerte, gelesen hatte: ein abstruser Beitrag, der die anhaltenden Auseinandersetzungen in der Analytischen Philosophie über Konzepte kritisierte, ein Thema, das meinen eigenen Interessen fernstand. Wentworth zufolge hatte Brickman an der Emory University in Philosophie promoviert und war Dozent am St. Olaf College in Northfield, Minnesota. Als ich jedoch bei St. Olaf nachfragte, stellte sich heraus, dass niemand namens Richard Brickman an diesem Fachbereich lehrte oder je gelehrt hatte. Natürlich gab es auch an der Emory University keine Unterlagen zu einem Doktoranden dieses Namens. Ich beschloss, mich direkt an Harriet Burden zu wenden, aber bis ich sie über ihre Tochter Maisie Lord in New York ausfindig gemacht hatte, war sie schon zwei Jahre tot.
Die Idee zu dieser Anthologie entstand während meines ersten Telefongesprächs mit Maisie Lord. Obwohl sie von Brickmans Brief wusste, war sie überrascht, als sie erfuhr, dass dessen Verfasser nicht der Mensch war, der er zu sein vorgab, wenn überhaupt eine reale Person. Sie vermutete, ihre Mutter habe Kontakt mit ihm gehabt, wusste aber nichts Genaues über ihre Beziehung. Harriet Burdens Kunstwerke waren zu der Zeit, als ich mit Maisie sprach, alle katalogisiert und eingelagert, und sie arbeitete seit Jahren an einem Dokumentarfilm über ihre Mutter. In dem Film kommen unter anderem im Off gesprochene Auszüge aus den vierundzwanzig persönlichen Tagebüchern vor – jedes mit einem Buchstaben des Alphabets benannt –, die ihre Mutter nach dem Tod ihres Mannes Felix Lord 1995 zu führen begonnen hatte. Soweit Maisie wusste, wurde Richard Brickman in keinem dieser Tagebücher erwähnt. (Ich selbst fand zwei Erwähnungen von R.B., vermutlich Richard Brickman, aber nichts Aufschlussreicheres.) Maisie war allerdings sicher, dass ihre Mutter in den Tagebüchern allerlei «Schlüssel» hinterlassen hatte, nicht nur zu ihrem pseudonymen Projekt, sondern auch zu dem, was sie «die Geheimnisse der Persönlichkeit meiner Mutter» nannte.
Zwei Wochen nach unserem Telefonat flog ich nach New York, wo ich Maisie, ihren Bruder Ethan Lord und Burdens Lebensgefährten Bruno Kleinfeld traf, die alle sehr ausführlich mit mir sprachen. Ich sichtete Hunderte von Arbeiten, die Burden nie irgendwo gezeigt hatte, und ihre Kinder teilten mir mit, dass ihr Werk gerade von der renommierten Grace Gallery in New York übernommen worden war. Die 2008 organisierte Burden-Retrospektive sollte die Beachtung und Anerkennung finden, nach denen sich die Künstlerin so verzweifelt gesehnt hatte, und lancierte im Grunde posthum ihre Karriere. Maisie zeigte mir Muster ihres unvollendeten Films und, was noch wichtiger war, machte mir die Notizbücher zugänglich.
Während ich die Hunderte von Seiten las, die Burden geschrieben hatte, war ich abwechselnd fasziniert, aufgebracht und frustriert. Sie hatte viele Tagebücher gleichzeitig geführt. Manche Einträge datierte sie, andere wieder nicht. Sie hatte ein System, die Notizbücher mit Querverweisen zu versehen, das mal einfach war und mal in seiner Komplexität hochgradig schwierig oder unsinnig erschien. Schließlich gab ich auf, es zu entschlüsseln. Ihre Schrift wird auf manchen Seiten unlesbar klein, auf anderen wiederum so groß, dass einige wenige Sätze eine ganze Seite einnehmen. Manche ihrer Texte werden durch Zeichnungen verundeutlicht, die ins Geschriebene hineinragen. Einige Notizbücher waren randvoll, andere enthielten nur ein paar Absätze. Notizbuch A und Notizbuch U waren größtenteils, aber nicht gänzlich autobiographisch. Sie fertigte ausführliche Aufzeichnungen über Künstler an, die sie liebte, manche über viele Seiten eines Notizbuchs. Vermeer und Velazquez zum Beispiel teilen sich V. Louise Bourgeois hat ihr eigenes Notizbuch unter L, nicht B, aber L enthält auch Exkurse über Kindheit und Psychoanalyse. William Wechsler, Notizbuch W, enthält Notizen zu Wechslers Werk, aber auch ellenlange Nebenbemerkungen über Lawrence Sternes Tristram Shandy und Eliza Haywoods Fantomina sowie einen Kommentar zu Horaz.
Viele Tagebücher sind im Wesentlichen Notizen zu ihrer Lektüre, die umfangreich war und viele Bereiche umfasste: Literatur, Philosophie, Linguistik, Geschichte, Psychologie und Neurowissenschaften. Aus unbekannten Gründen teilten John Milton und Emily Dickinson sich ein Notizbuch mit dem Etikett G. Kierkegaard ist in K, aber Burden schreibt darin auch über Kafka sowie einige Passagen über Friedhöfe. In Notizbuch H über Edmund Husserl sind Seiten über Husserls Idee der «intersubjektiven Konstitution von Objektivität» und die Konsequenzen einer solchen Idee für die Naturwissenschaften, aber auch Berührungslinien mit Merleau-Ponty, Mary Douglas und ein «Phantasie-Szenario» über künstliche Intelligenz. Q widmet sich der Quantentheorie und ihrer möglichen Verwendung für ein theoretisches Modell des Gehirns. Auf die erste Seite von Notizbuch F (offensichtlich für Frau) hat Burden «Hymnen an das schöne Geschlecht» geschrieben. Es folgen seitenlang Zitate. Eine kleine Kostprobe wird genügen, um die Geschmacksrichtung zu belegen: Hesiod: «Wer einem Weibe vertraut, vertraut Betrügern.» Tertullian: «Ihr [Frauen] seid der Schlund zur Hölle.» Victor Hugo: «Gott hat sich zum Manne gemacht, gut. Der Teufel machte sich zur Frau.» Pound (Canto XXIX): «Das Weibliche/Ist ein Element, das Weibliche/Ist Chaos, eine Krake/Ein biologischer Prozess.» Zusammen mit diesen Beispielen unverhohlener Misogynie hatte Burden Dutzende Zeitungs- und Zeitschriftenartikel an ein Einzelblatt mit dem Wort unterdrückt geheftet. Es gab kein gemeinsames Thema in diesen vermischten Texten, und ich fragte mich, warum sie sie zusammengelegt hatte. Und dann dämmerte mir, dass das Gemeinsame in ihnen Listen waren. Jeder Artikel enthielt eine Liste zeitgenössischer Bildender Künstler, Schriftsteller, Philosophen und Naturwissenschaftler, in denen der Name keiner einzigen Frau auftauchte.
In V zitiert Burden auch, mit und ohne Anführungszeichen, aus wissenschaftlichen Büchern. Ich fand folgendes Zitat: «Das Bild der ‹Frau-als-Missgeburt›, mit Frauen, die als Schlangen, Spinnen, Extraterrestrische und Skorpione dargestellt sind, ist in der Literatur von Männern nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und Japan sehr verbreitet (siehe T, S. 97).» Der Verweis in Klammern bezieht sich auf Burdens eigenes Notizbuch T für Teratologie, die Wissenschaft der Fehlbildungen, die, wie Burden auf der ersten Seite erklärt, «die Kategorie ist, die keine Kategorie ist, die Kategorie, die für das gilt, was nicht gelten darf.» Burden beschäftigte sich intensiv mit Monstren und sammelte Beispiele in Naturwissenschaft und Literatur. Auf Seite 97 von Notizbuch T zitiert sie Rabelais, dessen komische Missgeburten das Gesicht der Literatur veränderten, und weist darauf hin, dass Gargantua nicht aus der üblichen Körperöffnung geboren wurde: «Durch diesen Unfall öffneten sich die Cotyledone der Gebärmutter oberwärts, durch welche das Kind kopfüber hüpft’ in die hohle Ader, dann durch das Zwerchfell weiter kroch bis über die Achseln (wo sich gedachte Ader in zwey teilt) und, seine Straß’ zur Linken nehmend, endlich durchs linke Ohr zu Tage kam.» (Erstes Buch, sechstes Kapitel). Gleich darauf schreibt sie: «Aber die Missgeburt ist nicht immer ein Rabelais’sches Wunder von herzhaftem Appetit und grenzenloser Fröhlichkeit. Sie ist oft einsam und missverstanden (siehe M und N).»
Die zwei eng beschriebenen Notizbücher M und N behandeln das Werk von Margaret Cavendish, der Herzogin von Newcastle (1623–1673), und den materialistischen Organizismus, den sie in reifen Jahren als Denkerin entwickelte. Diese zwei Notizbücher diskutieren jedoch auch das Werk von Descartes, Hobbes, More und Gassendi. Burden verknüpft Cavendish mit zeitgenössischen Autoren wie Colin McGinn und David Chalmers, aber unter anderen auch mit dem Phänomenologen Dan Zahavi und dem Neurowissenschaftler Vittorio Gallese. Nachdem er die besagten Passagen gelesen hatte, erklärte Stan Dickerson, einer meiner Kollegen in der Neurobiologie, der weder von Burden noch von Cavendish je gehört hatte, Burdens Argumentation für «ein bisschen wild, aber fachkundig und überzeugend».
Wenngleich Cavendish im 17. Jahrhundert gelebt hatte, diente sie Harriet Burden als Alter Ego. Die Herzogin von Newcastle veröffentlichte in ihrem Leben Gedichte, erzählende Literatur und Naturphilosophisches. Obwohl einige ihr Werk damals verteidigten und bewunderten – vor allem ihr Ehemann William Cavendish –, fühlte sich die Herzogin gnadenlos von ihrem Geschlecht eingeengt und drückte wiederholt die Hoffnung aus, sie würde in der Nachwelt ein Lesepublikum und Zustimmung finden. Von vielen, mit denen sie gern einen Dialog aufgenommen hätte, vor den Kopf gestoßen, schuf Cavendish eine Welt von Gesprächspartnern in ihrem Schreiben. Wie Cavendish kann auch Burden, glaube ich, nicht verstanden werden, ohne dass das Dialogische ihres Denkens und ihrer Kunst berücksichtigt wird. Alle Notizbücher Burdens können als Formen des Dialogs gelesen werden. Sie wechselt ständig von der ersten Person in die zweite und dann in die dritte. Manche Abschnitte sind als Diskussionen zwischen zwei Versionen ihrer selbst geschrieben. Eine Stimme macht eine Aussage. Eine andere bestreitet sie. Ihre Notizbücher wurden der Boden, auf dem ihr widerstreitender Zorn und ihr gespaltener Intellekt einander auf dem Papier bekämpfen konnten.
Burden beschwert sich bitterlich über den Sexismus in der Kultur, insbesondere der Kunstwelt, aber sie beklagt auch ihre «intellektuelle Einsamkeit». Sie grübelt über ihre Isolation nach und prügelt auf ihre vielen vermeintlichen Feinde ein. Gleichzeitig ist ihr Schreiben (wie das von Cavendish) von Überspanntheit und Grandiosität gefärbt: «Ich bin eine Oper. Ein Aufruhr. Eine Bedrohung», heißt es in einem Eintrag, der sich unmittelbar mit ihrer geistigen Verwandtschaft mit Cavendish auseinandersetzt. Wie bei Cavendish wurde Burdens Wunsch nach Anerkennung zu ihren Lebzeiten schließlich in die Hoffnung verwandelt, ihr Werk würde am Ende Beachtung finden, wenn nicht, während sie lebte, dann zumindest nach ihrem Tod.
Burden hat so viel und so ausführlich geschrieben, dass mein herausgeberisches Dilemma sich um die entscheidende Frage drehte: Was nehme ich auf, was lasse ich draußen? Manche Notizbücher enthalten esoterisches Material, das außer für die, die sich in der Philosophiegeschichte oder der Naturwissenschaft oder der Kunstgeschichte gut auskennen, unverständlich ist. Es kam vor, dass ich bei manchen ihrer Verweise mit meinem Latein am Ende war, und selbst wenn ich sie aufgespürt hatte, blieb ihre Bedeutung im Kontext ihres Schreibens oft schleierhaft für mich. Ich habe meine Hauptaufmerksamkeit auf Maskierungen gerichtet und nur Passagen aufgenommen, die sich direkt oder indirekt auf das pseudonyme Projekt beziehen. Die ersten Exzerpte aus Burdens Tagebüchern in diesem Buch stammen aus Notizbuch G (Geständnisse? Geheimnisse?), Memoiren, die Burden irgendwann Anfang 2002 nach ihrem zweiundsechzigsten Geburtstag zu schreiben begann, die sie aber aufgegeben zu haben scheint, um sich wieder ihren anderen Notizbüchern und einem fragmentarischeren Stil zuzuwenden.
Dennoch fand ich es zweckmäßig, aus den verschiedenen Materialien, die Burden hinterlassen hat, so etwas wie eine Geschichte zu konstruieren. Ethan Lord schlug vor, ich solle schriftliche oder mündliche Äußerungen von Menschen sammeln, die seiner Mutter nahegestanden hatten, um zusätzliche Sichtweisen auf die Maskierungen zu bieten, und ich erklärte mich dazu bereit. Ich beschloss dann, Informationen von denen einzuholen, die etwas über das pseudonyme Projekt wussten oder daran beteiligt gewesen waren.
Seit der Ausstellung in der Grace Gallery hat das Interesse an Harriet Burdens Werk exponentiell zugenommen, obwohl ihre «Masken» immer noch umstritten sind, vor allem was die Einbeziehung des letzten und weitaus berühmtesten der drei Künstler, Rune, betrifft. Während Einigkeit darüber besteht, dass Burden Tishs Geschichte der Kunst des Westens sowie Eldridges Erstickungsräume selbst erschaffen hatte, herrscht wenig Einvernehmen darüber, was tatsächlich zwischen ihr und Rune vor sich ging. Die einen glauben, Burden sei nicht die Urheberin von Darunter oder habe nur sehr wenig zu der Installation beigetragen, die anderen sind davon überzeugt, Burden habe sie ohne Rune geschaffen. Wieder andere behaupten, Darunter sei ein Gemeinschaftswerk. Womöglich kann nicht mehr eindeutig bestimmt werden, von wem es stammt, obwohl klar ist, dass Burden sich von Rune verraten fühlte und sich gegen ihn wandte. Sie war auch davon überzeugt, er habe vier Arbeiten aus ihrem Atelier gestohlen, obwohl niemand erklären kann, wie der Diebstahl hätte geschehen können. Das Gebäude war abgeschlossen und mit einem Alarmsystem geschützt. Die Fenster, eine Serie mit zwölf Arbeiten, wurden von Rune als Kunstwerke verkauft. Die zwölf Kästen ähneln Konstruktionen von Burden, und es ist zumindest möglich, dass vier von ihr, nicht von ihm sind.
Runes Version der Ereignisse konnte nicht in die Anthologie eingehen. Sein breit abgehandelter Tod im Jahr 2004, ob durch Selbstmord oder nicht, war eine Sensationsgeschichte in den Medien. Seine Karriere ist umfangreich dokumentiert. Sein Werk wurde ausführlich besprochen; es gibt auch viele kritische Artikel und für jeden, der sich dafür interessiert, mehrere Bücher über ihn und sein Werk. Dennoch wollte ich, dass Runes Sicht in dieser Sammlung vorkommt, und fragte Oswald Case, einen Journalisten, Freund und Biographen Runes, ob er etwas zu dem Buch beitragen wolle. Er sagte freundlicherweise zu. Andere Beiträge stammen von Bruno Kleinfeld; von Maisie und Ethan Lord; von Rachel Briefman, einer engen Freundin Burdens; von Phineas Q. Eldridge, Burdens zweiter «Maske»; von Alan Dudek (auch bekannt als das Barometer), der mit Burden zusammenwohnte; und von Sweet Autumn Pinkney, die an der Geschichte der Kunst des Westens als Assistentin mitarbeitete und Anton Tish kannte.
Trotz herkulischer Anstrengungen gelang es mir nicht, Verbindung mit Tish aufzunehmen, dessen Bericht über seine Zusammenarbeit mit Burden unschätzbar gewesen wäre. Ein kurzes Interview mit ihm ist immerhin in dieser Sammlung enthalten. 2008 schrieb ich Runes Schwester Kirsten Larsen-Smith und bat sie um ein Interview über die Verbindung ihres Bruders mit Burden, doch sie äußerte Bedenken, sagte, sie fühle sich nicht imstande, über ihren Bruder zu sprechen, weil der Kummer über seinen viel zu frühen Tod noch zu groß sei. Dann, im März 2011, nachdem ich alle Materialien für das Buch zusammengetragen und bearbeitet hatte, rief Smith mich an und erklärte, sie habe beschlossen, mir doch ein Interview zu gewähren. Mein Gespräch mit ihr ist nun dem Buch angefügt worden. Ich bin ihr zutiefst dankbar für den Mut und die Ehrlichkeit, mit der sie über ihren Bruder spricht.
Ich habe einen kurzen Essay der Kunstkritikerin Rosemary Lerner aufgenommen, die zurzeit an einem Buch über Burden arbeitet; Interviews mit zweien der Kunsthändler, die Burdens «Masken» gezeigt haben; und ein paar kurze Besprechungen, die nach der Vernissage von Die Erstickungsräume erschienen, einer Ausstellung, die viel weniger beachtet wurde als die zwei anderen Teile der Maskierungen-Trilogie. Timothy Hardwicks Artikel, der nach Runes Tod erschien, wurde in die Anthologie aufgenommen, weil er Runes Ansichten über künstliche Intelligenz behandelt, ein Thema, das auch Burden interessierte, obwohl aus ihren Eintragungen hervorgeht, dass die beiden nicht einer Meinung waren.
Ich fühle mich verpflichtet, den kritischen Punkt einer psychischen Erkrankung anzusprechen. Auch wenn Alison Shaw die Künstlerin in einem Aufsatz über Burden in Art Lights einen «Ausbund von Gesundheit in einer ungesund verzerrten Welt» nennt, vertritt Alfred Tong in einem Artikel für Blank: A Magazine of the Arts den entgegengesetzten Standpunkt:
Harriet Burden war reich. Nachdem sie den renommierten Kunsthändler und Sammler Felix Lord geheiratet hatte, musste sie nie mehr arbeiten. Als er 1995 starb, erlitt sie einen schweren Zusammenbruch und wurde von einem Psychiater behandelt. Sie blieb bis an ihr Lebensende bei ihm in Therapie. Dem Vernehmen nach war Burden exzentrisch, paranoid, streitlustig, hysterisch und sogar gewalttätig. Mehrere Leute sahen, wie sie Rune in Red Hook am Wasser tätlich angriff. Einer der Zeugen erzählte mir persönlich, Rune habe den Schauplatz blutend und verletzt verlassen. Es fällt mir schwer zu verstehen, wie irgendjemand glauben sollte, sie wäre auch nur ansatzweise ausgeglichen genug gewesen, um Darunter hervorzubringen, eine kraftvolle, komplizierte Installation, die wohl Runes bedeutendstes Werk ist.
In den folgenden Auszügen aus den Tagebüchern schreibt Burden über ihr Leid nach dem Tod ihres Mannes, und sie schreibt über Dr. Adam Fertig, in dessen Schuld sie sich fühlt. Tong hat recht damit, dass sie in den acht verbleibenden Jahres ihres Lebens weiter zu Fertig ging, einem Psychiater und Psychoanalytiker, den sie zweimal in der Woche aufsuchte. Es stimmt auch, dass sie Rune vor etlichen Zeugen mit der Faust schlug. Die Schlüsse, die Tong aus diesen Tatsachen zieht, sind allerdings weitgehend unbegründet. Die Verfasserin der Notizbücher ist sensibel, gequält, wütend und neigt, wie die meisten von uns, zu blinden Flecken. Zum Beispiel scheint Burden oft zu vergessen, dass es ihre Entscheidung gewesen war, sich in der Welt der Kunst zum Verschwinden zu bringen. Sie stellte ihr Werk hinter wenigstens zwei, wenn nicht drei männlichen Masken aus, weigerte sich aber, die Kunst, die sie im Laufe vieler Jahre angehäuft hatte, einem einzigen Händler zu zeigen – eine Tatsache, die mehr als ein Hinweis auf Selbstsabotage ist.
Meine sorgfältige Lektüre der vierundzwanzig Notizbücher nebst den Texten und Äußerungen derer, die sie gut kannten, haben mir ein differenziertes Bild der Künstlerin und der Frau Harriet Burden verschafft, doch ich gestehe, dass ich während der sich mit Pausen über sechs Jahre erstreckenden Arbeit an dieser Anthologie – ihre Handschrift zu entziffern, mühsam ihre Verweise und Querverweise aufzuspüren und mir ihre mannigfaltigen Bedeutungen zusammenzureimen – manchmal das unbehagliche Gefühl hatte, Harriet Burdens Geist würde mich auslachen. Sie sprach in ihren Tagebüchern mehrmals von sich selbst als «Trickbetrügerin» und scheint Freude an allen möglichen Listen und Spielen gehabt zu haben. In Burdens Notizbuch-Alphabet fehlen nur zwei Buchstaben: I und O. Der Buchstabe I ist natürlich das Pronomen der ersten Person im Englischen, und ich begann mich zu fragen, wie Burden es geschafft hatte, dem zu widerstehen, ein Notizbuch unter diesem Buchstaben zu führen, und ob sie es nicht irgendwo versteckt hat, wenn auch nur, um Leute wie mich zum Narren zu halten, von denen sie offensichtlich gehofft hat, sie würden irgendwann von ihr und ihrem Werk Notiz nehmen. In Klammern sei noch hinzugefügt, dass sie mit I auch die Ziffer 1 gemeint haben mag. Was O betrifft, so ist es ebenfalls eine Zahl und ein Buchstabe, eine Nullität, eine Öffnung, eine Leere. Vielleicht ließ sie diesen Buchstaben absichtlich aus. Ich weiß es nicht. Und Richard Brickman? Es gibt Hunderte Richard Brickmans in den Vereinigten Staaten, aber ich nehme an, dass Brickman ein weiteres Pseudonym von Burden war. Als Ethan mir sagte, seine Mutter habe 1986 mindestens eine entscheidende Arbeit unter dem absonderlichen Namen Roger Raison veröffentlicht, war ich mir meiner Hypothese ziemlich sicher, obwohl ich keinen Beweis habe, der sie in irgendeiner Weise begründen kann.
Die beste Strategie ist vielleicht, die Leser und Leserinnen des Folgenden selbst darüber urteilen zu lassen, was Harriet Burden gemeint oder nicht gemeint hat und ob man ihrer Selbstdarstellung trauen kann. Die Geschichte, die sich aus dieser Anthologie von Stimmen entwickelt, ist intim, widersprüchlich und, wie ich zugebe, ziemlich eigenartig. Ich habe mein Bestes getan, den Text sinnvoll anzuordnen und Burdens Aufzeichnungen, wenn nötig, zur Verdeutlichung mit Anmerkungen zu versehen, aber die Worte gehören denen, die Beiträge geleistet haben, und ich habe sie mit nur geringfügigen redaktionellen Eingriffen stehenlassen.
Abschließend muss ich einige Worte zum Titel dieses Buchs hinzufügen. In Notizbuch W (möglicherweise für Wiedergänger, wieder besuchen oder Wiederholung – alle drei Wörter treten mehrfach auf), nach zwanzig Seiten über Gespenster und Träume, kommt eine Leerstelle, gefolgt von den Worten «Monster zu Hause». Das diente mir als Arbeitstitel, bis ich alle Texte bekommen, in der vorliegenden Reihenfolge angeordnet und durchgelesen hatte. Ich entschied, dass der Titel, den Burden Cavendish entlehnt hatte und dem letzten Werk gab, das sie vor ihrem Tod fertigstellen konnte, für die Geschichte insgesamt besser geeignet war: Diegleißende Welt.
Gerade als dieses Buch in Druck gehen sollte, informierten mich Maisie und Ethan Lord darüber, dass sie soeben ein weiteres Notizbuch wiedergefunden hatten: Notizbuch O. Die Eintragungen in O liefern zusätzliche Angaben über Harriet Burdens Beziehung zu Rune und offenbaren, dass Richard Brickman, wie ich vermutet hatte, ein Pseudonym von Burden ist. Die bedeutsamsten Seiten aus diesem Notizbuch wurden diesem Buch beigefügt, doch da sie meine Sicht der Künstlerin nicht grundlegend änderten, habe ich meine Einführung nicht revidiert. Wenn irgendwann eine zweite Auflage dieses Textes erfolgt und Notizbuch I (das, wie ich jetzt sicher meine, existiert) entdeckt wird, könnte es gut sein, dass ich mir meinen Text noch einmal vornehmen und entsprechend ändern muss.
I.V. Hess
Harriet Burden
Notizbuch G (Memoirenfragment)
Etwa ein Jahr nachdem Felix gestorben war, fing ich damit an, sie zu machen – Totems, Fetische, Zeichen, Geschöpfe wie er, und nicht wie er, alle möglichen sonderbaren Körper, die die Kinder erschreckten, obwohl sie erwachsen waren und nicht mehr bei mir wohnten. Sie befürchteten eine Art entgleiste Trauer, besonders nachdem ich beschlossen hatte, dass einige meiner Korpusse warm sein mussten, sodass man, wenn man den Arm um sie legte, die Hitze spüren konnte. Maisie sagte mir, ich solle es langsam angehen lassen: «Mom, das ist zu viel. Du musst damit aufhören, Mom. Du bist nicht mehr die Jüngste, weißt du.» Und Ethan, seinem Ethan-Selbst getreu, drückte seine Missbilligung aus, indem er sie «Muttermonster», «Dad-Dinger» und «pater horribilis» nannte. Nur bei Aven, der wundersamen Enkeltochter, fanden meine teuren Tierchen Anklang. Sie war damals noch keine zwei Jahre alt und näherte sich ihnen nüchtern und mit großer Behutsamkeit. Sie legte gern ihre Wange an einen strahlenden Bauch und krähte.
Aber ich muss mich zurückbewegen und einen Bogen schlagen. Ich schreibe dies, weil ich der Zeit nicht traue. Ich, Harriet Burden, meinen alten Freunden und ausgewählten neuen Freunden auch als Harry bekannt, bin zweiundsechzig, nicht uralt, aber auf dem besten Wege zum ENDE, und ich habe noch zu viel zu tun, bevor eines meiner Wehwehchen sich als Tumor oder Wortausfalldemenz entpuppt oder der aus der Spur gebrochene Lastwagen auf den Gehweg springt, mich gegen die Wand und den letzten Atemzug aus mir heraus quetscht. Leben heißt, auf Zehenspitzen über Landminen gehen. Wir wissen nie, was kommt, und wenn Sie meine Meinung hören wollen, wir haben auch das, was hinter uns liegt, nicht gut im Griff. Aber wir können todsicher eine Geschichte davon erzählen und uns beim Versuch, das richtig hinzukriegen, das Hirn zermartern.
Anfänge sind Rätsel. Ma und Pa. Der schwimmende Fötus. Ab ovo. Es gibt jedoch mehrere Momente im Leben, die Ursprünge genannt werden könnten; wir müssen sie nur als solche erkennen. Felix und ich frühstückten drüben in der alten Wohnung in der Park Avenue 1185. Er hatte wie jeden Morgen sein weichgekochtes Ei gekonnt mit dem Messer geköpft und den Löffel mit seinem weißen und gelb rinnenden Inhalt zum Mund geführt. Ich blickte ihn an, weil er kurz davor zu sein schien, mir etwas zu sagen. Er sah einen Moment lang überrascht aus, der Löffel fiel auf den Tisch, dann auf den Boden, und Felix sackte nach vorn, sodass seine Stirn auf einem Stück Toast mit Butter landete. Das Licht vom Fenster schien schwach auf den Tisch mit seiner weiß-blauen Decke, das abgelegte Messer lag quer auf dem Unterteller der Kaffeetasse; die grünen Salz- und Pfefferstreuer standen Zentimeter von seinem linken Ohr entfernt. Ich kann das Bild meines über seinem Teller zusammengebrochenen Mannes nicht länger als einen Sekundenbruchteil registriert haben, aber es ist in mein Gedächtnis eingebrannt, und ich sehe es immer noch vor mir. Ich sehe es, obwohl ich aufsprang und seinen Kopf hochhob, seinen Puls fühlte, Hilfe herbeirief, ihn Mund-zu-Mund beatmete, meine konfusen weltlichen Gebete betete, hinten im Rettungswagen bei den Sanitätern saß und die Sirene jaulen hörte. Inzwischen war ich eine Steinfrau geworden, eine Beobachterin, die auch Akteurin in der Szene war. Ich erinnere mich lebhaft an all das, und doch sitzt ein Teil von mir immer noch an dem kleinen Tisch in der langen, schmalen Küche am Fenster und starrt auf Felix. Es ist das Bruchstück von Harriet Burden, das nie mehr aufgestanden ist und nicht weitergemacht hat.
Ich wechselte auf die andere Seite der Brücke und kaufte ein Haus in Brooklyn, zur damaligen Zeit ein verwahrlosterer Stadtteil als heute. Ich wollte die Kunstszene von Manhattan fliehen, diesen inzestuösen, wohlhabenden, schwirrenden Globulus, der aus Menschen besteht, die ästhetische Objekte kaufen und verkaufen. Man kann durchaus sagen, dass Felix in diesem verweichlichten Mikrokosmos ein Riese gewesen ist, ein Händler der Stars, und ich Gargantuas Künstlerehefrau. Die Ehefrau überwog jedoch die Künstlerin, und nach Felix’ Tod war es dieser beau monde ziemlich egal, ob ich blieb oder sie verließ, um in die als Red Hook bekannte ferne Gegend zu ziehen. Ich hatte zwei Kunsthändler gehabt; beide hatten mich fallenlassen, einer nach dem anderen. Meine Arbeiten hatten sich nie gut verkauft und wurden wenig diskutiert, aber dreißig Jahre lang diente ich ihnen allen durch die Bank als Gastgeberin – den Sammlern, den Künstlern und den Kunstkritikern, ein wechselseitig abhängiger Club, so eingewachsen und verwachsen, dass ihre Identitäten zu verschmelzen schienen. Als ich all dem Lebewohl sagte, hatten die «heißen» neuen Produkte, frisch von der Kunstakademie, für mich allmählich alle gleich ausgesehen, mit ihrer Film- oder Performance-Kunst, ihrem prätentiösen Geplapper und ihren verquasten theoretischen Referenzen. Immerhin waren die jungen Künstler hoffnungsvoll; sie holten sich ihre Anregungen von den Hoffnungslosen – diesen Schwachköpfen, die für Art Assemblyschrieben, das hermetische Käseblatt, das seiner ebenso eifrigen wie ignoranten Leserschaft regelmäßig die kalten Überreste französischer Literaturtheorie auftischte. Jahrelang hatte ich mich so angestrengt, meinen Mund zu halten, dass ich fast daran erstickte. Jahrelang war ich in verschiedenen Kostümen von der leuchtenden, exzentrischen Sorte um den Esszimmertisch gegenüber dem Klee geglitten, hatte mit geschickten Signalen den Verkehr geregelt und gelächelt, immer gelächelt.
Felix Lord entdeckte mich, als ich an einem späten Samstagnachmittag in seiner Galerie in SoHo stand und einen Künstler betrachtete, der seit langem verschwunden ist, aber in den sechziger Jahren einen kurzen Augenblick des Ruhms hatte: Hieronymus Hirsch.[1] Ich war sechsundzwanzig. Er achtundvierzig. Ich war eins fünfundachtzig groß. Er eins fünfundfünfzig. Er war reich. Ich war arm. Er sagte mir, meine Haare sähen aus wie die von einer, die eine Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl überlebt hat, und ich sollte etwas dagegen tun.
Es war Liebe.
Und es waren Orgasmen, viele, in weichen, feuchten Laken.
Es war ein Haarschnitt, sehr kurz.
Es war die Ehe. Meine erste. Seine zweite.
Es waren Gespräche – über Gemälde, Skulpturen, Fotos und Installationen. Und Farben, sehr oft über Farben. Sie färbten auf uns beide ab, füllten unser Inneres. Es war einander Bücher vorlesen und darüber reden. Er hatte eine herrliche Stimme mit einem Kratzen von den Zigaretten, die er nie aufgeben konnte.
Es waren Babys, die ich wahnsinnig gern ansah, die kleinen Lords, sinnliche Wonnen von pummeligem Fleisch und Flüssigkeiten. Mindestens drei Jahre verbrachte ich in Fluten von Milch und Kacka und Pisse und Kotze und Schweiß und Tränen. Es war das Paradies. Es war eine Strapaze. Es war langweilig. Es war wonnig, aufregend und manchmal, seltsamerweise, sehr einsam.
Maisie, die manische Erzählerin des Lebensflusses, die Piepsstimme des summenden, brummenden Durcheinanders. Sie redet immer noch viel, sehr, sehr viel.
Ethan, das methodische Kind, das erst einen Fuß, dann den anderen in ein Parkettkarree setzt, die rhythmische, umherwandernde Betrachtung des Flurs.
Es waren Gespräche über die Kinder bis spät in die Nacht und Felix’ Geruch, sein dezentes Eau de Cologne und Kräutershampoo, seine schmalen Finger auf meinem Rücken. «Mein Modigliani.» Er verwandelte mein langes, unansehnliches Gesicht in ein Artefakt. Jolie laide.
Kindermädchen, damit ich arbeiten und lesen konnte: die dicke Luca und die muskulöse Theresa.
In dem Raum, den ich mein Mikroatelier nannte, baute ich winzige, schiefe Häuser mit viel Schrift an den Wänden. «Zerebral», sagte Arthur Piggis, der sich einmal die Mühe machte hinzuschauen.[2] Gallertartige Figuren schwebten, von fast unsichtbaren Drähten gehalten, an der Decke. Eine hielt ein Schild hoch, auf dem stand: «Was machen diese Fremden hier?» Dort schrieb ich – die Aufschreie, die niemand las, die wilden Ergüsse, die nicht einmal Felix verstand.
Felix auf dem Weg zum Flughafen. Seine aufgereihten Anzüge im Wandschrank. Seine Krawatten und seine Deals. Seine Sammlung.
Felix the Cat. Wir erwarten dich sehnsüchtigst nächste Woche in Berlin. Love, Alex und Sigrid. Innentasche des Anzugjacketts, das in die Reinigung kam. Seine Nachlässigkeit, meinte Rachel, war eine Art, mir von ihnen zu erzählen, ohne es mir zu erzählen. Das geheime Leben des Felix Lord. Es könnte ein Buch oder ein Theaterstück sein. Ethan, mein Schriftstellersohn, könnte es schreiben, wenn er wüsste, dass sein Vater drei Jahre lang in ein Paar verliebt war. Felix mit den abwesenden Augen. Und hatte ich nicht auch seine Undurchschaubarkeit geliebt? Hatte es mich nicht angezogen und verführt, wie er die anderen verführte, nicht mit dem, was da war, sondern mit dem, was fehlte?
Erst der Tod meines Vaters, dann der Tod meiner Mutter, innerhalb eines Jahres, und all die kranken Träume, ein ganzer Schwall, die ganze Nacht, jede Nacht – aufblitzende Zähne, Knochen und Blut, das unter zahllosen Türen hervorquoll, die mich durch Flure in Räume brachten, die ich hätte erkennen müssen, aber nicht erkannte.
Zeit. Wie kann ich nur so alt geworden sein? Wo ist die kleine Harriet geblieben? Was geschah mit dem großen, unansehnlichen Krauskopf, der so emsig studierte? Einziges Kind eines Professors und seiner Frau – Philosoph und Gefährtin, WASP und Jüdin –, nicht immer glücklich verheiratet in ihrer Wohnung auf der Upper West Side, meine linken, bedürfnislosen Eltern, deren einziger Luxus darin bestand, einen Narren an mir gefressen zu haben, ihrer cause célèbre, ihrer übergroßen, haarigen Bürde, die sie in einigem enttäuschte, in anderem nicht. Wie Felix fiel mein Vater eines Vormittags tot um. Eines Morgens in seinem Arbeitszimmer, nachdem er die Monadologie aus ihrem Zuhause im Regal gegenüber von seinem Schreibtisch genommen hatte, hörte sein Herz auf zu schlagen. Danach wurde meine einst laute, quirlige Mutter leiser und langsamer. Ich konnte zusehen, wie sie dahinschwand. Sie wurde täglich weniger, bis ich die winzige Figur in dem Krankenhausbett kaum noch erkennen konnte, die am Ende nicht nach ihrem Mann oder nach mir, sondern nach ihrer Mama rief – wieder und wieder.
Ich trauerte aufgewühlt um alle drei, ein großes, ruheloses, auf und ab tigerndes Tier. Rachel sagt, keine Trauer sei einfach, und ich habe festgestellt, dass meine alte Freundin Dr. Rachel Briefman bei den seltsamen Machenschaften der Psyche meistens richtigliegt – die Psychoanalyse ist ihre Berufung –, und es stimmt, dass mein Leben im ersten Jahr ohne Felix voller Wut und Rachsucht war, eine Implosion von Trauer über alles, was ich falsch gemacht, und alles, was ich vergeudet hatte, eine Zwickmühle aus Hass und Liebe für uns beide. Eines Nachmittags warf ich haufenweise teure Kleider weg, die er bei Barneys und Bergdorf’s für mich gekauft hatte, und die arme Maisie mit ihrem vorgewölbten Bauch schaute in den Schrank und plärrte etwas von Vaters Geschenke aufheben und wie ich nur so grausam sein könne, und ich bereute die alberne Tat. Ich verbarg so viel es ging vor den Kindern: den Wodka, der mir beim Einschlafen half, das Gefühl von Unwirklichkeit, wenn ich durch die Zimmer ging, die ich so gut kannte, und den furchtbaren Hunger nach etwas, was ich nicht benennen konnte. Das Erbrechen konnte ich nicht verbergen. Ich aß, und das Essen schoss wieder hoch und aus mir heraus, bespritzte die Toilette und die Wände. Ich konnte es nicht aufhalten. Wenn ich jetzt daran denke, spüre ich wieder die glatte, kühle Oberfläche der Klobrille, während ich sie umklammere, die würgenden, qualvollen Krämpfe in Kehle und Bauch. Ich sterbe auch, dachte ich, ich verschwinde. Tests und noch mehr Tests. Ärzte und noch mehr Ärzte. Nichts zu finden. Dann die Endstation für sogenannte «funktionale Beschwerden wegen einer möglichen Konversionsreaktion», für einen Körper, der sich des Sprechens bemächtigt hat: Rachel schickte mich zu einem Psychiater und Psychoanalytiker. Ich weinte und redete und weinte noch ein bisschen mehr. Mutter und Vater, die Wohnung am Riverside Drive, Cooper Union. Meine alten, geplätteten Ambitionen. Felix und die Kinder. Was habe ich getan?
Und dann, eines Nachmittags um zehn Minuten nach drei, kurz vor dem Ende der Sitzung, sah Dr. Fertig mich mit seinen melancholischen Augen an, die so viel Traurigkeit gesehen haben mussten, zweifellos so viel schlimmere Traurigkeit als meine, und sagte leise, aber eindringlich: «Es ist noch Zeit, die Dinge zu ändern, Harriet.»
Es ist noch Zeit, die Dinge zu ändern.
Das Erbrechen hörte auf. Da soll noch einer sagen, es gäbe keine magischen Worte.
Cynthia Clark
(Interview mit der früheren Besitzerin der Clark Gallery, New York, 6. April 2009)
Hess: Erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Harriet Burden?
Clark: Ja, Felix brachte sie mit in die Galerie. Er war inzwischen von Sarah geschieden, und er kommt mit diesem riesigen Mädchen rein, groß wie ein Turm, wirklich, und mit spitzenmäßiger Figur, aber mit einem langen, eigenartigen Gesicht. Sie wurde immer die Amazone genannt.
Hess: Waren Sie damals mit ihrem Werk vertraut?
Clark: Nein, aber ehrlich gesagt, war niemand mit ihrem Werk vertraut. Ich habe es inzwischen gesehen, die frühen Sachen, aber in Wahrheit hätte niemand in der Kunstszene damals seinen Wert erfasst. Es war zu überreizt, zu weit weg von den ausgetretenen Pfaden. Es passte in kein Schema. In den späten Sechzigern und frühen Siebzigern gab es eine Menge Kunstkriege. Sie war auch keine Judy Chicago mit einem feministischen Statement. Und ich vermute, Felix war auch ein Problem für sie. Er konnte sie schließlich nicht vertreten, das wäre Vetternwirtschaft gewesen.
Hess: Gibt es noch andere Eindrücke außer ihrem auffallenden Aussehen, die Sie uns für das Buch mitteilen möchten?
Clark: Einmal, bei einem Dinner, hat sie eine Szene gemacht, vor Jahren, fünfundachtzig, glaube ich. Sie redete mit Rodney Farrell, dem Kritiker – der baute schon langsam ab, aber damals hatte er noch einige Macht –, jedenfalls muss etwas, was er sagte, sie auf die Palme gebracht haben, und diese Frau, die wir alle für sehr ruhig gehalten hatten, brauste auf und redete drauflos über Philosophie, Kunst und Sprache. Sie war sehr laut, belehrend, unangenehm. Ich glaube, niemand hatte die leiseste Ahnung, worauf sie hinauswollte. Ehrlich gesagt, dachte ich, es wäre vielleicht Geschwafel. Alle hörten auf zu reden. Und dann fing sie an zu lachen, ein verrücktes, irres Lachen, stand auf und ging. Felix war verärgert. Er hasste Szenen.
Hess: Und die Pseudonyme? Hatten Sie irgendeinen Verdacht?
Clark: Überhaupt nicht. Nach Felix’ Tod verschwand sie. Kein Mensch sprach mehr von ihr.
Hess: Hat die Differenziertheit von Anton Tishs Werk Sie nicht gewundert? Er war damals doch erst vierundzwanzig, schien aus dem Nichts zu kommen, und in Interviews konnte er sich auffallend schlecht ausdrücken und schien nur oberflächliche Gedanken zu seinem Werk zu haben.
Clark: Ich habe viele Künstler ausgestellt, die nicht fähig waren, auszudrücken, worum es ihnen ging. Mein Standpunkt ist, dass das Werk für sich sprechen soll und dass der Druck auf Künstler, sich zu erklären, unangebracht ist.
Hess: Da stimme ich Ihnen zu, und doch ist Die Geschichte der Kunst des Westens ein komplexer Spaß über Kunst, voller Referenzen, Zitate, Wortspiele und Anagramme. In einem Bild von Chardin, das im jährlichen Salon der Académie gezeigt worden war, steckt eine Anspielung auf Diderot, die aus der französischen Ausgabe stammt. Der begleitende Essay wurde nie ins Englische übersetzt. Tish sprach aber nicht Französisch.
Clark: Hören Sie, ich habe das schon mal gesagt. Es ist schön und gut, jetzt zurückzublicken und zu fragen, wie wir nur darauf hereinfallen konnten. Da können Sie so viele Beispiele vorbringen, wie Sie wollen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wie er es gemacht hat. Er hat mir das Werk gegeben. Es hat Aufsehen erregt. Es hat sich verkauft. Ich habe ihn in seinem Atelier besucht, und überall waren Sachen, an denen er arbeitete. Was hätten Sie gedacht?
Hess: Ich weiß nicht genau.
Clark: Darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Man kann leicht behaupten, das Posieren, die Performance seien Teil des Werks selbst, alles gehöre zusammen, und wie Sie bestimmt wissen, erzielen von Anton Tish signierte Arbeiten aus dieser Ausstellung hohe Preise. Ich bereue nicht eine Sekunde lang, sie ausgestellt zu haben.
Hess: Ich denke, die eigentliche Frage ist: Hätten Sie sie ausgestellt, wenn Ihnen klar gewesen wäre, wer sie wirklich geschaffen hat?
Clark: Ich glaube schon. Ja, ich denke schon.
Maisie Lord
(bearbeitetes Transkript)
Nachdem meine Mutter nach Brooklyn gezogen war, sammelte sie Streuner – menschliche Streuner, nicht Tiere. Jedes Mal, wenn ich sie besuchte, schien ein anderer «Assistent», ein Dichter, Herumtreiber oder schlichtweg ein Sozialfall in einem der Zimmer zu wohnen, und ich machte mir Sorgen, sie könnten sie ausnutzen, sie berauben oder gar im Schlaf umbringen. Ich mache mir zu viele Sorgen; das ist chronisch. Ich wurde zur Bedenkenträgerin der Familie – mein Job. Der Mann, der sich Barometer nannte, wohnte lange bei meiner Mutter. Ehe er vor ihrer Haustür landete, war er zwei Wochen lang im Bellevue Hospital gewesen. Er quasselte von den Worten des Windes und machte eigenartige Bewegungen, um die Luftfeuchtigkeit zu verringern. Als ich meiner Mutter gegenüber meine Beunruhigung seinetwegen erwähnte, sagte sie: «Aber Maisie, er ist ein sanftmütiger Mensch, und er zeichnet sehr gut.» Wie sich herausstellte, hatte sie damit recht. Er wurde zum Thema eines meiner Filme, aber es gab noch andere, flüchtigere, zwielichtigere Typen, die mir nachts den Schlaf raubten, bis Phineas dazukam und ihre Angelegenheiten in Ordnung brachte, aber das war später. Das Gebäude, in dem meine Mutter wohnte, war riesig, ein altes Lagerhaus. Sie hatte zwei Stockwerke, das eine zum Leben, das andere zum Arbeiten. Beim Renovieren sorgte sie dafür, dass mehrere Zimmer für «alle meine künftigen Enkelkinder» hergerichtet wurden, aber ich denke, ihr schwebte auch vor, junge Künstler direkt zu unterstützen, indem sie sie aufnahm und ihnen Platz zum Arbeiten gab. Mein Vater hatte seine Stiftung. Meine Mutter hatte nun ihre spontane Red-Hook-Künstlerkolonie.
Nicht lange nach ihrem Umzug sagte meine Mutter zu mir: «Maisie, ich kann fliegen.» Ihre Energie war, gelinde gesagt, erheblich. Irgendwo las ich etwas über Hypomanie und fragte mich, ob meine Mutter nicht womöglich hypoman sei. Trauer kann von allen möglichen nervösen Schwankungen verkompliziert werden, und nach dem Tod meines Vaters war sie wirklich krank. So dünn und schwach, dass sie sich kaum bewegen konnte, aber nachdem sie sich erholt hatte, war sie nicht zu bremsen. Jeden Tag arbeitete sie lange in ihrem Atelier, und danach las sie noch zwei oder drei Stunden, ein Buch nach dem anderen, Romane, Philosophie, Kunst und Wissenschaft. Sie führte Tagebuch und Notizbücher. Sie kaufte sich einen dieser großen, schweren Boxsäcke und engagierte eine Frau namens Wanda, ihr Boxunterricht zu geben. Manchmal fühlte ich mich schon schlaff, wenn ich sie bloß ansah. Sie hatte immer etwas Aufbrausendes an sich gehabt, beim belanglosesten Vorfall konnte sie plötzlich explodieren. Einmal, als sie mich aufgefordert hatte, mir die Zähne zu putzen, und ich trödelte – da muss ich etwa sieben gewesen sein –, rastete sie aus. Sie kreischte und schrie und drückte eine ganze Tube Zahnpasta im Waschbecken aus. Aber meistens war sie meinem Bruder und mir eine geduldige Mutter. Sie war es, die uns vorlas und vorsang, die sich lange Geschichten ausdachte, um Ethan und mich zufriedenzustellen, keine leichte Aufgabe, weil ich Feen und Kobolde wollte und er Fahrzeuge, aus denen diverse Kampfmaschinen und Roboter ausrückten, weshalb sie Hybride erschuf. Ein ganzes Jahr lang erzählte sie uns eine endlos lange Geschichte von den Fervidlies aus dem Land Fervid. Jede Menge Zauberei und Kämpfe und ausgeklügelte Waffen. Während der ganzen Highschoolzeit half sie uns bei den Hausaufgaben. Noch vom College aus rief ich sie immer an, wenn ich Fragen zu meinen Kursen oder Seminararbeiten hatte. Meine Mutter interessierte sich für alles und schien alles gelesen zu haben. Sie war es, die unseren Spielen, musikalischen Darbietungen und Theateraufführungen beiwohnte. Mein Vater kam, wenn er konnte, aber er war viel auf Reisen. Als ich klein war, ging ich manchmal hinüber und schlief bei meiner Mutter, wenn er weg war. Sie redete im Schlaf. Ich weiß nicht, warum ich mich daran erinnere, aber einmal schrie sie auf: «Wo ist Felix?»
Kinder sind selbstsüchtig. Ich wusste, dass meine Mutter Künstlerin war und verschachtelte Häuser voller Puppen, Gespenster und Tiere machte, die sie mich manchmal anfassen ließ, aber ich betrachtete ihre Arbeit nie als Beruf. Sie war eben meine Mutter. Mein Vater nannte sie seine Madonna vom Geiste. Es ist schrecklich, wenn ich darüber nachdenke, aber mir ist nie in den Sinn gekommen, dass meine Mutter frustriert oder unglücklich sein könnte. Die fortwährende Ablehnung muss sie gekränkt haben, das Ungerechte daran, aber ich kann nicht sagen, dass ich es als Kind so empfunden habe. Bei der Arbeit an einer ihrer Konstruktionen summte sie immer gern vor sich hin und wiegte sich und wackelte mit den Fingern über einer Figur herum, bevor sie sie berührte. Manchmal schnupperte sie an den Materialien und seufzte. Hin und wieder schloss sie die Augen und sagte, dass es für sie keine Kunst ohne den Körper und seine Rhythmen gebe. Natürlich fand ich diese Gesten und Tics als Teenager unerträglich und versuchte, dafür zu sorgen, dass keiner meiner Freunde sie mitbekam. Als ich siebzehn war, sagte sie einmal zu mir: «Maisie, du hast Glück, dass du nicht meinen Busen geerbt hast. Ein großer Busen an kleinen Frauen ist attraktiv; ein großer Busen an einer großen Frau ist beängstigend – zumindest für Männer.» Mir wurde schlagartig bewusst, dass sie das Gefühl hatte, ihre Weiblichkeit, ihr Körper, ihre Größe hätten sich störend auf ihr Leben ausgewirkt. Das war lange vor den Pseudonymen, und ich war damit beschäftigt, an der Highschool meinen ersten kleinen Film zu machen, ein visuelles Tagebuch nannte ich das – sehr prätentiös, viele lange, düstere Einstellungen von meinen Freunden, die die Straße entlanggehen oder in Zuständen existenzieller Angst zu Hause in ihren Zimmern sitzen, solche Sachen. Was hatte mein Busen damit zu tun?
Viel, viel später, als es herauskam, überfiel mich der abscheuliche Gedanke, dass sie recht gehabt hatte. Natürlich, inzwischen war ich erwachsen und mit meiner eigenen Arbeit auf entsprechende Herabsetzung und Vorurteile gestoßen. Ich hatte geglaubt, sie benutze diese Männer als Strohmänner, um etwas zu beweisen, und das gelang ihr auch, zumindest teilweise, aber als ich ihr Memoirenfragment und die Tagebücher las, begriff ich, wie kompliziert ihr Verhältnis zu diesen Männern gewesen war und dass auch die Masken echt waren. Sie ist furchtbar missverstanden worden. Sie war kein berechnendes Biest, das Leute nach Strich und Faden ausnutzte. Ich glaube, niemand weiß wirklich, wann sie zum ersten Mal über Pseudonyme nachdachte. In den achtziger Jahren veröffentlichte sie eine dichte Kunstkritik unter dem Namen Roger Raison in einer Zeitschrift, in der sie über den Baudrillard-Wahn lästerte und seine Simulakra-Beweisführung auseinandernahm, aber sie wurde kaum beachtet. Ich erinnere mich, dass ich als Fünfzehnjährige mit der Familie in Lissabon war und meine Mutter hinging und das Standbild von Pessoa küsste. Sie sagte, ich solle ihn unbedingt lesen, und erzählte natürlich, dass er für das, was er seine Heteronyme nannte, berühmt sei. Sie war auch stark von Kierkegaard beeinflusst. Ihr Drang, jemand anders zu sein, ging zweifellos auf ihre Kindheit zurück. Rachel Briefman, ihre beste Freundin, ist Psychiaterin und Psychoanalytikerin. Sie hat wahrscheinlich recht damit, dass die Psychotherapie eine Harriet Burden freigesetzt hat, die niemand von uns jemals vorher gesehen hatte, ebenso wie etliche andere Charaktere oder Personae, die sie seit geraumer Zeit in sich niedergehalten hatte. Ich meine nicht, wie bei multiplen Persönlichkeiten, sondern wie bei proteischen Künstleregos, Egos, die herausgesprungen kommen und Körper brauchen. Nichts von dem hätte ich noch vor einem Jahr sagen können, aber langsam sehe ich meine Mutter in einem anderen Licht, oder vielleicht sollte ich sagen, in mehreren verschiedenen Lichtern.
Aber das ist erst im Lauf der Zeit so geworden. Als ich Erinnerungstraum zum ersten Mal sah, war ich unvorbereitet. Es schockierte mich. Eines Sonntags fuhr ich mit meiner Tochter Aven nach Red Hook zum Brunch. Oscar, mein Mann, war nicht dabei, ich erinnere mich nicht, wieso. Wahrscheinlich musste er einen Bericht über eines der Kinder schreiben, mit denen er arbeitet. (Er ist promovierter Psychologe und hat Privatpatienten, aber er widmet sich auch Pflegekindern im Sozialwesen, wofür er so gut wie nichts bezahlt bekommt.) Falls Mutter zu der Zeit irgendwelche Streuner beherbergte, so war keiner von ihnen da. Aven hatte damals gerade angefangen zu laufen, also muss es im Frühjahr 1996 gewesen sein, und wir hatten ein ereignisreiches Mahl, weil meine Tochter jede Minute mit Laufen verbrachte, oder vielmehr mit Laufen und Hinfallen, wieder Laufen und wieder Hinfallen. Meine Mutter klatschte in die Hände und lachte, und Aven war entzückt, tat sich immer stolzer hervor, bis sie sich verausgabt hatte und zu schluchzen begann; ich legte sie zum Schlafen auf ein Sofa, umgeben von Kissen, damit sie nicht herunterfiel. Meine Mutter hatte viele Kissen, in gedeckten wie in leuchtenden Farben. Sie sprach oft über Farbe und Bedeutung. Farbe, sagte sie, hat körperliche Bedeutung. Bevor wir die Farbe, die wir sehen, benennen können, ist sie in uns.
Wo war ich? Als Aven aufwachte, sagte meine Mutter, sie wolle mir etwas zeigen, woran sie arbeitete, und ging mit mir ans hintere Ende ihres Ateliers, das damals noch im Bau war. Sie hatte einen kleinen Raumkubus aus durchsichtigen Milchglaswänden konstruiert. Durch die Wand hindurch konnte ich eine Figur sehen, und auf einmal wurde mir klar, dass ich auf meinen in einem Sessel sitzenden Vater blickte. Die Ähnlichkeit muss in der Haltung der Figur gelegen haben, denn als Mutter die fast unsichtbare Tür aufstieß, hatte der ausgestopfte, weiche Körper, der Vater so ähnlich schien, recht plumpe Züge, trug aber einen seiner Anzüge, und Don Quijote, das Buch, das mein Vater am meisten liebte, lag aufgeschlagen in seinem Schoß. Als ich hinunterschaute, sah ich, dass der Boden mit Papier gepflastert war, Fotokopien, Berichte, Notizen, die mein Vater aufgeschrieben hatte, und dass mit der Handschrift meiner Mutter auf die roten Linoleumkarrees gekritzelt worden war. Und es gab drei Miniaturtreppen, die nach oben führten und an den Wänden endeten. Fünf Türen waren grob auf eine der Wände gezeichnet. Ich brach in Tränen aus. Dann fing Aven an zu weinen, und meine Mutter versuchte, die Wogen zu glätten. «Tut mir leid, tut mir so leid.» Das war typisch. Sie konnte es nicht ertragen, Leute unglücklich zu sehen. Es griff sie körperlich an. Sie schlang dann die Arme um ihren Oberkörper, als hätte jemand sie geschlagen. Wir erholten uns alle davon, aber bevor der Mietwagenservice mich und Aven abholte, sah meine Mutter mir in die Augen. Es war ein ernster Blick, nicht kalt, aber streng, so wie sie mich manchmal angesehen hatte, als ich klein war und gelogen oder betrogen oder Ethan geschlagen hatte.
Ich erinnere mich daran, weil ich mich schuldig fühlte, obwohl ich nicht wusste, warum. Sie schloss die Augen, öffnete sie dann wieder und sagte mit ruhiger, leiser Stimme: «Tut mir leid, dass es dich verstört hat, Maisie, aber es tut mir nicht leid, dass ich ihn gemacht habe. Es gibt da noch mehr Träume, fürchte ich, und die müssen raus.» Sie lächelte traurig und begleitete uns zum wartenden Auto.
Ich sehe noch vor mir, wie sie sich dann von uns entfernte. Ich wünschte, ich hätte sie damals gefilmt. Es ist schön da draußen am Wasser mit Blick auf die Freiheitsstatue, aber es war auch trostlos, öder als heute, und beim Anblick meiner Mutter, die unter einem weiten, bewölkten Himmel von uns weg auf das Backsteingebäude zuging, hatte ich das Gefühl, sie zu verlieren. So hatte ich mich auch immer gefühlt, wenn ich mich im Sommercamp von ihr verabschiedet hatte. Und dann – es war nur eine Kleinigkeit – bemerkte ich, dass sie sich das Haar wachsen ließ, und es sah aus wie ein wilder kleiner Busch auf ihrem Kopf.
Harriet Burden
Notizbuch G
Wo kamen sie her? Der geflügelte Penis, sein Penis, die hoch aufgehängten leeren Anzugjacken und -hosen, zusammen mit Felix’ Utensilien – Lesebrille, Eau de Cologne, eine glänzende Nagelfeile (File X), eine leere Leinwand (Hoffnung) –, der riesige Felix in einen meiner Raumkuben gezwängt wie Alice im Wunderland, die in einer Reihe aufgestellten winzigen Felixe in diversen Outfits; Ehemannpuppen nannte ich sie. Irgendwie kam auch mein Vater dazu. Der Buch-Mann, der auf einer Seite von Spinoza schlief, über Leibniz hinwegsprang (er liebte Leibniz), ein kleiner Daddy Luftmensch, der über einer Treppe schwebte, mit lauter Wörtern auf seinem zweiteiligen Anzug. Der Ausweichende, meine Ausweichenden begannen sich in den Zeichnungen und Plastiken zu vermischen, ihre Gesichter und ihre Kleidung, verschmolzenes Begehren, verrückt machende geliebte Menschen, in Harrys Geist vermengt. Und auch mit Wut vermischt, auf ihre Macht über mich. Deshalb wuchsen und schrumpften sie.
Wie ich meine Mutter machen sollte, wusste ich nicht. Das würde später kommen. Es war irgendwie problematisch, einen Menschen darzustellen, in dem ich früher einmal gewesen war.
Ihr brauchte ich nicht nachzujagen.
Den Männern jagte ich nach, flehte: Seht mich an!
Nicht existente, unmögliche, imaginäre Objekte sind ständig in unseren Gedanken; in der Kunst jedoch bewegt sich das Innere nach außen, Wörter und Bilder überschreiten die Grenze. Ich habe damals viel Husserl gelesen, während ich in dem großen Raum mit der tiefgezogenen, breiten Fensterfront und dem Blick über das Wasser auf dem Sofa lag. Die cogitationes sind die ersten absoluten Gegebenheiten. Husserl liebte Descartes, und auch er hatte seine Bewusstseinsströme wie William James (den er las), sie liefen neben-, hinter- und durcheinander, und er wusste, dass Einfühlung eine tiefe Form von Wissen ist.[3] Husserls Schülerin Edith Stein ist die beste Philosophin zu diesem Thema, und sie lebte es auch, lebte ihre Worte.[4] Philosophie ist schwer visualisierbar. Ich fragte mich, ob ich Einfühlung darstellen könnte, zum Beispiel indem ich einen Empathie-Kasten baute. Ich kritzelte mögliche Formen für das Innere. Ich machte mir Notizen. Ich summte vor mich hin. Ich hörte häufig die Matthäuspassion. Ich begriff, dass meine Freiheit gekommen war. Es gab nichts und niemanden, der mir im Weg stand, außer der Bürde, Burden zu sein. Die weit offene Zukunft, die gähnende Kluft der Abwesenheit machten mich schwindlig, ängstlich und gelegentlich high, als hätte ich Drogen genommen, was nicht der Fall war. Ich war die Herrscherin über mein kleines Lehen in Brooklyn, eine reiche Witwe, die sich nicht mehr um Babys, Kleinkinder und Teenager kümmern musste, und mein Gehirn war randvoll mit Ideen.
Aber dann kam die nächtliche Einsamkeit, das ruhelose Sehnen, das mich an die einsamen Jahre in meiner ersten Wohnung in der Stadt erinnerte, als ich an der Cooper Union studierte. Ich war auf mein junges Selbst zurückgeworfen – die allein lebende junge Künstlerin mit dem unbestimmten Verlangen nach einer Zukunft, die irgendwie sowohl Ruhm wie Liebe einschloss. Mir wurde allmählich klar, dass es bei den Gefühlen, die ich meiner Jugend zugeschrieben hatte, eigentlich nicht um diese Lebensphase ging. Die Unrast, die ich nach einem langen Arbeitstag verspürte, war die gleiche, die ich als kaum der Kindheit Entwachsene empfunden hatte. Ich verzehrte mich nach irgendeinem Jemand, einer möglichen Person, die die verbleibenden Stunden ausfüllen sollte. Felix, der alte Freund und Gesprächspartner, der feine, ausweichende, bissige, untreue, freundliche Felix war weg. Du hast mich fast um den Verstand gebracht! (Ich war zeitweilig eine Furie.) Aber mein Verstand blieb mir erhalten und auch ihm der seine, und wir hatten den Schaden daran fortlaufend behoben. Jetzt gab es nichts mehr zu reparieren. Keine Reparatur. Kein Felix. Ich hatte Mühe, die Leerstelle begrifflich auszufüllen, und sobald ich begonnen hatte, sie als Realität zur Kenntnis zu nehmen, nahm sie die Form jenes leeren anderen Wesens an, einer Lücke, eines Lochs im Geist, aber es war nicht das Loch namens Felix.
Ich ging dann hinüber in Sunny’s Bar, wo ich herumsaß und den Leuten beim Reden zusah – Stimmen des Trostes. Manchmal gab es auch Musikveranstaltungen. Einmal lauschte ich dort einer Lesung und unterhielt mich nachher mit der Dichterin – große Augen und rot geschminkte Lippen, noch viel jünger als Ethan –, und obwohl ich ihre Gedichte schrecklich fand, war sie mir eigentlich sympathisch. Sie nannte sich April Rain, ein Einfall, der ihr, wie ich annahm, beim Schreiben gekommen war. Das Mädchen hatte eine große Reisetasche mit aufklaffendem Reißverschluss dabei, an der Pullover und ein Hut befestigt waren, und als sie das Bündel hochhob und loszog, sagte ich ihr, sie sähe aus wie eine Einwanderin, die anno 1867 den Landungssteg hinunterwankte, und sie erklärte mir, dass sie bei einer Freundin auf dem Sofa schlafe, weil sie gerade keine Bleibe habe, und da nahm ich sie mit nach Hause.
April Rain, das zarte weiße Mädchen mit Tätowierungen von Vögeln auf den Unterarmen und massenhaft Glasscherben in ihren Gedichten, die mitunter Blutungen verursachten, war meine erste Gastkünstlerin. Sie blieb nicht länger als eine Woche. Eines Abends tat sie im Sunny’s einen zerzausten Beau auf und kehrte nicht zurück, aber solange sie da war, hatte ich sie gern um mich, und ihre Gegenwart fing die abends andrängenden Qualen ab. Beim Anblick von Ms. Rains weichem, blassem Gesicht und ihren dicken Wangen, wenn wir unsere Linsen oder gebratenes Gemüse aßen (sie war Vegetarierin) und über Hildegard von Bingen oder Christopher Smart plauderten, vergaß ich, wie ich aussah. Ich vergaß, dass ich Falten hatte, Brüste, die einen gewaltigen Büstenhalter brauchten, damit sie oben blieben, und einen wie eine Melone vorstehenden Bauch von Damen mittleren Alters. Diese Amnesie ist unsere Phänomenologie des Alltäglichen – wir sehen uns selbst nicht –, und was wir sehen, wird zu uns, während wir es betrachten. Eines Nachts schaute ich, nachdem ich meiner zweiundzwanzigjährigen Bardin gute Nacht gesagt hatte, vor dem Insbettgehen in den Spiegel, überraschte mich selbst mit meinem eigenen Gesicht und brach in Tränen aus. Felix hat diese verblühende Visage geliebt, dachte ich. Er hat sie gepriesen und gestreichelt. Jetzt ist niemand mehr da, der sie lieben könnte.