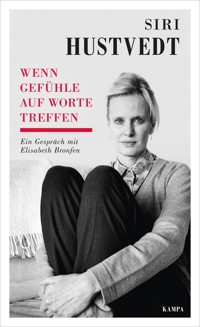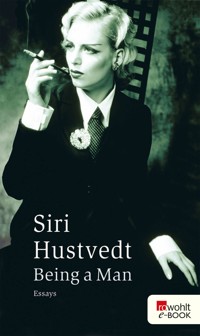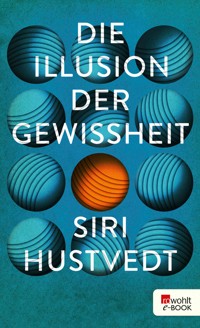14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Siri Hustvedts Themen in dieser neuen, sehr persönlichen Sammlung von erstaunlichen Essays reichen von der Natur von Erinnerung und Zeit bis zu dem, was wir von unseren Eltern erben, und sie erweitern ihre bekannten Forschungsgebiete: Feminismus, Psychoanalyse, Neurowissenschaften, die Kunst, das Denken und das Schreiben. An lebendig erzählten Beispielen aus ihrer privaten Familiengeschichte und Lebenserfahrung zeigt Hustvedt, wie porös die Grenzen zwischen uns und den anderen, zwischen Kunst und Betrachter, zwischen dem Ich und der Welt sind. Und so privat diese abwechslungsreiche Reise durch die unterschiedlichsten Themenfelder erscheint, so universell ist sie letztlich – ein vorläufiges Fazit von Siri Hustvedts lebenslanger Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir funktionieren und was uns als Menschen zusammenhält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Siri Hustvedt
Mütter, Väter und Täter
Essays
Über dieses Buch
Siri Hustvedts Themen in dieser neuen, sehr persönlichen Sammlung von erstaunlichen Essays reichen von der Natur von Erinnerung und Zeit bis zu dem, was wir von unseren Eltern erben, und sie erweitern ihre bekannten Forschungsgebiete: Feminismus, Psychoanalyse, Neurowissenschaften, die Kunst, das Denken und das Schreiben. An lebendig erzählten Beispielen aus ihrer privaten Familiengeschichte und Lebenserfahrung zeigt Hustvedt, wie porös die Grenzen zwischen uns und den anderen, zwischen Kunst und Betrachter, zwischen dem Ich und der Welt sind. Und so privat diese abwechslungsreiche Reise durch die unterschiedlichsten Themenfelder erscheint, so universell ist sie letztlich – ein vorläufiges Fazit von Siri Hustvedts lebenslanger Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir funktionieren und was uns als Menschen zusammenhält.
Vita
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sieben Romane publiziert. Mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Die gleißende Welt» und «Damals». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Nicht hier, nicht dort», «Leben, Denken, Schauen», «Being a Man», «Die Illusion der Gewissheit» und «Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen» vor.
Grete Osterwald, geboren 1947, lebt als freie Übersetzerin aus dem Englischen und Französischen in Frankfurt am Main. Sie wurde mehrfach mit Übersetzerpreisen ausgezeichnet, zuletzt 2017 mit dem Jane Scatcherd-Preis. Zu den von ihr übersetzten Autoren zählen Siri Hustvedt, Alfred Jarry, Anka Muhlstein, Jacques Chessex sowie Nicole Krauss, Jeffrey Eugenides und Elliot Perlman.
Uli Aumüller übersetzt u.a. Siri Hustvedt, Jeffrey Eugenides, Jean-Paul Sartre, Albert Camus und Milan Kundera. Für ihre Übersetzungen erhielt sie den Paul-Celan-Preis und den Jane Scatcherd-Preis.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel «Mothers, Fathers, and Others» bei Simon & Schuster, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Mothers, Fathers, and Others» Copyright © 2021 by Siri Hustvedt
Die Arbeit an der Übersetzung der vorliegenden Essays wurde durch ein großzügiges Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Scott Laumann/Theispot
ISBN 978-3-644-01178-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Tillie
Meine Großmutter väterlicherseits war grantig, dick und furchterregend. Sie hatte ein gackerndes Lachen, brütete aus nur ihr bekannten Gründen vor sich hin, blaffte ihre mitunter bedenklichen Meinungen heraus und sprach einen für mich unverständlichen norwegischen Dialekt. Obwohl in den Vereinigten Staaten geboren, lernte sie nie das englische «th» und nahm stattdessen mit einem einfachen «t» vorlieb, weswegen sie von «tings», «tunderstorms» und «Tanksgiving» sprach. In meiner Kindheit war ihr Haar voll und weiß, und lose hing es ihr fast bis zur Taille. Bevor ich sie kannte, war es kastanienbraun gewesen. Mit den Jahren wurde es dünner, aber ich erinnere mich an meine Ehrfurcht, wenn ich es offen sah. Das geschah nur abends, wenn sie vor dem trüben Spiegel in dem winzigen, muffigen, schimmeligen Schlafzimmer der Farm, auf der sie mit meinem Großvater wohnte, ihren Knoten gelöst hatte. Er hatte sein eigenes, noch kleineres Zimmer oben unterm Dach, gleich neben der schmalen Treppe, in einem Stockwerk, das wir selten betreten durften. Sobald das Haar herabhing und sie ihr Nachthemd anhatte, nahm meine Großmutter ihre Zähne heraus und legte sie in ein Glas am Bett, eine Handlung, die meine Schwester Liv und mich faszinierte, weil wir keine Körperteile hatten, die nachts herausgenommen und morgens wieder eingesetzt werden konnten.
Die entnehmbaren Zähne waren jedoch nur ein Teil eines ganz und gar fabelhaften, wenn auch manchmal einschüchternden Wesens. Unsere Großmutter schälte Kartoffeln mit einem Schälmesser in, wie mir schien, Lichtgeschwindigkeit, schleppte Scheite von dem Holzstoß am Haus heran und riss mit einem einzigen Ruck, stark wie ein Mann, die schwere Tür des Rübenkellers hoch, ehe sie uns in den kalten, feuchten Raum hinunterführte, wo Eingemachtes in Gläsern auf Regalen vor Erdwänden stand. Es war ein Ort, der nach Grab roch, ein Gedanke, der mir damals gekommen sein mag oder auch nicht, aber der Ausflug war immer mit einem Hauch von Bedrohlichkeit verbunden – von der Fantasie, ich würde bei den Einmachgläsern und den Schlangen und Gespenstern in der Finsternis zurückgelassen.
Sie war die einzige Erwachsene, die wir kannten, die gern Kacka-Witze erzählte. Bei unseren Aa-Späßen bog sie sich vor Lachen, als wäre sie selbst ein Kind, und wenn sie guter Laune war, erzählte sie uns Geschichten aus der lang vergangenen Zeit ihrer eigenen Kindheit, wie sie Überschlag und Radschlagen und auf einem Drahtseil balancieren gelernt hatte und wie sie und ihr Bruder Segel auf ihren Schlitten anbrachten und pfeilschnell über den zugefrorenen See in der Nähe der Farm, wo sie aufwuchs, getrieben wurden. Bevor wir «zu Besuch» gingen – Worte, die anzeigten, dass wir gleich in den alten Ford steigen und verschiedene Nachbarn aufsuchen würden –, setzte Großmutter ihren Strohhut mit den Blumen auf, der an einem Haken innen an der Haustür hing, griff sich ihre schwarze Handtasche mit dem goldenen Verschluss, in der ihre kleine Münzgeldbörse steckte, und los ging’s.
Meine Großmutter starb mit achtundneunzig. Eine Zeit lang war sie ein Geist in meinem Leben, doch seit Kurzem ist sie als Bild vor meinem geistigen Auge zurückgekehrt. Ich sehe Matilda Underdahl Hustvedt mit zwei schweren Eimern Wasser auf mich zukommen. Hinter ihr ist die rostige Handpumpe, die heute noch auf dem Hof steht, und hinter der Pumpe sind die Steine, die einst das Fundament der alten, lange vor meiner Geburt abgerissenen Scheune waren. Es ist Sommer. Ich sehe den vorne geknöpften Hauskittel meiner Großmutter. Ich sehe ihre Hängebrüste, ihren mächtigen Körper und die dicken Beine. Ich sehe das lockere Fleisch unter ihren Armen wabbeln, während sie mit den emaillierten Eimern an gestreckten Armen geht, und ich sehe ihre rot geränderten durchdringenden Augen hinter den Brillengläsern. Ich spüre die Sonne und den heißen Wind, der über das wogende Tiefland des ländlichen Minnesota weht. Ich sehe einen unermesslichen Himmel und den von Feldgehölzen unterbrochenen weiten, leeren Horizont. Das Erinnerungsbild wird von einer Mischung aus Zufriedenheit und Schmerz begleitet.
Tillie, ihre Freunde nannten sie Tillie, wurde 1887 als Tochter eines eingewanderten Vaters, Søren Hansen Underdahl, und Sørens zweiter Frau Øystina Monsdattar Stondal geboren, die wohl auch Immigrantin war, doch mein Vater erwähnt dies nicht in der Familiengeschichte, die er für uns schrieb, daher kann ich nichts darüber berichten. Jedenfalls war Øystinas Vater wohlhabend und hinterließ jeder seiner drei Töchter einen Hof. Tillie wuchs auf dem Besitztum ihrer Mutter im Ottertail County, Minnesota, auf, in der Nähe der Stadt Dalton. Als Tillie acht war, starb ihre Mutter. Eine Geschichte, die meine Großmutter uns über die achtjährige Tillie erzählte, die die Schwester meines Vaters, Tante Erna, uns erzählte und die auch meine Mutter uns erzählte, erlangte den Status einer Familienlegende. Nach Øystinas Tod suchte der Pastor des Ortes die Familie auf, um zu tun, was lutherische Pastoren so an den Leichnamen Verstorbener taten. Bevor er das Anwesen verließ, verkündete er allen Anwesenden salbungsvoll, der vorzeitige Tod der Frau sei der «Wille Gottes» gewesen. Darauf stampfte meine Großmutter, lange bevor sie meine Großmutter war, zornig mit dem Fuß auf und schrie: «Ist es nicht! Ist es nicht!» Und sie war froh, dass sie es getan hatte, und wir auch.
Tillie besuchte nie «die alte Heimat». Sie sah nie das erste Heim ihres Vaters, Undredal in Sogn, mit seiner winzigen Kirche ganz nah an der steilen Klippe des Berges, der sich direkt aus dem Fjord erhebt. Soweit ich es mitbekommen habe, hat sie nie einen derartigen Wunsch zu erkennen gegeben. Sie war selten sentimental. Ihr Mann, mein Großvater Lars Hustvedt, reiste zum ersten Mal mit siebzig nach Norwegen. Er erbte etwas Geld von einem Verwandten und kaufte sich davon ein Flugticket. Er fuhr nach Voss, wo sein Vater geboren war, und wurde herzlich von Verwandten umarmt, die er noch nie gesehen hatte. Laut der Familienüberlieferung kannte er «jeden einzelnen Stein» in Hustveit, dem Hof der Familie. Der Vater meines Großvaters muss heimwehkrank gewesen sein, und durch dieses Heimweh und die Geschichten, die sich darum rankten, muss sein Sohn sich nach einer Heimat gesehnt haben, die keine war, sondern eher eine Idee von Heimat. Wir übernehmen die Gefühle anderer, besonders die Gefühle geliebter anderer, und bilden uns ein, dass das, was wir nie gesehen oder berührt haben, durch eine Fantasieverbindung auch zu uns gehört.
Mein Vater machte diese Fantasieverbindung zu seinem Leben. Nachdem er im Zweiten Weltkrieg in Neuguinea und auf den Philippinen gekämpft und kurze Zeit in der Besatzungsarmee in Japan gedient hatte, kehrte er nach Hause zurück, studierte mithilfe des G. I. Bill an der University of Wisconsin in Madison Skandinavistik und promovierte in dem Fach. Er lehrte am St. Olaf College in Northfield, Minnesota, Norwegisch und norwegische Literatur und war Schriftführer der Norwegian-American Historical Association, deren umfangreiches Archiv mit Einwandererdokumenten er ordnete und kommentierte, ein Posten, für den er nie bezahlt wurde.
In dem Text Die Familie Hustvedt, den er uns hinterließ, finden sich nur spärliche Informationen über die Familie seiner Mutter, mit Ausnahme dessen, was ich über Øystinas Erbe berichtet habe. Die bewusste Identität meines Vaters war von der väterlichen Linie geprägt, und er fand, so viel er konnte, über die Männer aus Voss heraus, die vor ihm kamen, seinen Großvater, Urgroßvater und Ururgroßvater. Ich glaube nicht, dass es ihm in den Sinn kam, sich in die mütterliche Linie zu vertiefen. Womöglich hat Tillie keinerlei Dokumente oder Briefe ihrer Eltern aufbewahrt. Sie konnte lesen und schreiben, besuchte aber nur zwei Jahre die Schule. Die Briefe an ihren Sohn, als er Soldat war, sind flüssig, aber mitunter fehlerhaft.
Erst als Erwachsene war ich imstande, über das Problem der Auslassung nachzudenken – eher darüber, was fehlt, als darüber, was da ist – und allmählich zu verstehen, dass das Ungesagte ebenso laut spricht wie das Gesagte.
Zumindest ging meine Großmutter meinem Vater auf die Nerven. Er reagierte gereizt, wenn sie etwas Unbedarftes über den Zustand der Welt äußerte oder bei Tisch stumm und finster dasaß. Er schimpfte selten, aber an seinem Gesicht ließ sich ablesen, wie unglücklich er war, und ich spürte die Konflikte zwischen Mutter und Sohn als tiefe Kratzer irgendwo in meiner Brust, die manchmal unerträglich wurden, und dann bat ich um Entschuldigung und floh vor den zumeist unausgesprochenen Familienreibereien in den Garten, wo ich zusehen konnte, wie die noch grünen Fuchsrebentrauben in der Laube langsam blau wurden, und mich darauf konzentrierte, in die süßen weißen Enden von Grashalmen zu beißen. Schon damals wusste ich, dass sich hinter der Gereiztheit meines Vaters Geschichten verbargen, die ich spüren konnte, aber nie hören würde.
Grandpa war eine sanftere Seele als Grandma. Eineinhalb der zweieinhalb Hektar Ackerland gingen in der Weltwirtschaftskrise an die Bank verloren, und diese Erzählung erklärte ihre große Armut. Sie haben wohl mit Sozialhilfe überlebt. Ich weiß es nicht genau. Das Gehalt meines Vaters war gering, und wir lebten jahrelang von der Hand in den Mund, sodass die Unterstützung, die er ihnen gegeben haben mag, nicht erheblich gewesen sein kann. Mein Großvater hatte schon lange, bevor ich ihn kannte, nicht mehr von der Landwirtschaft leben können.
Ich erinnere mich nicht, meine Großeltern jemals im Gespräch oder einander berührend gesehen zu haben. Wir haben jedoch Fotos von ihnen, auf denen sie nebeneinandersitzen.
Grandpa war ein in sich gekehrter, schweigsamer Mann, der gründlich Zeitung las, die Politik genau verfolgte, der endlos lange in einem Sessel in dem vollgestellten Wohnzimmer saß, Tabak kaute und in eine Folgers-Kaffeedose zu seinen Füßen spuckte. Er lächelte wohlwollend über unsere Zeichnungen und schenkte uns gestreifte Bonbons aus einem Gefäß, das er in der Küche aufbewahrte. Nach Lars’ Tod sagte mir mein Vater, dass «mehr als die Hälfte» seiner Liebe für «den Ort» – womit er die Farm meinte – vergangen sei. Ich war achtzehn und sann über diese dunkle Erklärung nach, die ich schließlich so verstand, dass er seinen Vater mehr geliebt hatte, als er seine Mutter liebte.
Als Tillie im Sterben lag, verbrachte meine Mutter einige Zeit mit ihr allein. Tillie packte die Hand meiner Mutter und jammerte: «Ich hätte netter zu Lars sein sollen. Ich hätte netter zu Lars sein sollen.»
Nach dem Tod seiner Mutter schrieb mein Vater eine Grabrede, in der er sie «die letzte Pionierin» nannte. Mein Vater verfasste ausgezeichnete Reden. Er schrieb gut und mit Witz. Aber es ist etwas Unbeteiligtes an der Trauerrede, als betrachtete er seine Kindheit aus einer großen Entfernung, und es fehlt seine Verbindung zu der Frau, die ihn ausgetragen, gestillt und versorgt hat. Wo war sie geblieben? Schwand sie mit der Verbitterung über die Ehe seiner Eltern? Gibt es noch ein anderes Element, ein weitaus dunkleres und schwer zu bestimmendes? Verschwand, was er ihr schuldete, in dem vergessenen Land der Mutter und der Mütter, dem sprachlosen Reich des Mutterleibs, in dem jeder Mensch beginnt und aus dem jeder geboren wird, einem Bereich, den die westliche Kultur in einem Maße sorgsam verdrängt, ausgeblendet oder gemieden hat, das ich inzwischen als spektakulär betrachte? Die Auslassung von Tillies Seite der Familie erschien meinem Vater «natürlich», weil wir Zeit in der Welt meiner Kindheit nicht durch Mütter, sondern nur durch Väter erzählten. Der Vatername markiert eine Generation und dann die nächste. Ich vermute jetzt, dass Die Familie Hustvedt teilweise der Rehabilitation jener Patriarchen diente, die von der Geschichte zerdrückt worden waren, einer Geschichte, in der enthalten war, was mein Vater als Junge mitbekommen hatte – die demütigenden Verluste seines Vaters, die der Sohn durch intensive Identifikation als seine eigenen verinnerlichte.
Meine Großmutter erlitt auch Verluste. Sie erbte von ihrem Vater Geld, brachte es zur Bank und sparte es. Ich weiß nicht, wie viel es war, aber es war ihr Geld. Jahre später, nachdem der Bruder meines Großvaters, David, bei einem Arbeitsunfall an der Westküste beide Beine verlor, gab sie das Geld her, um ihm Beinprothesen zu bezahlen. Das Geld wurde geschickt, aber der Bruder verschwand. David Hustvedt starb viele Jahre später in Minneapolis, wo er auf der Straße Bleistifte verkaufte. Er schaffte es, sich fortzubewegen, indem er die Knie in ein Paar Schuhe steckte. Auf der Straße war er als «Dave, der Bleistiftmann» bekannt. Ich habe diese Geschichte in einem Roman, Die Leiden eines Amerikaners, verwendet.
Meine Eltern sind tot. Während ich dies schreibe, ist meine Mutter erst seit drei Monaten tot. Sie starb am 12. Oktober 2019, im Alter von sechsundneunzig Jahren. Mein Vater starb am 2. Februar 2004. Am 19. Februar 2020 werde ich fünfundsechzig, am selben Tag, an dem meine Mutter siebenundneunzig geworden wäre, wenn sie noch lebte. Keiner von ihnen ist jung gestorben, und selbst wenn ich bald sterbe, heute oder morgen, werde auch ich nicht jung sterben.
Meine Eltern lernten sich 1950 oder 51 an der Universität Oslo kennen. Meine Mutter studierte dort, und mein Vater hatte ein Fulbright-Stipendium. Meine Mutter wurde in Mandal geboren und zog mit zehn Jahren nach Askim, einer Stadt bei Oslo. Ziemlich dumm, brauchte ich eine Weile, bis mir klar wurde, dass meine Eltern beide die Blüte ihrer Jugend im Krieg oder unter der Besatzung verbrachten. Mein Vater war neunzehn, als er eingezogen wurde. Meine Mutter war siebzehn, als die Nazis am 9. April 1940 Norwegen überfielen.
Wenige Jahre nachdem sie den Enkel norwegischer Immigranten kennengelernt hatte, wurde meine Mutter selbst eine norwegische Immigrantin, war auf einmal verheiratet und lebte in Minnesota.
Sie wusste nicht, dass die Eltern des gut aussehenden Amerikaners, den sie im American Club in Oslo kennengelernt hatte, auf einer Farm ohne fließend Wasser lebten, dass sie keinen Strom hatten, bis mein Vater nach dem Krieg Leitungen verlegte, und dass keiner von beiden die Grundschule und noch weniger die Highschool abgeschlossen hatte. Sie wusste nicht, dass zwei Holzöfen alles waren, was sie in den frostigen Wintern Minnesotas zum Heizen hatten. Das alles verschwieg mein Vater ihr. Er ließ sie es selbst entdecken. Die Gründe für diese Geheimhaltung hat er mit ins Grab genommen.
Als Kinder hielten meine Schwester und ich unsere Großeltern nicht für arm. Nicht, dass wir nicht gewusst hätten, was das Wort bedeutet, vielmehr glaubten wir nicht, es könnte ein Wort sein, das auf Mitglieder unserer eigenen Familie zutraf. Arm beschwor Märchen herauf, einen Mann und eine Frau mit drei Töchtern oder drei Söhnen, die in einer Hütte im Wald oder weit entfernten städtischen Elendsvierteln wohnten, die für uns nur in dramatischen Grautönen im Fernsehen sichtbar wurden. Anscheinend kamen meine Großeltern ganz gut zurecht, als mein Vater, das älteste von vier Geschwistern, und seine Schwester Erna, das zweite Kind, noch klein waren, aber als die Weltwirtschaftskrise zuschlug, wurde das heikle Gleichgewicht des Haushalts erschüttert und brach dann zusammen. Die Menschen lebten weiter, aber die Farm, an die ich mich erinnere, schien etwa 1937 in der Zeit stehengeblieben zu sein. Lähmung bestimmte den Ort.
Bei unseren Besuchen im Sommer konnten wir vier Schwestern und unsere Cousinen und Cousins uns dort austoben. Es war unser Wunderland. Wir kletterten auf den Fahrersitz des Traktors, der im hohen Gras neben dem Obstgarten mit Apfel- und Birnbäumen verrostete. Und wir hockten vergnügt oben auf einem liegen gebliebenen alten Autowrack. Wir mochten die am Haus aufgereihten Regenfässer und die geheimnisvollen Haufen von Gerümpel in der kleinen weißen Garage, einschließlich eines ausrangierten Kühlschranks, dessen Anblick mir Angst machte, weil ich die Geschichte eines Jungen gehört hatte, der sich in einem eingeschlossen hatte und gestorben war. Ich mochte die Schüssel, die als Spülbecken diente, und die graue Lavaseife mit Grus darin, speziell für Farmer und Handwerker. Ich mochte den Napf und die Kelle mit dem langen Stiel zum Wassertrinken. Ich erinnere mich, dass ich mit Seitenstechen, Grasflecken auf Knien und Handflächen, Schnitten und Insektenstichen für ein Pflaster ins Haus lief, an Limonade und wilde Spiele wie Räuber und Gendarm, Schiffbruch, Tornados, Entführungen und Piraten.
Als meine Mutter Tillie im Juli vor der im August geplanten Hochzeit meiner Eltern gestand, dass sie mit mir schwanger war, pustete meine Großmutter Luft zwischen den Lippen hervor, machte «pfff» und wischte das Thema vom Tisch. Es hatte keine Bedeutung. «Grandma war das ganz egal», sagte mir meine Mutter viele Jahre später, als wir eines Abends lange auf waren und redeten.
Es gibt eine Geschichte, die zu schreiben mein Vater nicht über sich brachte, nicht in die Familiengeschichte oder das Memoir über sein Leben aufnahm, die ich aber irgendwann hörte, nicht von ihm, sondern von seiner Schwester oder einem seiner Brüder, eine Geschichte, die anschließend von meiner Mutter bestätigt wurde. Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise inspizierte ein Kontrolleur der Regierung die Farm, erklärte, die Milchkühe hätten Maul- und Klauenseuche, und ordnete an, sie zu töten. Nachdem das Schreckliche getan worden war, kam heraus – ich weiß nicht, wie –, dass die Kühe nicht krank gewesen waren. Der Kontrolleur hatte sich geirrt. Es gab keine Entschädigung.
Ich habe das Bild dieses Gemetzels jahrelang im Kopf gehabt, eines Gemetzels, das ich nie gesehen hatte.
Ich glaube, mein Vater hasste den Ort ebenso sehr, wie er ihn liebte.
Die Landschaft ist unverändert. Das Ackerland, jetzt unter der Leitung riesiger Farmen oder «Agrarunternehmen», erstreckt sich noch immer über Meilen und Meilen. Das Farmhaus auf dem verbliebenen einen Hektar steht da als leeres Denkmal der Familienerinnerung, unweit der Urland Church, wo die Asche meines Vaters in einem Urnengrab am Rand eines unmittelbar an den Friedhof angrenzenden Waldes ruht. Daneben, in einer anderen Urne, ist die Hälfte der Asche meiner Mutter. Die andere Hälfte dessen, was einmal meine Mutter war, werden die vier Töchter diesen Sommer nach Norwegen bringen, nach Mandal, wo sie geboren wurde. Nahebei liegen meine Großeltern Lars und Matilda, mein Onkel Morris, mein Onkel Mac McGuire, ein irischer Polizist, der Tante Erna heiratete, mit nur zweiundfünfzig Jahren starb und nach dem Tod zwischen den Norwegern landete. Das Land sieht noch genauso aus, aber die Einwanderer und ihre Norwegisch sprechenden Kinder sind tot. Die aus der Generation meines Vaters, der dritten, der letzten, die noch die Sprache sprach, sind jetzt fast alle tot. Meine Generation, die nach ihnen kam, ist im weißen Amerika verschwunden. Für viele ist die Verbindung zu ihrer Immigrantenvergangenheit bestenfalls schwach, auf einige Andenken beschränkt – einen fest gestrickten Norwegerpulli oder einen Teller Lefse, das weiche Kartoffelbrot ohne Hefe, die Spezialität meiner Großmutter. Am besten schmeckt es mit Butter bestrichen, darüber Zucker gestreut, dann zusammengerollt und schnell oder langsam gegessen, je nach Neigung.
Im Sommer glühend heiß, im Winter von Schneestürmen und Temperaturen weit unter null geplagt, ist das Klima in Minnesota extrem. Das Leben in der Prärie war ein regelmäßig wiederkehrender Kampf, das Wetter zu überleben. Mein Vater erinnerte sich an Dürren, Heuschrecken und lange vom Schnee unpassierbar gemachte Straßen. Wenn keine Autos fahren konnten, nahmen sie den Pferdeschlitten, eine Erinnerung, die ein freudiges Lächeln auf dem Gesicht meines Vaters hervorrief. Tillie hatte Angst vor vereisten Straßen und rührte sich lieber nicht weg, wenn der bedrohliche Eisregen fiel und im Radio oder im Fernsehen davor gewarnt wurde. Ich erinnere mich an ihre brüchige, ängstliche Stimme, die aus dem Telefon kam, wenn sie mit meinem Vater sprach. Unter solchen Bedingungen würde sie die halbstündige Fahrt nach Northfield nicht unternehmen. Tillie erinnerte sich wohl an irgendein erschreckendes Erlebnis mit glatten Straßen, aber ich weiß nicht, was es war.
Wir alle sind mehr oder weniger aus dem gemacht, was wir «Erinnerung» nennen: nicht nur die für uns in Bildern sichtbaren kleinen Stücke Zeit, die sich mit unseren wiederholt erzählten Geschichten verhärtet haben, sondern auch die Erinnerungen, die wir verkörpern und nicht verstehen – der Geruch, der etwas Verlorenes mit sich bringt, oder die Geste oder Berührung eines Menschen, die uns an jemand anderen erinnert, oder ein Ton, nah oder fern, in dem ein unbekannter Schrecken mitschwingt. Und dann gibt es die Erinnerungen anderer, die wir übernehmen, bei unseren eigenen einsortieren und manchmal mit diesen verwechseln. Und dann gibt es noch Erinnerungen, die sich verändern, weil die Perspektive in eine andere Richtung verdreht wurde – meine Großmutter ist in einer anderen Erscheinung zu mir zurückgekehrt: neu erinnert und umgestaltet.
Als mein Großvater Ivar Hustvedt 1868 nach Minnesota kam, hatten die Dakota-Indianer 1851 im Treaty of Traverse des Sioux der US-Regierung 97000 km2 Land abgetreten, wodurch sie, ein Nomadenvolk, in ein schmales Reservat entlang des Minnesota River abgedrängt wurden. 1853 wurde das Land für die Besiedlung geöffnet, und die Norweger begannen einzutreffen. 1862, während des Bürgerkriegs, übten einige durch Vertragsbrüche verratene, dem Verhungern nahe Dakota an den Siedlerfamilien Vergeltung, woraufhin es in ganz Minnesota zu schweren Kämpfen kam. Dakota, Einwanderer und amerikanische Soldaten starben. Meine Großeltern müssen Geschichten gehört haben, Geschichten darüber, was geschah, bevor ihre Eltern ankamen, Geschichten über die Indianerkriege und den Bürgerkrieg, in dem ein Regiment Norweger unter der Führung des eisernen Abolitionisten Colonel Hans Christian Heg für die Union kämpfte. Sie wurden eingezogen, sobald sie den Boden von Minnesota betraten. Die Männer sprachen kein Englisch. Sie führten das Kriegsgeschäft auf Norwegisch.
In der Antwort auf einen Brief seines Bruders Torkel, in dem dieser von seinen Auswanderungsplänen geschrieben hatte, riet Ivar ihm, nicht zu kommen.
Jene, die aus Norwegen auswanderten, schließlich und endlich ein Viertel der Bevölkerung des Landes, jene, die in großen Wellen während des 19. Jahrhunderts und bis ins 20. Jahrhundert kamen, waren keine vermögenden Menschen. Viele waren Bauern ohne Hof – zweit-, dritt- und viertgeborene Söhne, für die kein Erbe vorgesehen war. Auf der Suche nach Arbeit gingen sie in die Städte, aber Arbeit war nicht immer zu haben, und in Amerika gab es Land. Die Männer kamen allein oder brachten ihre Frauen mit. Manche dieser Menschen wurden gut mit dem Leben in der Prärie fertig, der Einwanderertyp floss in den amerikanischen Mythos von den tapferen Pionieren ein, die den «jungfräulichen» Boden «zähmten». Aber viele andere kehrten nach Hause zurück. Einige wurden verrückt. 1932 führte Ørnulf Ødegård eine breite psychiatrische Studie durch, die belegte, dass in Minnesota die Zahl der wegen psychotischer Störungen behandelten norwegischen Einwanderer signifikant höher war als bei Norwegern, die in ihrem Land geblieben waren, wie auch bei gebürtigen Amerikanern norwegischer Herkunft. Ødegård spekulierte, die Differenz sei den schwierigen Gegebenheiten geschuldet, als Fremder in einem fremden Land zu leben.
Natürlich ist das die erweiterte, langfristige Sicht der Dinge, eine Sicht, die meine Großmutter wohl nie eingenommen hat, als sie darum kämpfte, ihre Kinder mit Essen und Kleidung zu versorgen, nachdem ihr Mann als Tagelöhner auf benachbarten Farmen arbeiten ging und später, im Krieg, das Land durchquert hatte, um in einer Waffenfabrik im Staat Washington zu arbeiten. Vater und Sohn begegneten sich dort. Mein Vater war einer Geheimdiensteinheit zugeteilt worden, die in Oregon als Teil eines vorläufigen Plans der Alliierten eine Invasion in Norwegen trainierte. Seine Qualifikationen: Er hatte bei einem Test einen hohen IQ bewiesen und sprach Norwegisch. In seinem Memoir erinnert sich mein Vater, dass sein Vater, als er ihn traf, seinen Ehering trug und dass er glücklich darüber war. Nirgendwo sonst in dem Memoir wird Verbitterung oder Entfremdung zwischen den Eltern beschrieben. Es gibt keine weitere Erwähnung von getragenen oder nicht getragenen Eheringen oder vom Schmerz über einen nackten Finger im Gegensatz zu einem mit dem Zeichen für den Ehepakt.
Meine Großmutter sagte oft, sie hätte Lars nicht heiraten sollen. Wir alle hörten es. Wir alle fanden es schrecklich, so etwas zu sagen.
Ich weiß nicht, wann mein Großvater den Mut verlor und in sich selbst verschwand. Ich weiß, dass er Albträume hatte, oft schreiend aufwachte und einmal gegen die Decke des kleinen Zimmers schlug, in dem er schlief. Ich erinnere mich nicht daran, woher ich das weiß, doch Geheimnisse wanderten in der Familie weiter, emotionsgeladene Geheimnisse. Ich hatte das Gefühl, dass sie wie Steine in Geheimtaschen im Mantel eines großen Mannes waren, und diesen Mantel zu tragen, bedeutete, von Scham niedergedrückt zu sein. Bildeten die Erwachsenen sich ein, wir Kinder spürten das nicht? Ist es möglich, dass ich es stärker spürte als meine Schwestern und Cousinen und Cousins? Ich habe das Bild von einer Stimmgabel schon anderswo verwendet, aber so erinnere ich mich an mein kindliches Selbst, als einen Resonanzboden, nicht für Töne, sondern für Gefühle in den verschiedenen Räumen, in denen ich mit Erwachsenen und ihren wirren Regungen von Liebe und Hass zusammen war, die sich mit meinen eigenen und dem sehnlichen Wunsch vermischten, von ihrer bedrückenden Gesamtheit frei zu sein. Doch dieser Wunsch war für mich ebenso unaussprechbar wie für meinen Vater. Ich habe das große Glück, jetzt darüber schreiben zu können.
Die Rolle von Skandinaviern im Allgemeinen und von Norwegern im Besonderen ist oft die von stoischen, verklemmten Menschen, die ihre Qualen eher hinter den Kulissen als auf der Bühne ausleben. Henrik Ibsen stellte Geheimnisse und Geister, die Angst und die Scham, die sie in davon Besessenen erzeugten, vor Theaterpublikum offen zur Schau. Mein Vater lehrte Ibsens Stücke. Es war sein Lieblingskurs. Als er starb, fragte er mich, was ich von Rosmersholm hielte, und ich wünschte, ich hätte mich besser an das Stück erinnert. Nach seinem Tod habe ich es noch einmal gelesen. Es ist dicht und tief und verklumpt mit – ausgesprochenen und unausgesprochenen – sexualpolitischen Ängsten und Hoffnungen. Im Mittelpunkt des Stücks steht Rebecca West, eine Figur von zielstrebigem Ehrgeiz, enormer psychologischer Komplexität und moralischer Ambiguität. Sie ist schuld, Beate, die Frau von Rosmers, dem Mann, den sie liebt, in den Selbstmord getrieben zu haben. Sie ist auch ein Geschöpf von hochfliegendem Idealismus, stiller Wut und einer strategischen Intelligenz. Ibsen drang mit grimmiger Klarheit in die unmögliche Lage von Frauen in der Väterwelt ein. «Du warst die Stärkste in Rosmersholm, wahrhaftig», sagt Rosmers zu Rebecca. «Stärker als Beate und ich zusammengenommen.»
Mein Großvater hatte nicht die Stärke meiner Großmutter. Er hatte nicht ihre Chuzpe – um ein Wort aus einer anderen Immigrantenkultur zu stehlen, in die ich eingeheiratet habe, die Kultur der osteuropäischen Juden, die im 19. Jahrhundert ebenfalls in großer Zahl kamen. Tillie machte und verkaufte Lefse, um sich der Verzweiflung zu erwehren. Es gab ein Gerücht, sie habe einmal etwas aus einem Laden mitgenommen – sie habe gestohlen. Meine Mutter erzählte mir das mit leiser Stimme. Einzelheiten fehlen. Vielleicht hat Tillie gestohlen. Sie kam nicht ins Gefängnis. Ich bin nicht schockiert.
Die Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte, habe ich von meiner Mutter, aber sie gehört zu Grandma. Eines Sommers besuchten meine Cousins und Cousinen, die in Seattle wohnten, ihre Familie im Mittleren Westen. Onkel Stanley war der einzige Hustvedt-Nachkomme, der weit weggezogen war. Er und seine Frau Pat waren strenge Eltern. Ihre vielen Sanktionen und Strafandrohungen richteten sich nur gegen ihre eigenen vier Kinder, aber wenn ich in Hörweite der autoritären Anweisungen war, fühlte ich, wie sich in nachempfundenem Alarm meine Innereien verkrampften und mein Herz schneller schlug. Sie lebten in einer Welt und wir in einer anderen, und es war seltsam, wenn die beiden Welten auf der Farm zusammenprallten. Ich wusste, dass meinen nachgiebigen Eltern das andersartige Regiment nicht gefiel, aber sie tolerierten das wesensfremde Treiben schweigend. Von den Erwachsenen tat nur Grandma ihre Missbilligung kund. Sie zuckte zusammen, murrte, schüttelte den Kopf und gackerte, wenn ihr Sohn und ihre Schwiegertochter Befehle erteilten. Daran erinnere ich mich.
Woran ich mich nicht erinnere, weil ich nicht dabei war, ist, dass Stanley und Pat ihre Kinder ein paar Tage bei Grandma und Grandpa ließen, um allein irgendwo hinzufahren. Grandpa ist nicht an der Geschichte beteiligt, aber wo er auch war, man kann sich schwer vorstellen, dass er wild darauf gewesen wäre, sich irgendwie in die Pläne seiner Frau einzumischen. Grandma erzählte meiner Mutter, dass sie und die Kinder zuschauten, wie das Auto mit den Eltern abfuhr, an der Urland-Kirche vorbei, und hinter dem kleinen Hügel verschwand. Dann wandte sie sich ihren Schutzbefohlenen auf Zeit zu, nickte und sagte: «Okay, jetzt tobt euch aus.» Sie richteten sich danach. Sie brüllten, johlten, wälzten sich in der Einfahrt auf der Erde, warfen mit allem, was ihnen unterkam, rannten ins Haus und wieder hinaus, knallten Türen, traten gegen Bäume und Zäune und bespuckten sich gegenseitig in einer Orgie der Freiheit, während meine Großmutter sie, seelenruhig auf dem Rasen sitzend, mit klammheimlicher Freude beobachtete.
Wie leid ich die abgedroschenen Erzählungen über Großmütter bin, den Gegenstand von so viel Kulturgeschwafel, und nicht nur im Stil der Kitschpostkarten, obwohl es eine Menge davon gibt. «Eine Grandma ist herzliche Umarmungen und süße Erinnerungen», informiert uns die Lebenshilfe-Autorin Barbara Cage. Wie praktisch die Plattitüden und Geschichten über Grandmas Herzlichkeit, Güte, Aufopferung und ergreifendes Leiden waren, wieder und wieder erzählt, um spätere Generationen zu trösten und jede Gefahr, sie könnte ganz anders gewesen sein, zu entschärfen.
Tillie war eine schwierige Frau. Sie schluckte weder ihre Auflehnung hinunter, noch unterdrückte sie ihr sarkastisches Lachen oder ihre offene Fröhlichkeit. Und sie verbarg es nicht, wenn die Wut sie überkam.
In ihrem Buch Gefühle in der Geschichte von 2021 schreibt Ute Frevert: «Seit der Antike wurde Wut als Charakterzug der Mächtigen gesehen.» Ich habe Brett Kavanaugh, jetzt Richter am Supreme Court der Vereinigten Staaten, im Fernsehen beobachtet, wie er mit Tränen in den Augen gegen die Demütigung der ganzen Sache wütete. Wie konnte er, er, der Gesalbte des Gesetzes, von dieser Professorin Christine Blasey Ford eines sexuellen Übergriffs beschuldigt werden? Wut ist ein Privileg der Mächtigen, der weißen Männer in Amerika. Sie ist nicht für uns Übrige, die wir sie für uns behalten oder hinunterschlucken müssen. Die Frau muss bescheiden dasitzen, während sie, eifrig bemüht, bei der Befragung zu «helfen», mit weicher, ruhiger, damenhafter Stimme aussagt.
«Meine Wut hat Schmerz für mich bedeutet, aber ich verdanke ihr auch mein Überleben. Bevor ich sie aufgebe, müsste ich sicher sein, dass es auf dem Weg zur Erkenntnis einen mindestens ebenso machtvollen Ersatz für sie gibt», sagte Audre Lorde in ihrer Rede «Vom Nutzen der Wut: Wie Frauen auf Rassismus reagieren». Lordes Wut schärfte ihre Brillanz und setzte die Prosa ihrer Essays unter Strom. Sie wusste, gegen wen sie gerichtet war und warum, nicht zuletzt weiße Feministinnen, die die Augen vor unbequemen und hässlichen Wahrheiten verschlossen. Meine Großmutter hatte keine so erlesene Klarsicht, keinen so intellektuellen Scharfsinn, kein so philosophisches Eindringungsvermögen in ihr Los. Sie war eine weiße Frau, den verwirrenden Realitäten der Ehe, der daraus folgenden Armut und der Scham ausgesetzt, die damit einhergingen. Sie hatte die Wut. Sie half ihr zu überleben.
Ihr Geist ist, Eimer voll Wasser schleppend, zu mir zurückgekehrt, eine Frau, die mich zugleich erfreute und erschreckte, deren Bild, zumindest teilweise, durch die Ambivalenz meines Vaters gefiltert war, jene Mischung aus Liebe und Hass, über die er nie wirklich sprechen konnte. Es ist nichts Einfaches, Heroisches oder Reines an diesem Geist. Mir ist sehr wohl bewusst, dass vieles an ihr mir verborgen bleibt, vieles, was ich nie erfahren werde. Die Zeit hat Matilda Underdahl Hustvedt in der Vorstellung ihrer Enkelin verändert. Ich erinnere mich daran, wie sie immer wieder das Schweigen brach.
2020
Der Atlantik meiner Mutter und wie er meiner wurde
Bevor ich den Atlantik sah, gab es Geschichten über den Atlantik, die Geschichten meiner Mutter aus Mandal, einer Stadt an der Südspitze der Küste Norwegens, wo sie mit ihren drei Geschwistern und ihren Eltern auf einem kleinen Berg in einem Haus mit Blick über die flache Weite der Nordsee in einem Zustand beinahe paradiesischen Glücks lebte, wenn man ihr glauben kann (und ich habe ihr meistens geglaubt, obwohl ich zugestehe, dass Kindheitserinnerungen gewöhnlich in den rosa Farben der Freude oder den trostlosen Schattierungen des Elends eingefärbt sind und viel seltener in den veränderlichen Grautönen der Ambivalenz), sicher aber ist, dass der salzige Wind den Geruch von Fisch und Lake über den Sand und die Felsen und das Kopfsteinpflaster der Straßen blies, auf denen meine Mutter als Mädchen ging, rannte und kletterte, und dass die Geschichten, die sie als Frau erzählte, in meine und die Fantasie meiner drei Schwestern wehte, uns Bewohnerinnen von Northfield, Minnesota, die wir aus dem Fenster auf Mais- und Kleefelder blickten, auf durchhängende Stacheldrahtzäune, hinter denen Kühe weideten, die in der Sonne trocknende Fladen hinterließen, aber wir kannten keinen Atlantik, außer aus den Erzählungen unserer Mutter, und so entdeckten wir die kräftigenden Wirkungen des maritimen Lebens, ohne es erlebt zu haben.
Mein Urgroßvater war Kapitän und befehligte sein Schiff, die Mars, in die Südsee. Dieser unbestreitbar auf Tatsachen beruhende Satz versetzte mich als Kind in Träumereien. Die düstere Gestalt des norwegischen Patriarchen vermischte sich mit Captain Smollet in Die Schatzinsel und dem ehrgeizigen Nemo in dem Film, den ich, bevor ich zwölf war, mindestens sechs Mal gesehen hatte (dank der Samstag-Matinees für Kinder im Grand Movie Theater): 20000 Meilen unter dem Meer. Und dann war da Onkel Oskar, der ältere Bruder meines Großvaters, ein Erster Offizier, der nach Coconut Island vor der Küste Australiens fuhr, eine melanesische Prinzessin heiratete und mit dieser hochgeborenen Dame nach Norwegen zurückkehrte, doch er segelte auch nach Indien und brachte meiner Großmutter als Geschenk ein rotes Teeservice aus feinem dünnem Porzellan mit, das meine Mutter bis heute in einer Glasvitrine in ihrem Zimmer in dem Seniorenheim aufbewahrt, wo sie jetzt im landumschlossenen Minnesota lebt.
Aber meine Lieblingsgeschichten sind die persönlichen meiner Mutter von Ausflügen an den Strand während der langen Sommertage, wenn die Nacht nie wirklich Nacht ist, sondern eher eine Vertiefung des Blaus darüber, das bald einem heller werdenden Sonnenlicht weicht, und ich sehe Andora, die Tante meiner Mutter, in ihrem ausgeleierten wollenen Badekostüm vor mir, wie sie sich ins Wasser wirft, ein paar forsche Züge schwimmt, sich aufstellt und an Land watet, bevor sie den Strand betritt, jedoch ein Ritual vollführt, das meine Mutter vor ein Rätsel stellt: Andora beugt sich vor, schöpft eine Handvoll Wasser und besprüht damit die Vorderseite ihres übergroßen Badeanzugs, salbt zuerst ihre rechte und dann ihre linke Brust. Und ich sehe meine Großtante auch an einem anderen Tag, unterwegs zu dem Boot, das die Familie zu einer der kleinen Inseln vor der Küste bringen soll, als plötzlich das Gummiband ihrer Unterhose nachgibt und das Kleidungsstück ihre Beine hinunter auf ihre Fußgelenke rutscht, während meine peinlich berührte junge Mutter zuschaut, doch die gelassene Andora steigt aus der heruntergerutschten Pumphose, angelt das seidene Häufchen mit ihrer Schuhspitze, gibt ihm einen geschickten Kick, fängt es auf, steckt es in ihre Handtasche und geht weiter. Das sind die Wunder des Lebens am Meer.
2017
Steine und Asche
In dem Regal über meinem Schreibtisch bewahre ich einen Pass meines Vaters auf. Er starb am 2. Februar 2004. Er wurde eingeäschert und dann auf dem kleinen Friedhof der ländlichen Kirche in Minnesota, die er als Kind besuchte, beigesetzt. Es ist ein kurzer Weg von dort bis zu dem kleinen Farmhaus meiner Großeltern, das jetzt leer steht und dessen Anstrich graue Flecken zeigt. Der riesengroße Ahornbaum, die weinumrankte Laube, die Pfingstrosen und Fliederbüsche, die Birn- und Apfelbäume sind noch kräftig. Niemand pflegt sie mehr, doch die Büsche und Bäume blühen, und die Früchte kommen jedes Jahr wieder.
Wir besuchen das Grab. Wir pflanzen Blumen.
Was besuchen wir da?
Keine menschliche Kultur entsorgt ihre Toten ohne Zeremonie. Die Toten ohne Riten zurückzulassen, ist eine Schande. Anscheinend begruben sogar die Neandertaler ihre Toten.
Obwohl man lange dachte, Trauer sei ein ausschließlich menschliches Verhalten, legt die Forschung nahe, dass auch andere Säugetiere wie Elefanten und einige Vögel um ihre Mitgeschöpfe trauern, dass nicht nur wir von Generation zu Generation weitergegebene kulturelle Praktiken haben.
Die Vielfalt menschlicher Bräuche, die den Tod begleiten, ist verblüffend.
Die Wikinger bahrten den Leichnam in einem Langschiff auf, zündeten es an und stießen es aufs Meer hinaus.
Die Zulus verbrennen die Besitztümer des Toten, weil sie darin die Gegenwart des Geistes fürchten.
Der französische Anthropologe Pierre Clastres, der Die Chronik der Guayaki schrieb, einen Bericht über seine zwei Jahre bei einem abgeschieden lebenden Volk in Paraguay, erzählte, die Stammesmitglieder seien vage und nicht mitteilsam gewesen, wenn er sie zu ihren Totenritualen befragte. Einer sagte dies, ein anderer etwas anderes. Es ergab für ihn keinen Sinn. Kurz bevor Clastres den Stamm verließ, klärte eine alte Frau (der man nicht gesagt hatte, dass der Außenseiter nichts erfahren dürfe) ihn darüber auf, dass die Guayaki ihre Toten aßen. Das Verzehren der Leichen sollte die Verbindung zwischen Geist und Körper kappen und dadurch den Geist befreien oder vertreiben, sodass er den Lebenden nichts antun konnte.
Menschen betrauern, fürchten und verehren die Toten.
1975, beim Besuch eines Dorfs im Norden Thailands, erschreckte ich die Kinder, die mich für einen Geist hielten. Sie hatten noch nie jemanden gesehen, der so groß, so weiß und so blond war. Sie liefen vor mir weg, wobei sie «pii, pii» riefen, das Thai-Wort für Gespenst.
In vielen Kulturen wird der Raum für die Toten abgegrenzt: Friedhöfe, Steine, Totempfähle, Urnen, Mausoleen, unmittelbar in Felswände geschlagene Gräber, an Berghängen herabhängende Gräber und Särge auf Stelzen, ein paar Meter über dem Boden.
Lewis Mumford schrieb: «Die Stadt der Toten war vor der Stadt der Lebenden da.» Er behauptete, Menschen hätten gern in der Nähe der Grabstätten ihrer Vorfahren leben wollen, zu denen sie sich mit gemischten Gefühlen von Verehrung und Furcht hingezogen fühlten, und so sei die Stadt geboren worden: Nekropolis vor Metropolis.
Aber es gibt auch die buchstäbliche Aufbewahrung der Toten: Einbalsamierung, Mumifizierung, verschiedene Methoden, den Leichnam zu erhalten. Im Museo Chileno de Arte Precolombino in Santiago de Chile erklärte mir ein Kurator, dass ein längst verschwundener Stamm in dem Gebiet, das heute Chile heißt, zwar Sammler und Jäger waren, aber aufwendige Rituale und Einbalsamierungen durchführten. Das war für Anthropologen eine große Überraschung, weil sie so eine hoch entwickelte Technik bei Sammlern und Jägern nicht vermutet hatten. Ihrem Nachleben wurde viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet als ihrem Leben vor dem Tod.
Die Aborigines im Norden Australiens heben die Knochen der Toten auf und bemalen sie.
Angehörige eines Stammes in Afrika tragen die Knochen des Toten, solange sie trauern. Die Engländer der viktorianischen Epoche hatten eine Vorliebe für Schmuck, der aus dem Haar eines teuren Verstorbenen gefertigt war.
Zum Teil weil der Platz für Beisetzungen begrenzt ist und Gräber nach sechzig Jahren aufgelassen werden müssen, verwandelt eine zunehmende Anzahl von Südkoreanern die Asche ihrer Lieben in bunte Perlenschnüre, die zu Hause ausgelegt werden können.
Meine Großmutter hörte meinen Großvater nach seinem Tod manchmal im Haus umgehen. Einmal sah sie, wie er seinen Hut vom Haken auf der Rückseite der Küchentür nahm. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen in ihrem Schmerz die Toten halluzinieren, aber das Phänomen ist nur wenig untersucht, vielleicht, weil Wissenschaftler sich gegen die Vorstellung von Geistern wehren. Solche Gespenster schenken hauptsächlich Trauernden Trost. Sie sind lebendige Reinkarnationen eines geliebten Verstorbenen, Wachträume inbrünstiger Wünsche.
Eine Frau, von der ich las, sah ihre tote Katze zufrieden durch die Zimmer streifen, in denen sie einst zusammengewohnt hatten.
Wenige von uns sind frei davon, den Tod, die gewöhnlichste Tatsache der menschlichen Existenz, auch unsagbar befremdlich zu finden. Wenn ein Mensch nicht mehr da ist, versuchen wir, das, was war, in dem, was ist, zu bewahren, mit Zeichen und Andenken. Um mich herum sterben Menschen, doch wenn ich den Verstorbenen gernhabe, ist der Verlust in mir, nicht außerhalb von mir. «Denn länger ist die Zeit, da denen drunten ich gefallen muss als denen hier», sagt Antigone in Sophokles’ Tragödie zu ihrer Schwester Ismene. «Dort nämlich ruhe ich auf ewig.» Die tragische Heldin weigert sich, ihren Bruder unbestattet liegen zu lassen, ohne ihn mit den Beisetzungsritualen zu versehen, die er verdient. Sie trotzt der Vorschrift, die das verbietet, obwohl sie weiß, dass es ihren Tod bedeutet.
Es stimmt, dass wir auf ewig ruhen. Es stimmt auch, dass wir die Leiber unserer Toten nicht so behandeln können, als wären sie nichts anderes als der Abfall, den wir routinemäßig in den Rinnstein werfen. Wir müssen den Verlust symbolisieren und auf die eine oder andere Weise für die Überreste sorgen. Wie wir das tun, hängt von unserer Kultur ab, aber kulturelle Praktiken entwickeln und verändern sich.
Ich möchte verbrannt und dann auf dem Green-Wood Cemetery in Brooklyn über oder unter meinem Mann bestattet werden, je nachdem, wer von uns zuerst stirbt. Als wir den Platz in dieser riesigen Nekropolis fanden, war ich glücklich. Wie kurios dieses Gefühl war. Ich will nicht sterben. Ich befürchte ständig zu sterben, bevor ich geschrieben habe, was ich noch zu schreiben hoffe, und doch erfreue ich mich an der Grabstelle, erfreue mich daran zu denken, wie sie im Frühling und im Sommer grünt und blüht, sich im Herbst rötlich färbt und im Winter öde oder weiß wird, obwohl ich – da jegliches Bewusstsein dahin ist – die wechselnden Jahreszeiten nicht mehr genießen werde.
Ich mag den Song von Tom Waits mit seinem hartnäckigen Refrain: «Wir werden alle nur Dreck in der Erde sein.» Ich singe mit. Ich tanze. Ich lache. Ich weiß eigentlich nicht, warum.
Ich bin froh, dass die Erde, in der die Asche meines Vaters ruht, mit seinem Namen gekennzeichnet ist.
Während ich dies schreibe, ist meine Mutter dreiundneunzig Jahre alt. Sie hat ihre vier Töchter gebeten, die Hälfte ihrer Asche neben meinem Vater zu begraben und die andere Hälfte in ihr heimatliches Norwegen zu bringen. Sie möchte, dass wir sie über den Gräbern ihrer Eltern in Mandal verstreuen, der Stadt, in der sie geboren wurde und ihre Kindheit verbrachte. Auf dem kleinen Berg, der sich über diesen Gräbern erhebt, steht das Haus, das mein Großvater entworfen hat und in dem meine Mutter als Mädchen lebte. Von da aus sieht man direkt auf das Meer.
2017
Ein Spaziergang mit meiner Mutter
Oft erinnere ich mich an den Gang meiner Mutter. Es war ein entschlossener Gang, aber mit leichtem Schritt. Seinen entschiedenen, zuversichtlichen Rhythmus kann ich noch immer hören und fühlen. Sie ging gern – in den Wäldern Minnesotas, den norwegischen Bergen, überall am Strand –, und sie ging jeden Tag zügig und lange, bis eine Reihe von Krankheiten sie mit neunzig bremste. Sie ging zum Vergnügen. Sie ging, um den Wind, die Sonne, Schnee oder Regen in ihrem Gesicht zu spüren und um am Wegesrand Wunderdinge zu finden – Wildblumen, hohe Gräser, von der Brandung rund geschliffenes Glas, Steine in überraschenden Farben, abgefallene Rinde und knorrige Äste.
Meine Mutter Ester Vegan Hustvedt starb am 12. Oktober 2019. Ich bin froh, dass sie vor der Pandemie starb. Ich hätte unmöglich neben ihr sitzen und sie im Arm halten können, wenn sie jetzt, im Sommer 2020, gestorben wäre. Die gehende Mutter, an die ich mich erinnere, ist eine besondere Frau, geboren 1923 in Mandal, Norwegen, als jüngstes von vier Kindern, deren Familie die Stadt verließ, als sie zehn war, und nach Askim in der Nähe von Oslo zog. Sie erlebte die Nazi-Besatzung mit ihren Entbehrungen, und 1954 war sie in den Vereinigten Staaten, verheiratet mit meinem Vater. Meine Mutter ist nicht «Die Mutter», das Urbild oder Klischee, das unweigerlich aufkreuzt, wenn Mütter in Erinnerung gerufen werden, eine in Hierarchien von männlich und weiblich gepresste Person oder die kultisch verehrte Große Mutter oder die Jungfrau Maria oder Mutter Natur oder die Mutter von weichgezeichneten Werbefotos in Elternzeitschriften. Und doch durchdringen Mutterbilder das Muttersein mit einer starren Moral von Gut und Böse, die das Vatersein selten betrifft.
Zur Feier meines fünfzigsten Geburtstags, der auch der zweiundachtzigste Geburtstag meiner Mutter war, hielt sie eine Rede. Sie begann nicht mit meiner Geburt, sondern mit dem Augenblick, als sie die ersten Kindsbewegungen spürte, ein Kitzeln im Bauch, das Anzeichen ihrer ersten Schwangerschaft. Sie sprach über ihre tiefe Freude, und ich dachte im Stillen: Es ist gut, ein von seiner Mutter gewolltes Kind zu sein. Die einfache Tatsache, dass jeder Mensch in einem anderen Menschen entsteht, ist unlösbar mit Mutterschaft verbunden. Die einfache Tatsache, dass die meisten Frauen das Baby aus ihrem Körper pressen, ist unlösbar mit Mutterschaft verbunden. Die Tatsache, dass viele Frauen ihre Kinder mit der Milch ihrer Brüste nähren, ist unlösbar mit Mutterschaft verbunden. Ohne weibliches Fortpflanzungssystem gibt es keine ersten Kindsbewegungen, keine Wehen, keine Geburt, kein Stillen.
Meine Mutter sagte oft, sie fände das Kleinkindalter zu kurz. Sie hatte vier Töchter und genoss unser frühestes Lebensalter. Sie erzählte mir, als sie mit vierzig meine jüngste Schwester Ingrid gebar, habe sie gewusst, dass es wahrscheinlich das letzte Mal war, und ein Gefühl von Verlust gespürt. Ihre Wehen waren kurz und intensiv – alle weniger als drei Stunden. Anders als andere Frauen jener Zeit in den USA wurde sie nie betäubt, und ihre bevorzugte Geburtsstellung war hockend. Die letzten fünf Jahre ihres Lebens wohnte sie in einem Zimmer eines Heims für betreutes Wohnen. Wenn sie im Bett lag, schaute sie geradewegs auf vier Schwarz-Weiß-Fotos ihrer Kinder als Babys. Bei unseren fast täglichen Telefongesprächen fragte ich sie dann, was sie gerade tue. Oft antwortete sie: «Ich sehe mir die Babys an.» Ihr ältestes Baby war da vierundsechzig.
Sie war eine leidenschaftliche Mutter, die in vielerlei Hinsicht einer Fantasie von Müttern entsprach, wie sie im Fünfzigerjahre-Amerika der Nachkriegszeit propagiert wurde. Sie arbeitete im Haus, bis alle ihre Kinder zur Schule gingen, und hatte nie, was man einen «Beruf» nennt. Für den ersten Schultag, Weihnachten und Ostern nähte sie ihren Töchtern vier gleiche Kleider. Sie nähte auch Kleider für unsere Puppen und strickte Pullover für sie. Jeden Tag, wenn wir nach langen Stunden des Lesens und Rechnens und manchmal spannungsvollen, verwirrenden Dramen mit anderen Kindern mit dem Bus nach Hause gekommen waren, saß jede von uns auf einem Hocker in der Küche, wir aßen die Kekse oder Kuchen, die unsere Mutter für uns gebacken hatte, und erzählten ihr, was es Neues gab. Sie legte unsere Kleider für die Schule heraus, steckte Handtücher in den Trockner, damit sie warm waren, wenn wir aus der Badewanne stiegen, polierte bei besonderen Anlässen unsere Lackschuhe mit Vaseline. Sie bügelte wunderschön. Sie liebte das Haus in perfekter Ordnung, glänzendes Kupfer, staubfreie Flächen, klar funkelndes Glas. Sie gab beneidenswerte Dinnerpartys. Sie war stolz auf ihre hausfraulichen Fähigkeiten. Sauberkeit und elegante Arrangements bereiteten ihr sinnliche Freude.
Obwohl Frauen immer Kinder geboren haben, haben sich die Vorstellungen von Mutterschaft mit der Zeit verändert. Im klassischen Griechenland waren Frauen zum Kinderkriegen da, mit wenigen Rechten auf ihr Heim beschränkt, doch in der griechischen Mythologie gibt es mächtige und furchterregende weibliche Figuren. Man denke nur an die Amazonen, die Kriegerinnen; die schlangenhaarige Medusa, die Männer in Stein verwandelt; und Medea, die ihre Kinder ermordet. Es scheint, dass die griechischen Frauen im Mythos blutige Rache nahmen. Trotz intensiver Ängste vor der weiblichen Sexualität im Mittelalter wurde Jesus oft als mütterliche Figur dargestellt. Der jahrhundertelang anhaltende uralte Glaube, Muttermilch wäre umgewandeltes Blut, verstärkte das Bild noch. Wie eine Mutter ihr Kleines nährt, so nährte Jesus die Schar der Jünger beim Abendmahl mit seinem Blut.
Die sich aufopfernde, geduldige Königin des häuslichen Reichs, die die moralische Erziehung ihrer Kinder übernahm, wurde jedoch im achtzehnten Jahrhundert geboren. Dem französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau kommt ein erhebliches Verdienst dafür zu. Diese ideale Frau war mehr als bloß der Herrschaft ihres Mannes untertan. Sie hatte ihren eigenen Bereich im Haus, wo sie sich um ihre Kinder kümmerte. «Die wahre Hausfrau lebt indes nicht weniger abgeschlossen in ihrer Häuslichkeit als die Nonne in ihrem Kloster», schrieb Rousseau. Die wahre Hausfrau war ein Mittelschichtgeschöpf. Arme Frauen und solche aus der Arbeiterschicht sind nie in der Lage gewesen, zu Hause zu bleiben. Versklavte Frauen hatten keine Kontrolle über ihren Körper oder ihre Familie. Nur Frauen aus der Mittelschicht waren aufgefordert, das Ideal zu verwirklichen, gegen das Virginia Woolf rebellierte: «Das Töten des Engels im Haus gehörte zu den Tätigkeiten einer Schriftstellerin.»
Der Vater meiner Mutter war Postmeister in Mandal und Grundbesitzer in einer Gegend Norwegens, die bekannt war für ihren Pietismus, ein Merkmal, das sie nie abgelegt hat. Sie bleibt ein Teil von Norwegens «Bibelgürtel», einer Bastion konservativer Werte, einschließlich des Widerstands gegen die Gleichberechtigung der Geschlechter. Meine Mutter war nie besonders religiös und glaubte nicht, Frauen müssten unterwürfig oder stumm sein. Dennoch lebte sie in einer Welt, in der männliche und weibliche Arbeit strikt getrennt war und die Wichtigkeit der ersten gegenüber der zweiten unhinterfragt. Jahre nach dem Tod meines Vaters erzählte mir meine Mutter, dass seine Angewohnheit, sie zu unterbrechen, wenn sie sprach, sie gekränkt und geärgert habe. Als sie es ihm vorhielt, war er gekränkt und verärgert.
Meine Mutter vertrat die guten Manieren, die sie als Kind gelernt hatte. Das Repertoire enthielt besondere Regeln für Mädchen: die Knie fest beieinanderhalten, die Hände im Schoß falten und vor Erwachsenen einen Knicks machen – ein Benehmen, das in Gesellschaft streng zu befolgen war. Gleichzeitig ließ Ester ihre Töchter im Wald hinter dem Haus toben, meilenweit herumstromern, wobei sie sich am Stacheldraht kratzten, von Blutegeln ausgesaugt wurden und dann durchnässt, schmutzig und voller Insektenstiche nach Hause kamen, im Schlepptau Hunde, Frösche, Salamander und Heuschrecken.
In Northfield, Minnesota, der Kleinstadt, in der meine Mutter durch ihre Heirat landete, waren die Frauen mehrheitlich Hausfrau und Mutter. Ich erinnere mich nicht, als Heranwachsende jemals einer verheirateten älteren Frau ohne Kinder begegnet zu sein. Es muss sie gegeben haben, aber ich erinnere mich nicht an sie. Es gab ein Grüppchen Witwen in der Stadt, mehrere alte Jungfern, die Lehrerin waren oder bis zu ihrem Tod als Sekretärinnen arbeiteten, und zwei ältere unverheiratete Schwestern, die zusammenwohnten, von denen eine einen Doktor hatte und Professorin für Geschichte gewesen war. Sie trugen Schals und robuste Altdamenschuhe. Ich habe mir wohl auch vorgestellt, eines Tages verheiratet zu sein und Kinder zu haben. Ich liebte meine Puppen, aber schon als Kind träumte ich davon, Künstlerin zu werden. Ich würde irgendwo weit weg leben und Kunst machen.
Wo platziere ich meine eigene geliebte Mutter in der Dichotomie ideale Mutter/reale Mutter? In Von Frauen geboren. Mutterschaft als Erfahrung und Institution von 1976 unterschied Adrienne Rich zwischen zwei Bedeutungen von Mutterschaft: «Das potenzielle Verhältnis jeder Frau zu ihrer Reproduktionsfähigkeit und zu den Kindern; und die Institution, die sicherstellen soll, dass das Potenzial – und alle Frauen – unter männlicher Kontrolle bleiben.» Die Unterscheidung ist wichtig, aber sie ist keineswegs klar. Eine Institution ist bestehendes Recht, Praxis oder Usus. Die Institution Mutterschaft ist kein Gebäude, in das wir hinein- und herausgehen. Es ist eine Sozialstruktur mit Regeln, die kollektives Verhalten organisieren, eine Struktur, die auch innerlich und oft unbewusst ist, eine erlernte Seinsweise. Mein Mann hatte eine Tante, die ihre Töchter mit folgender Drohung auf Trab brachte: «Putzt euch die Zähne, oder ihr werdet nicht geheiratet.»
Kein Mensch kann aus der Welt, in der er lebt, herausgehoben werden. Kein Mensch kann aus seinem Kontext gelöst werden. Unsere Wünsche sind von Erfahrung, von Lust und Schmerz, von Ge- und Verboten geprägt. Ein Neugeborenes hat Lust und Schmerz – Empfindungen, die es einlullen oder ihm wehtun –, und erlernte Muster bilden sich früh aus, Gefühlsrhythmen, die Bedeutung annehmen und ein Teil von ihm werden. Jeder hilflose Säugling braucht ständige Versorgung. In der Welt, in der ich aufwuchs, war die Hauptversorgerin fast immer die leibliche Mutter, aber das ist nicht universell so. Alleiniges Bemuttern ist nicht die Regel. Es gab immer auch andere Versorger: Väter, Ammen, Kindermädchen, Großmütter, Onkel, Cousinen und Cousins. Die Evolutionsbiologin Sarah Hrdy entwickelte in ihrem Werk die Idee der «kooperativen Aufzucht», ein nicht nur bei Menschen vorkommendes Merkmal. Elefanten, Schimpansen, Lemuren und viele Vogelarten sind ebenfalls kooperative Aufzüchter. Menschlichen Müttern wurde und wird von «Alloparentalen» geholfen, anderen aus der Gruppe, die behilflich sind. «Wenn hominine Mütter nicht mit einer erheblichen alloparentalen sowie väterlichen Beteiligung an der Pflege und Versorgung eines mit hohem Aufwand verbundenen, langsam reifenden Nachkommen hätten rechnen können, hätte sich die Gattung Mensch gar nicht weiterentwickeln können.» Ein Sprichwort der Swahili bringt die Idee auf den Punkt: «Eine einzige Hand kann ein Kind nicht versorgen.»
Ich war zweiunddreißig, als meine Tochter Sophie geboren wurde, genau im gleichen Alter wie meine Mutter, als ich geboren wurde. In Sophies ersten Lebensmonaten hatte ich das starke Gefühl, in Flüssigkeiten, ihren und meinen, zu baden. Ich hatte den Eindruck, eine Art mobilen Anhang aus meinem Körper ausgestoßen zu haben. Sie konnte an meinen Mann, meine Mutter, meine Schwestern, ihre Nanny und andere weitergereicht werden, würde am Ende aber wieder an meinem Körper landen, obwohl sie nicht mehr in mir war. Mir brachten diese langen, kurzen ersten Monate ihres Lebens mehr Lust als Schmerz. Anders als meine Mutter hatte ich Hilfe. Es war trotzdem anstrengend und manchmal zermürbend, sie zur Ruhe zu bringen. Sophie war kein entspanntes Geschöpf. Sie zappelte, strampelte und brüllte. Sie schlief kaum. Mein Mann und ich wippten und schaukelten sie auf dem Arm und in ihrem Wagen. Selbst wenn ich sie nicht hielt, ertappte ich mich dabei, auf und ab zu wippen, als wäre ich zu einem hirnlosen Aufziehspielzeug geworden.
Andererseits liebte ich es, ihren kahlen Kopf zu streicheln, in ihr rätselhaftes kleines Gesicht zu schauen, zu sehen, wie sie mich ihrerseits anstarrte und ihren Mund zu kleinen unwillkürlichen Saugbewegungen spitzte. Ich liebte ihre heile Haut und deren goldene Farbe, die winzigen, weichen Fingernägel und strampelnden, undisziplinierten Extremitäten. Ich liebte ihren kleinen, in meinen eingerollten Körper, wenn ich sie stillte, die schäumende Milch, die ihr aus den Mundwinkeln rann, während sie grunzte und nuckelte, ein gieriges Tierchen, komisch in ihrem völligen Mangel an Selbst-Bewusstsein. Ich liebte den Druck ihrer winzigen Faust um meinen Finger. Ich liebte ihren Geruch. Ich verliebte mich in sie. Sie ist jetzt zweiunddreißig. Ich bin immer noch verliebt in sie.
Ein paar Tage nach Sophies Geburt saß meine Mutter auf der Bettkante in unserer damaligen Wohnung in Brooklyn und sagte mit leicht überraschter Stimme: «Du siehst aus, als hättest du schon immer ein Baby im Arm gehabt.» Sophie war mein Post-Dissertations-Baby. Ich war nicht lange nach der Verteidigung für meinen Ph.D. in Anglistik an der Columbia University schwanger geworden. Die Erfahrung mit meiner Tochter ist meine eigene – sie soll nicht stellvertretend für universelle Mutterschaft stehen. Das könnte der springende Punkt bei der Sache sein. Mutterschaft war und ist in so viel rührseligen Unsinn getaucht, mit so vielen Vorgaben für das, was man zu tun und zu fühlen hat, dass sie, sogar heute noch, eine kulturelle Zwangsjacke bleibt. Die Metapher ist sehr bewusst gewählt. Die Zwangsjacke, mit der Patienten in der Psychiatrie gebändigt wurden, ist ein passendes Bild für das, was Adrienne Rich damit meinte, Frauen sollten unter männlicher institutioneller Kontrolle gehalten werden. Wenn das Mütterliche ein statisches Konzept wird, eine Fantasie von aufopferndem, grenzenlosem Nähren, dient es als moralische Waffe, Mütter, die als wild betrachtet werden, zu bestrafen. Und da die Institution weder ein Gebäude noch ein Regelwerk ist, sondern eine Seinsweise, die Teil des Gemeinschaftslebens selbst ist, ist sie auch eine Waffe, die Mütter als Scham oder Schuld von innen trifft.
Als Sophie noch keine zwei Jahre alt war, waren wir als Familie auf Reisen. Ich erinnere mich weder, welchen Flughafen wir passierten, noch, wohin wir unterwegs waren. Ich weiß, ich war gestresst und müde, behängt mit prall gefüllten Taschen, und fuhr mit meinem Kind in seinem Buggy eine Rolltreppe hinunter. Plötzlich kippte Sophie nach vorn, und in einem einzigen entsetzten Augenblick sah ich, dass sie nicht angeschnallt war. Ich packte sie, zog sie zurück, und die Katastrophe war abgewendet. Ein vor mir hinuntergleitender Geschäftsmann mit einer kleinen viereckigen Aktentasche wurde Zeuge des Beinahunfalls. Er warf mir einen Blick zu, den ich nie vergessen habe. Es war ein Blick des Abscheus, und meine Scham war so vernichtend, dass ich diese Geschichte bis jetzt nie jemandem erzählt habe. In seinen Augen sah ich mich: ein Monster an Fahrlässigkeit, die schlechte Mutter.
Es dauerte Jahre, bis mir klar wurde, dass der Mann auf der Rolltreppe eine Inkarnation der gegen Mütter gerichteten heftigen moralischen Gefühle in der Kultur war. Er machte keine Bewegung, um den drohenden Sturz meines Kindes aufzuhalten. Er zeigte kein Mitgefühl für meinen Schrecken oder die nachfolgende Erleichterung. Er war eine Figur reinsten, brutalsten Richtens. Wäre die Person auf der Rolltreppe nicht ich, sondern mein Mann gewesen, hätten seine Augen, da bin ich mir sicher, eine andere Botschaft gesandt: Der arme Mann; wo ist seine Frau? Obwohl Feministinnen seit Langem gegen die einengende Ideologie der Mutterschaft rebelliert haben, ist der entrüstete Richter keine Figur der Vergangenheit. Nachdem Rachel Cusk 2001 Über das Mutterwerden veröffentlicht hatte, worin sie den Schock, die Entfremdung und den Selbstverlust beschrieb, die sie empfand, als sie ihre kleine Tochter versorgte, wurde sie von der Kritik, darunter viele Frauen, als narzisstische, «von sich selbst besessene Langweilerin» heruntergemacht. Ihre Sehnsucht zu schreiben und die durch die Mutterschaft entstandenen Schranken zwischen ihr und ihrer Arbeit riefen nicht nur leisen Tadel, sondern Schmähung hervor.
Ich erinnere mich lebhaft an eine Frau, die nicht auf mich, sondern auf Harriet Burden, eine meiner Figuren, schimpfte. Eine Professorin hatte mich zu einer Buchklub-Veranstaltung eingeladen, um über meinen Roman Die gleißende Welt zu diskutieren. Als Autorin des Buchs hatte ich irrigerweise angenommen, höflich behandelt zu werden. Harriet, meine aggressive, ehrgeizige und verbitterte Künstlerin, erzürnte eine der Frauen so sehr, dass sie mich mit unverhohlener Wut angriff. Harriet habe so ein Schwein, sagte sie. Sie hätte mit ihrem guten Leben zufrieden sein sollen, massenhaft Geld und Kinder, die sie großzog. Danach fragte ich mich, welche Sehnsüchte sie im Namen der Mutterschaft unterdrückt hatte.