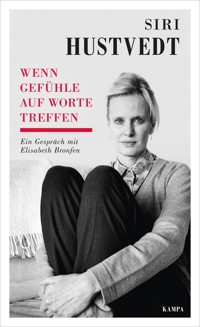9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau bezieht ein winziges Zimmerchen im heruntergekommenen Morningside Heights. Das Jahr ist 1979, und S.H. kommt direkt aus der amerikanischen Provinz; daher ihr Spitzname: "Minnesota". Das wilde New York lockt, und sie, die Schriftstellerin werden will, genießt den Schmutz wie den Glanz, das turbulente Leben wie die Einsamkeit. Alles Neue saugt sie begierig in sich auf. So auch, durch die papierdünnen Wände zur Nachbarwohnung, die oft skurrilen Monologe und gesungenen Mantras ihrer Nachbarin: Lucy Brite, liest sie auf dem Klingelschild. Doch mit der Zeit wünscht sie, sie hätte nicht so genau hingehört. Immer dringlicher werden Lucys Gesänge, immer klagender. Von Misshandlung ist die Rede, von Gefangenschaft, von Kindstod, ja von Mord. Nach und nach wird die Nachbarin zu einer immer schrecklicheren Obsession. Bis eines Nachts ein dramatisches Ereignis in Minnesotas Wohnung Lucy Brite in Person auf den Plan ruft - und nun beginnt ein Geheimnis sich zu lüften... Vierzig Jahre später erzählt die gealterte S.H., inzwischen eine anerkannte Schriftstellerin und Wissenschaftlerin, was davor und danach geschah: erzählt von Frauensolidarität und Männerwahn, von Liebe und Geschlechterkampf, von Gewalt und Versöhnung. Erzählt aber auch vom Mysterium der Zeit, von Erinnerung und Phantasie, von der Art und Weise, wie alles im Leben zu Geschichten wird, erzählt vom Erzählen. Und das mit einer unbändigen Lust daran, die uns wünschen lässt, das Buch wäre nie zu Ende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Siri Hustvedt
Damals
Roman
Über dieses Buch
Eine junge Frau bezieht ein winziges Zimmerchen im heruntergekommenen Morningside Heights. Das Jahr ist 1979, und S.H. kommt direkt aus der amerikanischen Provinz; daher ihr Spitzname: «Minnesota». Das wilde New York lockt, und sie, die Schriftstellerin werden will, genießt den Schmutz wie den Glanz, das turbulente Leben wie die Einsamkeit.
Alles Neue saugt sie begierig in sich auf. So auch, durch die papierdünnen Wände zur Nachbarwohnung, die oft skurrilen Monologe und gesungenen Mantras ihrer Nachbarin: Lucy Brite, liest sie auf dem Klingelschild.
Doch mit der Zeit wünscht sie, sie hätte nicht so genau hingehört. Immer dringlicher werden Lucys Gesänge, immer klagender. Von Misshandlung ist die Rede, von Gefangenschaft, von Kindstod, ja von Mord. Nach und nach wird die Nachbarin zu einer immer schrecklicheren Obsession. Bis eines Nachts ein dramatisches Ereignis in Minnesotas Wohnung Lucy Brite in Person auf den Plan ruft – und nun beginnt ein Geheimnis sich zu lüften …
Vierzig Jahre später erzählt die gealterte S.H., inzwischen eine anerkannte Schriftstellerin und Wissenschaftlerin, was davor und danach geschah: erzählt von Frauensolidarität und Männerwahn, von Liebe und Geschlechterkampf, von Gewalt und Versöhnung. Erzählt aber auch vom Mysterium der Zeit, von Erinnerung und Phantasie, von der Art und Weise, wie alles im Leben zu Geschichten wird, erzählt vom Erzählen. Und das mit einer unbändigen Lust daran, die uns wünschen lässt, das Buch wäre nie zu Ende.
Vita
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sechs Romane publiziert, mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Der Sommer ohne Männer» und «Die gleißende Welt». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Leben, Denken, Schauen», «Nicht hier, nicht dort», «Being a Man» und «Die Illusion der Gewissheit» vor.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel «Memories of the Future» bei Simon & Schuster, New York.
Die Übersetzerinnen bedanken sich beim Deutschen Übersetzerfonds für die großzügige Förderung ihrer Arbeit.
Bildnachweis Totenmaske der Baroness auf S. 223: Fonds Marc Vaux, (©) Bibliothèque Kandinsky, Paris
Copyright der Coverabbildung und Zeichnungen © 2019 by Siri Hustvedt
Lettering Marcus Gärtner
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg bei Reinbek, März 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg bei Reinbek
«Memories of the Future» Copyright © 2019 by Siri Hustvedt
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
(1. Auflage 2019)
ISBN 978-3-644-00227-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Kapitel Eins
Vor Jahren verließ ich die weiten, flachen Felder des ländlichen Minnesota und zog auf die Insel Manhattan, um den Helden meines ersten Romans zu finden. Als ich im August 1978 dort ankam, war er weniger eine Figur als eine rhythmische Möglichkeit, eine embryonale Kreatur meiner Phantasie, die ich auf den Streifzügen durch die Straßen der Stadt als eine Serie metrischer, mit meinen Schritten bald schneller, bald langsamer werdender Beats verspürte. Ich glaube, ich hoffte, mich selbst in ihm zu entdecken, zu beweisen, dass er und ich jeder Geschichte wert waren, die sich uns bot. Ich war in New York nicht auf der Suche nach Glück oder Komfort. Ich war auf der Suche nach Abenteuern, und ich wusste, dass der Abenteurer leiden muss, ehe er nach unzähligen Widrigkeiten zu Lande und zu Wasser nach Hause kommt oder am Ende von den Göttern ausgelöscht wird. Damals wusste ich nicht, was ich jetzt weiß: Während ich schrieb, wurde ich auch geschrieben. Das Buch war begonnen worden, lange bevor ich die Ebenen verließ. Zahlreiche Entwürfe für einen Detektivroman waren schon in mein Gehirn eingeschrieben, aber das bedeutete nicht, dass ich gewusst hätte, wie er ausgehen würde. Mein unausgereifter Held und ich waren unterwegs zu einem Ort, der nicht viel mehr war als eine schimmernde Fiktion: die Zukunft.
Ich hatte mir genau zwölf Monate gegeben, um den Roman zu schreiben. Falls mein Held am Ende des folgenden Sommers tot geboren wurde, falls er im Säuglingsalter sterben oder sich als derartiger Depp erweisen sollte, dass sein Leben keinen Kommentar verdiente, anders gesagt, falls er überhaupt kein Held wäre, würde ich ihn und seinen Roman hinter mir lassen und mich ins Studium der Vorfahren meines toten (oder missglückten) Jungen stürzen, der Bewohner all der Bücher, welche die Geisterstädte füllen, die wir Bibliotheken nennen. Ich hatte ein Stipendium für vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University angenommen, und als ich anfragte, ob ich meine Zulassung auf das folgende Jahr verschieben könne, hatten mir die unsichtbaren Autoritäten einen weitschweifigen Brief geschickt, in dem sie meine Bitte bewilligten.
Ein dunkles Zimmer mit einer Kochnische, ein noch dunkleres Schlafzimmer, ein winziges, schwarz-weiß gekacheltes Bad und eine Kammer mit bauchig gewölbter Putzdecke im Haus 309 West 109th Street kosteten mich zweihundertzehn Dollar im Monat. Es war ein trostloses Apartment in einem schäbigen, ramponierten, schadhaften Gebäude, und wäre ich nur ein kleines bisschen anders gewesen, etwas materieller eingestellt oder eine Spur weniger belesen, hätten sein schwefelgrüner Anstrich und die Ausblicke auf zwei schmutzige Backsteinwände in der übelriechenden Sommerhitze mir und meinen Ambitionen den Garaus gemacht, doch den dafür notwendigen Grad von Andersartigkeit, wie verschwindend auch immer, gab es damals nicht. Hässlich war schön. Ich dekorierte die gemieteten Räume mit den magischen Sätzen und Absätzen, die ich nach Belieben aus den vielen Büchern in meinem Gehirn holte.
Sein Kopf bevölkerte sich mit dem, was er in den Büchern fand, mit Verzauberungen und Turnieren, mit Schlachten, Fehden, Blessuren, Liebesschwüren, Amouren, Herzensqualen und anderem abwegigen Unfug. All das nistete sich so fest in seinem Geist ein, dass ihm das Lügengebäude der phänomenalen Phantastereien, von denen er las, ganz unverrückbar wurde und es für ihn auf Erden keine wahrere Geschichte gab.
Die ersten Momente in meinem ersten Apartment haben in der Erinnerung etwas Strahlendes, was nichts mit Sonnenlicht zu tun hat. Sie sind von einer Idee erleuchtet. Kaution hinterlegt, erste Monatsmiete bezahlt, Tür hinter meinem untersetzten, grinsenden Hausmeister Mr. Rosales geschlossen, sprang ich mit Schweißflecken unter den Achseln in einer Art Freudentanz auf den Dielen herum und warf triumphierend die Arme in die Luft.
Ich war dreiundzwanzig Jahre alt, mit einem Bachelor in Philosophie und Englisch vom St. Magnus College (einer kleinen, liberalen, von norwegischen Einwanderern gegründeten geisteswissenschaftlichen Universität in Minnesota), fünftausend Dollar auf der Bank, einem Haufen Kohle, den ich gespart hatte, als ich nach dem Examen ein Jahr lang in meiner Heimatstadt Webster als Barfrau gejobbt und mich umsonst zu Hause einquartiert hatte, einer Smith-Corona-Schreibmaschine, einem Werkzeugkasten, von meiner Mutter gespendeten Küchenutensilien und sechs Kisten voller Bücher. Aus Kanthölzern und einer Sperrholzplatte baute ich mir einen Schreibtisch. Ich kaufte zwei Teller, zwei Tassen, zwei Gläser, zwei Gabeln, zwei Messer und zwei Löffel in Erwartung des zukünftigen Liebhabers (oder Reigens von Liebhabern), mit dem ich nach einer ekstatisch durchbumsten Nacht Toast und Eier zu frühstücken plante, die wir, da ich weder Tisch noch Stühle hatte, auf dem Fußboden verspeisen würden.
Ich erinnere mich daran, wie sich die Tür hinter Mr. Rosales schloss, und an meinen Jubel. Ich erinnere mich an die zwei Zimmer des alten Apartments und kann im Geiste von einem ins andere gehen. Ich sehe den Raum noch vor mir, doch wenn ich ehrlich bin, kann ich die genaue Konstellation der Risse in der Schlafzimmerdecke nicht beschreiben, jener krakeligen Linien und zarten Blüten, die, wie ich weiß, da waren, denn ich hatte sie eingehend betrachtet, und auch der Größe des Kühlschranks bin ich mir nicht absolut sicher, nur dass er, glaube ich, ziemlich klein war. Ganz sicher bin ich mir, dass er weiß war und an den Kanten abgerundet, nicht eckig. Je mehr ich mich darauf konzentriere, desto mehr Einzelheiten kann ich wahrscheinlich liefern, aber diese Details mögen ebenso gut erfunden sein. Und deshalb werde ich nicht schildern, wie die Kartoffeln aussahen, die vor achtunddreißig Jahren vor mir auf dem Teller lagen. Ich werde Ihnen nicht erzählen, ob sie blass und gekocht oder leicht sautiert, gratiniert oder frittiert waren, weil ich mich nicht daran erinnere. Falls Sie zu den Lesern gehören, die mit unmöglich konkreten Erinnerungen gefüllte Memoiren genießen, muss ich sagen: Den Autoren, die noch Jahrzehnte später eine perfekte Erinnerung an ihre Kartoffelpuffer zu besitzen behaupten, ist nicht zu trauen.
Und so komme ich in der Stadt an, von der ich geträumt habe, seit ich acht war, die für mich aber ein böhmisches Dorf ist.
Und so komme ich in der Stadt an, die ich in Filmen gesehen und von der ich in Büchern gelesen habe, der Stadt, die New York ist, aber auch andere Städte: Paris, London oder St. Petersburg, die Stadt des Glücks und Unglücks des Helden, eine reale Stadt, die auch eine imaginäre ist.
Ich erinnere mich an die unheimliche Beleuchtung, die durch die kaputte Jalousie drang, als ich am 25. August zum ersten Mal im Apartment 2B übernachtete. Ich sagte mir, ich müsse ein neues Rollo anschaffen, sonst würde es nie richtig dunkel im Zimmer. Die heiße Luft stand darin. Mein Schweiß durchtränkte die Laken, und meine Träume waren schlimm und lebhaft, doch als ich dann am nächsten Morgen Kaffee gekocht und mit der Tasse auf meine Schaumstoffmatratze zurückgekehrt war, hatte ich vergessen, was ich geträumt hatte. Während meiner ersten Woche in New York schrieb ich vormittags und fuhr nachmittags mit der Subway herum. Ich hatte kein Ziel im Kopf, aber ich weiß, dass mein Herz schneller schlug, wenn der Zug durch die Eingeweide der Stadt rumpelte, und dass meine neu entdeckte Freiheit fast unmöglich schien. Eine Subway-Münze kostete fünfzig Cent, und solange ich nicht durch eine Sperre und die Treppen hinaufging, konnte ich von einem Zug in den anderen umsteigen, ohne nochmals zu bezahlen. Ich tuckerte mit der IRT uptown und downtown, sauste express mit dem A-Train und kreuzte mit dem Shuttle von der West Side zur East Side hinüber, ich erkundete die kuriose Route des L-Trains, und wenn der F-Train an der Ecke Smith und 9th Street ans Tageslicht aufstieg und sich mir ein unerwarteter Blick auf das dampfende Brooklyn mit seinem Gewirr aus aufragenden Betonblöcken, Lagerhäusern und Plakatwänden bot, merkte ich, dass ich aus dem Fenster lächelte. In einem der Wagen sitzend oder stehend, vom Anhalten und Abfahren gerüttelt und geschüttelt, huldigte ich den omnipräsenten Graffiti, nicht wegen ihrer Schönheit, sondern wegen ihres aufrührerischen Geistes – ein Geist, den ich für meine eigenen künstlerischen Zwecke aufzusaugen und nachzuahmen hoffte. Ich hatte meine Freude an den quietschenden Zügen und an der Stimme des Mannes, dessen Ansagen zu einem unverständlichen, aber sonoren Kratzen aus dem Lautsprecher wurden. Ich genoss den Druck der Menge, während ich in einem kollektiven Bewegungsschwall zur Tür hinausgedrängt wurde, und rezitierte Whitmans Zeilen «ich selbst unbeträchtlich, jeder Einzelne unbeträchtlich und doch Teil des Ganzen». Ich wollte Teil des Ganzen sein. Ich wollte jedermann sein. Ich lauschte all den Sprachen, die gesprochen wurden, manche erkennbar – Spanisch, Mandarin, Deutsch, Russisch, Polnisch, Französisch, Portugiesisch –, und manche, die ich noch nie gehört hatte. Ich schwelgte in der Vielfalt der Hautfarben um mich her, nachdem ich in Webster, Minnesota, von lutherischer Blässe und ihren entflammten Nuancen von Rosa über Rot bis zu sonnenverbranntem Farmerbraun so übersättigt worden war, dass es mir für den Rest meines Lebens reichte.
Ich studierte die Penner, Bettler und Bag Ladies in verschiedenen Stadien ihres Abstiegs zu den Demütigungen der Straße. Jahre vor meiner Ankunft in New York hatten die damaligen Machthaber die Türen der psychiatrischen Abteilungen geöffnet und deren Patienten in eine zweifelhafte Freiheit entlassen. Verrückte schlichen auf den Bahnsteigen herum und kratzten an ihrem Grind. Manche brüllten Verse. Manche sangen, jammerten oder predigten vom Kommen Jesu oder von Jehovahs Zorn, und manche saßen still in dunklen Ecken, nur mehr Hüllen der Verzweiflung. Ich atmete den Gestank ihrer ungewaschenen Körper, ein für mich völlig neuer Geruch, und hielt die Luft an.
Der Reim auf die Straßen von Manhattan würde warten müssen. Wie sich ein Viertel zum anderen verhielt, konnte auf dem Stadtplan, den ich mit mir herumtrug, nachvollzogen werden, aber das hatte noch keine sinnliche Logik. Wenn ich die Stufen hinaufsprang in die Sonne und das Menschengewimmel, wenn meine Schuhe auf den gebackenen Asphalt und den schmelzenden Teer trafen und ich inmitten des Stimmengewirrs, zwischen Verkehrslärm und allgemeinem Getöse die Kakophonie der Musik aus Ghettoblastern hörte, die auf Schultern oder wie Koffer an Oberschenkeln hin und her schwingend getragen wurden, dann bekam ich eine Gänsehaut, mein Kopf fühlte sich leicht an, und ich rüstete mich für den bevorstehenden Angriff auf die Sinne. Ich erinnere mich an meinen ersten Gang durch die zudringliche, beißend riechende Canal Street, die an den Füßen hängenden gebräunten Enten hinter fettigem Glas, die Wannen mit glänzenden ganzen Fischen, die Körbe und Kartons voller Körner und Gemüse, und die Früchte, deren Namen ich erst später lernen würde: Karambole, Mangostane, Brotfrucht oder Longan.
Dann das schmuddelige Vergnügen der Spaziergänge über den Times Square – die Kunden anlockenden Schilder mit X und XX, XXX und Burlesque, auch Burlesk oder (bedingt durch ein heruntergefallenes l) Bur-esk buchstabiert, Peepshows, das Paradise Playhouse, Filthy’s und Circus Circus mit Girls live auf der Bühne für nur 25 Cent und 10 $ «komplett», die Silhouetten nackter Frauen mit vorspringenden Brüsten und langen Beinen über den Leuchtschriften, der Anblick von Pizzerien, Spielhallen und trostlosen kleinen Wäschereien mit hoch aufgetürmten, braun verpackten zugeschnürten Bündeln, dazu der Müll, der aufwirbelte und durch die Luft flog, wenn der Wind blies, Kümmelblatt-Betrüger, die sich auf dem Gehweg niederließen, um die Trottel abzuzocken, und Männer mit vor Hitze bis zum Ellbogen aufgekrempelten Hemdsärmeln, die, einen Moment gebannt von der Verheißung wackelnden Fleisches und schneller Erleichterung, stehen blieben, ehe sie entweder hineingingen, um sich ein bisschen befriedigen zu lassen, oder, sich nach links oder rechts wendend, weiterzogen.
Ich erforschte das Greenwich Village wegen seiner Boheme-Mythologie, auf der Suche nach der brillanten Dada-Truppe. Ich hielt Ausschau nach Djuna Barnes und Marcel Duchamp, nach Berenice Abbot, Edna St. Vincent Millay und Claude McKay, nach Emmanuel Radnitzky alias Man Ray. Ich hielt Ausschau nach William Carlos Williams und Jane Heap, nach Francis Picabia und Arthur Craven und der erstaunlichen Person, die im Zuge meiner Dada-Forschungen aufgekreuzt war, einer Frau, die ich bis in die Archive der University of Maryland verfolgt hatte, wo ich drei Tage lang ihre zum großen Teil unveröffentlichten Gedichte mühselig mit Bleistift abschrieb: der Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven, geborene Elsa Hildegard Plötz, Künstlerin als Urpunk, als Ihr-könnt-mich-mal-Aufrührerin, die mit Vogelkäfigen auf dem Kopf und Scheinwerfern auf den Hüften posierte und Gedichte schrieb wie Heulen und Rülpsen, das tief aus dem Zwerchfell kam.
«Kein Mensch fragt nach diesen Sachen», sagte mir die Archivarin, bevor sie die Kästen hervorzog. Dann bin ich also kein Mensch, dachte ich. Die Dokumente der Baroness waren 1970 nach Maryland gelangt, weil Djuna Barnes, die Verfasserin des berauschenden Romans Nachtgewächs, die Briefe, Manuskripte und Zeichnungen ihrer toten Freundin gerettet und in ihrer New Yorker Wohnung aufbewahrt hatte. Als die Universität Barnes’ Nachlass erwarb, kam die Baroness gleich mit. Stunde um Stunde saß ich über Elsas linierten und unlinierten vergilbenden Seiten, studierte einen Entwurf nach dem anderen eines einzigen Gedichts, bis ich benebelt war und mir die Augen weh taten. Am Ende des Tages saß ich auf dem Bett meines Zimmers im Holiday Inn, um nachzulesen, was ich aufgeschrieben hatte, und zu spüren, wie das perkussive Rucken und Zucken der Baroness meinen Körper erschütterte. Sie lebte in den Blättern, die ich nach New York mitnahm, aber downtown gab es keine Spur von ihr. Sie war nicht mal ein Geist. Nichts von ihr war in den engen, schräg verlaufenden Seitenstraßen des Village geblieben.
Die Christopher Street vibrierte damals, ein Open-Air-Theater, das ich gern inkognito durchstreifte, wobei ich in Schaufenstern verstohlen erotische Requisiten und Kostüme einer Art betrachtete, von deren Existenz ich irgendwie gewusst, die ich aber nie gesehen hatte, und ich fragte mich, was mein alter Freund Pastor Weeks wohl von alldem gehalten und dazu gesagt hätte, wenn er neben mir hergegangen wäre, und antwortete mir mit den Worten, die er gewählt haben würde: «Wir sind alle Brüder und Schwestern im Herrn.» Ich bewunderte die stolzen, wie Zwillinge aufgemachten Paare, schlank und gepflegt, in abgestimmten Jeans, hautengen T-Shirts und perfekter Körperhaltung mit einem kleinen Hüftschwung und vielleicht einem Hund an der Leine zwischen sich, während sie dahinschlenderten, um mit ihrer vollkommenen Schönheit zu prahlen, und ich mochte die großgewachsenen «Mädchen» mit Boas und hohen Absätzen, und war bemüht, nicht die jungen Männer anzustarren, die ich im Stillen als «lederne Gefahr» titulierte, Muskelprotze in schwarzer Montur mit silbernen Nieten und Beschlägen und einer intensiven Mimik, bei der ich die Augen senkte.
Ich drückte mich in Buchhandlungen herum, im Coliseum und im Gotham Book Mart, bei Books and Company und im Strand. Im Eigth Street Bookshop kaufte ich Some Trees von John Ashbery, las es in der Bahn und dann wieder und wieder laut bei mir zu Hause. Ich entdeckte den National Bookstore am Astor Place, der vollgestopft war mit verlockenden wissenschaftlichen Büchern, in Plastik verpackt, um das Befingertwerden durch Leute wie mich zu verhüten, und überwacht von einem weißhaarigen Tyrannen, der mit seinem pochenden Bleistift die Zeit vorgab und losbellte, wenn man zu lange bei einem Buch verweilte, und ich musste ja sparen, deshalb ging ich gewöhnlich mit leeren Händen hinaus, aber der alte Salter, auch nicht gerade der Freundlichste, ließ mich in seinem Buchladen, der direkt gegenüber der Columbia in meinem Viertel lag, auf dem Fußboden sitzen, und dort las ich gegen ein Regal gelehnt so lange, bis ich wusste, dass ich dieses oder jenes Buch wirklich haben wollte, zumeist von Dichtern, die mir neu waren, und bevor das Jahr um war, hatte ich die ganze New York School of Poets und noch mehr gekauft, mehr von Ashbery wie auch von Kenneth Koch, Ron Padgett, James Schuyler, Barbara Guest und Frank O’Hara, der zwölf Jahre, bevor ich kam, auf Fire Island von einem Strand-Buggy getötet worden war. Und ich erinnere mich noch immer an Guests Worte, die mich dazu bewegten, ihr Buch zu kaufen: «Die Distanz zwischen Charakteren verstehen.» Das versuche ich bis heute.
Und wenn ich wollte, dass die Stadt Pause machte, sprang ich die Stufen zwischen den steinernen Löwen hinauf, schritt durch die Türen der New York Public Library und ging schnell in den großen, eines Königs würdigen Lesesaal, setzte mich an einen der langen Holztische unter der gewaltigen Gewölbedecke, von der hoch über meinem Kopf ein Kronleuchter herabhing, und während das stille Tageslicht durch das große Fenster auf mich fiel, bestellte ich ein Buch, und dann las ich stundenlang und fühlte mich, als wäre ich ein Wesen reiner Möglichkeit geworden, ein Körper, der sich in einen verzauberten Raum endloser Ausdehnung verwandelt hatte, und so, beim eintönigen Rascheln umgeblätterter Seiten, beim Husten und Schniefen und hallenden Schritten in dem riesigen Saal und gelegentlich ungezogenem Geflüster dort sitzend und lesend, fand ich Zuflucht im Rhythmus des jeweiligen Geistes, den ich für die Dauer des Lesens entlehnt hatte, in Sätze vertieft, die ich nicht geschrieben oder erdacht haben könnte, und selbst wenn der Text abstrus, verkorkst oder mir zu hoch war, und davon gab es viele, hielt ich durch, machte mir Notizen und begriff, dass meine Mission eine von Jahren, nicht Monaten war. Wenn ich mir den Kopf mit der Weisheit und Kunst aller Epochen füllte, würde ich im Lauf der Zeit, Buch um Buch, zu der Riesin anwachsen, die ich sein wollte. Obwohl Lesen Konzentration verlangt, war diese nicht so fordernd wie die auf der Straße, und ich konnte mich im Lesesaal entspannen. Ich atmete gleichmäßig. Meine hochgezogenen Schultern sanken herab, und oft ließ ich meine Gedanken versonnen mit einem einzelnen Satz spielen. «Die Unvernünftigkeit einer Sache ist kein Argument gegen ihre Existenz, sondern eher eine Voraussetzung dafür.» In der Bibliothek hatte ich Flügel.
Bevor ich das Gebäude verließ, machte ich immer Halt beim Slawischen Lesesaal, öffnete die Tür und warf einen Blick auf die alten Männer, die aussahen wie Elfenbeinschnitzereien ihrer selbst, mit einer Haut von der Farbe grau getönter Eierschalen und langen Bärten in einem blasseren Ton desselben Graus. Sie trugen Schwarz und schienen auf den ersten Blick reglos über den alten Büchern zu sitzen. Nur ihre langen Zeigefinger bewegten sich bedächtig beim Umblättern der Seiten, eine gleichförmige Geste, die mir bewies, dass die Statuen lebendig waren. Die alten Männer müssen jetzt lange tot sein, und der Slawische Lesesaal existiert nicht mehr, aber ich versäumte es nie, hineinzuschauen und diesen speziellen trockenen Geruch alter Gelehrter und wertvollen Papiers zu atmen, in dem mir eine leichte Spur von Weihrauch und der mystischen Philosophie des vorrevolutionären Wladimir Solowjow enthalten zu sein schien. Ich traute mich nie über die Schwelle.
Die Bibliothek ist ein amerikanischer Palast, mit Lennox- und Astor-Geld erbaut, um dem hochnäsigen europäischen Geld zu zeigen, dass es uns nicht das Wasser reichen kann. Aber eins muss ich sagen: Niemand musterte mich abschätzig von oben bis unten, stellte mich mit einem Intelligenztest auf die Probe oder kontrollierte meinen Kontostand, ehe ich durch die Tür ging. In Webster, Minnesota, gab es keine richtig reichen Leute. Wir betrachteten einige Truthahnfarmer und Ladenbesitzer als reich, sowie Ärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte und Professoren, denen, so bescheiden ihr Einkommen auch sein mochte, aufgrund ihrer Jahre an der Universität ein Klassenbonus zugestanden wurde, oft zum Groll der armen Farmer, Mechaniker und zahlloser anderer innerhalb und außerhalb der Stadt, die keine Buchstaben vor ihren Namen hatten. In New York jedoch war Geld zum Begaffen da. Es schlenderte über die Fifth und die Park Avenue, allein oder paarweise, und es lachte und plauderte hinter den Scheiben von Restaurants an Tischen mit Weinflaschen und niedrigen Kerzen auf glatten, weißen Damastdecken. Es entstieg Taxen in Schuhen, deren Sohlen nie einen Gehweg berührt zu haben schienen, und es ließ sich anmutig auf die Rückbank chauffierter Limousinen fallen. Es funkelte in den mit Uhren, Ohrringen und Schals dekorierten Auslagen von Geschäften, die zu betreten ich zu schüchtern war. Und ich musste einfach an Jay Gatsbys schöne Hemden in vielen Farben und die dumme, leere Daisy denken, und an das traurige grüne Licht. Und ich dachte auch an Balzac, wie sollte man nicht, an die schmutzige, glanzvolle menschliche Komödie, und an Proust, seine Diners im Ritz mit den Freunden, denen er so erschreckend genau ihre Charakterzüge raubte, und Odettes «kleinen Clan», der zwar klein, aber nicht fein, sondern eigentlich vulgär war, und ich kämpfte darum, mich über das alles erhaben zu fühlen, meine eigene Figur zu sein, jene vornehme, junge, wenngleich arme Person mit dem erlesenen, verfeinerten literarischen und philosophischen Geschmack, doch in dem Geld, das ich sah, steckte Macht, eine brutale Kraft, die mich erschreckte und auf die ich neidisch war, weil sie mich in meinen eigenen Augen kleiner und jämmerlicher machte.
Ich bin noch immer in New York, aber die Stadt, in der ich damals lebte, ist nicht die Stadt, die ich jetzt bewohne. Das Geld rollt wie gehabt, doch sein Glanz hat sich über den gesamten Bezirk Manhattan ausgedehnt. Die verblassten Schilder, zerfledderten Markisen, abblätternden Plakate und dreckigen Klinker, die den Straßen meiner alten Nachbarschaft auf der Upper West Side ein allgemein unübersichtliches, trübes Aussehen verliehen, sind verschwunden. Wenn ich mich jetzt an den alten Orten befinde, sehe ich mich mit den gefestigten Konturen bürgerlichen Aufstiegs konfrontiert. Eine lesbare Beschilderung und klare, saubere Farben haben die frühere visuelle Düsternis ersetzt. Und die Straßen haben ihre Gefährlichkeit verloren, diese allgegenwärtige, wenn auch unsichtbare Bedrohung, es könnte jederzeit Gewalt ausbrechen, sodass eine defensive Haltung und entschlossenes Gehen nicht optional, sondern notwendig waren. In anderen Teilen der Stadt konnte man 1978 den schlendernden Schritt des Flaneurs pflegen, aber nicht hier. Binnen einer Woche hatten meine Sinne eine Schärfe gewonnen, die sie zuvor nie gebraucht hatten. Ich rechnete immer mit dem plötzlichen Quietschen, Jaulen oder Krachen, mit der jähen Bewegung, dem wankenden Gang oder dem anzüglichen Grinsen eines sich nähernden Fremden, mit dem undefinierbaren Odeur von Irgendetwas-stimmt-nicht-ganz, der hier und da waberte und mich veranlasste, meine Schritte zu beschleunigen oder mich in eine Bodega oder einen koreanischen Gemüseladen zu verdrücken.
Ich führte in jenem Jahr Tagebuch. Darin fand ich meinen Helden, den Homunculus meiner vagabundierenden Gedanken, und ich probierte in dem Notizbuch Passagen seines Romans aus. Ich kritzelte und zeichnete und vermerkte zumindest einiges von meinem Kommen und Gehen, meinen Gesprächen mit anderen und mit mir selbst, doch das schwarzweiße Mead-Heft mit dem Bericht über mein früheres Selbst verschwand, kurz nachdem ich die Seiten vollgeschrieben hatte. Und dann, vor drei Monaten, fand ich es ordentlich verpackt in einer Kiste mit Krimskrams, den meine Mutter aufgehoben hatte. Ich musste wohl ein anderes Heft angefangen und das alte im Sommer 1979 nach einem Besuch bei meinen Eltern dort gelassen haben. Als ich das an einer Ecke leicht zerknitterte Notizbuch mit dem absurden handschriftlichen Titel Mein neues Leben auf dem Deckel unter einer Schachtel mit unsortierten Fotos erblickte, begrüßte ich es, als wäre es ein geliebter Verwandter, den ich für tot gehalten hatte: zuerst das Wiedererkennen, bei dem mir der Atem stockte, dann die Umarmung. Erst Stunden später zeitigte das Bild von mir mit an die Brust gedrücktem Notizbuch die lächerliche Wirkung, die es sicher verdiente. Dabei war das zweihundert Seiten dicke Büchlein von unschätzbarem Wert, einfach weil es das, woran ich mich nicht oder falsch erinnerte, mit einer Stimme, die zugleich meine und nicht ganz meine ist, mal mehr, mal weniger zurückbrachte. Es ist komisch. Ich dachte, ich hätte jeden Eintrag mit «Liebe Seite» begonnen, einer Anrede, die ich damals witzig fand, tatsächlich aber nannte ich meinen imaginären Gesprächspartner bei mehreren Namen und manchmal bei gar keinem.
Meine Schwester und ich gingen das ganze Hab und Gut unserer Mutter durch, weil sie aus der unbetreuten Fünfzimmerwohnung auszog, die sie nach dem Tod unseres Vaters fast ein Jahrzehnt bewohnt hatte. Ihr Ziel war ein Einzelzimmer im Flügel für Betreutes Wohnen derselben Seniorenanlage, was bedeutete, dass wir nur Meter, keine Kilometer zurücklegen mussten, aber der Umzug erforderte eine drastische Verringerung ihrer Besitztümer. Obwohl kein fröhliches Ereignis, war der Wechsel weniger schmerzlich, als er hätte sein können, da unsere zweiundneunzigjährige Mutter zwischen ihren neuneinhalb Jahren «Unabhängigkeit» und dem neuen Wohnort, der «Betreuung» einschloss, die schwache, bettlägrige Bewohnerin des als «Pflegestation» bekannten dritten Flügels der Einrichtung gewesen war. Zehn Monate zuvor hatte der behandelnde Arzt sie für so gut wie tot erklärt, natürlich ohne diese Worte zu gebrauchen. Dr. Gabriel hatte uns gesagt, wir müssten uns auf ihr Ableben vorbereiten, natürlich ohne auch dieses Wort zu benutzen. Stattdessen hatte er uns letztes Jahr Anfang Oktober eindringlich gebeten, uns auf ein «frühes Weihnachten» einzustellen, Weihnachten Ende Oktober oder Anfang November, was heißen sollte, dass unsere Mutter im Dezember wohl kaum noch irgendwo auf Erden sein würde, wenn sie also noch ein bisschen Freude an ihrem Lieblingsfest haben wollte, sollten wir uns besser damit beeilen.
Obwohl keine von uns beiden ihm darauf antwortete, fanden wir den Vorschlag absurd, das Kalenderjahr zu türken, um es dem wahrscheinlichen Tod unserer Mutter anzupassen. Die Monate folgen einander einer nach dem anderen, und wenn sie im Oktober oder im November sterben sollte, würden wir nicht so tun, als wäre an Halloween oder Thanksgiving Weihnachten, und wenngleich unsere Mutter die Zeit im Allgemeinen durcheinanderbrachte und die Serie der Notfälle vergessen hatte – den gebrochenen Fuß, den gebrochenen Arm, die kongestive Herzinsuffizienz, die Pseudogicht, die ihre dünnen Beine zu entsetzlichen roten Kloben anschwellen ließ, und schließlich die Infektion, die in ihre Blutbahn gelangte und bewirkte, dass sie tote Freunde und Kinderchöre halluzinierte und Elfen mit Zylinderhüten sah, die ihr von draußen vor dem Fenster zuwinkten –, hätte sie unser Schummeln mit den Jahreszeiten doch aufs schärfste missbilligt. Sie hat sich immer für «philosophisch» gehalten. Ihre eigenwillige Definition des Wortes lautet: Wir alle leiden, und wir alle sterben. «Sag nie ‹entschlafen› für ‹sterben›», bläute sie mir ein, als ich elf war. «Menschen sterben. Sie lösen sich nicht in Luft auf.»
Unsere Mutter erlebte Halloween, sie erlebte Thanksgiving, sie erlebte Weihnachten und Ostern, und als der Sommer gekommen und gegangen war und die Blätter der Bäume jenseits der Pflegestation allmählich rostbraun wurden, lag sie nicht mehr im Sterben, und da sie sich von der letzten Schwelle zurückgezogen hatte und die Verwaltung der Pflegestation ihr Bett für jemanden brauchte, der wirklich an der «Pforte des Todes» (auch dies nie ausgesprochene Worte) stand oder vielmehr lag, stuften sie sie in Betreutes Wohnen hoch, stimmten aber nicht der Rückkehr in ihr altes unabhängiges Quartier zu, was sowohl den Umzug als auch meine Entdeckung des Notizbuchs und das Schreiben dieses Buchs beschleunigte.
Meine Mutter hat sich inzwischen gut in ihrem neuen Zimmer eingelebt, und es würde mich nicht wundern, wenn sie noch weitere zehn Jahre lebte, aber sie vergisst. Sie vergisst, was ich ihr eben am Telefon gesagt habe. Sie vergisst, wer gerade mit einer Tablette, einem Glas Wasser oder getoastetem Rosinenbrot in ihr Zimmer gekommen war. Sie vergisst, dass sie die Tablette gegen ihre Arthroseschmerzen eingenommen hat, und sie vergisst, ob irgendjemand zu Besuch da war, und spricht mit mir stattdessen über die Orchideen auf ihrer Fensterbank. Sie beschreibt die Farben und wie viele Blüten an den einzelnen Zweigen übrig sind und wie das Licht darauf fällt, «ein paar Wolken heute, deswegen ist das Licht gleichmäßig». Sie ist wortgewandt und erinnert sich an vieles in ihrem Leben, besonders an ihre Kindheit und Jugend, und kommt dieser Tage gern auf die alten Geschichten zurück. Gestern erzählte sie mir eine meiner Lieblingsgeschichten, die ich als Kind immer wieder von ihr erzählt bekommen wollte. Sie und ihr Bruder hatten das Gesicht von Eva Harstad am Fenster im ersten Stock des Hauses, in dem sie aufgewachsen war, am Ende der Maple Street in Blooming Field gesehen. «Oscar und ich gingen bei Sonnenuntergang nach Hause. Am Himmel waren rosa Streifen und ein seltsames Licht. Wir sahen sie beide am Fenster. Unmöglich, wie du weißt, denn sie hatte sich ein Jahr zuvor erhängt, die arme Eva. Wir kannten sie nicht gut. Es war ein Kind unterwegs, verstehst du. Niemand fand je heraus, wer der Vater war. Ihr Tod hatte jeden in der Stadt, der nicht böswillig, scheinheilig oder heuchlerisch war, traurig gemacht, aber da war sie mit ihrem langen blonden Haar, das ihr ums Gesicht hing. Ich weiß, ich habe es dir schon oft erzählt, aber mit ihren Lippen stimmte etwas nicht. Sie bewegte sie wie verrückt, so wie manche Sänger sich den Mund aufwärmen, um ihn aufs Singen vorzubereiten, doch es kam kein Ton heraus. Wir rannten nicht weg, aber das Blut gefror uns in den Adern, wenn du weißt, was ich meine. Wir gingen schnell. Oscar mochte nie daran erinnert werden. Ich glaube, es hat ihn mehr erschreckt als mich. Ich sollte ihn fragen. Nicht wahr? Wo ist Oscar denn jetzt?» Onkel Oscar ist 2009 gestorben. An manchen Tagen ist meine Mutter sich darüber im Klaren, an anderen nicht.
Die Vergangenheit ist fragil, fragil wie Knochen, die mit dem Alter brüchig geworden sind, fragil wie an Fenstern gesehene Geister oder wie Träume, die beim Aufwachen zerfallen und nichts hinterlassen als ein Gefühl des Unbehagens oder der Bedrängnis oder, seltener, eine Art unheimliche Befriedigung.
Liebe Seite,
wie habe ich auf dieses Jetzt gewartet, das Jetzt, das verschwinden wird, wenn ich es nicht packe, schüttele und seine berstende Präsenz entlade.
Mein heldenhafter Junge ist in nur wenigen Tagen mehr geworden als ein Impuls! Er hat eine Gestalt, groß und dünn, und einen festen Wohnsitz – nebensächlich für die Belange der meisten. So sind wir uns also ähnlich, er und ich. Ian Feathers. Seine Initialen: I.F., wie «if» oder «wenn» … eine konjunktivische Figur mit Flügeln und Flugfähigkeit, aus Federn, Stiften und Schreibmaschinen. Mein Ritter aus dem Mittelwesten, benebelt von Detektivgeschichten und den Versuchungen der Logik.
Und etwas Seltsames: Meine Nachbarin nebenan psalmodiert jeden Abend. Vielleicht ist sie eine Hare-Krishna-Jüngerin, oder sie gehört zur Sekte dieses dumm aussehenden, fetten Maharadscha-Jungen, dessen Bild ich mehrfach gesehen habe. Sie sagt bindau, bindau, bindau, immer und immer wieder. Gestern unterbrach sie ihr Bindau-Gejammer und sagte laut: «Sie wollten jemand anders.» Das Leid in ihrer Stimme schnürte mir einen Moment die Kehle zu. Ich konnte nicht umhin, mich zu fragen, wer «sie» waren, und der Satz geht mir immer noch nach. Als hätte er irgendeine besondere, schreckliche Bedeutung. Ich glaube, sie hat wohl mitten in der Nacht auch gejault und geröchelt, aber ich war nicht wach genug, um die Laute zu verfolgen.
Ian Feathers las als Kind so viele Detektivromane, dass seine Mutter sich Sorgen machte, seine Augen würden vor Überanstrengung blind werden und seine der Sonne entzogenen Glieder vor Bewegungsmangel verkümmern. Mr. und Mrs. Feathers glaubten, wie vor ihnen die Griechen, an «Mäßigung in allen Dingen». Die amerikanische Version dieses antiken Sinnspruchs lautete «ausgewogen». Die Feathers liebten ihren großen, dünnen, kurzsichtigen, gefräßig lesenden Jungen, aber sie gaben sich große Mühe, ihn zurechtzustutzen und zu formen – zu seinem eigenen Besten. Wie alle gottesfürchtigen Midwesterner wussten sie, dass der ideal ausgewogene Junge nie zu viel von irgendetwas hatte. Er tat sich in der Schule hervor, aber nicht so sehr, dass man ihm geistige Verschrobenheit vorwerfen konnte. Hin und wieder ließ er sich in eine Auseinandersetzung verwickeln (um zu beweisen, dass er Schneid hatte), aber der Zoff, in den er geriet, war nie schlimm und führte gewöhnlich zu einer Prügelei mit einem weniger als ideal ausgewogenen Jungen. Sein moralischer Kompass war genau nach Norden ausgerichtet, schwankte aber regelmäßig, weil niemand Streber mag. Er war selbstverständlich bescheiden, wohlwollend gegenüber den vielen Unterlegenen und eher groß, aber nicht zu groß. In Ians Teil der Prärie und Amerikas im Allgemeinen verstand es sich in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts von selbst, dass der ideal ausgewogene Junge weiß war (auch wenn er im Sommer hübsch bräunte), nicht-fanatischer Christ und, wie jedenfalls in der Unterhaltungsliteratur dargestellt, rotblondes Haar und hundert Prozent Sehkraft hatte. Wenn dem idealen Jungen eine Temperatur zugeteilt werden müsste, wäre es lauwarm. Tatsächlich stand diesem Ausbund an Mittelmäßigkeit nur eine Arena des Extremen offen, eine, die sogar die Griechen gebilligt hätten: Sport.
Obwohl Ian, um seine Eltern zu erfreuen, von Zeit zu Zeit eine angenehme Ausgewogenheit anstrebte, zumindest den Anschein davon, gehörte seine Leidenschaft für mysteriöse Sachlagen, ungelöste Verbrechen, Diebstahl, Raubüberfall und Mord, insbesondere Mord, in die unamerikanische Kategorie des Zuviel. Ians «wirkliches» Leben wurde in Büchern gelebt, nicht außerhalb von ihnen. Dabei war die Grenze zwischen innerhalb und außerhalb der Buchdeckel nicht entscheidend. Morde kamen in Feathers’ Heimatstadt Verbum, Minnesota, selten vor, doch Ian trainierte hart für den künftigen Fall. Er studierte die Anordnung von Fusseln und Falten auf Jackenärmeln und Hosenbeinen und registrierte die Katzen- und Hundehaare an Haustierbesitzern. Er untersuchte die Sohlen von Schuhen (ob potenzielle Verdächtige sie nun trugen oder nicht) auf Schmutz, Rückstände und Kaugummi. Er notierte die verschiedenen Stärken menschlicher Transpiration und ihrer Wirkung auf den Achselbereich von Hemden. Stundenlang prägte er sich Reifenspuren von Fahrrädern, Abschleppwagen, Kombis und Pick-ups ein. Er begann Persönlichkeitsmerkmale aus Zigarettenkippen herauszulesen, zum Beispiel denen, die in zwei Hälften zerdrückt waren, im Gegensatz zu solchen, die in einem Aschenbecher zu nichts verglühten. Der Junge lebte in einer vollständig aus Hinweisen bestehenden Welt.
Liebenswürdig nahm Ian über die Jahre die Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke seiner Eltern an, die seinen Fanatismus umlenken sollten – den Basketball (in den sie wegen der überragenden Statur ihres Sprösslings große Hoffnungen setzten), den Baseball samt Schläger; ihre späteren Gaben Tennisschläger, Skier, Badehose und Taucherbrille; und ihren letzten Versuch in Richtung des Anderen, der er, wie sie hofften, werden könnte – ein Federballnetz und -bälle –, doch Ian weigerte sich nicht nur, Sport zu treiben, er mochte ihn nicht einmal. Wäre er eine geometrische Figur und kein Junge gewesen, dann ein großes Kuboktaeder mit vielen vorstehenden Punkten, Punkten, die er schärfte, seit er seine Berufung im Leben durch jenes unnachahmliche Genie der Analyse und Logik entdeckt hatte, den glänzenden S.H.: Sherlock Holmes.
Jahrelang erinnerte ich mich an meine ersten Wochen in New York als an die Periode von Niemand Wirklichem. Ich wusste, ich hatte mit dem aus Fleisch und Blut bestehenden Mr. Rosales gesprochen, den ich immer mit einem «Hallo» begrüßte, aber so oft ich mit ihm sprach, schossen seine Augen in alle Richtungen und senkten sich dann zu Boden. Ich glaube, er war besorgt, ich könnte Reparaturen von ihm verlangen. Ich las Gedichte, Romane und Philosophiebücher, in denen überall in der einen oder anderen Form Menschen vorkamen, und mein Held begann sich langsam zu finden, genauso wie seine hochwichtige Vertraute, sein Sancho, sein Watson: Isadora Simon, I.S., im Englischen die Initialen des Seins – Gegenwartsform. Ich durchstreifte Manhattan, aber ich hatte keine Freunde oder Bekannte. Wenn ich die Geschichte meiner Initiation ins Stadtleben erzählte, sagte ich immer: «Ich war wohl eine der wenigen, die nach New York gezogen sind und keine Menschenseele kannten.» Das stimmt. Keine Freunde, keine Freunde von Freunden, keine Cousinen vierten Grades und deshalb keine Telefonnummer, die ich hätte anrufen können. Dann fügte ich, auf eine ergreifende Wirkung aus, noch hinzu: «Die ersten drei Wochen habe ich mit niemandem gesprochen.» Das erweist sich nun als eklatant falsche Angabe, obwohl ich nie die Absicht hatte zu lügen.
Heute Nachmittag war ich wieder im Hungarian Pastry Shop, meinem neuen Lieblingslokal. Las zwei Stunden bei einem Kaffee mit Gratisnachschank. Rauchte zu viel. Buch: Bergsons Das Lachen. Ein Essay über die Bedeutung des Komischen. Machte Notizen und begann dann Gespräch mit Mädchen namens Wanda – große Augen, kleiner Mund, dunkelblondes Haar, studiert russische Geschichte an der Columbia. Wir diskutierten über Symbolismus. Ich redete viel, gestikulierte, platzte mit aufgestauten Gedanken heraus. Tage der Einsamkeit haben mich redselig gemacht. Symbolismus führte zu Abendessen im Ideal (kubanisch-chinesisch an der Ecke 107th und Broadway). Ich fragte sie nach Gogols Toten Seelen und Parataxe aus, sagte ihr, ich wünschte, ich hätte Russisch studiert, und dann stellte ich ihr Fragen zu ihr selbst, und nach einigen einleitenden Sätzen erzählte sie mir, dass ihre Mutter voriges Jahr einen Schlaganfall erlitten hatte. Die linke Gesichtshälfte hing schlaff herunter, ebenso der linke Arm, und auf derselben Seite zog sie das Bein nach. «Halbier mich einfach und rede mit der guten Seite», sagte sie zu ihrer Tochter, aber sie verschliff die Worte. Ein zweiter Schlaganfall brachte ihr den Tod. Trocken, ausdruckslos und starr erzählte Wanda mir die Geschichte mit einer völlig gefühllosen Stimme, aber ich bemerkte, dass sie mit der Wand hinter mir sprach, nicht mit mir, was, nahm ich an, eine Art war, dem Mitgefühl auszuweichen, das sich auf meinem Gesicht abgezeichnet haben musste. Es war peinlich, und ich glaube, sie bereute, es mir gesagt zu haben. Als sie die Geschichte zu Ende erzählt hatte, wurde sie rot. Sie musste sofort gehen. Ich verspürte den Drang, sie zum Abschied auf beide Wangen zu küssen, doch als ich ihre fest zusammengepressten Lippen sah, hielt ich mich zurück und brachte mein Gesicht nirgendwo in die Nähe des ihren. Wir schüttelten uns die Hand und tauschten Telefonnummern aus.
Ich habe keine Erinnerung an Wanda.
Ich erinnere mich an Ian Feathers, und er bleibt mir bis zum heutigen Tag eine liebe Erfindung, von der ich hoffte, sie würde sich über mich hinaus auf- und in die Welt schwingen, während Wanda nicht einmal ein verschwommenes geistiges Bild ist, und glauben Sie mir, ich habe versucht, ihre großen Augen, den kleinen Mund und das dunkelblonde Haar heraufzubeschwören, aber die Studentin russischer Geschichte entzieht sich meiner Erinnerung. Wie viele andere Menschen, Ereignisse, Gespräche und Geschichten über tote Eltern habe ich vergessen? Wie viele Wandas gibt es? Hunderte, würde ich vermuten. Das Gedächtnis ist nicht nur unzuverlässig. Es ist porös. So weit meine Erinnerung reicht, könnte eine Fremde jene Worte über Wanda geschrieben, oder mein früheres Selbst könnte die ganze Sache erfunden haben. Letzteres allerdings ist fraglich. Ich erinnere mich gut genug an mein jüngeres Selbst, um zu wissen, dass ich trotz meines heranreifenden Sinnes für Ironie ehrlich blieb, wenn es um tote Mütter ging.
Ich schwebe über dem Selbst, das Wanda kennenlernte und dann über sie schrieb. Ich bin irgendwo oben an der rissigen Decke des schäbigen, fast leeren Apartments, der Geist des Was-sein-wird, der mit einer Mischung aus Verwunderung und Mitleid auf die über ihr Heft gebeugte junge Person hinabblickt. Die Tagebucheinträge rufen mir in Erinnerung, dass ich damals rauchte – ich füge meiner mentalen Szenerie eine Zigarette hinzu und beobachte, wie der Rauch von dem weißen Glimmstängel zwischen ihren Fingern aufsteigt. Eine junge Frau sitzt rauchend da und produziert Prosa, eine Seite um die andere, manche gut, manche schlecht, aber bald verirrt sie sich in einem selbstgemachten Labyrinth, obwohl Feathers, der sich auch nicht sicher war, wohin sein Weg führte, ihr eine gewisse Hilfe bot.
Die Geschichte geht weiter.
Meinem Tagebuch zufolge begriff ich am 5. September, zwei Tage nachdem ich Wanda kennengelernt hatte, dass meine Nachbarin kein Mitglied einer fernöstlichen Sekte war. Ich schlief nicht gut. Wenngleich die schlimmste Hitze vorüber war, hatten sich die Räume des Apartments noch nicht abgekühlt, und meine Nächte waren erfüllt vom Lärm der Stadt, einem Krach, der einiger Gewöhnung bedurfte, da ich mit so andersartigen Geräuschen aufgewachsen war. Im Sommer reichte zu Hause eine einzige klagend neben meinem Ohr schwirrende Mücke, um mich wach zu halten, aber ich liebte es, dem Chor der Grillen in der Abenddämmerung oder den frühmorgens singenden Heuschrecken zu lauschen. Ich schlief bei ihren Gesängen und den unterschiedlich starken Winden, die Äste knacken und das hohe Gras draußen vor dem Haus flüstern ließen. Wenn die Junistürme kamen, donnerte es nahe, und es donnerte in weiter Ferne, und mein Herz pochte vor Aufregung, während der Himmel strömendes Wasser auf das Dach ergoss, und im Winter, wenn uns ein Schneesturm traf, lauschte ich seinem heiseren Brüllen, dem in Abständen folgenden Heulen und dann der fast lautlosen Stille – alles gelähmt, nur Sonne und Schnee. Aus meiner Beschreibung höre ich Nostalgie heraus, doch mit dreiundzwanzig war ich nicht nostalgisch. Ich begrüßte den städtischen Krawall. Meine Nachbarin beendete ihre Leier meistens gegen zehn, aber der Aufzug öffnete und schloss sich zu jeder Tages- und Nachtzeit, und vom Broadway schrillten Sirenen herüber. Ich hörte andere, aus angelehnten Fenstern und durch den Luftschacht getragene Stimmen. Die Fernseher meiner Nachbarn redeten und weinten und trällerten Werbesongs. Von der Straße drangen trunkene Rufe herein, und das gedämpfte, gutturale Rumpeln der Müllwagen weckte mich gegen fünf Uhr früh. Ich vernahm den Leerlauf der Motoren und dann das Geräusch über den Gehweg ratternder Metallcontainer. Eines Morgens hörte ich eine Frau schreien und setzte mich, noch im Halbschlaf, ruckartig im Bett auf, um zu lauschen. Erst am nächsten Morgen fragte ich mich, ob es nicht die Person nebenan gewesen war. In mein Notizbuch schrieb ich, der Schrei habe geklungen «wie ein Vorbote von Schrecken und Freude». Unter dieses romantische Gefasel kritzelte ich eine Zeile aus Baudelaires Fleurs du Mal: «Si le viol, le poison, le poignard, l’incendie …»
An dem Abend, auf den ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, saß ich an meinem Schreibtisch, starrte auf die Seite vor mir und grübelte über den vierzehnjährigen Ian und das Rätsel nach, das er lösen will: die häufig beobachtete Erscheinung des Gesichts von Frieda Frail am Fenster des Hauses, in dem sie ein Jahr zuvor an einem epileptischen Anfall gestorben war. Die Notiz, die ich für mich selbst ins Mead-Heft schrieb: «Ians Sherlock-Verehrung führt ihn geradewegs in die Welt der Aussagenlogik und der gültigen oder ungültigen Schlussfolgerung. Unser nicht-so-idealer Junge lebt dafür, Wahres vom Falschen zu scheiden, und beschäftigt sich eifrig mit den Formeln, den darin enthaltenen p’s und q’s und r’s, wie auch mit den Zeichen für nicht (¬), und (⋀), oder (⋁), wenn, dann (⇒) und wenn, und nur wenn (⇔). Er geht Schritt für Schritt vor. Seine Beweisführungen sind perfekt, aber unser Held wird sich von seinen Schlussfolgerungen irreführen lassen. Isadora Simon, Ians Watson, wird einen anderen, effektiveren Weg einschlagen.»
Während meiner Grübelei über Ian, Isadora und die symbolische Logik, mit der ich mich am College befasst hatte, hörte ich meine Nachbarin wieder zu ihrem Singsang anheben, bindau, bindau, bindau. Der Tonfall hatte etwas von einem Klagelied an sich, und ich merkte, dass die leidenden Wiederholungen in mir zu arbeiten begonnen hatten. Sie verlangsamten meine Gedanken und lenkten sie in Richtung von Unglück und Verletzung, als hätte jemand angefangen, mir systematisch die Brust mit Sandpapier abzureiben. Ich ging an die Wand, drückte mein Ohr daran, wünschte, ich hätte das alte Stethoskop, das mein Vater mir überlassen hatte, als ich zehn war, und das jetzt zu Hause in der obersten Schublade meiner Kommode lag, und horchte mit angespanntem, ganz auf die Beschwörungsformel eingestelltem Körper. «Bindau, bin-dau, bin-trau, bin trau, bin traurig.» Und so weiter, mit einer einzigen Variation: «Lucy ist traurig, ist traurig, bin traurig, bin traurig, bin traurig.» Das war schlimmer als ein Mantra. Ich wohnte neben einer Frau, die so traurig war, dass sie ihre Traurigkeit jeden Abend laut proklamierte. Ich konnte fast sehen, wie sie in ihrem Zimmer vor und zurück schaukelte. Ins Tagebuch schrieb ich: «Ich muss sie ausblenden. Habe beschlossen, ein billiges Radio zu kaufen und es abends anzustellen. Ich weiß, wenn sie so weitermacht, werde ich wahnsinnig. Ich stopfte mir Toilettenpapier in die Ohren und schlug Schaum.
«Schaumschlagen» war Code für selbsterzeugtes Tandaradei.
Ich masturbierte viel in jenen Tagen, aber damals war ich so diskret, dass es mir widerstrebte, meine onanistischen Phantasien zu Papier zu bringen. Diese Schamhaftigkeit ist verschwunden. Ich legte mich also rücklings auf die Schaumstoffmatratze meines selbstgebauten Plattformbetts aus weggeworfenen Apfelsinenkisten, die ich auf der Straße gefunden hatte, und einer maßgerechten Sperrholzplatte, schuf mir einen Liebhaber oder eine Liebhaberin, indem ich meine Hand je nach momentaner Präferenz seine oder ihre Hand werden ließ, und wand und wälzte mich keuchend in den Laken, die meine Mutter mir bei Sears gekauft hatte, während ein Fremder mit schwarzem Haar, das ihm in die Stirn fiel, betont schmalen Hüften und einem schönen runden Po den Schlafwagen eines Zuges von Berlin nach Paris betrat, sich unter mir entkleidete, nach oben in mein Stockbett kroch und meine Schultern gegen die harte Unterlage presste, und während er mich eingehend betrachtete, bemerkte ich den Glanz auf seiner Oberlippe, weil es warm war im Zug, und plötzlich drehte er mich um und fickte mich von hinten, und ich liebte es, oder ein blondes Mädchen, das aussah wie Marilyn Monroe, bestieg mich in demselben Abteil und knöpfte sich langsam die Bluse auf, derweilen der Waggon, in dem wir uns befanden, auf den Gleisen schaukelte und Pfiffe ertönten, und dann schob ich sie auf den Bauch, zog ihr den Slip herunter und ließ die Schönheit ihres prachtvollen Hinterns auf mich wirken, ehe ich in dieser oder jener Stellung ihre Klitoris befummelte, bis sie kam und ich kam – bis wir alle kamen, und manchmal, wenn ich mich für ein Trio entschieden hatte, alle zusammen im Chor. Ich nahm jede Rolle ein. Ich war Mann, und ich war Frau. Ich war Frau mit einem Mann oder auch Mann mit einer Frau und dann wiederum Frau mit einer Frau. Ich habe kein Problem, mich heute an die Masturbationsphantasien zu erinnern, da sie seltsam fixiert geblieben sind. Der Rest von mir ist gereift und hat sich verändert. Ich bin jetzt alt und weise, geläutert durch das, was die Jahre an Schmerzen und Verständnis bringen, aber die erotische Gymnastik, die sich damals in meinem Kopf abspielte, ist der heutigen erstaunlich ähnlich. Die Sexphantasie ist eine Maschine, kein Organismus. Ich habe noch immer eine Schwäche für Sex in Zügen. Es muss ihr Rhythmus sein.
«Mit dem Bücherschreiben ist es, wie wenn man ein Lied summt – wenn Sie nur im Ton bleiben, Madame, gleichviel, ob Sie einen hohen oder tiefen anschlagen.» Ich hatte das Zitat aus Leben und Ansichten des Tristram Shandy, Gentleman von Reverend Laurence Sterne über meinem Schreibtisch an die Wand geklebt, zur Inspiration und als pointierte Erinnerung daran, dass Romane nicht in einer einzigen Variante daherkommen. Wie meine Großtante Irma zu sagen pflegte: «Die Welt ist bunt.»
Als ich im kleinen Eingangsflur des Gebäudes auf dem Briefkasten für 2C nachsah, fand ich den Namen einer Einzelperson, L. Brite. Sicher stand L. für Lucy: Lucy Brite. Ein hübscher Name, der einer hübschen, wenngleich traurigen Frau gehören konnte. Brite erinnerte an «bright» und weckte Assoziationen an die Helligkeit der Sonne, aber auch an das blendend weiße Strahlelächeln einer Zahnpastareklame, das genaue Gegenteil von dem, was meine Nachbarin durch die Wand vermittelte. Es gibt auch eine metaphorische Helligkeit, wie im intellektuellen Glanz einer Person oder dem Einfall einer tollen Idee, konkretisiert durch das Bild einer über dem betreffenden Kopf hängenden Glühbirne, von der feine Linien ausgehen, die der Betrachter als Strahlen verstehen soll. Der Name inspirierte mich, und ich machte eine kleine Zeichnung von einer imaginären, in der Dunkelheit ihres Kummers glühenden Lucy. Ich hatte auch die Zeichnung vergessen, bis ich in meinem alten Notizbuch wieder darauf stieß.
Tagsüber sang meine Nachbarin ihre Traurigkeit nicht heraus. Sie klopfte und hämmerte an etwas herum, wovon ich annahm, es könnte eine kleine Schreinerarbeit sein, und während sie damit beschäftigt war, pfiff sie. Lucy Brite pfiff gut, eine Gabe, die mich an meinen Vater erinnerte, der beim Singen keinen Ton getroffen, aber jede Melodie perfekt gepfiffen hatte, worüber ich als Kind immer erstaunt gewesen war. Wie war es möglich, dass mein Vater in der Kirche mit einer so eintönigen Stimme Lieder brummte, dass ich mich zurückhalten musste, keine Grimassen zu schneiden, aber pfeifen konnte wie ein Himmelsbote? Das Pfeifen meines Vaters war eine Demonstration bester Laune, ein Zeichen, dass das Leben zumindest im Augenblick gut zu ihm war, was bedeutete, auch gut zu uns, seinen Kindern, den beiden Mädchen, die auf dem Rücksitz des Autos den wortlosen Interpretationen von «Camptown Races», «I’ve Been Working on the Railroad» oder «There is Power in a Union» lauschten, was wiederum erklärt, weshalb ich pfeifen mit einem Bild meines Vaters von hinten verbinde – dem dunklen Haarkranz unterhalb der Schädelglatze und den Ohren, «die schön flach an seinem Kopf anlagen», genau so, wie unserer Mutter zufolge Ohren liegen sollten.
Wir mochten es, wenn er pfeifend am Steuer des ersten Familienautos saß, an das ich mich erinnern kann, Clunky, ein braun-weißer Chevy von 1959 mit einer Beule im Kotflügel, die nie repariert wurde, weil sie «den einwandfrei schnurrenden Motor in keinster Weise störte». Mein Vater sah das leicht zerknautschte Blech aus einer rein utilitaristischen Perspektive, einer Sicht, die meine Mutter nicht teilte und noch immer nicht teilt. Vor jeder Autofahrt schielte sie entsetzt auf Clunkys Flanke, sagte aber nichts zu dem Affront gegen ihre ästhetischen Werte aus Respekt vor dem Patriarchen, der Priorität in allem hatte, was draußen war, angefangen mit der Garage (paradoxerweise, da sie praktisch doch eine Art Innenraum war), dem darin untergestellten Auto samt dem ganzen Werkzeug, das an den Wänden hing, bis hin zur Straße, zum Briefkasten und dann weiter in Richtung Stadt und darüber hinaus. Die einzige Ausnahme von der Draußen-Regel waren die Beete mit den Ringelblumen, Zinnien und Rosen, die sich an die Seite des Hauses schmiegten und ausschließlich unserer Mutter gehörten.
Als Kind dachte ich, die ganze Welt sei auf diese Weise organisiert, mit Müttern, die meistens drinnen, und Vätern, die meistens draußen sind, war mir jedoch nie ganz sicher, wie ich in dieses Schema passte oder wie meine Schwester Kari, die zwei Jahre nach mir geboren wurde, da hineinpassen sollte, denn Kari war eine radschlagende, über Zäune springende, auf Bäume kletternde Pferdeliebhaberin, die notfalls die Ehre der Familie verteidigen konnte. Ich sehe noch immer Daryl Stankeys Gesicht vor mir, wie er sich auf die Ellbogen hochrappelte und vom Schotter der Old Dutch Road, wo er durch Karis Schlag gelandet war, zu uns heraufstarrte. Ich sehe seine dreckigen, von Tränenspuren gestreiften Wangen und den Tropfen blassgrüner Rotze direkt unter seinem linken Nasenloch. Ich war so stolz. Obwohl die Anerkennung allein meiner Schwester gebührt, inspiriert mich das Bild des besiegten, heulenden Daryl bis heute. Es inspiriert mich genauso wie Shandys Abschweifungen, genauso wie Marilyn Monroe, genauso wie die beißende Prosa von Anne Conway, der Philosophin aus dem siebzehnten Jahrhundert, die ich kürzlich gelesen habe. Karis Faust traf Daryls Kinn, weil dieser den Arzt, der unser Vater war, einen «Quacksalber» genannt hatte.
In meiner Erinnerung sind jene Tage väterlichen Pfeifens warm, nicht kalt, und die Fensterscheiben des Autos bis zum Anschlag heruntergekurbelt, der Fahrtwind weht zu Kari und mir herein, und ich lasse nur meine Nasenspitze über die Schwelle, darauf bedacht, bloß nicht «den Kopf rauszustecken», denn ich weiß genau, das könnte mit Enthauptung enden. Wiederholt stellte ich mir vor, meinen Kopf an einen mit rasender Geschwindigkeit entgegenkommenden Lastwagen zu verlieren. Ich sah ihn auf die Straße fliegen, nachdem er sich vom Hals getrennt hatte – jetzt ein blutiger Stumpf an einem bedauernswerten Kleinmädchenkörper, der auf die Rückbank gekippt war, um sich nie mehr zu regen, und das qualvolle Mitleid, das ich für Kari, für meinen Vater und für meine Mutter empfand, die mit dem toten Ich in zwei schaurigen Teilen zurückblieben, löste Bauchkrämpfe und ein so intensives Gefühl von Schwäche und Übelkeit bei mir aus, dass ich mich auf dem Sitz vorbeugen, die Augen schließen und tief durchatmen musste, um wieder zu mir zu kommen. Die zugigen Wonnen, sich den Wind bei hundert Stundenkilometern wie verrückt ins Gesicht blasen zu lassen, wetteiferten mit meiner Einbildungskraft, die mir in mögliche Gräuel vorauseilte. Ich hatte meinen Drang nach augenblicklicher Befriedigung fest unter Kontrolle: Der Kopf blieb im Auto. Über meine Phantasien dagegen übte ich wenig oder gar keine Macht aus.
Es wäre falsch zu sagen, ich hätte mich an meinen Vater erinnert, als ich Zigaretten rauchend am Schreibtisch in der 109th Street saß und versuchte, meine Donquijoterie zu schreiben. Ich habe keine Erinnerung daran, damals an meinen Vater gedacht zu haben, und die Tagebucheinträge enthalten sehr wenig über meine Eltern. Die Pfeifverbindung zwischen dem ersten Mann in meinem Leben und meiner unsichtbaren Nachbarin kommt mir erst heute in den Sinn. Mein Vater ist mittlerweile seit zwölf Jahren tot, aber 1978 war er noch voller Energie, noch praktizierender Arzt, noch angewidert von den Republikanern. Sein Pfeifen war willkommen, denn er litt unter etwas, was seine Tante Irma «düstere Stimmungen» nannte, während derer er zu verschwinden schien. In diesen regelmäßig auftretenden Zuständen sah und hörte er niemanden von uns. Es kam mir vor, als gärte ein Aufruhr unausgesprochener Qualen in ihm, die mit Wucht aus ihm herauszuschießen drohten, als könnte mein Vater Lava spucken, aber er tat es nie.
Was genau er über die Tochter dachte, die in einer literarischen Mission von zu Hause fortgegangen war, bleibt sein Geheimnis, das er mit zahllosen anderen Geheimnissen auf dem Friedhof der St. Paul’s Church in Webster mit ins Grab genommen hat, aber ich vermute, dass er mein Schreibjahr missbilligte, ohne je ein Wort darüber zu verlieren. Als Sohn eines Landarztes, der zu Krankenbesuchen von Haus zu Haus gezogen war, im Sommer mit dem Auto und im Winter, wenn die Straßen vom Schnee blockiert waren, mit dem Pferdeschlitten, hatte mein Vater an ländlichen im Gegensatz zu städtischen Wahrheiten festgehalten, an der Idee von guter Nachbarschaft ohne Zäune, an Genügsamkeit im Krisenmodus der Großen Depression und einem Misstrauen gegenüber Reichtum, an der Vorstellung von Farmern und Arbeitern (und dem gelegentlichen Doktor), die sich zusammentaten, um eine bessere Welt zu schaffen, eher sozialistisch als kapitalistisch, an kollektiver Arbeit jeder Art, einschließlich Unkrautjäten der versammelten Familie im Gemüsegarten, und der immerwährenden Idee eines nützlichen Lebens. Kunst um der Kunst willen ergab für meinen Vater keinen Sinn.
Lucy Brite hatte eine Vorliebe fürs Pfeifen irischer Balladen, die im Allgemeinen traurig sind und von denen ich einige wiedererkannte. «The Wind that Shakes the Barley» gehörte dazu. Ihre Lieder troffen vor melodischer Sentimentalität, sodass ich auch ohne Texte unwillkürlich an hübsche Burschen und ertrunkene Liebchen denken musste, an verpasste Schäferstündchen und gewundene Straßen in jenem grünsten aller grünen Länder, das nie eingenommen wurde oder, wenn doch, dann nur um den Preis stolzer Rebellion und Tragödie, die in melancholischer Ausweglosigkeit endete, denn wenn die Jungen sterben, ob durch verlorene Liebe oder politischen Aufruhr, ist es schrecklich, und diese unausgesprochenen, aber melancholischen Motive verstärkten den Schmerz direkt unter meinem Brustkorb, den ich überall mit mir herumtrug, obwohl ich nie wusste, was ihn verursacht hatte – eine physische Erinnerung an meine Verletzlichkeit und unaufhörlichen Schuldgefühle, vermute ich, ein in den Köper implantiertes Andenken an unzählige namenlose Verletzungen, die mir in der Vergangenheit zugefügt worden waren und die ich anderen zugefügt hatte, Verletzungen, die sicher in Zukunft wiederkehren würden. In unseren westlichen Gesellschaften geistert die falsche Vorstellung herum, der Mensch sei ein Isolat, das über seinen oder ihren Weg entscheidet und allein vorwärtsstürmt. Tatsächlich sind wir immer irgendwo, und dieses Irgendwo ist immer in uns. Lucys ständiges «Bin traurig» zu hören war schlimm genug, aber Musik, sogar in Form klarer, dünner Pfeiftöne, geht tiefer. Musik dringt durch Haut und Muskeln und setzt sich schließlich in den Knochen fest. Sie kann eine Stimmung von Optimismus in Trübsinn kippen lassen und einen Gedanken von luftiger Kontemplation in hüftwackelnde, schweißnasse Lust treiben. Darin ist Musik wie das Wetter – Sonne gibt der Seele Auftrieb, und Regentage belagern sie mit düsterer Niedergeschlagenheit. Was Musik anbelangt, so sind wir Menschen hilflos, werden gerüttelt und geschüttelt, hochgehoben, niedergedrückt und herumgewirbelt, bis uns schwindelt vor Benommenheit. Es hängt alles von der Melodie ab.
Wäre Lucy Brite jemand anders gewesen und hätte sich weniger schwermütige Lieder zum Pfeifen ausgesucht, dann wäre ich wohl nicht von Gefühlen überwältigt worden, die auf Feathers’ Geschichte und die lebhaften Träume abfärbten, unter deren Einfluss seine Logik allmählich durcheinanderkam. Ich war mir nicht sicher, wohin der Traum in der Geschichte führen würde, aber ich komponierte ihn jedenfalls für ihn und schrieb ihn ins Notizbuch.
Im Traum öffnet Ian Feathers eine Tür und befindet sich auf einmal in Frieda Frails nächtlichem Schlafzimmer. Woher er weiß, dass dieses Zimmer der toten Frau gehört, ist das Geheimnis des Traums. Er weiß es jedoch, und er mustert den Raum mit der kalten Distanz eines erfahrenen Detektivs und sucht nach Hinweisen. Das Einzelbett, der Nachttisch, die Lampe und der Flickenteppich auf dem Boden haben etwas an sich, was ihn stört. «Zu perfekt», denkt er. Sie haben die unwirkliche Glätte eines Raums auf einem Werbefoto. Ian geht zum Fenster, um auf den Rasen und den Gehsteig hinauszuschauen, und bemerkt einen auf dem Fensterbrett liegenden Schlüssel. Während er ihn anblickt, erschauert der Schlüssel leicht, als wäre er lebendig. Ian schlägt mit der Hand darauf, fühlt das Beben unter der Handfläche, schließt ihn aber fest in seine Faust. Als er sich umdreht, entdeckt er eine Tür, die vorher nicht da gewesen war, öffnet sie mit dem lebendigen Schlüssel und sieht ein Mädchen mit einem Pappschild auf dem Rücken, auf dem steht I.F.F. Das Schild verwirrt ihn, und plötzlich begreift er, dass er ein Verbrechen begangen hat, und wird von einem furchtbaren Schuldgefühl gepackt. Aber was für ein Verbrechen? Was habe ich getan? Er überlegt. Das Mädchen springt vier Stufen auf einmal eine Treppe hinauf, und bei jedem fliegenden Sprung weht das Kleid über ihren Kopf, und er erblickt darunter flüchtig ihren nackten Körper. Er bekommt eine Erektion. Der Traum wird ein feuchter Traum, und Ian Feathers wacht auf.