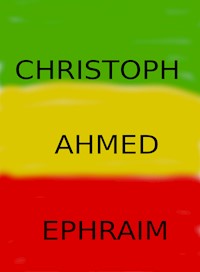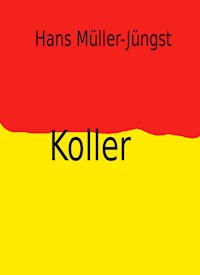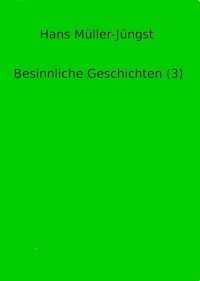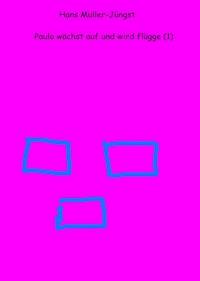Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Besinnliche Geschichten
- Sprache: Deutsch
"Peter und Fips" ist die Geschichte aus der Kindheit des Autor, "der Weise" ist der Omnipotente und Allwissende,."Peter Harbacher" wird als Wasserbauingenieur nach New York gerufen, "Orhan und seine Katze Filippo" schildert einen Auszug aus dem Leben des Orhan in Istanbu. "Mbagwene und Nkomo" ist die Geschite zweier San, die durch einen Diamantenfund plötzlich reich geworden sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Müller-Jüngst
Besinnliche Geschichten (1)
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Peter und Fips
Der Weise
Peter Harbacher
in Siegen
Pedro und seine Lamas
Orhan und seine Katze Filippo
Charles-August Dutronc
Mbagwene und Nkomo
Mbagwene ist verliebt
Nkruma
Impressum neobooks
Peter und Fips
Peter ist ein elfjähriger Sextaner und gerade auf das Gymnasium gewechselt. Er bekommt zu seinem Geburtstag einen Jack Russel Terrier geschenkt, den er Fips nennt. Wegen seiner Unachtsamkeit erleidet der Hund einen Unfall mit einem Auto und muss zum Tierarzt. Peter hat Glück, dass seinem Hund nichts Schlimmes passiert ist...
Peter war ein kluger Junge, der gut in der Schule war und viele Freunde hatte. Er war gerade auf das Gymnasium gewechselt. An seinem elften Geburtstag hatte er einen ganz besonderen Wunsch, er wusste auch, dass das ein besonderer Wunsch war. Trotzdem ging er frühzeitig zu seinen Eltern und teilte ihnen seinen Wunsch mit: Er wünschte sich einen Hund, einen mittelgroßen braun-weißen Jack-Russel-Terrier, ganz für sich allein. Er hatte so einen Hund in seiner Lieblingsserie im Fernsehen gesehen, „Jo und seine Tiere“. Jo war ein Junge, der mit vielen Tieren auf einem Bauernhof lebte und eben auch einen Jack-Russel-Terrier hatte. So einen wollte Peter auch haben, diese Hunde waren sehr munter und aufgeweckt, aber auch sehr anhänglich.
Als er seinen Eltern seinen Wunsch mitteilte, sahen sie sich mit großen Augen an und sagten beide wie aus einem Munde: „Was willst Du haben? Einen Hund? Der fehlt uns hier gerade noch!“
Peter war sehr enttäuscht und lief mit Tränen in den Augen aus dem Zimmer. In den Tagen bis zu seinem Geburtstag sprach er nicht viel und aß auch seinen Teller nie leer.
An seinem Geburtstag kam er aus seinem Zimmer herunter in die Küche und war eigentlich auch ganz gut gelaunt. Mama gratulierte ihm von ganzem Herzen und drückte ihn an sich.
Dann ging er zu seinem Geschenketisch und sah sich die Pakete an, die für ihn gekommen waren, von Tante Luise und Onkel Josef, von Gerd, seinem Onkel väterlicherseits und von seiner Cousine Britta.
Dann gab es da noch ein kleines Päckchen, das er zunächst gar nicht beachtete, von Mama und Papa. „Für Peter“ stand darauf.
„Na ja“, dachte er, „was soll da schon drin sein, wahrscheinlich ein neuer Füller oder ein Taschenrechner“. Aber so fühlte sich das Päckchen nicht an, es war eher weich, nur an einer Ecke war etwas Hartes.
Er öffnete das Päckchen und war völlig verdutzt: eine Hundeleine!
„Aber Mama, was soll ich denn mit einer Hundeleine?“ schrie er ganz laut und drehte sich zu seiner Mutter um. Was er jetzt sah, nahm ihm fast den Atem. Da stand seine Mutter an den Küchenschrank gelehnt und hielt ein braun-weißes Wollknäuel im Arm. „Aber, das ist ja ein Hund!“ schrie Peter völlig außer sich.
„Na sieh mal an“, sagte Mama, „Du wolltest doch einen Hund!“
Ganz vorsichtig nahm Peter den kleinen Hund auf seinen Arm und drückte ihn an sich. Der Kleine jaulte ganz vergnügt und Peter war glücklich.
„Danke, danke Mama!“ sagte er und hatte für seine anderen Geschenke gar keinen Blick mehr übrig.
„Wenn Du mit dem Hund raus gehst, musst Du ihm immer die Leine umbinden“, sagte Peters Mutter, „er muss sich erst an Dich gewöhnen! Du musst ihm auch noch einen Namen geben, denk doch mal nach!“ - „Den habe ich schon lange,“ rief Peter, „mein Hund heißt Fips!“
„Na gut“, sagte Mutter, „dann kümmere Dich auch gut um ihn!“
Peter war wie vom Sinnen, er war überglücklich.
Zuerst gab er Fips etwas Milch zu trinken, dazu stellte er ein kleines Schälchen in die Ecke der Küche, wo die Tür zum Wohnzimmer abging. Fips schleckte die Milch bis auf den letzten Tropfen aus.
Dann lief Peter schnell zum nächsten Geschäft und kaufte eine Dose Hundefutter, extra für kleine Hunde. Das Futter gab er auf einen kleinen Teller.
Fips tat sich erst etwas schwer, fraß dann aber alles auf. Zufrieden schnüffelte er in der Gegend herum und lief dann ins Wohnzimmer.
Auf dem weichen Teppich suchte er sich ein Plätzchen unter dem Wohnzimmertisch und schlief sofort ein.
Plötzlich fiel Peter ein, dass er sich um einen Schlafplatz für Fips kümmern musste, am besten wäre ein Korb mit einer weichen Decke. Aber erst einmal sollte der Hund ruhig im Wohnzimmer schlafen.
Kurze Zeit später ging die Wohnungstür auf und sein Vater kam von der Arbeit nach Hause. „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag mein Junge!“ sagte er stolz und gab Peter ein großes, aber nicht sehr schweres Paket.
Peter riss das Papier ab und sah zu seiner großen Freude einen schönen Hundekorb, sogar ein weiches Fell lag dabei. „Damit Dein Hund auch ein schönes zu Hause hat“, sagte Peters Vater.
Peter war außer sich vor Freude. Jetzt hatte er alles zusammen, was er brauchte.
„Wie heißt denn eigentlich Dein Hund?“, fragte Vater. „Ich habe ihn Fips genannt“, antwortete Peter.
„Fips ist ein schöner Hundename“, meinte Vater.
„Komm, ich zeige Dir, wie er schläft, er hat schon getrunken und gegessen“, rief Peter.
Dann ging er leise mit Vater ins Wohnzimmer und zeigte ihm, wie Fips gemütlich schlief. Bei genauem Hinsehen entdeckte er einen nassen Fleck auf dem Teppich. „Na ja“, dachte Peter, „da hat er wohl nicht an sich halten können!“
„Du musst regelmäßig mit ihm raus,“ meinte Vater, „jeden Tag mindestens zweimal!“
„Ich werde gleich noch mit ihm ins Dorf gehen,“ sagte Peter, „wenn er wach wird.“
Das dauerte nicht mehr lange. Fips streckte alle vier Pfoten von sich und gähnte mit weit aufgerissenem Maul, beim Schließen des Maules konnte man hören, wie die Zähne aufeinander klappten.
„Komm Fips, wir gehen spazieren!“, sagte Peter leise.
Der Hund sah ihn an, als verstünde er jedes Wort, er begann, mit dem Schwänzchen zu wedeln.
Dann nahm Peter die Hundeleine und legte ihm das Halsband um. Fertig war alles für den ersten Dorfspaziergang.
Fips schüttelte sich und kratze mit den Vorderpfoten am Halsband, weil es ihn störte, aber es blieb an seinem Platz.
Dann zog Peter seine Jacke an und machte die Wohnungstür auf.
Fips rannte sofort los und zog kräftig an der Leine. Er war richtig fidel und nach dem Essen und Schlafen auch gut bei Kräften.
Draußen vor dem Haus begann er zu bellen, und als er die Katze vom Nachbarn sah, riss er an der Leine und wollte die Verfolgung aufnehmen. Aber Peter hielt die Leine gut fest.
Dann bogen beide in die kleine Dorfstraße ein, die zur Dorfmitte führte. Fips war aufgeregt, er lief von einer Seite des Bürgersteiges zur anderen, so wie es die Leinenlänge gerade erlaubte. Er schnüffelte an jeder Ecke und an der nächsten Laterne hob er eine Hinterpfote.
Es war nichts los auf der Dorfstraße und Peter dachte, dass er Fips doch wenigstens für einen kurzen Moment von der Leine lassen könnte.
Gesagt getan, er zog Fips zu sich ran und löste die Leine vom Halsband.
Fips genoss sofort die ihm zugestandene Freiheit und rannte los.
Peter wurde angst und bange, was wenn Fips jetzt weglaufen würde?
Er rannte schnell hinter Fips her und rief immer wieder nach seinem kleinen Hund. Und siehe da, Fips kam wieder zurück, schnüffelte an Peters Beinen und rannte wieder los. Wenn Peter rief, kam er zurück – wenn auch mit etwas Verspätung.
Peter war fürs Erste zufrieden, sein Hund hatte seine erste Prüfung bestanden, er begann, auf Peters Kommandos zu hören, allerdings musste noch viel trainiert werden. Wichtig war, dass er Fips oft genug bei seinem Namen rief. Auf jeden Fall würde er seinen Hund gleich wieder an die Leine nehmen.
Plötzlich erstarrte Peter vor Schreck: Fips entdeckte auf der anderen Straßenseite den Hund eines Spaziergängers, fing sofort an zu kläffen und rannte auf die Fahrbahn.
„Fips“, schrie Peter, „komm zurück, Fips!“
Doch da half kein Schreien, Fips stürmte los, komme was da wolle.
Auf einmal kam ein schwerer Mercedes zügig um die Kurve und fuhr Richtung Dorf. Fips kannte natürlich nicht die Gefahr, die von fahrenden Autos ausging, woher auch. Peter war entsetzt, er sah das Unglück geradezu kommen und konnte nichts dagegen unternehmen. Er schrie noch einmal: „Fips, Fips!“, aber da war es auch schon passiert.
Peter hörte noch quietschende Reifen, und dann sah er das schrecklichste Bild, das man sich vorstellen kann, er würde es sein Leben lang nicht vergessen.
Vor dem Mercedes flog ein braun-weißes Bündel durch die Luft und landete ungefähr fünf Meter weiter auf der Straße.
Peter wusste eine Zeit lag gar nicht, was er tun sollte, er war steif vor Schreck, ihm fehlten die Worte.
Er rannte zu Fips und beugte sich zu ihm runter. Da lag sein kleiner Liebling und fiepte leise, er hatte Blut am rechten Hinterlauf.
Peter wusste nicht, ob er weinen sollte, er hatte natürlich Schuld auf sich geladen, warum hatte er Fips nur von der Leine gelassen, der wusste doch noch gar nichts mit Peters Kommandos anzufangen!
Aber das nutzte jetzt auch nichts. Fips musste so schnell wie möglich zum Tierarzt, vielleicht hatte er innere Verletzungen, Brüche, Verstauchungen!
Während er so da hockte und über seinen Fehler nachdachte, kam aus Richtung Mercedes eine ältere elegante Dame auf ihn zu und fragte in strengem Ton, was denn mit dem Hund los sei, sie träfe keine Schuld, Peter sollte froh sein, dass sie rechtzeitig gebremst hätte.
Da fing Peter an zu weinen, er weinte so stark, dass er nicht sprechen konnte.
Die Frau wurde auf einmal freundlicher, umgänglicher.
Sie bot sich an, Peter mit seinem Hund zur Tierklinik zu fahren, sie wüsste, wo die lag, ungefähr zehn Minuten zu fahren.
Peter schluckte mehrmals, sah dann zu der Frau hoch und blickte in ein jetzt doch recht freundliches Gesicht.
Dann sah er wieder runter zu Fips, er griff ganz vorsichtig unter seinen Bauch und nahm ihn dicht an sich. Er setzte sich schnell in den Wagen und die Frau brauste davon.
Zum Glück war in der Tierklinik nichts los und Peter kam sofort dran. Kurz erzählte er mit tränenerstickter Stimme, was passiert war, dann legte er Fips auf die Untersuchungsbahre, die Schwester hielt Fips sanft fest.
Dann begann der Tierarzt, den Hund zu untersuchen. Er schaute ihm in die Augen, drückt ihm den Bauch, bewegte jede Pfote einzeln. Als er die rechte Hinterpfote bewegte, jaulte Fips kurz auf. „Das müssen wir röntgen!“ sagte der Arzt, und die Schwester ging in die Ecke des Behandlungsraumes, wo sie einen Röntgenapparat einschaltete.
Vorsichtig brachte sie Fips Hinterpfote in Position und machte Röntgenaufnahmen. Man musste kurz warten, bis die Bilder entwickelt waren. Die Schwester kam mit den durchsichtigen Schwarzweißaufahmen zurück und gab sie dem Doktor.
Er klemmte die Bilder auf einen Leuchtrahmen und schaute eine Zeit lang angestrengt, ob es etwas zu entdecken gab.
Peter war sehr aufgeregt und rechnete mit dem Schlimmsten. Es verging in seinen Augen eine Ewigkeit, bis der Arzt anfing zu reden.
„Also“, begann er, „da hast Du mit Deinem Hund noch einmal großes Glück gehabt. Es ist nichts gebrochen. Der Hund ist noch sehr jung, die Knochen sind noch biegsam. Er hat aber einige Verstauchungen, die auskuriert werden müssen. Wie heißt Dein Hund?“ - „Fips“, stammelte Peter.
„Du hast mir ja gerade erzählt, wie die ganze Sache passiert ist. Du musst in Zukunft darauf achten, dass Fips immer an der Leine ist, wenn Du mit ihm draußen bist. Mindestens eine Woche muss Fips aber zu Hause bleiben und sich ausruhen, er muss gut fressen, er braucht wirklich absolute Ruhe. Aber ich bin davon überzeugt, dass er das alles bei Dir bekommt. So und jetzt nimm Deinen Hund, die Dame, die Euch gebracht hat, wird Euch auch wieder nach Hause fahren. Ach, ich sehe gerade auf Deiner Karteikarte, Du hast ja heute Geburtstag! Meinen herzlichen Glückwunsch, die Behandlung ist heute für Dich umsonst, ein Geschenk der Klinik.“
Peter strahlte vor Freude. Jetzt kamen auch die Dame und die Schwester und gratulierten ihm.
Der Arzt verließ den Behandlungsraum, nachdem er sich von Peter verabschiedet hatte.
Die freundliche Dame, die die ganze Zeit in einer Ecke des Raumes gestanden hatte, lächelte jetzt sogar.
Peter nahm Fips langsam auf den Arm und die Frau fuhr mit ihnen nach Hause.
Die Eltern hatten sich schon große Sorgen gemacht und überall im Dorf gesucht bis sie jemanden trafen, der den Unfall beobachtet hatte.
Jetzt waren sie froh, Peter endlich wiederzusehen. Sie bedankten sich herzlich bei der Dame und gaben ihr ihre Telefonnummer, wenn irgendetwas an ihrem Auto zu reparieren wäre. Dann verabschiedete sich die Frau von allen, strich Peter einmal über die Haare und fuhr los.
Peter legte Fips in seinen neuen Korb auf das weiche Fell. Er legte ihn auf die gesunde Seite. Es dauerte nicht lange, dann gähnte Fips und schlief ein.
Den Tag würde Peter nie vergessen!“
Der Weise
Auf dem Flug von Venezuela nach Barbados erscheint Paulo beim Blick aus dem Kabinenfenster das Gesicht eines Weisen in den Wolken. Er holt Paulo aus dem Flugzeug und zeigt ihm auf dem Grund des Bermuda-Dreiecks alle Wracks verlorengegangener Schiffe und Flugzeuge, gleichzeitig klärt er ihn über die Auswirkungen eines Methanblowouts auf.
Ich schaute wieder hinaus und bemerkte plötzlich ein Gesicht, das sich aus den Wolkenformationen gebildet hatte, das Gesicht eines weisen Mannes mit weißem Haupthaar und Vollbart, das lächelte.
Es lächelte mich an, als ob ich ihm bekannt vorkäme, es war vertrauenerweckend.
Ich wollte Tina auf das Gesicht aufmerksam machen, und; als ob es mein Vorhaben erahnte, hielt es plötzlich einen großen Zeigefinger auf seinen lächelnden Mund gedrückt, um mich davon abzuhalten, irgendjemandem etwas von meiner Beobachtung mitzuteilen.
Ich schaute mit weit aufgerissenen Augen aus dem Fenster und empfand eine Mischung aus großem Erstaunen und Furcht.
Mit einem Male befand sich die Verlängerung des Zeigefingers direkt neben meinem Kabinenfenster und signalisierte mir, ich sollte aufstehen und mitkommen.
Ich war völlig verstört. Was war das, was da draußen geschah?
Im Hintergrund war noch immer das lächelnde Gesicht des Weisen zu sehen.
Ich war wie von Sinnen und dachte schon gar nicht mehr an die Passagiere, die mit mir in der Kabine saßen.
Ich löste langsam meinen Gurt und fasste mit der linken Hand an die Scheibe meines Fensters, doch merkwürdig, ich spürte überhaupt keinen Widerstand, da schien gar keine Scheibe zu sein, meine Hand glitt durch das Fenster nach draußen. Ich bemerkte aber keinen Luftzug, der müsste ja eigentlich enorm sein, bei geschätzten 900 Km/h, mit denen sich das Flugzeug nach vorn bewegte.
Auch war kein Druckabfall festzustellen, der in circa 10000 m Höhe hätte eintreten müssen, ebenso hätte man die -30° C, die draußen herrschten, in der Kabine fühlen müssen.
Ich schaute wieder in das lachende Gesicht und begann, mich durch das enge Kabinenfenster zu zwängen, der große Zeigefinger bot mir einen sicheren Halt.
Ich lag dann auf dem ausgestreckten Fingerglied des freundlichen Weisen, der mich zu sich lockte.
Es herrschte eine vollkommene Stille und eine angenehme Temperatur, von der großen Geschwindigkeit, mit der ich mich bewegte, war nichts zu spüren.
Das merkwürdige Wesen, zu dem der Finger gehörte, zog mich zu sich, doch ich hatte keine Angst. Es mussten hunderte von Kilometern sein, die ich mit einem Ruck überwand.
Ich schaute nach unten und sah die Wasseroberfläche des karibischen Meeres in großer Tiefe.
Dann stoppte die Bewegung des Fingers. Ich blickte mich um und sah nur große Wolkengebirge. Das Gesicht war verschwunden.
Jetzt bekam ich doch ein wenig Angst, wurde aber nicht von großer Furcht gepackt, wie eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Ich musste mich jetzt inmitten des großen Bermuda-Dreiecks befinden.
Langsam senkte sich der Riesenfinger, auf dem ich wie ein kleiner Wurm lag und bewegte sich Richtung Wasser. Ich schaute nach unten und sah die großen Entfernungen, in denen ich vorwärtsflog, unter mir waren leicht noch 8000 m!
Über und neben mir gab es nur Wolkenberge, das Gesicht blieb verschwunden.
Plötzlich wich unter mir das Wasser zurück und es bildete sich ein Art Kessel von vielleicht zehn Kilometer Durchmesser und einer Tiefe von geschätzten 3000 m.
Am Kesselgrund war der Meeresboden zu erkennen. Der Finger senkte sich mit mir bis zum Meeresgrund.
Da erkannte ich in der Kesselwand, die ja aus aufgetürmtem Wasser bestand, das freundliche Gesicht wieder, es lachte, als versuchte es, mich in dieser völlig unwirklichen Situation zu beruhigen. Man stelle sich das doch einmal vor, zurückgewichenes Wasser1
Wie damals beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, als sich das Rote Meer teilte!
Wer sollte einem so etwas glauben?
Der Finger setzte mich auf dem Grund ab. Ich befand mich jetzt völlig trockenen Fußes auf dem Grund des Westatlantiks in ungefähr 3000 m Tiefe. Ein total verrücktes Märchen!
Ich blickte nach oben und sah die aufgetürmten Wassermassen und mitten drin das lachende Gesicht des Weisen!
Ich lief ein Stück über den Grund und machte plötzlich Wracks aus.
Das erste Wrack war eine uralte DC-3.
Ich erinnerte mich, dass im Fernsehen Bilder von einer DC-3 gezeigt worden waren, die am 28. Dezember 1948 auf dem Weg von Puerto Rico nach Miami mitsamt ihrer Passagiere spurlos verschwunden war. Das Flugzeug war arg zerstört, es waren keine Leichen zu sehen.
Ein Stückchen weiter lag ein Schiffswrack. Der Schiffsbug war mir zugewandt und ich konnte den Namen „Marine Sulphur Queen“ lesen. Das Schiff sollte damals, das war der 7. Februar 1963 in Norfolk/Virginia anlegen, kam dort aber nie an. Ich erinnerte mich an ein Hörspiel „Das Geheimnis des Bermuda-Dreiecks“ von H.G. Francis aus dem Jahre 1978.
Da also lag die „Queen“! Man hatte überall nach ihr gesucht und lediglich ein Nebelhorn und eine Rettungsweste gefunden, allerdings südwestlich von Key West, also außerhalb des Bermuda-Dreiecks. Wie die „Queen“ dahin geraten war, war mir ein Rätsel!
Noch ein Stück weiter sah ich ein Wrack, das komplett mit Algen und Muscheln überzogen war, es musste also schon sehr lange da auf dem Meeresgrund liegen.
Mit Mühe konnte ich am Heck die Aufschrift „Raifuku Maru“ erkennen. Dieser Frachter war schon am 18. April 1925 gesunken, wie ich vor kurzem in einem Buch über Unglücke im Bermuda—Dreieck gelesen hatte. Ich hatte sofort drei Wracks gefunden, die die ganze Welt vergeblich gesucht hatte.
Welch eine faszinierende Stille dort unten in dem Kessel herrschte!
Was, wenn jetzt die gewaltige Wassermacht über mir zusammenbräche?
Ich sah zu dem Weisen hoch, der immer noch lächelte und einen absolut vertrauenswürdigen Eindruck machte.
Plötzlich erschien wieder der große Finger neben mir. Ich begab mich auf die große Fläche der Fingerkuppe und legte mich hin.
Dann begann der Finger, sich 3000 m hoch zu bewegen, so hoch, dass er sich gerade oberhalb des Meeresspiegels befand.
Mit einem Male fiel der Wasserkessel in sich zusammen und begrub die Wracks wieder unter sich, die schon Jahrzehnte dort unten lagen.
Der Weise zeigte sich jetzt wieder in einem Wolkengebirge und lachte.
Als die Wassermassen auf den Meeresgrund fielen, entstand ein so markerschütternder Lärm, dass ich mir die Hände vor die Ohren hielt. Das Meer schäumte auf und beruhigte sich kurze Zeit später wieder. Das Wasser war dann still, es bildete eine spiegelglatte Fläche, auf der sich plötzlich ein kleiner Frachter befand. Ich konnte nicht erkennen, ob jemand an Bord war und woher dieses Schiff kam, es war mit einem Male da.
Es sah so aus, als käme es aus San Juan und wäre unterwegs, die 1684 Km nach Miami zu bewältigen. Von Ladung keine Spur, nichts war zu sehen.
Das Schiff war wie in merkwürdig gleißendes Licht gehüllt, sodass man es gut sehen konnte, während seine Umgebung im Dunkel der Nacht versank.
Auf einmal fing das Wasser um das Schiff an zu kochen, es stob aufwärts. Große Wellen brachen sich an dem Schiff, das Meer brodelte. Plötzlich verschwand das Schiff. Es ging innerhalb von Sekunden unter und ward nicht mehr gesehen.
Ich schaute sehr genau auf die brodelnde, schäumende Stelle im Meer, nichts von einem Schiff zu sehen.
Das Wasser wurde schnell wieder still, und es bildete da, wo vorher ein Schiff war, eine Spiegelfläche.
Was sich da unter mir abgespielt hatte, war so unglaublich, gewaltig, mächtig, dass ich es kaum beschreiben konnte.
Ich war Zeuge eines „Methanblowouts“ geworden!
Die Theorie von Methanausbrüchen im Bermuda-Dreieck geisterte schon länger durch die Köpfe der Geowissenschaftler aus Japan, Deutschland und den USA.
Diese Wissenschaftler hatten in Tiefen von 2000-3000 m gigantische Methanvorkommen geortet. Das Methan war als Methanhydrat in eisähnlichen Brocken gebunden. Änderten sich Druck und Temperatur mit der Zeit, entwich das Methan langsam aus diesen Brocken. Kam es aufgrund von Seebeben oder tektonischen Verschiebungen zu plötzlichen Änderungen von Druck und Temperatur, wurde das Methanhydrat binnen Kurzem in seine Bestandteile-Methan und Wasser-zerlegt. Das Methan stieg dann in unzähligen Blasen nach oben.
Dieses Gas-Wasser-Gemisch wies einen deutlich veränderten Auftrieb auf, sodass Schiffe nicht mehr schwimmen konnten und unweigerlich wegsackten.
Das war ein gewaltiges Naturphänomen, und ich war dessen erster Augenzeuge.
So waren also die Wracks auf den Grund des Kessels gekommen!
Ich blickte mich um und sah den Weisen, wie er lächelte, wollte er mir das zeigen? Wollte er, dass ich meinen Freunden und Bekannten von diesem Phänomen erzählte?
Was würden die wohl sagen, wenn ich von einem riesigen Zeigefinger erzählte, der zu einem lächelnden weisen Mann gehörte, der mich in einen Wasserkessel gesenkt hatte, ungefähr 3000 m tief und hinterher wieder hochhob, sodass ich Zeuge eines „Methanblowouts“ werden konnte, und der mich vorher durch das Kabinenfenster meines Flugzeuges hatte aussteigen lassen?
Der „Methanblowout“ erklärte aber nicht das Verschwinden so vieler Flugzeuge.
Hier hätte es so sein können, dass sich aufsteigendes Methan an den Motoren der Maschinen entzündete, dort explodierte und die Maschinen zum Absturz gebracht hätte. Plausibel, wie ich meinte, aber in der Wissenschaft heftig umstritten.
Also doch „Methanblowout“, dachte ich.
Wenn es gelänge, diese riesigen Methanhydratmengen unter Wasser nach oben zu holen und in nutzbare Energie umzuwandeln!
Das Problem bestand darin, dass das als Methanhydrat gebundene Methan beim Hochholen an die Wasseroberfläche frei würde und in die Atmosphäre entwiche.
Deshalb befürworteten viele Wissenschaftler ein Schmelzen des Methanhydrates bereits am Meeresboden und ein Abfangen des Methans bereits dort unten.
Man schätzte die Weltvorkommen an Methan auf 12 Trillionen Tonnen, mehr als doppelt soviel Kohlenstoff wie in allen Erdgas-, Erdöl- und Kohlevorkommen der Welt.
Das Problem, das sich stellte, war die Frage, wie der Meeresboden reagieren würde, wenn man ihm diese gewaltige Materiemenge entzöge.
Aber auch dabei war man in der Wissenschaft schon vorangeschritten, die Vorstellung war, dass man Methanhydrat förderte und dabei CO2 als CO2-Hydrat entsorgte, um damit den Meeresboden stabil zu halten.
Der Weise hatte seine Position etwas verändert, er befand sich jetzt weiter westlich, immer noch in einem riesigen Wolkengebirge und lächelte.
Aber auch gegen dieses in seiner Logik einfache Vorhaben der CO2-Entsorgung gab es ernstzunehmende Einwände. CO2 wirkte nämlich in hoher Konzentration toxisch, in der Umgebung von CO2-Einleitungen könnten Meeresorganismen beeinträchtigt werden.
CO2 reagiert in Wasser als leichte Säure, es könnte bei Einleitung in großen Mengen zu Änderung im Säuregrad des Meeres führen.
Die Meeresströmungen verbinden die Tiefsee mit der Oberfläche und bewirken, dass CO2 schnell wieder nach oben gelangen und in die Atmosphäre freigesetzt werden könnte.
Das bedeutete eigentlich, dass die Exploitation von Methanhydrat nicht ohne „Sequestrierung“ von CO2 in die Methanhydratlagerstätten stattfinden durfte, wobei man sich der negativen Konsequenzen der Einlagerung von CO2 bewusst sein musste.
Für die „CO2-Sequestrierung“ kamen im Prinzip die großen Hohlräume in der Erdkruste in Frage, die geologisch so stabil waren, dass sie das CO2 auf Dauer sicher vom Entweichen in die Atmosphäre abhielten, wenn man auf unterseeische „Sequestrierung“ verzichten wollte.
Ich lag da auf der immensen Fingerkuppe und machte mir Gedanken über „CO2-Sequestrierung“, der Weise lächelte, und mein Flugzeug würde bald auf Barbados landen!
Ich sah nach unten und sah plötzlich einen Riesentanker unter mir erscheinen, er verlangsamte seine Fahrt und blieb direkt unter mir stehen.
Ich konnte chinesische Schriftzeichen an seinem Bug ausmachen, am Heck las ich „Shanghai“.
Dann begann die Besatzung, sehr lange Rohrleitungen auszubringen und auf den Grund zu versenken. Ein kleines Tauchboot mit Greifarmen wurde auch zu Wasser gelassen.
Anschließend lösten sich sehr lange Ausleger vom Tanker, vier Stück, jeder entfernte sich in eine andere Himmelsrichtung. Als sie ihre Position circa hundert Meter vom Schiff erreichten, wurden an ihrem Ende großvolumige Ballons aufgeblasen, welche die Ausleger über Wasser hielten.
Ich konnte mir auf die ganze Geschichte zuerst keinen Reim machen, dann wurde mir aber klar: die Chinesen wollten Methan vom Grunde des Meeres in ihre Tanks pumpen.
Um einem möglichen „Methanblowout“ entgegenzuwirken, der ein Sinken des Tankers bedeutet hätte, fuhr man die Ausleger mit den Ballons an ihrem Ende aus, die sich für diesen Fall als Stütze für den Tanker, der ja seinen Auftrieb verloren hätte, erweisen sollten.
„Sehr ausgeklügelt!“, dachte ich, aber von „CO2-Sequestrierung“ war nichts zu bemerken. Die Chinesen kümmerte es scheinbar gar nicht, was mit dem Meeresboden passierte oder mit dem entstehenden CO2.
Sie würden das Gas einfach in die Atmosphäre schicken.
Langfristig würde so eine sich selbst erhaltende Spirale in Gang gesetzt: das CO2 würde die Erderwärmung forcieren, die Erwärmung würde die Meerestemperatur erhöhen, sodass das Methanhydrat schmilzen könnte, das Methan würde in die Atmosphäre aufsteigen, wo es dreißigmal so stark wie das CO2 wirken würde, und die Erderwärmung stiege noch stärker an. „Unverantwortlich, was die da unten machten!“, dachte ich bei mir.
Ich meinte, langsam wieder in mein Flugzeug zu müssen, es würde bald auf Barbados landen.
Der Weise lächelte. Wie sollte ich mich verständlich machen?
Ich könnte in die Fingerkuppe kneifen, ohne ihm weh zu tun. Ein Kniff in die Fingerkuppe wäre für den Alten kaum spürbar, er wäre viel weniger als ein Mückenstich!
Aber er schien zu merken, dass ich unruhig wurde und auf der Fingerkuppe hin- und herlief.
Mit einem Male sah ich, wie unter mir das Wasser zu kochen und zu schäumen anfing. Und siehe da, um dem „Methanblowout“ zu entgehen, kamen die Ausleger des Tankers zum Einsatz, die riesigen Ballons hielten den Tanker an der Oberfläche, bis sich das Wasser wieder glättete.
Man musste sich einmal vorstellen, welcher Aufwand betrieben wurde, um an das Methan zu kommen!
Wer wusste schon, wie viele ähnliche chinesische Tanker oder Tanker aus anderen Ländern mit gleicher Technik auf den Weltmeeren unterwegs waren? Lediglich das Tauchboot hätte Schwierigkeiten bekommen können, wegen des fehlenden Auftriebes hätte es schnell absinken und auf dem Meeresboden aufschlagen können.
Wenn es sich aber schon unten befand, bestand keine Gefahr.
Ich musste zurück, ich wusste gar nicht, wie lange ich mich schon auf dem Finger befand!
Aber vielleicht spielte die Zeit auch gar keine Rolle! Es hätte eigentlich längst hell werden müssen!
Stattdessen herrschte immer noch tiefste Dunkelheit. Ich winkte zu dem Alten hinüber zur weit entfernten Wolkenwand, er lächelte, schien aber mein Winken zu bemerken, ich merkte eine ganz leichte Erschütterung im mich haltenden Zeigefinger.
Dieser begann, sich zu bewegen. Ich legte mich wieder hin, und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit schoss er mit mir über die Wasseroberfläche.
Nach kurzer Zeit sah ich in der Ferne mein Flugzeug fliegen. Der Finger ging etwas höher auf Flughöhe. Dann näherte er sich der Maschine und setzte an dem Kabinenfenster an, aus dem ich vorher ausgestiegen war. Ich stand auf und machte Anstalten, mich in die Passagierkabine zu begeben.
Als wäre keine Scheibe in dem Fenster, durchstieg ich das schmale Loch und setzte mich auf meinen Platz.
Die Maschine flog jetzt sehr ruhig. Ich schnallte mich wieder an. Tina schlief neben mir friedlich, und auch die anderen Passagiere dösten vor sich hin.
Niemand hatte bemerkt, dass ich das Flugzeug verlassen hatte. Ich hatte das Gefühl, dass überhaupt keine Zeit verstrichen war, seit ich aus dem Flugzeug gestiegen war. Dann erschien die Stewardess und fragte, ob ich eine Decke haben wollte, um mich zu wärmen, ich winkte dankend ab. Ein Blick aus dem Fenster zeigte nur Dunkelheit, der Weise war nicht mehr zu sehen, auch sah ich kein Licht in der Ferne, alles war so, wie bei unserem Start in Trinidad/Tobago.
Was war das, was ich da erlebt hatte? Offensichtlich wollte mich der Weise auf einen großen Umweltfrevel aufmerksam machen. Wem sollte ich davon erzählen, ohne dass mich mein Gegenüber für verrückt erklärte? Ich glaubte, verstanden zu haben, selbst aktiv werden zu müssen! Aber wie?
Peter Harbacher
Peter Harbacher ist Wasserbauingenieur aus Siegen und mit der Renaturierung der Sieg beschäftigt, als ihn ein Angebot aus New York erreicht: er soll sich um den Abfall der 2 Türme des World Trade Centres kümmern, den man nicht so einfach in den Hudson kippen kann. Er sagt zu und ist von da an Mitarbeiter des New York Waste Departments. Er macht seine Sache so gut, dass er eine Festanstellung bekommt. Er lernt Isabelle Mac Allister kennen und gründet eine Familie mit ihr.
Peter Harbacher hatte an der Universität Siegen Wasserbau studiert und seinen Diplomingenieur gemacht. Sein berufliches Ziel war etwas, was mit der Renaturierung der Sieg von etwa Siegen bis zur Rheinmündung zu tun hätte.
Er bekam eine Anstellung beim „Staatlichen Umweltamt“ in Köln (StUA).
Zu Beginn seiner Tätigkeit beim Umweltamt fuhr er täglich die Strecke Siegen-Köln mit dem Auto.
Er wohnte in Weidenau in der Charlottentalstraße. Er fuhr die A 45 bis zum Kreuz Olpe, dann die A 4 bis Köln.
Wenn er sehr früh fuhr, das hieß, wenn er vor sieben Uhr auf der Rheinbrücke war, hatte er Glück und keinen Stau.
Kam er später, konnte er manchmal eine um eine Stunde längere Fahrzeit einkalkulieren.
Er fuhr nach der Brücke die Abfahrt Zoo runter, die Riehler Straße Richtung Innenstadt und dann rechts ab in die Blumenthalstraße. Da lag das StUA und war deshalb sehr gut zu erreichen.
Allerdings brauchte man bei normalen Straßenverhältnissen eine knappe Stunde mit dem Auto bis dorthin! Und die Benzinkosten gingen natürlich auch an die Substanz.
Peter Harbacher überlegte, nach Köln zu ziehen. Köln gefiel ihm als Stadt sehr gut. Als Student war er mit Kommilitonen oft in der Südstadt.
Verheiratet war er nicht, Kinder hatte er keine, er war ungebunden.
Aber er dachte schon daran, so ungefähr mit 30 Jahren eine Familie zu gründen. Da musste er erst einmal eine Frau kennenlernen!
Aber das dürfte eigentlich so schwierig nicht sein.
Peter sah gut aus, er hatte ein ansprechendes Gesicht, war glattrasiert und hatte einen athletischen Körper.
Früher hatte er während des Studiums mit seinen Kommilitonen abends oft Hochschulsport betrieben. Vor allem Fitnesstraining hatten sie dort gemacht.
Außerdem war er als Wasserbau-Diplomingenieur mit festem Job beim „Staatlichen Umweltamt“ gut abgesichert.
Eine Wohnungsannonce im Kölner Stadtanzeiger brachte sofort Erfolg.
Natürlich hatte er in seiner Anzeige alle Register gezogen: Dipl.-Ing. Junggeselle, fester Job usw. Da war es kein Wunder, dass er schnell positiven Bescheid bekam.
Er sagte bei einer Privatanzeige zu: 3 Zimmer, Küche, Diele, Bad, Balkon auf dem Krefelder Wall. Das lag in direkter Nachbarschaft zu seiner Arbeitsstätte, er konnte vom Krefelder Wall in die Blumenthalstraße laufen.
Zum nächsten Ersten war die Wohnung frei, er musste die Weidenauer Wohnung erst noch kündigen, ein, zwei Monate würden sich die Mietverhältnisse überschneiden, er würde in dieser Zeit doppelte Miete zahlen müssen, konnte das aber nicht ändern.
Er freute sich schon auf seine Kölner Wohnung und kündigte gleich seine Weidenauer Unterkunft.
Die hatte er seit seiner Studentenzeit. Er hatte zwei Jahre lang in der Wohnung eine Wohngemeinschaft gehabt. Dann machten alle Examen bzw. Diplom und zogen aus. Er blieb als Hauptmieter übrig.
Das Erste, was er in Köln machen würde, wäre ein Fahrradkauf.
Mit dem Auto durch die Stadt zu fahren, wäre wohl nicht so erstrebenswert gewesen, zumal der Kölner Innenstadtbereich Umweltzone war.
Aber davon abgesehen, hätte es ziemliche Parkprobleme gegeben.
Außerdem war er aktiver Umweltschützer und wollte sein Auto nur in absoluten Sonderfällen benutzen.
Beim Umzug würden ihm sicher ehemalige Kommilitonen helfen, viel Zeug hatte er ja nicht.
Er würde bei IKEA in Köln noch einkaufen müssen.
Er lieh sich einen 7.5-Tonner, und an einem der nächsten Samstage packte er seinen ganzen Krempel auf den LKW und zog nach Köln.
Im Haus auf dem Krefelder Wall gab es einen Lift, den man für Umzugszwecke erweitern konnte. Das war praktisch, er wohnte nämlich in der vierten Etage.
Die Charlottentalstraße wurde umgehend wieder an Studenten vermietet.
Kurze Zeit dachte Peter an seine Studentenzeit zurück, dann fasste er aber seine Zukunft in Köln ins Auge.
Er war mittlerweile drei Monate beim Umweltamt und hatte vornehmlich Bürotätigkeiten verrichtet. Sein eigentliches berufliches Ziel, als Diplomingenieur maßgeblich an der Renaturierung der Sieg mitzuarbeiten und für eine Wiederansiedelung von Lachsen zu sorgen, verlor er dabei nicht aus dem Sinn.
So ließ er diesen Wunsch immer wieder bei seinem Chef anklingen, bis dieser ihn einer Arbeitsgruppe zuteilte, die sich mit dem Lachsaufzuchtsprogramm beschäftigte.
Er musste Verbindungen zum Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherherschutz in Rheinland-Pfalz knüpfen bzw. aufrechterhalten. So fuhr er oft nach Mainz, um mit dem zuständigen Dezernenten beim Ministerium zu verhandeln. Zwischen Niederschelden und Windeck floss die Sieg über 44 km durch Rheinland-Pfalz.
Die Arbeit verlief sehr erfolgreich, es konnte eine natürliche Fortpflanzung der Lachse in der Sieg nachgewiesen werden. Peter hatte auch an der Errichtung einer Fischwandertreppe in Buisdorf mitgewirkt. Buisdorf lag an der Grenze zu Rheinland-Pfalz.
Im Anschluss an seine Tätigkeit für die Flussrenaturierung begann für ihn wieder die Büroarbeit.
Ein Jahr war bis dahin vergangen, seit er nach Köln gezogen war bzw. eineinviertel Jahre, seit er seinen Job beim Umweltamt angetreten hatte.
Von seiner Beschäftigung bei der Lachsaufzucht und der Renaturierung der Sieg einmal abgesehen, fand er seinen Job nicht sehr spannend.
Es waren auch keine Projekte, die einen Außeneinsatz erforderten in Aussicht. Dem Land fehlte das Geld, beruflich sah seine Zukunft also nicht sehr rosig aus.
Auch privat tat sich bei seiner Brautschau nicht sehr viel. Es hatte hie und da mal gefunkt, aber so richtig für die Dauer hatte er noch niemanden kennengelernt.
Er begann, seine Suche im Internet fortzusetzen.
Er hatte aber da auch keinen Erfolg.
Er fuhr, wenn das Wetter schön war, mit seinem neuen Rad fast jeden Tag in die Südstadt. Das brachte ihm den körperlichen Ausgleich zu seiner Bürotätigkeit. Nach dem Aufstehen machte er immer fünfzig Liegestütze. Meistens fuhr er den Rhein entlang bis zur Severinsbrücke. Er trank dann in seiner Stammkneipe zwei, drei kleine Kölsch, bevor er wieder nach Hause radelte.
So verging ein weiteres Jahr, ohne dass sich etwas Bemerkenswertes ereignete.
Eines Tages stieß er im Internet bei einer New-York-Recherche auf eine Anzeige der New Yorker Stadtverwaltung, die in Deutschland Wasserbauingenieure suchte, die mit der Beseitigung des Schutts des World Trade Centers betraut werden sollten. Große Mengen des Schutts sollten in den Hudson gekippt werden. Man musste dafür wasserbautechnische Untersuchungen anstellen.
Am 11.09.01 war das World Trade Center nach Attacken durch Flugzeuge in sich zusammengestürzt. Der ganze Welt war bestürzt. Auch Peter war sehr betroffen, er hatte während seiner Arbeitszeit davon Wind bekommen.
Er sprach mit Arbeitskollegen, die noch ein Jahr vor dem Attentat auf den Twin Towers waren. Viele sahen das Attentat des arabischen Terrorismus als Angriff auf die Symbole der Freiheit.
Es war unbeschreiblich, welche Szenen sich in New York abgespielt hatten, nachdem die Flugzeuge in die Türme geflogen waren.
Bis März 2001 war die Mülldeponie „Fresh Kills“ auf Staten Island geöffnet, sie war das größte von Menschenhand je geschaffene Bauwerk auf Erden. Sie ragte an ihrer höchsten Stelle 25 m über den höchsten Punkt der Freiheitsstatue empor. Täglich kamen 25 Frachtschiffe mit jeweils 650 t Müll aus New York an der Deponie an, irgendwann war Schluss damit.
Nach dem World-Trade-Center-Desaster stellte sich die Frage, wohin mit dem Schutt? Es handelte sich um 1494220 Tonnen Schutt!
50000 t geborstene Stahlträger waren als Altmetall nach Shanghai gegangen-und der Rest?
Peter dachte lange nach, was hielt ihn noch in Köln? Okay, er hatte einen gut dotierten sicheren Arbeitsplatz und eine schöne Wohnung.
Aber er war jung, sollte das denn alles sein, was ihm das Leben zu bieten hatte?
Er schickte eine E-Mai nach New York, in der er sein Interesse an der ausgeschriebenen Position bekundete. Er wollte noch etwas ganz Neues machen, etwas, das ihn fordern würde.
Er bekam nach einer Woche Antwort, man bat ihn nicht, dass er sich vorstellen und bewerben sollte, sondern er sollte binnen vier Wochen seine Arbeit aufnehmen.
Das war ungewöhnlich und strömte mit aller Macht auf Peter ein, auf der anderen Seite zwang es ihn zu handeln und die Entscheidungen für sein Leben zu treffen.
Peter sagte zu und kündigte in Köln. Er gab seinen sicheren Beamtenjob, A 13 mit Pensionsaussicht, auf zugunsten einer Berufsperspektive, deren Zielrichtung gar nicht so klar war.
Er bewarb sich bei „New York Waste Management“, die im Auftrage der Stadtregierung die Beseitigung des World-Trade-Center-Schutts vornehmen sollten.
„Waste Management“ bot Peter eine Wohnung in Downtown Manhattan und ein gutes Gehalt an.
Das allein waren schon zwei Punkte, die ihm die Entscheidung leicht machten. Er müsste ein wenig an seinem Englisch feilen, dachte Peter und meldete sich zu einem zweiwöchigen Crash-Kurs bei der Vokshochschule an.
Die Wohnung hatte er bereits gekündigt, „Waste Management“ würde 10000 $ Überbrückungsgeld zahlen. Er musste zwei Monatsmieten zahlen, weil er drei Monate Kündigungsfrist hatte und er musste den Umzugscontainer bezahlen, der seine Möbel nach New York enthielte, die er gerne mitnehmen würde.
Auch sein Fahrrad käme mit, er könnte dann immer zum „Ground Zero“ fahren.
Zwei Wochen später kamen Packer einer Kölner Übersee-Spedition, die seine ganze Wohnung leerräumten und in einen Container verluden.
Vier bis sechs Wochen wäre der Container unterwegs, sagte man ihm.
Er musste sich zwei Wochen lang irgendwie behelfen. Er schlief und aß wärend dieser Zeit bei Arbeitskollegen.
Seine Sachen schickte er zu seiner neuen Adresse: 270 Bleecker Street, New York, NY 10014, USA.
Und dann kam der Tag der Abreise. Die Maschine ging um 13.45 h von Düsseldorf zum „John-F.-Kennedy-Airport“, er hatte einen Arbeitsvertrag für zwei Jahre in der Tasche, so lange wäre er mindestens weg.
Nach acht Stunden landete er auf dem „JFK-Airport“.
Er hatte während des Fluges nicht eine Minute gegrübelt, ob seine Entscheidung richtig gewesen wäre. Er war fest entschlossen, in New York einen guten Job zu machen.
Sein Arbeitgeber war der Müll-Multi „Waste Management“.
Auf dem „JFK-Airport“ ging er zum Schalter des „Ground-Transportation-System“ und fuhr nach Downtown Manhattan.
Er unterhielt sich mit dem Fahrer, der ihn in seinem 8-Zylinder-Ford-Van die dreißig Kilometer nach Manhattan fuhr. Aber bei dem Stau, durch den sie sich quälten, war es egal, welches Auto man fuhr.
Dann endlich fuhren sie über die Williamsburgbridge und die Delancey Street entlang, in die Kenmare Street, rechts in die Lafayette Street, links in die West 3rd Street und links in die Thompson Street bis zur Bleecker Street.
Der Fahrer staunte nicht schlecht, als Peter ihm von seiner neuen Adresse erzählte. Peter war mit einem Mitarbeiter von „Waste Management“ verabredet, der ihm die Wohnungsschlüssel übergeben sollte. Bis er den traf, ging er einen Cappuccino trinken. Er war also am Big Apple, mitten im Zentrum des Weltgeschehens.
Es herrschten angenehme Temperaturen in New York, es war Frühsommer. Das Attentat auf das World Trade Center lag ein halbes Jahr zurück.
Als er vor dem Haus mit seiner Wohnung stand, sprach ihn plötzlich ein jüngerer Mann an und stellte sich als Mr. Harper vor. Er käme von „Waste Management“ und wollte ihm die Wohnungsschlüssel geben.
Peter bliebe aber keine Zeit, die Wohnung zu besichtigen, sondern er sollte ihn gleich zum Firmensitz begleiten, wo man ihn zur Entsorgung des WTC-Schutts befragen wollte.
Peter schluckte zweimal, darauf war nicht vorbereitet, dass er sofort seinen Job antreten müsste.
Der Firmensitz von „Waste Management“ lag in der West 20th Street.
Mr. Harper hatte seinen Wagen in der Thompson Street geparkt, man fuhr zur Firma.
Die Fahrt dauerte ungefähr eine halbe Stunde.
„Waste Management“ handelte im Auftrag des „Department of Sanitation New York City“ (DSNY).
Man begrüßte Peter, fragte kurz, wie es ihm ginge und wollte dann sofort Konkretes von ihm wissen. Ob es seiner Ansicht nach möglich wäre, den WTC-Schutt im Hudson zu versenken.
Peter sagte, dass er sich erst einmal einen Überblick über Art und Umfang des Schutts verschaffen müsste. Das wurde ihm zugestanden. Er würde am nächsten Tag in Begleitung eines Firmenmitarbeiters zum „Ground Zero“ fahren und sich ein Bild machen können.
Niemand wollte Peters Zeugnisse oder sein Diplom sehen, es herrschte ziemlicher Druck. Peter war verwirrt. Er wurde zu seiner Wohnung gefahren.
Dort holte er erst einmal Luft. Er hatte immer noch sein Gepäck dabei, das stellte er jetzt ab.
Zum Glück war seine neue Wohnung wenigstens teilmöbliert, so konnte er sich auf eine Couch setzen, er war ziemlich müde.
Es gab auch eine volleingerichtete Küche, aber er musste erst einmal etwas einkaufen, um sich etwas zubereiten zu können. Stattdessen ging er zum Chinesen in der Nachbarschaft und aß sich richtig satt. Er kaufte ein paar Flaschen Bier und ging wieder hoch in seine Wohnung.
Solange seine Möbel unterwegs wären, würde er auf der Couch schlafen. In einem Schrank fand er zwei Decken und ein Kissen, das müsste reichen. Es war ja warm, viel zum Zudecken brauchte er nicht.
Nach seiner Besichtigung des „Ground Zero“ würde er am nächsten Tag einkaufen gehen.
Am nächsten Morgen wurde er abgeholt, es war 8.00 h und man fuhr zu den Ruinen.
Sie fuhren die Liberty Street entlang und erreichten die Reste der Twin Towers. Peter war völlig fassungslos bei dem, was er sah. So ungefähr musste es nach einem A-Bombenangriff aussehen, dachte er.
Ein unübersehbarer Wust von Trümmern, die als Stahlskelette zum Teil 20 m in den Himmel ragten.
Was er auf den ersten Blick erfassen konnte, waren Glas, Betonteile, Stahlträger, zermalmtes Büroinventar. Unter dem ganzen Schutt mussten aber auch jede Menge Leichenteile liegen. Experten schätzten bis zu einer Million Gewebeteile im Schutt des WTC.
Zur Identifizierung der Getöteten halfen nur DNS-Proben, und die wurden 2000 Meilen weiter westlich in Utah bei „Myriad Genetics“ genommen. Es gab in und an den Türmen des WTC 2603 Getötete, von denen nur 1600 identifiziert werden konnten. Peter war entsetzt.
John Harper von „Waste Management“ führte ihn herum und gab erläuternde Hinweise. Peter konnte eine Zeit lang gar nicht sprechen, so hatte ihn der Anblick des Schuttgebirges mitgenommen.
Was er in Deutschland im Fernsehen gesehen hatte, war nichts im Vergleich zu der realen Anschauung.
Die Frage von John Harper, was er von einer Schuttverklappung im Hudson hielte, ließ er lange auf sich einwirken.
Dann sagte er, dass er sich ein Bild von den Eigenschaften des Hudson machen müsste, bevor abschließend etwas dazu sagen könnte.
Soweit er wüsste, wären doch schon bei der Errichtung der Twin Towers tausende Tonnen von Abraum in den Hudson gekippt worden, Manhattan sei auf diese Weise um die Battery Park City gewachsen.
John Harper gab ihm recht, das wäre aber im Vergleich zu der Menge Schutt, die dort zu beseitigen wäre, relativ wenig gewesen, es handelte sich dort um 1.5 Mio. t Material, das zu beseitigen wäre.
Peter überschlug kurz im Kopf das Volumen des Mülls: der Einfachheit halber nahm er ein spezifisches Gewicht von 1 g / cm^3 für den Schutt an. Das ergäbe 1 kg für 1000 cm^3, 1 m^3 wäre 1 t, 1.5 Mio. t wären 1.5 Mio. m^3. Das entspräche einem Würfel mit der Kantenlänge von rund 115 m. Wenn man den Grund des Hudson auch nur einen Meter hoch mit dem Schutt anfüllte, bedeckte der schon eine Fläche von 1225 mal 1225 Metern. Diese Rechnung setzte allerdings eine hochverdichtete Menge Schutt voraus, wovon man da nicht unbedingt ausgehen konnte. Am Ende wurden 108440 LKW-Fuhren weggebracht.
Es wäre nicht so einfach, sagte Peter, den Schutt in den Hudson zu schütten. Diese Menge würde die Strömungsgeschwindigkeit des Flusses und das Gezeitenverhalten im Fluss verändern und damit den Schiffsverkehr beeinflussen.
Peter nahm ein Stück Schutt in die Hand, es war ein kleines Stück Beton, handtellergroß, vielleicht vom obersten Stockwerk eines der Türme, er wog es in den Händen und warf es dann wieder zurück.
Er sähe ziemliche Probleme beim Verklappen des Schutts, sagte er dann. Er überlegte, dass er eigentlich kein Müllfachmann war, rief sich aber in Erinnerung, dass er sich mit Änderungen der Strömungsverhältnisse in Flüssen während des Studiums und auch während seiner Arbeit an der Sieg befasst hatte.
In Köln müssten seine ehemaligen Arbeitskollegen noch das Material dazu haben. Er setzte sich über das Internet mit ihnen in Verbindung und hielt Stunden später seine damaligen Untersuchungsergebnisse in Händen.
Er erinnerte sich, wie sich beim Anlegen der Fischtreppe in Buisdorf die Frage im Raume stand, wie sich die gestaute Sieg verhalten würde und welche Auswirkungen das veränderte Fließverhalten und den Fischbestand haben würde.
Doch könnte er die Untersuchungen an der Sieg einfach auf den Hudson übertragen? Der Hudson war ein viel größerer Fluss, er wurde von Schiffen befahren, er war Ebbe und Flut ausgesetzt.
Es kam noch ein weiteres Problem hinzu: der WTC-Schutt war vergiftet, er war mit Asbest, PVC, Quecksilber, Blei und anderen giftigen Stoffen verseucht. Konnte man dieses Material einfach in den Fluss kippen? Was war die Alternative?
John Harper zuckte mit den Schultern, er sagte, dass „Waste Management“ von der Verklappung des Schutts im Hudson ausgehe.
Über Alternativen hätte man noch gar nicht nachgedacht.
Sie fuhren zur Firma zurück und beriefen einen Krisenstab ein. Man diskutierte drei Stunden lang und wog alle denkbaren Alternativen gegeneinander ab.
Was sich herauskristallisierte und was vielen zu denken gab, war eine Reaktivierung von „Fresh Kills“, der 1948 geöffneten und am 21. März 2001 geschlossenen Riesenmüllkippe von New York City.
„Fresh Kills“ war so gigantisch, dass sie mit bloßem Auge, wie die Chinesische Mauer, aus dem Weltraum zu sehen war.
In Spitzenzeiten landeten täglich 20 Frachtkähne an, jeder mit einem Fassungsvermögen von 650 t, 6 Tage die Woche lang.
Auf Druck der Bevölkerung und auch der „United States Environmental Protection Agency“ (EPA) wurde „Fresh Kills“ geschlossen, und es wurde versucht, Renaturierungsmaßnahmen einzuleiten, ein „Fresh-Kills-Park-Project“ wurde ins Leben gerufen. Der „Fresh Kills Park“ sollte dreimal so groß werden wie der Central Park.
Er sollte eine Vielzahl an Erholungs- und Freizeiteinrichtungen bieten: Naturpfade, Reiten, Moutainbiking, Dinieren in freier Natur, Sportplätze und Kanufahren.
Entgegen allen Widerständen, besonders seitens der Bevölkerung von Staten Island oder von Carteret, einer kleinen Stadt in New Jersey, die direkt neben der Deponie lag, wurde „Fresh Kills“ wiedereröffnet, um die 1.5 Mio. t Schutt des WTC aufzunehmen.
Der Hudson Plan war damit ad acta gelegt.
Peter Harbachers Job war damit eigentlich erledigt. Er hatte sich aber in der kurzen Zeit zu solch einem Müllfachmann entwickelt, dass „Waste Management“ ihn weiter beschäftigen wollte.
Er fuhr mit John Harper raus nach Carteret. Sie nahmen John`s Wagen und fuhren die gleiche Strecke, die auch die LKWs nehmen würden.
Durch den Brooklyn Battery Tunnel, den Gowanus Expy nach Süden, über die Verrazano Narrow Bride nach Staten Island.
Dann nahmen sie den Staten Island Expy bis zum Pearl Harbour Memorial Expy, der führte direkt nach Fresh Kills.
Er zog über Meilen an Müllbergen vorbei, die aber alle mit Mutterboden abgedeckt waren.
In regelmäßigen Abständen ragten Rohre aus der Erde, die das Methan ableiteten.
Sie sahen den Arthur Kill, über den jahrelang die „death barges“ mit dem Müll gekommen waren.
Kill kam aus dem Altniederländischen und bedeutete soviel wie Fluss.
Eigentlich sah die Gegend dort ganz normal aus, aber weder John Harper noch Peter Harbacher hatten den Vergleich zu vorher.
Sie wollten hinüber nach Carteret und mit ein paar Leuten sprechen.
Sie fuhren den Pearl Harbour Memorial Expy weiter nach Süden und dann über die Outerbridge Crossing nach New Jersey rüber.
Sie nahmen die State Street, die West Ave. und die Roosevelt Ave. nach Norden bis Carteret.
Sie waren direkt gegenüber Fresh Kills und konnten verstehen, dass sich dort im Ort massiver Widerstand gegen die Wiedereröffnung der Deponie regte, bei Westwind roch man doch die Deponie sehr stark, und Westwind blies in Carteret praktisch immer.
Sie fuhren über die Irving Street in den Ort hinein bis zum Schulzentrum in der Washington Ave.
Dort sprachen sei einen Herrn an, der sich zufällig da aufzuhalten schien. Es war Tom Meehan, der eine Tochter im Südturm verloren hatte, Colleen, die als Projektmanagerin im 103. Stockwerk gearbeitet hatte.
John und Peter fragten Mr. Meehan, was er von dem Vorhaben, die Deponie zu reaktivieren, hielte.
Mr. Meehan zeigte hinüber nach „Fresh Kills“ und deutete auf einen grünen Hügel auf der anderen Seite des Flusses Arthur Kill, „dort soll dann die Asche unserer Tochter liegen,“ sagte er mit einem unüberhörbaren Schluchzen in der Stimme.
John und Peter sahen sich an und bedankten sich bei Mr. Meehan, der wie beiläufig abwinkte.
Der geplante „Fresh-Kills-Park“ würde Jahrzehnte brauchen, bis er so aussähe, wie auf der Bildschirmpräsentation.
Die Landschaftsarchitektin Ellen Neises von der New Yorker Firma „Field Operations“ war mit dem Projekt betraut.
Es war auch an eine Gedenkstätte gedacht, von der aus man einen Blick auf die Skyline von Manhattan hätte.
Es gäbe zu „Fresh Kills“ keine Alternative, nirgendwo in New York gab es einen Platz, wo eine so große Menge Material gelagert werden könnte, so die Stadtoberen.
Das tröstete Tom Meehan nicht über den Verlust seiner Tochter hinweg, es wäre der dauernde Blick auf die Stätte, wo die sterblichen Überreste Colleens lägen, der Tom Meehan bestürzte.
Aber das änderte nichts an dem Vorhaben, „Fresh Kills“ noch einmal zu öffnen und die 1.5 Mio. t Schutt des WTC dort zu lagern.
Neben den LKWs-über 100000 während der ganzen Aktion-fuhren auch wieder Schiffe in den Arthur Kill, die wie früher mit Abfall beladen zur „Island of Meadows“ fuhren, um ihre Fracht dort abzuladen.
FBI-Beamte würden ein halbes bis ein ganzes Jahr in dem Müll herumstochern, um verwertbare Reste, die der Identifikation von Vermissten dienten, aber auch Leichenteile sicherzustellen.
Peter ließ sich von John zur Anlegestelle der Staten Island Ferry bringen, um mit dem Schiff zurück nach Manhattan zu fahren.
Auf dem Weg durch die Upper New York Bay dachte er immer daran, dass es der falsche Weg gewesen wäre, den ganzen Schutt in den Hudson zu kippen.
Dann legte die Fähre in der South Street in Manhattan an.
Peter lief die State Street bis zum Broadway hoch. Er ging durch den Canyon of Heroes bis zur Wall Street. Dort stieg er in die U-Bahn und fuhr uptown.
Er stieg Union Square aus und lief die paar Blocks hoch bis zur West 20th Street. Er ging wieder in die Firma.
Dort traf er John, der schon längere Zeit wieder da war und sprach mit ihm über das Carteret-Erlebnis.
Er sagte, dass Mr. Meehan ihn ziemlich mitgenommen hätte, auch John war sehr betroffen.
Aber an der Wiedereröffnung von „Fresh Kills“ ging kein Weg vorbei, was sollte man auch sonst tun?
Kurze Zeit später begann die große Schuttentsorgungsaktion. Die Stadtverwaltung erlaubte den LKW-Einsatz nur von 24.00 h bis 6.00 h morgens, damit das Stadtleben nicht unnötig gestört würde.
Tagsüber arbeiteten Männer mit Presslufthämmern und Baggern, um den Schutt transportfähig zu machen.
Auch Schneidbrenner waren im Einsatz, um die Stahlträger in transportable Stücke zu zerteilen.
Und dann setzte ein Abtransportprozess ein, der ein halbes Jahr dauern sollte.
Nächtelang fuhren LKWs und wurden Frachtkähne beladen, alles hatte ein Ziel: „Fresh Kills“.
Inzwischen waren drei Monate ins Land gegangen, längst waren Peters Sachen aus Deutschland angekommen.
Er hatte sich seine Wohnung in der Bleecker Street eingerichtet.
Es gefiel ihm gut dort, er lernte Nachbarn kennen und verabredete sich mit denen schon einmal zum Fahrradfahren.
Sehr oft war er im Washington Square, wo er Inline Skater fuhr.
In der Gegend war eine Menge los, er fühlte sich an seine Studentenzeit erinnert.
Er wohnte in Greenwich Village, diese Gegend war sehr angesagt in New York. Das war schon was anderes als Weidenau mit seinem „Belle Epoque“.
Als er einmal nach Hause kam, traf er seine Wohnungsnachbarin im Treppenhaus. Er fand, sie sah umwerfend aus, und er wollte sie immer schon einmal ansprechen.
Sie tauschten kurz Blicke und Peter glaubte, ein Lächeln in ihrem Gesicht erkannt zu haben. Jedenalls nahm er das zum Anlass, sich vorzustellen und sie zu einem Drink einzuladen.
Auch auf die Gefahr hin, sehr plump zu wirken und mit der Tür ins Haus zu fallen, sagte er: „Entschuldigen Sie, dass ich Sie hier im Flur einfach so anspreche. Mein Name ist Peter Harbacher, ich bin Deutscher und wohne seit drei Monaten neben Ihnen, ich möchte sie gerne zu einem Drink einladen, haben Sie Zeit, wir könnten in die Bar im Hause gehen?“
Seine Wohnungsnachbarin sah ihn erfreut an und sagte: „Ja gerne, mein Name ist Isabell Mac Allister, und ich habe mich schon oft gefragt, was das wohl für ein Mensch ist, der früh morgens das Haus verlässt und erst spät abends zurückkehrt. Sagen Sie Isabell zu mir, darf ich Peter sagen?“
Damit war der erste Kontakt hergestellt. Sie gingen in die Bar, deren Eingang direkt neben der Haustür von Isabell und Peter lag und unterhielten sich.
Peter erzählte von „Waste Management“ und dass er mit der Entsorgung des Schutts am WTC zu tun hätte, was das für Probleme mit sich brächte. Plötzlich rief der Wirt zu ihnen herüber: „Dr. Mac Allister, auch mal wieder hier?“
Peter schaute verdutzt, dann erzählte Isabell, dass sie Unfallchirurgin am „New York University Medical Center“ wäre und mit der Versorgung der Opfer des WTC-Desasters zu tun gehabt hätte, viele Feuerwehrleute wären unter den Verletzten gewesen.
Viele wären gestorben. Manche würden noch Jahre unter den Folgen leiden, sie hätten Asthma oder asbestverseuchte Lungen, steife Glieder oder psychische Schäden.
Peter hörte Isabell interessiert zu und fand sie immer attraktiver.
Er fragte nach ihren Freizeitaktivitäten, ob sie Sport triebe.
Isabell sagte, dass sie in ihrer Freizeit oft zu ihren Eltern raus nach Newark führe, die schwer mit dem Tod ihrer Schwester zu tun hätten. Mary Anne wäre im Südturm gewesen, als dieser einstürzte.
Ihre Eltern hätten noch eine halbe Stunde vorher mit ihr über Handy gesprochen.
Das sei auch für sie eine harte Erfahrung gewesen, sagte Isabell.
Mary Anne hätte für eine Bank gearbeitet und wäre schon 5 Jahre im WTC beschäftigt gewesen.
Peter sagte, dass es ihm sehr leid täte und erzählte von seiner Begegnung mit Mr. Meehan in Carteret, gegenüber von „Fresh Kills“, der auch eine Tochter im Südturm verloren hätte.
Isabell trank ihren Drink aus und sagte, dass sie zwei Stunden später im Medical Center sein müsste.
Sie könnten sich doch mal zum Fahrradfahren verabreden.
Damit war Peter sofort einverstanden und sie verließen die Bar wieder.
Peter brachte Isabell hoch zu ihrer Wohnung und verabschiedete sich von ihr. Am Wochenende wollten sie zusammen Radfahren.
„Waste Management“ wollte Peter auf jeden Fall behalten, er hatte sich in den Augen seiner Chefs bewährt.
Peter fuhr gerne in die West 20th Street zur Arbeit, er arbeitete viel mit John Harper zusammen.
Sie trafen sich gelegentlich mit Ellen Neises, die den „Fresh Kills Park“ anlegen sollte. „Waste Management“ war in die Park-Planung eingebunden.
Am Samstagmorgen traf Peter sich mit Isabell zur verabredeten Fahrradtour. Peter hatte sein „Scott Moutain-Bike“ noch in Köln gekauft, Isabell hatte einen „Koga Miyata Tourer“, zwei edle Räder also.
Das Wetter war prima, richtiges Bike-Wetter.
Isabell hatte an diesem Samstag frei, Peter musste auch nicht arbeiten.
Peter schlug vor, zur Battery Park City zu fahren, anschließend könnten sie runter zum Battery Park fahren, dann würde man weitersehen.
Isabell war einverstanden, beide waren sportlich gekleidet, Peter hatte seinen Radlerdress an, den er immer in Köln getragen hatte, wenn er in die Südstadt gefahren war, Isabell trug eine Radlerhose und eine Biker-Jacke darüber.
Sie hatte wunderschöne braune Beine, auf die Peter immer schauen musste, als sie losfuhren. Bei jedem Pedaltritt spannten sich ihre Wadenmuskeln, toll sah das aus.
Sie fuhren durch SoHo (South of Houston Street), dann quer durch TriBeCa (Triangle below Canalstreet) und kamen über die Church Street zum „Ground Zero“.
Dort sollte der „Freedom Tower“ gebaut werden. Daniel Liebeskind hatte den Architektenwettbewerb gewonnen, und die Architekten Skidmore, Owings und Merril wurden mit dem Bau beauftragt.
Der Bau sollte 1776 Fuß hoch werden, was an die Unabhängigkeitserklärung von 1776 erinnern sollte.
Es sollte 108 Etagen geben, die Gesamtnutzfläche sollte 241548 m^2 betragen.
Der Grundstein des Gebäudes sollte aus schwarzem Granit bestehen und 20 t wiegen. In einer Inschrift sollte der 2748 Opfer des WTC-Attentates gedacht werden.
Der Schutt war weggeräumt, Peter dachte zum wiederholten Male, wie gut es war, das vergiftete Material nicht in den Hudson gekippt zu haben.
Battery Park City war durch den Aushub bei der Errichtung des WTC entstanden.
Isabell und Peter radelten die Vesey Street bis zum Parallelweg zum West Side Hwy, dann ging es bis zur Liberty Street, dann rechts und wieder links bis zur S. End Ave. An der W. Thames Street fuhren sie links, um dann wieder rechts in die Battery Pl. einzubiegen. An der 2nd Pl. Bogen sie in den Robert F. Wagner Jr. Park ab. Dort setzten sie sich eine Weile an das Hudson Ufer.
Sie waren kein bisschen müde und guter Dinge.
In der Ferne konnten sie Staten Island sehen, davor die Freiheitsstatue und Ellis Island.
Liberty Island lag mit der Freiheitsstatue etwas entfernt.
Peter fragte Isabell, wie sehr sie ihrer Schwester Mary Anne verbunden war.
Isabell antwortete, dass sie ihre Schwester sehr geliebt hätte, sie hätten früher alles zusammen unternommen, sie wären immer von Newark nach Manhattan gefahren und hätten die Gegend unsicher gemacht.
Erst als Mary Anne einen Freund hatte, und Isabell in New York Medizin studierte, sah man sich nicht mehr so oft.
Mary Anne heiratete später und wohnte mit ihrem Mann in Jersey City.
Isabell wäre früher manchmal hingefahren, um das Wochenende dort zu verbringen, ihre Eltern wohnte auch nicht weit entfernt.
Der Verlust von Mary Anne würde sie sehr schmerzen, sagte Isabell mit Tränen in den Augen.
Peter legte den Arm um ihre Schulter, um sie zu trösten. Isabell ließ sich das gefallen.
Dann ging es weiter zur Staten Island Ferry, wo sie sich ein Eis kauften und sich noch einmal ans Wasser setzten.
Sie lachten sich beide an, und Peter umarmte Isabell. Sie erwiderte seine Umarmung und schloss die Augen. Peter küsste sie auf die Wange und war glücklich, nach langer Zeit mal wieder eine Frau in den Armen zu halten.
Sie standen eine Zeit lang umarmt in der warmen Sonne, sie sagten nichts, schauten sich nur an.
Dann fuhren sie weiter, die Broad Street hoch, bis sie in die Williams Street einbogen. Der folgten sie bis zum Zubringer zur Brooklyn Bridge. Sie fuhren rechts in die Spruce Street und links in die Gold Street, die dann als Rose Street den Brooklyn-Bridge-Zubringer unterquerte. Dann die Madison Street entlang bis zur Worth Street, links und wieder rechts in die Mulberry Street, nach 500 m kamen sie zur Hester Street. Sie waren in Little Italy. Isabell und Peter gingen in ein italienisches Cafe. Peter lud Isabell zu Espresso und Ecclaires ein. Die Ecclaires hatten schon im Fenster Peters Blicke auf sich gezogen.
Drinnen war es saugemütlich, man glaubte, an der Piazza Navona in Rom zu sein, an New York erinnerte nichts.
Peter bestellte zwei Espressi und für jeden zwei Schokoladenecclaires.
Sie machten in dem italienischen „Cafe Da Bruno“ eine lange Pause, als Isabell plötzlich anfing, mit der Bedienung italienisch zu sprechen. Die Kellnerin war sehr freundlich und froh, endlich einmal in ihrer Muttersprache mit jemandem reden zu können.
Sie kam aus Mailand und war seit 5 Jahren in New York. Das Cafe gehörte ihrem Onkel und er ließ sie dort arbeiten.
Sie wollte in einem oder zwei Jahren ein Studium aufnehmen, wahrscheinlich Sprachen, Italienisch und Englisch.
Ihr Name war Carla.
Nach eineinhalb Stunden zahlte Peter und sie verließen das Cafe wieder. Sie fuhren die Mulberry Street hoch bis zur Houston Street und erreichten 5 Minuten später die Bleecker Street.
Dann waren sie wieder zu Hause, sie hatten für ihre Radtour fast den ganzen Samstag gebraucht.
Peter verabredete sich mit Isabell für den Abend, sie wollten essen gehen. Isabell feute sich sehr über Peters Einladung. Dann küssten sie sich im Hausflur, und jeder ging in seine Wohnung.
Drei Stunden später würden sie sich wiedersehen.
Peter ging duschen, rasierte sich und war sich aufs Bett. Eine Stunde lang döste er weg.
Er schaltete den Fernseher an; den es in der Wohnung gab und goss sich ein Glas Cola ein.
Im Fernseher liefen gerade die Nachrichten, nach dem internationalen Teil kamen Meldungen aus New York City. Man zeigte den Baufortschritt am Freedom Tower, kurz wurde über „Fresh Kills“ berichtet. Der Park nahm langsam Formen an, es waren neue Wege angelegt worden. Man sah schon die ersten Inline Skater.