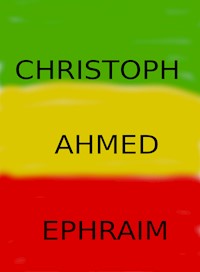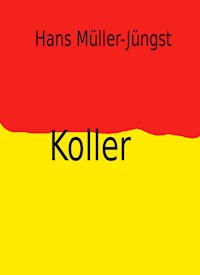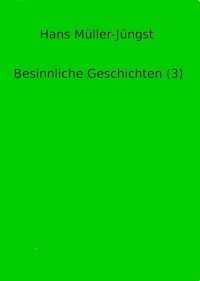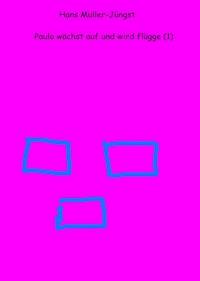
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Paulo Köhler ist nach seiner Jugendzeit plötzlich erwachsen und fährt in die Welt hinaus, er weiß zunächst nicht wie es mit ihm weitergehen wird und lässt das Leben auf sich einströmen, er saugt es in sich auf.Nachdem er während seiner Jugendzeit und auch noch als Student mehr oder weniger unbeteiligt dem Leben gegenüberstand, nimmt er vom Zeitpunkt seiner Reisen an alles selbst in seine Hände, was ihn betrifft und gestaltet sein Erlebensumfeld.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Müller-Jüngst
Paulo wächst auf und wird flügge (1)
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Los Rios
EBRO
DUERO
Tajo
„Peter und Fips
GUADIANA
GUADALQUIVIR
EL VIAJE Mexiko
Moskau
Istanbul
„Orhan und seine Katze Filippo:
Impressum neobooks
Los Rios
Mein Name ist Paulo Köhler, ich bin der Sohn von Alfred Köhler, einem Polizeibeamten und seiner Ehefrau Ilse, einer Hausfrau.
Mein Bruder Klaus ist 14 Monate und mein Bruder Fred ist 9 Jahre älter als ich.
Klaus machte eine Ausbildung zum Fernmeldemonteur, Fred wurde Einzelhandelskaufmann.
Ich war dazu auserkoren, das Gymnasium zu besuchen.
Schon früh entwickelte ich einen Hang zum Spanischen.
Meine Mutter sagte sehr oft die fünf spanischen Hauptflüsse auf: Ebro, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir.
Komischerweise hat sie die aus ihrer Schulzeit behalten.
Ich konnte sie bald nachplappern.
Mutter kannte auch die Namen der zwölf Apostel, die habe ich aber nicht gelernt.
Ich schaute mir das schöne große Land Spanien oft im Atlas an.
Meine Eltern flogen später oft nach Mallorca, wie viele andere auch.
Ich fuhr viele Male nach Spanien; zuerst an die Atlantikküste ins Baskenland.
Mein Klassenkamerad Axel und ich, wir hatten einen alten Opel P1, für den wir in Poitiers eine neue Lichtmaschine kaufen mussten.
Wir hatten die Haare lang und fielen deshalb natürlich überall auf.
Geschlafen haben wir in Bundeswehrschlafsäcken am Strand.
Ein schöneres Bett habe ich nie gehabt.
Spanien war damals spottbillig, eine Stange Celtas Selectas kostete umgerechnet drei Mark, die Rückbank im Auto lag immer voll mit Zigaretten.
Ein riesiges Glas Gin Tonic (Gordon`s Dry Gin, Schweppes Tonic Water) kostete 80 Pfennige.
Ein Zimmer kostete 5 Mark die Nacht und ein Essen im Restaurant waren extrem billig.
Hier ließ sich leben, dazu die fantastische Landschaft und das herrliche Wetter.
Dass die Spanier zum Teil in relativer Armut lebten, dass das Franco-Regime schon seit fast dreißig Jahren an der Macht war, dass die Guardia Civil sich so manchen Übergriff erlaubte - ein Beamter stand mal mit seinen Stiefeln auf meinen bloßen Füßen und schaute mir aus circa dreißig Zentimetern direkt in die Augen, weil wir barfuß und mit freiem Oberkörper durch das Dorf gingen – das bekam man nur am Rande mit.
Im Jahr darauf fuhr ich mit meiner Freundin Carola wieder ins Baskenland, von da quer durch das riesige Land ebroabwärts bis zur Costa Brava.
Ein anderes Mal fuhr ich zur Ebromündung nach Alcanar in das Haus einer guten Bekannten.
Später ging es nach Andalusien und nach Sevilla.
Selbstverständlich war ich auch ein paar Mal auf Mallorca und einmal auf Gran Canaria.
Ich lernte die spanische Lebensart und die spanische Kultur lieben.
Weil ich in der Schule Latein gelernt hatte, fiel es mir relativ leicht, Spanisch zu sprechen, g und j sprach man wie das ch in Lachen aus.
Das war vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig.
Ansonsten musste man die Vokabeln kennen, um wenigstens zu radebrechen.
Meine Spanienliebe brachte mir irgendwann den Namen Paulo ein,den wurde ich nicht mehr los.
Paulo war ein lustiger Name, der erste Sohn Pablo Picassos hieß Paulo.
Ich hatte Pablo Picasso immer verehrt.
EBRO
Vater brachte nach Dienstschluss immer seine Uniform mit nach Hause. Die hing zusammen mit seinem Pistolenhalfter, seinem Gürtel und einem Knebel im Flur an der Garderobe.
Der Knebel war eine Kette, die Verhafteten um die Handgelenke geführt wurde, an deren Ende befanden sich verstärkte Griffe, die man ineinanderlegen konnte, sodass sie nur einen Griff bildeten.
Durch Verdrehen dieses Griffes zog man die Kette um die Handgelenke stramm und machte sich so den Verhafteten gefügig.
Mein Bruder und ich haben mit dem Knebel oft „Abführen“ gespielt, an die Pistole haben wir uns nicht getraut.
Vater hatte immer Schichtdienst beim Verkehrsunfallkommando. Er hatte die Führerscheine aller Klassen und konnte mit dem öffentlichen Personennahverkehr umsonst fahren.
Er fuhr immer mit dem Bus zum Dienst.
Stets trug er – auch im Sommer – lange Unterhosen. Wahrscheinlich hatte sich diese Angewohnheit aus der Kriegszeit erhalten, er war ja Soldat gewesen.
War er mittags zu Hause, so legte er sich unmittelbar nach dem Mittagessen hin und hielt einen zweistündigen Mittagsschlaf. Wir mussten in dieser Zeit leise sein, jedenfalls so leise, dass er nicht gestört wurde.
War er abends zu Hause, so saß er zumeist in der Küche und las Zeitung.
Vor den Fernseher setzte er sich nur zur Tagesschau, zur Wetterkarte und samstags zur Unterhaltungssendung.
Wochentags verließ er das Wohnzimmer unmittelbar nach der Wetterkarte.
Bekam er noch die Programmansagerin zu sehen, machte er oft die Bemerkung:
„Was ist das denn für ein Schmalzküken?“ oder er sagte empört:
„Mein Gott und das für unsere sieben Mark!“
Morgens oder nachmittags war Vater unten.
Unten waren der Hof, die Laube, der Schuppen, der Kaninchenstall und natürlich der Garten.
Er trug unten meistens seine Holzschuhe, die er Klotschen nannte.
Unten gab es jede Menge zu tun, nicht nur mussten die Kaninchen versorgt werden, es musste auch Holz gehackt, es mussten die Schuhe geputzt, es mussten die Hühner gefüttert und der Garten umgegraben werden.
Die Gartenarbeit variierte je nach Jahreszeit, war in der Regel aber immer anstrengend, jedenfalls für uns Kinder bzw. Jugendliche.
Mutter war immer dominant, was Vater aber akzeptierte, ohne als Pantoffelheld dazustehen.
Er sprach Mutter oft ein Lob für ihre Hausarbeit aus, besonders lobte er ihre Kochkunst.
Jedes Jahr ließ er sich wegen eines Ischiasleidens eine Kur verschreiben, sodass er bald alle Kurorte kannte. Später fuhr Mutter oft mit zur Kur, beide machten sie einen schönen Urlaub.
Von der Sanitätsstelle der Polizei brachte er jede Menge kostenloser Medikamente mit, so zum Beispiel gezuckerte Hustenpastillen, die wir „Knüsselchen“ nannten.
Er war ein schwer zu beschreibender Mensch, insgesamt war er eher ruhig (nicht still), lachte aber gern in Gesellschaft; vermutlich war er ein Kriegsopfer, redete aber nicht so gern darüber.
Seine Arbeit war wohl belastend, seinen Beamtenstatus wusste er aber auszukosten, jedenfalls ließ er gelegentlich seine Beziehungen spielen.
Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde wählte ihn später zum Kirchmeister.
Von da an spielte sich ein großer Teil der Gemeindepolitik bei uns zu Hause ab.
Die jeweiligen Pastoren gaben sich die Klinke in die Hand, mussten doch alle finanziellen Kirchenentscheidungen den Segen meines Vaters tragen.
Im Laufe der Jahre machte sich bei ihm ein verschlepptes Lungenemphysem bemerkbar, das er sich sicher im Kriege oder bei seiner Raucherei eingehandelt hatte.
Er verstarb im Jahre 1986.
Oma Buchecker wohnte unten im Hause, ihre Wohnung lag zur Hofseite hin. Sie stammte aus Ostpreußen, was man unschwer hören konnte, hängte sie doch an alles, was sie sagte, ein typisches „näch“ an.
Theo Kolb, dessen Schwiegermutter Oma Buchecker war, hatte die Wohnung nebenan. Er wohnte da mit seiner Familie, unter anderem mit seinem Sohn Theo, der etwa so alt war wie mein Bruder und ich, mit dem wir aber nicht so viel zu tun hatten.
Theo Kolb besaß einen Opel Kadett A, heute ein legendäres Modell, den er am Wochenende immer auf den Hof fuhr und dort wusch.
Wir schauten dann neidisch auf den weißen Wagen, denn wir hatten nie ein Auto besessen.
Mein Vater pflegte beim Thema Auto die Bemerkung zu machen:
„Auto fängt mit Au an und hört mit o auf!“
Sicher hatte er während seines Dienstes bei der Polizei schlechte Erfahrungen mit Autos gemacht, aber in erster Linie spielten wohl die Kosten eine Rolle.
Onkel Bruno und Tante Thea wohnten in der Stolbergstraße, ungefähr zehn Minuten Richtung Borbeck zu Fuß. Deren VW Käfer stand unten vor der Tür, war dunkelgrün und hatte das Kennzeichen E-A 971.
Tante Thea war oft leidend, sie sprach meistens so, als wollte sie gleich zu heulen anfangen.
Ich glaube, dass sie von Mutter missachtet wurde.
Mutter verstand es sehr gut, Menschen zu verstehen zu geben, ob sie sie mochte oder nicht, wenn nicht subtil, dann durchaus auch offen und direkt, was manchmal peinliche Züge annahm, wenn man dabei war.
An Weihnachten wurde die Tür zum Wohnzimmer mit einem stabilen Band an der Klinke verschlossen, abschließen konnte man die nicht.
Vor der Bescherung wurde dann in der Küche ausgiebig gegessen.
Das kleinste Geräusch wurde den Engelchen zugeschrieben, die im Wohnzimmer dabei wären, die Geschenke unter den Tannenbaum zu legen.
Das traditionelle Heiligabendessen war bei uns Kartoffelsalat, selbstverständlich mit selbst gemachter Majonäse, warmer Fleischwurst, Tatar und allerlei Wurst und Käse.
Für uns Kinder war die Spannung bis zur Bescherung kaum auszuhalten.
Wenn es dann soweit war, betraten wir mit großen Augen das Wohnzimmer und betrachteten zuerst den Tannenbaum.
Er stand in der Zimmerecke auf der Fernsehtruhe. Er war relativ spärlich geschmückt mit Lametta und Wunderkerzen.
Auf dem Zimmerboden davor lagen die Geschenkpakete.
Man erahnte schon an der Paketform das obligatorische SOS-Geschenk, Schlips, Oberhemd, Socken, oft auch noch Unterhosen.
Meine Aufgabe bestand darin, die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium vorzulesen.
Erst danach durften wir an unsere Geschenke.
Die mit Abstand besten Geschenke gab es für uns von Onkel Bruno und Tante Thea.
Beide kamen regelmäßig zu Heiligabend, um mit uns gemeinsam zu feiern.
Einmal schenkten sie uns ein Epidiaskop, das allerdings schon recht bald daran glauben musste. Wir stellten das kostbare Gerät unter das Bett, dachten nicht mehr daran und als wir auf dem Bett tobten, ging unser schönes Geschenk zu Bruch, unrettbar.
Ein anderes mal gab es eine Dampfmaschine, so wie sie heute noch zu kaufen ist.
Man erhitzte in einem kleinen Kessel mittels Esbittabletten Wasser und trieb mit dem unter Druck stehenden Wasserdampf alle möglichen Geräte an, das war eine richtig ausgeklügelte Technik, und wir freuten uns sehr.
Irgendwann verloren wir aber auch daran unseren Spaß.
Schließlich schenkten Onkel Bruno und Tante Thea uns Gewehre.
Man schob hölzerne Pfeile, die an der Spitze Gummisauger hatten, in den Lauf, wo sie eine Feder spannten.
Beim Betätigen des Hahnes flogen sie ziemlich weit. Später entfernten wir die Gummis und spitzten die Holzpfeile mit unseren Messern an.
Dann waren sie richtig gefährlich.
Nach dem Sichten der Geschenke und dem ersten Kosten der Süßigkeiten, die auf dem Weihnachtsteller lagen, nach dem ersten Anstoßen der Erwachsenen mit Wein und Bier, auch mit Schnaps, wurden Weihnachtslieder gesungen.
Zum Teil gab es unübliche Lieder, deren Text ich heute nicht mehr kenne.
Ich denke, die gehen auf meine Oma mütterlicherseits zurück, denn die war neuapostolisch.
Oma war natürlich immer dabei, sie wohnte später auch bei uns im Anbau.
Meine Oma Köhler, Vaters Mutter also, lebte in einem Altenheim in der Stadt.
Sie war erzkatholisch und es hieß immer, dass ihr die Schwestern das Geld aus der Tasche zögen.
Wir besuchten sie manchmal sonntags.
Gesungen wurde bei uns gern, nicht nur an Weihnachten.
Onkel Bruno sang immer Kopfstimme, sehr hoch und sehr schön.
Vater hatte keine gute Singstimme, er grölte immer ein bassähnliches Geräusch dagegen, oft falsch.
Die anderen hielten sich zurück, man konnte sie aber gut vernehmen.
Wenn auf der stark befahrenen Bottroper Str., auf der wir wohnten, ein Bus oder LKW vorbeifuhr, wackelte das ganze Haus.
Die Bottroper Str. war eine Hauptverkehrsstraße. Ein Großteil unserer Katzen, von denen später noch die Rede sein wird, war auf dieser Straße überfahren worden.
Wir beerdigten sie alle bei unserer Bude hinten im Garten.
Sie bekamen sogar ein Holzkreuz.
Die Bude hatten wir gebaut, indem wir ein großes Loch aushoben, dieses mit einem Türblatt abdeckten und darauf wiederum Mutterboden schaufelten, sodass man außer einer kleinen Bodenerhebung nichts von unserer Bude wahrnehmen konnte.
Wenn wir uns in der Bude aufhielten, rauchten wir oft Zigaretten, die wir aus alten Teeblättern gedreht hatten oder wir fuhren mit unserer Karre zur Bushaltestelle am Sulterkamp, sammelten weggeworfene Kippen, fuhren zurück zur Bude und pulten den Tabak aus den Zigarettenstummeln heraus.
Meistens drehten wir daraus Zigaretten mit Zeitungspapier.
Einer guckte immer aus der kleinen Luke, die wir gelassen hatten und beobachtete den Garten, ob Vater oder Mutter in der Nähe waren.
Vor der Bude gab es an der Gartenabschlussmauer eine Kochstelle. Das war ein Geviert aus Ziegelsteinen, über welche ein alter Backofenrost gelegt wurde. Mutter hatte uns einen ihrer Töpfe überlassen und wir machten oft Feuer und kochten zum Beispiel Suppe aus Maggiwürfeln.
Die Karre, die schon erwähnt wurde, war für uns ein wichtiges Transportmittel.
Sie war eine Konstruktion aus einem langen Brett, unter dessen Enden alte Kinderwagenachsen montiert wurden.
Bevor die Räder darauf geschoben wurden, kam eine Portion Staufferfett auf die Achsenden, damit die Räder leicht liefen.
Die vordere Achse wurde drehbar montiert und mit Seilen versehen, die wie Zügel benutzt wurden, und mit denen man somit die Karre lenken konnte.
Einer setzte sich darauf, während der andere mit einem alten Schüppen- oder Besenstiel anschob.
Bergab lief die Sache natürlich von selbst, sofern man die Karre vorher bergauf geschoben hatte.
Wir haben unsere Karre viele Jahre benutzt und ein ähnliches Modell in einem Schwarzwaldurlaub gebaut – davon später mehr.
Im Herbst bauten wir uns Drachen oder Windvögel, wie wir sagten.
Dazu besorgten wir uns schmale Tapezierleisten, die es in den entsprechenden Geschäften zu kaufen gab.
Aus den Leisten wurde ein großes Kreuz gebaut.
Rund um das Kreuz wurde ein an den Enden der Leisten befestigtes Band gespannt.
Die Querleiste wurde leicht nach innen gebogen und die Spannung mit einem kurzen Stück Band, das an deren Enden befestigt war, gehalten.
Das Band wiederum wurde durch eine ganz kurzes Stückchen Leiste, welches in der Mitte der Querleiste aufgestellt wurde, gespannt.
Legte man dieses Stückchen Leiste um, war die Spannung aus dem Drachen genommen.
Jetzt wurde das Leistenkreuz mit großen Papierbögen verklebt.
Zeitung eignete sich dazu nicht, weil sie zu leicht einriss.
Es gab zu diesem Zweck eigens verstärktes Drachenpapier, das man bei uns im Zeitschriftenhandel bei Frau "Ulbricht" erstehen konnte.
War der Drachen soweit gediehen, wurde an das Kreuzende ein langes Band befestigt, aus dem dann der Drachenschwanz, meist aus Grasbüscheln, entstand.
Es war schon eine gehörige Windstärke nötig, um die recht schwere Drachenkonstruktion in die Luft zu erheben.
Es klappte aber jedes mal recht gut, war der Drachen einmal in der Luft, musste man nur darauf achten, dass er nicht zu tief absank.
Es waren immer zwei Leute nötig, um den Drachen steigen zu lassen.
Einer musste den Drachen startbereit hochhalten, der andere lief mit gespannter Leine los, bis sich der Windvogel weit genug in die Höhe begeben hatte, um dann Leine nachzulassen.
Die große Wiese, die sich hinter dem uns gegenüberliegenden Jugendheim anschloss, war der geeignete Ort, um die Windvögel steigen zu lassen.
Auf der anderen Seite des Hauses wohnte Ferdinand Pilz.
Er war alt und hatte einen unglaublichen Buckel. Immer, wenn man ihn sah, bat er:
„Kratz mich doch mal am Rücken!“
Er selbst konnte das aus verständlichen Gründen nicht.
Herr Pilz hatte auf der Seite des Gartens, die der unsrigen gegenüber lag, eine große Voliere, in der er unzählige Kanarienvögel und Wellensittiche hielt.
Er lebte mit seiner Schwester Friedchen zusammen (ich weiß nicht, wie deren korrekter Name war).
Über den beiden wohnte Herr Prinz mit Frau. Er hatte eine Steinstaublunge und werkelte oft in seinem Schuppen auf dem Hof.
Ich ging immer dorthin, um zu rauchen.
Neben dem Gang zum Hof wohnte Herr Lukaj mit seiner Schwester in einem sehr alten kleinen Häuschen.
Wir wussten nicht viel über die beiden, sicher waren sie Flüchtlinge. Sie hatten einen großen Garten wie wir und einen Hund, der hieß Blacky.
Immer, wenn man den Gang entlang auf den Hof ging oder wenn eine unserer Katzen zum Hof lief, rannte er laut kläffend den Zaun entlang.
Er war eine kleine schwarz-weiße Promenadenmischung. Herr Lukaj hielt auch Tauben, ich glaube, um sie zu essen.
Frau Lukaj sah man kaum.
Vater oder Mutter unterhielten sich manchmal über den Zaun hinweg mit einem von beiden.
Sie sprachen dann einen kaum zu verstehenden westfälischen Dialekt, jedenfalls glaube ich, dass es einer war.
DUERO
Als ich aufs Gymnasium (colegio) gehen sollte (und wollte), musste ich mich einer dreitägigen Aufnahmeprüfung unterziehen.
Ich erinnere mich noch dunkel an Mathematik.
Ich erinnere mich auch noch dunkel an den Prüfungsraum.
Das Gymnasium war ein großer alter Bau in der Prinzenstraße in Borbeck.
Es war glaube ich circa einhundert Jahre alt und hatte eigentlich einen relativ guten Ruf.
Es verfügte über ein riesiges Außensportareal, wir hatten einen eigenen Fußballplatz, auf dem allerdings auch der SV Borbeck trainierte.
Es gab eine Vierhundert-Meter-Bahn, auf der ich so manchen Schweißtropfen gelassen hatte.
Ferner war eine gute Weitsprunganlage vorhanden. Vom großen Schulhof aus ging man in den Fahrradkeller, den ich lange benutzt hatte.
Der große Turnhallenanbau ragte in den Hof hinein, über der Turnhalle lag der Kunsttrakt.
Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich ein weiterer Anbau mit Klassenräumen, der die provisorischen Pavillons ablöste.
Vor dem Bau gab es den Lehrerparkplatz mit relativ bescheidenen Ausmaßen, viele Lehrer kamen damals noch mit Bus oder Bahn zur Schule.
Der Chef, Dr. Lofing, hatte einen VW 411 Fließheck, der kam damals gerade heraus, hässlich!
Wenn man den Bau durch den Haupteingang betrat, ging man in den Gang nach rechts zum Lehrerzimmer, hier gab es auch die Schulbibliothek.
Im Keller lagen Räume für den „ND“, die katholische Jugend.
Auch ein Fotolabor gab es hier, ich habe mich aber nie dafür interessiert.
Halb links ging man in die Umkleideräume und dann in die Turnhalle.
Wenn man den Treppentrakt ganz hoch ging, kam man unter dem Dach zum Musikraum.
Musik unterrichtete Herr Ellinghaus.
Er war ein begnadeter Musiklehrer von sehr hoher Fachkompetenz, sofern man das als musikalischer Laie beurteilen konnte.
Die wichtigste Funktion kam in seinem Unterricht dem Flügel zu.
Er saß eigentlich permanent vor seinem Instrument und spielte während er gleichzeitig zu uns sprach.
Ab und zu stand er auf und schrieb etwas an die Tafel, was wir abzuschreiben hatten.
Natürlich quatschten wir auch untereinander.
Bekam er das mit, stand er auf, fragte kurz:
„Wer war das?“, forderte denjenigen, der sich meldete, auf, sich zu erheben, schlug ihm heftig ins Gesicht, dass man alle seine Finger auf dem Gesicht erkennen konnte und setzte sich wieder vor seinen Flügel, so als wäre nichts geschehen.
Ein Schüler musste die Musikanlage bedienen, wenn wir mal eine Symphonie oder ein anderes Werk hören sollten.
Es gab ausschließlich Schallplatten, die von einem Plattenspieler abgetastet wurden.
Die Qualität litt natürlich mit der Zeit, die Platten mussten eine Zeit lang halten und hatten im Laufe ihrer Benutzung einige Kratzer abbekommen.
Der Musikunterricht war so qualifiziert, dass ich heute noch einige musikalische Grundbegriffe kenne.
Der Chor wurde von Frau Hegemanns geleitet. Sie hatte mir die Bassstimme zugewiesen.
Da wir aber, zumal die Bässe ganz hinten im Chor standen, fast ausschließlich Mist machten, flog ich sehr bald wieder aus dem Chor.
Ich erinnere mich aber noch an das Stück „Gaudeamus igitur“, das wir mit Inbrunst übten.
Auch im Musikunterricht wurde sehr viel gesungen. Wer ein Instrument auch nur ansatzweise spielen konnte, so wie ich die Gitarre, wurde eine Notenstufe heraufgesetzt.
Herr Ellinghaus war immer fröhlich und ging in seiner Musik auf.
Biologie wurde von Herrn Strasser unterrichtet.
Der Biologiesaal war, wie auch der Physiksaal, als Hörsaal ausgelegt, die Bankreihen stiegen nach hinten hin auf.
Er lag über dem Lehrerzimmer.
Vor dem Biologiesaal gab es Schauterrarien, in dem einen wurde eine Boa gehalten, die ausgesuchte Schüler in der großen Pause mit Mäusen füttern durften.
Wir schauten oft dabei zu.
Herr Strasser war streng, er ließ uns viel zeichnen, was sicher zu einem guten Biologieunterricht gehörte.
Auch mussten wir nicht angekündigte Tests schreiben, die ich mit Ach und Krach schaffte.
Auch Herr Strasser schlug die Schüler, wenn auch weniger oft als Herr Ellinghaus.
Das Biologiebuch war der Hermann Linder, den es heute noch mit dickem gelbem biochemischem Anhang gibt.
Wenn Filme gezeigt wurden, konnte man schwarze lichtundurchlässige Rollos herunterlassen.
Mein Klassenkamerad Inderwies hat dann regelmäßig onaniert.
Es wurden große 16-mm-Bauer-Projektoren benutzt, in die man den Film in unzähligen Schlaufen einfädeln musste.
Neben den Projektor wurde die Abdeckung gestellt, in die ein Lautsprecher montiert war.
Oft war nur ein lautes Knistern zu hören.
Eine große Attraktion war im Nebenraum des Biologiesaales der „Hugo“.
„Hugo“ war ein menschliches Skelett, angeblich ein echtes.
Genau wusste das aber niemand.
Der Physiksaal lag über dem Biologiesaal. Herr Flake gab Physik, und das tat er sehr rigide.
Er war wohl Berufsanfänger, jedenfalls jung und setzte ordentliche Mathematikkenntnisse voraus. Trotz seiner Strenge konnte er hervorragend erklären.
Ich als Großschnauze versuchte Herrn Flake manchmal zu verunsichern, zum Beispiel mit der Bemerkung:
„Na, gestern beim Friseur gewesen?“
Herr Flake ging zwar über solche Bemerkungen hinweg, ganz unberührt ließ ihn so etwas aber nicht.
Er machte, wie sich das für einen anschaulichen Physikunterricht gehört, sehr oft Versuche, ich erinnere mich noch an die schiefe Ebene, an der die gleichmäßig beschleunigte Bewegung veranschaulicht wurde oder an das Bleiband aus einer Gardine, das zur Verdeutlichung der Schwingungslehre benutzt wurde (Longitudinalwellen).
Die harmonische Schwingung brach mir, neben Latein, ich glaube in der zehnten Klasse, das Genick, ich blieb sitzen.
Herr Grüter gab Latein, später Dr. Lau.
Grüter war ein Prolet, er popelte und schmierte sein Popelergebnis unter das Pult.
Sein markigster Spruch war:
„Lange Haare, kurzer Verstand!“
Das war auch gegen mich gerichtet, der ich inzwischen die Haare schon recht lang trug.
Herr Grüter hatte auch etwas gegen meine Ringelsocken, was ich zum Anlass nahm, meine Beine ordentlich unter der Bank auszustrecken.
Zu Beginn jeder Stunde überprüfte Herr Grüter die Vokabeln.
Die Lateingrammatik aus „Ludus Latinus“ habe ich heute noch in großen Teilen präsent, das Pauken der Grammatik half mir auch in Deutsch und Englisch.
Bei Klassenarbeiten wurde oft der „Pons“ benutzt, der half aber nicht immer.
Dr. Lau, der Herrn Grüter später aböste, war ein ganz anderer Typus von Lehrer.
Er war eine elegante Erscheinung und legte Wert auf gut formulierte, wenn es ging freie Übersetzung. Merkwürdigerweise hatte ich Talent für freie Übersetzungen, ich wurde von Dr. Lau gelobt und stand dann plötzlich drei in Latein.
Zur Mathematik hatte ich anfangs kein gutes Verhältnis.
Mathe wurde von Herrn Becker unterrichtet.
Ich erinnere mich noch an Ungleichungen, Betragsrechnen und Grenzwertbetrachtungen.
Herr Becker und Herr Flake waren befreundet, sie spielten zusammen Fußball im Lehrersport.
Herr Becker hatte einen alten VW-Käfer und kam jeden Morgen aus Werden.
Das waren sicher zehn Kilometer pro Strecke.
Er hatte die Eigenart, bei Klassenarbeiten dicht am Fenster zu stehen und in der Scheibe zu beobachten, ob jemand fuschte.
Er rauchte dabei und blies den Qualm zum Fenster hinaus.
Ich weiß noch, dass er „Astor“ rauchte.
Herr Becker war unser Klassenlehrer, wir fuhren mit ihm nach Berlin in das Jugendgästehaus in der Kluckstraße.
Begleitlehrer waren Herr Linnenborn und Herr Agatz.
Herr Agatz war ein komischer Kauz.
Er gab Philosophie bei uns.
Er war unglaublich intelligent, wenngleich man vieles von dem, was er im Unterricht von sich gab, nicht verstand.
Ich erinnere mich noch an seine überaus verständlichen Tafelbilder, mit denen er unter Verwendung vieler Pfeile die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt zu veranschaulichen suchte.
Einmal ließ er zu seinem Geburtstag einen Kasten Bier hoch holen.
Wir tranken dann in seinem Unterricht Bier.
Ich denke, er hatte oft Streit mit der Schulleitung.
Sport machte eigentlich sehr viel Spaß, wenn man mal von anstrengenden Vierhundert-Meter-Runden absieht.
Im Winter fand der Sportunterricht in der Halle statt, und hier gab es tolle Sportgeräte, an denen man seine Kräfte und sein Geschick messen konnte, wie Barren, Kasten, Pferd, Hochreck.
Sport wurde von Herrn Ganther, Herrn Dömkes, Herrn Detering und Herrn Hönsch unterrichtet.
Herrn Deterings Erscheinungsbild änderte sich vom Erdkundeunterricht, den wir auch bei ihm hatten, zum Sport dadurch, dass er sich eine Trainingsjacke anzog und sich in der Turnhalle eine Zigarre ansteckte.
Er ließ uns alle im Kommandoton antreten und zu Beginn jeder Sportstunde drei Runden laufen. Dabei stand er in der Mitte der Halle und rauchte genüsslich.
Dann befahl er, wieder im Kommandoton, den Mattenwagen zu holen und das Reck aufzubauen.
Die armen Säcke, die am Reck keinen Aufschwung konnten, weil sie zum Beispiel zu dick waren, wie Kanther, waren die Würstchen.
„Du Würstchen, stell Dich hinten an“, war dann sein Kommentar.
Auch in Erdkunde gab es Würstchen, wenn man nämlich zum Beispiel vorne an der Karte nicht zeigen konnte, wo Breslau lag.
An Herrn Ganther erinnere ich mich, wenn ich an die Leichtathletik draußen denke.
Er verstand es, die Schüler zu motivieren und übte mit uns den Start beim Hundert-Meter-Sprint vom Startblock, sowie Anlauf und Absprung beim Weitsprung.
Wir lernten, unsere Anlaufstrecke so zu markieren, dass wir beim Absprung exakt den Absprungbalken trafen.
Herr Ganther brachte mich und einige Mitschüler dazu, dass wir uns Spikes in der Stadt kauften.
Die kosteten vierzig Mark bei Sport Vosswinkel, ich musste mir noch zehn Mark bei meiner Schwägerin leihen, den Rest konnte ich durch Nachhilfe, die ich gab, selbst bezahlen.
Die Spikes waren aus Nappaleder.
Ich trug sie stolz wie Oskar und lief die vierhundert Meter mit siebzehn Jahren in siebenundfünfzig Sekunden. Das war keine schlechte Zeit.
Der Leichtathletikunterricht fand im Rahmen des Spielturnens statt, das war Sportunterricht, der nachmittags für eineinhalb Stunden gegeben wurde.
Unsere Sportanlage war hervorragend, ein Platzwart kümmerte sich um deren ordnungsgemäßen Zustand.
Wir spielten zwar ab und zu Fußball, meistens aber traktierten wir die Aschebahn.
Der Vierhundert-Meter-Lauf war sehr hart, man dachte in der letzten Kurve, dass einem die Beine durch Bleigewichte ersetzt worden waren.
Beim Zieldurchlauf war man dermaßen außer Atem, dass man noch eine Zeit lang gehen musste, um wieder einigermaßen gut Luft zu bekommen.
Herr Hönsch galt als homosexuell. Er soll Jungen immer beim Duschen zugeschaut und ihnen auch einmal an den Hintern gegriffen haben.
Gerüchte, die ich durch eigene Beobachtung nicht bestätigen konnte.
Das Spielturnen fand immer mittwochs nachmittags statt.
Im Winter ging es in die Halle.
Auch hier habe ich einiges gelernt, auf das ich später stolz war.
Ich konnte am Boden einen Salto und einen Handstandüberschlag, auch am Pferd schaffte ich einen Handstandüberschlag, natürlich mit Sprungbrett, am Barren konnte ich einen Oberarmstand aus dem flüchtigen Handstand und eine Schwungkippe, am Hochreck schaffte ich eine halbe Riesenfelge mit anschließender Hocke über die Stange und Strecksprung auf der Matte.
Beim Üben der Riesenfelge konnte ich mich einmal nicht halten und flog vor eine am Hallenrand stehende Gymnastikbank, ich habe mir Gott sei Dank nichts getan.
Seitdem habe ich mir immer die Hände mir Magnesia eingrieben, um den Handschweiß zu binden.
Mittwochs morgens fand in der ersten Stunde der Schulgottesdienst statt, die ganze Schule nahm daran teil.
Die Evangelischen gingen in die Dreifaltigkeitskirche, die Katholischen in die St. Dionysiuskirche.
Stets wurde die Anwesenheit kontrolliert, und ich ging auch immer hin.
Ein- oder zweimal hatte ich Russisch in der nullten Stunde.
Das war um 7.15 h.
Damit hörte ich dann sehr bald wieder auf.
Englisch gab anfangs Herr Spörl, dann Frau Pfrogner, die auch Russisch gab.
Frau Pfrogner machte einen grundsoliden Unterricht, wenn man das als Schüler überhaupt sagen durfte. Sie kombinierte ihre Strenge aber mit einer Liebenswürdigkeit, mit der sie zumindest uns Jungen um den Finger wickelte.
Damals wurden bei englischen Klassenarbeiten noch Nacherzählungen geschrieben.
Hier waren eindeutig die im Vorteil, die ein gutes Gedächtnis hatten.
Leider blieb ich hier immer im unteren Bereich.
Ich lernte aber, Englisch zu sprechen, jedenfalls basicly, was mir auf späteren Reisen sehr viel half.
Frau Pfrogner nahm ihren Unterricht sehr ernst, oft gab es Ermahnungen wegen Quatschens und Störens.
In der Rückschau betrachtet war das aber ganz okay.
Unser Buch war in der Mittelstufe „Britain and America“.
Hier gab es noch die klassischen Geschlechterrollen nach dem Motto:
„Peter spielt im Garten Fußball und Betty hilft ihrer Mutter in der Küche“.
Herr Cromer war für den Geschichts- und später auch den Erdkundeunterricht zuständig.
Er war schon damals sehr alt, wahrscheinlich ein reaktivierter Pensionär.
Ich denke, er war ein ehemaliger Nationalsozialist, wenn man sein Alter, besonders aber sein Verhalten im Unterricht berücksichtigte.
Bei der kleinsten Störung musste man aufstehen, er kam dann zu einem hin, zog an den gerade mal spärlich vorhandenen Koteletten den Kopf hoch, um dann an dessen höchstem Punkt mit der flachen Hand in voller Wucht auf die Backe zu schlagen.
Das tat sehr weh und hinterließ auf der Backe die Spuren seiner Finger.
Im Erdkundeunterricht mussten wir die Namen ehemals spanischer amerikanischer Städte oder Staaten, wie zum Beispiel California oder Florida, spanisch aussprechen, um die englische Sprache zu vermeiden.
Cromer war extrem unbeliebt.
Es heißt, man habe ihm eines Tages nach der Schule aufgelauert, ihm einen Sack über den Kopf gezogen und ihn dann verdroschen.
Deutsch unterrichtete anfangs Dr. Schwarzkopf.
Er bimste mit uns die Präpositionen und die lateinischen Grammatikbegriffe.
Die saßen dann aber auch.
Später bekamen wir Dr. Göbel.
Er nahm mit uns wichtige literarische Werke durch, besonders erinnere ich mich an „Faust“. Heinrich Böll verschmähte er, er sagte:
„Der Böll, der bellt mir zu viel!“.
Dr. Göbel rauchte „Gelbe Rose“, er machte immer einen kränklichen Eindruck.
Gegen Ende meiner Schullaufbahn starb er.
Zu meinen Freunden (amigos) während meiner Schulzeit gehörte Rolf Trenkler.
Er wohnte am Germaniaplatz und war nie ein guter Gymnasiast.
Er war aber ein guter Gitarrist und hatte auch eine Band.
Ich ging oft nach der Schule zu ihm und wir hörten dann meistens Bob Dylan, auch Donovan oder Rolf spielte Gitarre.
Mit seiner Band war er mal bei Boeker in der Stadt aufgetreten.
Ich glaube sie haben sich dann aufgelöst.
Rolf war zeitig von der Schule abgegangen.
Rainer Hegselmann ist heute Philosophieprofessor. Zusammen mir Thomas Gabrysch machte er vor allem beim ND mit.
Thomas und er waren gute Schüler.
Er wohnte am Fliegenbusch und machte mit Thomas in seiner Freizeit Raketenversuche.
Auch interessierten sich die beiden für Fotografie und benutzten oft das schuleigene Fotolabor.
Olaf Pluta war ein musikalischer und guter Schüler. Er wohnte oben auf der Frintroper Straße.
Sein Vater war Musiklehrer, was dem Schild am Hause zu entnehmen war.
Auch er ist heute Philosophieprofessor, auch er hatte sich sehr im ND engagiert.
Er war ein in sich gekehrter Mensch, man hat ihn nie zu Hause besucht.
Olaf wusste sehr früh etwas über „Ovulationshemmer“.
Joachim Kelterbaum war Klassenbester.
Er wurde immer von den Lehrern hervorgehoben und ging für ein Jahr als Austauschschüler in die USA.
Helmut Sachse war eine Zeit lang mein besonderer Freund.
Er wohnte in Mühlheim-Dümpten, sein Vater hatte dort ein Radio- und Fernsehgeschäft.
Helmut war von uns allen der mit Abstand beste Sportler, er lief einmal die hundert Meter in zehn Komma acht Sekunden und sprang über sechs Meter weit.
Ich traf ihn vor Vaters Tod als Stationsarzt im Borbecker Krankenhaus wieder.
Ich weiß noch, dass er Vater für meinen Großvater hielt.
Axel Berendonk war später mein Kumpel, mit dem ich, wie ich am Anfang schon erwähnt hatte, auch in Urlaub gefahren bin.
Er wohnte auf der Margarethenhöhe und fuhr von da jeden Morgen mit der Straßenbahn quer durch die Stadt.
Ursprünglich besuchte er dort ein Gymnasium, kam dann dort aber nicht zurecht und so zu uns.
Mit ihm verbrachte ich die Oberstufe zusammen. Oft bin ich mit ihm nach der Schule am Markt in die Kneipe Billard spielen gegangen, oder wir fuhren in die Stadt und gingen in einen Billardsalon.
Nach dem Abitur verdienten wir uns zusammen im Straßenbau Geld, mit dem wir einen gebrauchten VW 1500 kauften und dann eine elftausend Kilometer lange Südosteuropatour machten.
Ich habe Axel dann aus den Augen verloren, traf ihn dann Jahre später aber noch einmal in einer Kneipe in Werden.
Mein Nachbar Rudi Hajduk war derjenige, mit dem ich eine lang andauernde Freundschaft unterhielt. Wir gingen in die gleiche Klasse, jedenfalls bis ich sitzen blieb.
Rudi wohnte gegenüber von Frisör Willi Bott neben der Bahnstrecke.
Meist ging ich nach der Schule zu ihm und machte mit ihm Hausaufgaben.
Am Wochenende fuhren wir oft in die Düsseldorfer Altstadt ins „Mizzi“ oder nach Amsterdam ins „Paradiso“ oder einmal auch in den Puff.
Rudi hatte einen gebrauchten VW-Käfer Standard, ein grundsolides Auto, das allerdings nicht sehr schnell war.
Wir waren bestimmt zwanzig mal in Amsterdam, immer zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück.
In Düsseldorf waren wir noch öfter.
Rudis Eltern kamen aus Gotha, sie waren also Flüchtlinge.
Mit ihnen wohnten noch Rudis Onkel und seine Oma in der Wohnung.
Rudis Vater arbeitete bei der NRZ, der Onkel bei der Dresdner Bank, was die Mutter arbeitete, weiß ich nicht.
Die Familie Hajduk machte auf mich einen verhärmten unlustigen Eindruck.
Rudi hatte ein Dachzimmer, wo wir Musik von seinem Uher Variocord hörten, Shadows und Beach Boys.
Rudi hatte später einen Mini, an dem er viel vor der Garage seines Vaters schraubte.
Sein Vater hatte einen Opel Rekord.
Ich habe dann auch Rudi aus den Augen verloren.
Auf unserer Tour nach dem Abitur lernte ich in Rumänien Carola kennen.
Ich habe mich unheimlich in sie verliebt (enamorse). So war ich vorher nur in Brigitte Bialaß verliebt.
Ich habe mich später mit Carola verlobt und hatte mit ihr zusammen eine Wohnung in Bremen in der Alwinenstraße.
Die Verlobung hielt aber nur eineinhalb Jahre.
Brigitte hatte ich während eines Hollandurlaubes kennengelernt.
Sie wohnte in Bergerhausen.
Ich war mit ihr in der Tanzschule gewesen und besuchte sie sonntags immer.
Vorher rief ich sie von der Telefonzelle am Sulterkamp aus an, dann fuhr ich mit dem Bus (Linie 66) bis nach Bergerhausen.
Ich schmiss mich in Schale und beträufelte meinen Anzug mit „Tabac“-Herrenparfüm.
Auch mein Taschentuch, das ich früher immer bei mir hatte, wurde beträufelt.
Das Telefonat in der Telefonzelle kostete zwanzig Pfennige, zu Hause hatten wir kein Telefon.
Ein Zustand, der heute auf völliges Unverständnis stößt.
Niemand hatte im Hause ein Telefon, wenn es etwas wichtiges gab, ging man rüber zum Gemeindeamt, dort saß Fräulein Reinecke und ließ einen ausnahmsweise telefonieren.
Irgendwann war dann mit Brigitte Schluss.
Ich lernte Sylvia kennen, sie war klein und nett.
Sie wohnte am Viehoferplatz.
Die ganze Sonntagsprozedur spielte sich von jetzt ab mit Sylvia ab, nur die Busfahrt war nicht mehr so weit.
Sie wohnte im Hause von Waagen Rämsch.
Der Name Rämsch spielte viel später mal eine Rolle.
Markus von Haumeder war ein Quereinsteiger und wohnte in der Goethestraße.
Sein Vater war Arzt.
Wir fuhren oft mit seinem Volvo hinaus ins Grüne, einmal sogar bis ins Sauerland.
Er liebte Ringkämpfe, so forderte er mich im Grünen immer heraus.
Ich zog dann meist den Kürzeren.
1968 ging es mit seinem VW Käfer nach Paris. An Studentenunruhen dachten wir nicht.
Wir bekamen auch nichts davon mit.
Ich glaube, Markus war viel älter als wir alle.
Reinhold Horst wurde nur der „dicke Horst“ genannt. Er war ein merkwürdiger Kauz, sehr korpulent, aber trotz seiner Korpulenz von sich eingenommen.
Er wohnte Bottroper/Ecke Hafenstraße.
Wenn er mit seinem capeähnlichen Umhang an der Haltestele stand, sah er schon lustig aus.
Ich habe ihn öfters zu Hause besucht und mit ihm gute Musik gehört.
Er hatte in seinem Zimmer eine Dual-Anlage und immer die aktuellen Platten da.
Als die psychedelische Musik aufkam, projizierte man dazu Farben an die Wand.
Man gab dazu zwischen zwei Objektträgerplatten etwas Farbe, die unter der Hitzeeinwirkung des Projektors zu zerlaufen begann.
Das gab tolle Effekte bei den Bildern an der Wand. Wenn man bekifft war, hatte das eine sensationelle Wirkung.
Reinhold war ein Meister in der Handhabung der Farben und des Projektors.
1969 flog ich mit ihm nach Schottland.
Wir hatten Flüge beim Deutschen Jugendherbergswerk gekauft und 99 Mark bezahlt. Dafür flogen wir nach Edinburgh. Von da wollten wir trampen, rüber nach Irland und über Südengland wieder zurück.
Schon bald zerstritten wir uns aber und ich trampte alleine weiter.
Unterwegs lernte ich jemand anderen kennen.
Der Urlaub war klasse, mein erster Alleinurlaub.
Toll war es in Allihies in der Südwestecke Irlands. Ich habe da lange an der Steilküste gesessen und mir die Atlantikbrandung angeschaut.
Übernachtet wurde, wenn nicht draußen, dann in der Jugendherberge, wie eben in Allihies.
In Brighton habe ich auf dem Golfplatz geschlafen; meine Güte, was war das für ein toller Rasen. Morgens kamen die ersten Golfspieler schon recht früh, sie ließen uns aber schlafen und spielten einfach weiter.
Zur Schule kamen Rudi und ich mit dem Bus, früher mit dem Fahrrad.
Wir trafen uns bei Möller – einer Trinkhalle an der Haltestelle.
Für den Bus brauchte man eine Wochenkarte, die war mit Passbild und Wertmarke versehen.
Die Wertmarke kaufte man bei Wigge in Borbeck. Die Wochenkarte musste beim Betreten des Busses dem Schaffner gezeigt werden, der hinten im Bus in seinem Kabäuschen saß.
Ganz früher fuhren wir mit Halbdoppeldeckern.
Da gingen wir natürlich immer sofort nach oben.
Dann ging es über Schräplerstraße, Leimgardsfeld bis Hülsmannstraße oder wir stiegen schon Leimgardsfeld aus, dann liefen wir circa 300 m bis zur Prinzenstraße.
Oder wir fuhren mit dem Fahrrad (bicicleta).
Das ging dann durch die Heegstraße und dann den Hüttenberg hinauf.
Wie der Name schon sagt, oben stand die Zinkhütte, und wenn man die Rauchschwaden, die bei der Zinkverhüttung entstanden, eingeatmet hatte, wir fuhren ja berghoch, dann wusste man oben, was man getan hatte.
Es ging dann die Stolbergstraße entlang noch höher. Oben kam man an das Leimgardsfeld und war außer Atem.
In der Schule angekommen, schob man sein Rad über den Hof und stellte es in den Fahrradkeller.
Oder wir liefen die circa drei Kilometer zu Fuß.
Wir kamen dann bei Onkel Bruno in der Stolbergsraße vorbei und konnten auf dem Schiedsmannschild seinen Namen lesen. Oft stand sein grüner Käfer vor der Tür.
Auch die Lauferei war anstrengend, wir hatten schließlich unsere schweren Taschen dabei. Allerdings gingen wir nicht den Hüttenberg hoch, sondern wir nahmen die Abkürzung hinter der Brücke rechts Richtung Schrotthändler Welles.
Der Heimweg war mit dem Fahrrad am schönsten, weil es immer bergab ging.
Ich hatte ein Sportrad mit Torpedo Dreigangschaltung.
Da kam man auf der Stolbergstraße und hinterher auf dem Hüttenberg richtig auf Geschwindigkeit, ich glaubte, einmal 65 Stundenkilometer abgelesen zu haben.
Ich hatte mein Fahrrad gebraucht von Heinz Heer aus Gelsenkirchen bekommen.
Helga Heer war eine alte Freundin von Mutter, Heinz Heer wurde später mein Patenonkel.
Das Rad war der letzte Schrei, es war unglaublich gut ausgestattet.
Neben der schon erwähnten Dreigangschaltung hatte es batteriebetriebene Blinker, es hatte ein Kombiinstrument von VDO, das heißt Tacho und Uhr nebeneinander, die Uhr musste regelmäßig aufgezogen werden.
Die Bowdenzüge waren mit bunten, aus Kunstoff geflochtenen, Schutzhüllen ummantelt.
Rudi hatte an einer senkrecht hoch stehenden Stange einen Fuchsschwanz befestigt.
Wir haben uns später noch Nabenreiniger zugelegt, das waren zu Ringen zusammengebogene Bürsten, die um die Naben gelegt wurden und so während der Raddrehung die Felgen blank wienerten.
Sturmschellen waren eigentlich verboten, warum auch immer, wahrscheinlich wegen des Krachs, den sie machten.
Wir hatten natürlich welche.
Sie wurden, wie auch der Dynamo, an der Gabel befestigt.
Sie hatten auch ein Laufrad, das über einen Seilzug, der durch einen Bowdenzug lief und am Lenker befestigt war, gegen den Reifen gedrückt werden konnte.
Wurde es so in Drehung versetzt, bewegte es in dem Klingelkörper einen Mechanismus, der einen infernalischen Lärm erzeugte.
Die Schellen waren so laut, dass, wenn man sie neben einem Bürgersteig betätigte, die Fußgänger regelmäßig erschraken.
Nach und nach verloren die Räder samt ihrer Luxusausstattung ihre Funktion und wir fuhren nur noch Bus oder liefen.
Wenn wir mit dem Bus nach Hause fuhren, stiegen wir am Germaniaplatz ein.
Der Germaniaplatz war das Zentrum Borbecks, hier hielten alle Busse und Straßenbahnen, hier stiegen alle Schüler ein, um nach Hause zu fahren.
Logisch, dass der Platz nach Schulschluss von Schülern nur so wimmelte.
Zu unserer Zeit war der Germaniaplatz eine Augenweide, ich glaube, es gab sogar ein öffentliches Pissoir.
Mitten auf dem Platz stand die Viktoria zum Gedenken an die Gefallenen des Krieges von 1870/71 und des Ersten Weltkrieges.
Wir nutzen den Aufenthalt am Germaniaplatz immer zum Quatschen und vor allem zum Rauchen (fumar).
Wir ließen so mehrere Busse durchfahren, mit denen wir eigentlich hätten nach Hause fahren müssen, wo die Mutter mit dem Essen auf uns wartete.
Rudi rauchte – ich kurze Zeit auch – mit Spitze, das war angeberische Spinnerei, wir erregten aber Aufmerksamkeit.
Überhaupt war man am Germaniaplatz stets darauf bedacht, positiv in Erscheinung zu treten.
Schließlich war auch eine Menge Mädchen dabei, die – so glaubten wir jedenfalls – auf einen achteten.
Um der ganzen Angeberei die Krone aufzusetzen, rauchte Rudi „Abdullah“–Zigaretten, schon damals sündhaft teuer, oder man kaufte sich im Tabakladen eine fünfundzwanziger Packung Nil, die gibt es heute wieder.
Die Qualmerei wurde mir schnell zu teuer, ich fing an zu drehen.
Ich kaufte mir zuerst eine Tabakdose.
Das Besondere daran war, dass beim Zudrücken des Deckels ein Mechanismus betätigt wurde, der aus dem vorher in einer Stofftasche plazierten Tabak und dem darüber angelegten Blättchen eine Zigarette drehte. Man musste nur noch die Gummierung des Blättchens anlecken.
Später drehte ich von Hand.
Ich rauchte „Schwarzer Krauser“, aber den von „Kramer“, die andere Sorte, „Schwarzer Krauser Nr. 1“, war zu stark.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten klappte das Drehen von Hand ausgezeichnet, es war vor allen Dingen, vom Schnorren abgesehen, die billigste Art zu rauchen.
Auf unseren Fahrten nach Amsterdam lernte ich den stärksten Tabak kennen, den es gab (und wahrscheinlich heute noch gibt):
„Van Nelle Zware Shag“.
Ein Päckchen Van Nelle kostete früher einen Gulden fünfzig, die Blättchen dazu (am besten „Maskotte“ oder „Rizla“) noch einmal zehn Cent, das bedeutet nach heutigem Umrechnungskurs circa fünfundsiebzig Eurocent!
Als wir in der Oberstufe waren, gingen wir nach der Schule oft in den Vogelpoth.
Das war eine uralte Kneipe, ein alter Flachbau, der später einem Parkhaus weichen musste.
Frau Vogelpoth war eine sehr nette Wirtin, sie hatte etwas Mütterliches an sich.
Hier im Vogelpoth spielten wir Skat, egal wie spät es war, egal, ob die Mutter zu Hause wartete.
Das Skatspielen habe ich allerdings zu Hause gelernt, wenn ich mit Mutter und Oma, oder mit Mutter, Vater und Oma spielte.
Die spielten mit dem nötigen Ernst ohne dabei aber allzu verbissen zu sein, Spaß war trotzdem immer dabei.
Es wurde zwar auch geschimpft, wenn man sich verwarf, das war aber nie schlimm.
Auch konnte man verworfene Karten korrigieren, was bei manchen Spielern gar nicht ging und was eigentlich nach der deutschen Skatregel auch nicht erlaubt war.
So machte das Spielen aber Spaß und wurde nicht durch die Verkniffenheit der Mitspieler verdorben.
Das Bier kostete im Vogelpoth fünfzig Pfennige, nebenan gab es in der Pommesbude für fünfzig Pfennige eine Frikadelle mit Senf und Brötchen.
Im Vogelpoth waren nach der Schule alle Tische besetzt, so beliebt war die Kneipe.
Ich erinnere mich noch an ein altes Adressbuch, das dort herumlag.
Ein dickes Ding, in dem alle Stadtbewohner mit Adresse, Telefonnummer und Beruf vermerkt waren. Ich glaube, dass es solche Adressbücher aus Datenschutzgründen heute nicht mehr gibt.
Gegenüber dem Haupteingang der Schule lag der Laden von Herrn Storch.
Storch war der Laden für Schüler.
Wenn man ein Heft brauchte, einen Bleistift, ein Radiergummi, einen Pinsel oder einen Block, man bekam hier alles.
Aber Storch hatte natürlich auch Süßigkeiten, wie jeder normale Kiosk.
Und auch das Bier für Agatz´ Geburtstag wurde hier gekauft.
Das Tollste war aber, dass Herr Storch Zigaretten einzeln für zehn Pfennig das Stück verkaufte.
Das wurde natürlich von der Schulleitung nicht gerne gesehen, in den großen Pausen waberten Heerscharen von Schülern von der Raucherecke über die Straße und kauften sich ihre Zigaretten bei Storch.
Etwas weiter hoch Richtung Germaniaplatz gab es einen ganz normalen Kiosk, wir sagten Bude dazu. Hier kauften wir ein Brötchen mit Rollmops oder ein Brötchen mit Rolleschokolade.
Rolleschokolade war eine Art poröse Luftschokolade, die nicht so mächtig war, wie die gewöhnliche Tafelschokolade. Das Stück Rolle mit Brötchen kostete zwanzig Pfennige.
Manchmal reichte das Geld auch noch für eine kleine Cola nach dem Spielturnen.
Tajo
Zu Haus gab es zu Mittag Dinge zu essen, die man heute nicht mehr auftischt, zumindest wird man Verwunderung auslösen, wenn man Pilzgulasch, Nierchen, Stielmus, Himmel und Erde (gebratene billige Blutwurst mit Apfelmus und Kartoffelpüree) Panhas (das kennt heute kaum noch jemand) oder Hühnersuppe mit Magen und Herz serviert.
Als gymnasiales Großmaul hatte ich natürlich immer was zu meckern, Mutter war dann oft ganz fertig, ich rückte auch nach mehrmaligem Nachfragen nicht mit der Sprache heraus.
Ziemlich regelmäßig kam gegen vierzehn Uhr Oma hoch.
Sie wohnte im Anbau und hatte mit den Treppen zu kämpfen, die zu uns hoch führten.
Oma war neuapostolisch.
Ich denke, damit hing zusammen, dass sie statt eines Arztes einen Homöopathen aufsuchte, wenn sie gesundheitliche Probleme wie ihre Herzschmerzen therapiert haben musste.
Sie klagte, besonders wenn sie zu uns hereinkam, über Herzschmerzen und ließ sich in den Küchensessel fallen, um auszuruhen.
Wenn dann aber die Skatkarten auf dem Küchentisch lagen und wir zu spielen anfangen wollten, waren alle Herzschmerzen schnell vergessen.
Oma spielte gut Skat und freute sich immer, wenn sie ein Spiel gewonnen hatte („Da haben wir das Ferkel wieder geschlachtet!“).
Wir spielten fast jeden Mittag.
Nach jedem Spiel wurde gezahlt, es ging um einen Zehntel Pfennig, es wurde aufgerundet, ein einfacher Kreuz Solo kostete somit drei Pfennige, ein Grand mit Dreien – der Grand zählte bei uns zwanzig – acht Pfennige.
Kontra und Re verdoppelten jeweils, bei verlorenem Kontra, bei Re, bei einem Spiel ab hundert – zum Beispiel bei einem Grand mit Vierer, bei einem sechziger Spiel („der Arsch hat sich gespalten“) oder bei Schwarz - wurde Bock gespielt. Ramschen gab es bei uns nicht.
Viel Geld gewann oder verlor man so nicht!
Wenn Vater da war, das heißt, wenn er Spätschicht hatte, spielte er kurz auch mit.
Oder wir würfelten, wenn Oma mal nicht da war, das konnte man auch zu zweit.
Entweder wir spielten ein Spiel, das wir „tausend“ nannten oder wir „kniffelten“, dabei musste man immer zuerst die Kniffeltabelle aufzeichnen. Oft gab es einen Einsatz, zum Beispiel zwanzig Pfennige, den der Gewinner bekam.
Mutter trank beim Spielen immer Kaffee, Oma auch, das war das „Näppchen“.
Zum Kaffee wurden „Bärenmarke“ und Zucker genommen.
„Glücksklee“ war verpönt, es musste „Bärenmarke“ sein, der Kaffee war immer „Tschibo“-Kaffee.
Dienstags und freitags war in Borbeck Wochenmarkt (mercado).
Das war eine uralte Einrichtung.
Der Wochenmarkt fand natürlich immer auf dem Marktplatz statt.
Ich erinnere mich an den „billigen Jakob“, der Heftpflaster meterweise verkaufte, der Fischhändler hatte ein Heringsfass, Kieler Sprotten gab es in Spankörben.
Rogen und Milchner wurden verkauft und zu Hause in der Pfanne gebraten, Mutter kannte man schon auf dem Markt, sie ging immer zu denselben Händlern. Oft gab man ihr ein Extra, wie zum Beispiel ein Stück Fleischwurst oder ein paar Äpfel.
Sie fuhr mit ihrem Rad zum Markt, den gleichen Weg, den wir zur Schule nahmen.
Schwer bepackt rollte sie bergab nach Hause.
Sie war stolz darauf, dass sie den Weg bis ins hohe Alter mit dem Rad bewältigte, während andere Frauen den Bus benutzten.
Mutter hatte einen Riecher für Sonderangebote.
Manchmal fuhr sie außer der Reihe mit dem Rad los, um ein Sonderangebot zu kaufen, von dem sie in der Zeitung gelesen hatte.
Sie war äußerst sparsam, sie war nicht geizig.
Auf dem Markt wurde auch die Wurst gekauft, die wir zu Hause vertilgten.
Ich erinnere mich an Zungenwurst, Schwartemagen, grobe geräucherte Leberwurst und an Corned Beef, Fleischwurst gab es immer.
Es ging nichts über ein frisches, noch leicht warmes Brötchen mit guter Butter und Fleischwurst oder frischer Zungenwurst.
Der Begriff gute Butter stammt noch aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, als es keine Butter gab.
Wie ja überhaupt Nahrungsmittelknappheit herrschte.
Ein Stück gutes Fleisch wurde als Delikatesse angesehen.
Verschiedene Wurstsorten galten fast als Luxus.
Ich hatte aber nie Hunger gelitten und konnte mir die Situation, in der viele nach dem Kriege Hunger litten, kaum vorstellen.
Es wurde aber von meinen Eltern manchmal an die Hungerzeit erinnert, wenn wir den Teller nicht leer aßen, wurde gesagt:
„Wir waren früher froh, wenn wir eine Scheibe trockenes Brot hatten“.
Käse war eigentlich auch immer im Kühlschrank. Meist gab es Holländer, das war junger Gouda.
Vater aß aber auch Stinkkäse („Limburger“) und Camembert.
Der Kühlschrank war abschließbar, ich weiß aber nicht, ob wir überhaupt einen Schlüssel hatten.
Wir kauften eigentlich nur ganz selten in der Nachbarschaft ein, so bei „Prenting“, bei „EKU“ schon gar nicht, höchstens, wenn man mal etwas vergessen hatte.
Oder wir Jungen kauften für zehn Pfennig rohes Sauerkraut, das wir mit den Fingern verdrückten. Für Sauerkraut fuhren wir mit unserer Karre auch bis zum Metzger Dicke.
Früher gab es in den Lebensmittelläden Rabattmarken, die man in Markenbücher klebte.
Für ein volles Markenbuch gab es Geld.
Die Rabattmarken entsprachen in ihrem Wert drei Prozent Skonto.
Früh am Morgen brachte Bäcker Goworrek mittwochs und samstags das Brot.
Mutter nahm immer ein Kassler, manchmal einen Stuten, ein Schwarzbrot (Pumpernickel) und samstags ein paar Brötchen.
Die gekaufte Menge wurde in ein Heft eingetragen und am Samstag bezahlt.
Dieser Brauch war sicher aus der Zeit übrig geblieben, als es noch Wochenlöhne gab.
Manchmal stand ich noch beim Anziehen in der Unterhose, wenn Herr Goworrek klopfte und unmittelbar darauf eintrat.
Er trug einen stabilen Karton auf dem Arm, in dem er die Backwaren hatte.
Milch wurde von Willi Winn gebracht.
Er hatte hinter der Gaststätte „Buchmöller“ eine Milchstube. Herr Winn kam mit Pferd und Wagen, er verkaufte in der Anfangszeit die Milch lose.
Dazu hatte er auf seinem Wagen einen Pumpmechanismus, mit dem er die Milch in die mitgebrachten Milchkannen füllte.
Später gab es Glasflaschen mit Aluminiumkappe. Auch Kakao wurde so verkauft.
Man bekam Liter- und Halbliterflaschen. Die Schulen hatten auch Viertelliterflaschen. Der Milchof war „Kutel“, dort wurde die Milch abgefüllt.
Ich habe da mal drei Wochen lang gearbeitet.
Meine Aufgabe bestand darin, hinter den Flaschenkästen, die auf einem Transportband zur Spülmaschine bewegt wurden, herzulaufen und die Reste der Alukappen zu entfernen, bevor die Flaschen in der Spülmaschine verschwanden.
Dazu bekam ich morgens ein Paar Gummihandschuhe, das am Nachmittag bei Feierabend aufgebraucht war, weil die scharfen Alureste das Gummi zerschnitten hatten.
Alureste blieben deshalb auf den Flaschen, weil die Alukappe meist mit dem Daumen eingedrückt wurde und danach ein Ring übrig blieb.
Das war eine der vielen Ferienarbeiten, die ich ausübte, bei denen ich permanent auf die große Uhr schaute, die in der Halle hing.