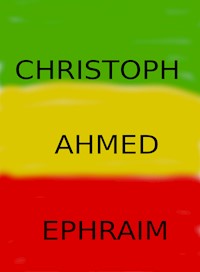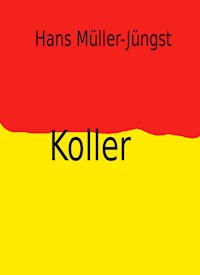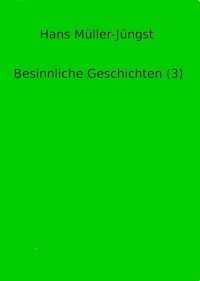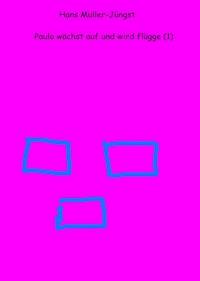Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Besinnliche Geschichten
- Sprache: Deutsch
Paulo begibt sich auf die Seidenstraße und kommt zuerst nach Istanbul. Dort lässt er sich ein Reisemesser schmieden und wird fortan darum bewunder. Er gerät in ein Erdbeben und kommt an den Van-See, wo er sich verliebt. Er fährt aber weiter nach Teheran, auch dort verleint er sich, setzt aber seine Reise fort. Am Ende kommt er nach Zentrralasien in das Ferganatal und hält sich dort länger auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Müller-Jüngst
Besinnliche Geschichten (2)
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Das Messer
Kirmes in Leopoldsau
Der Vluynbusch
Bingöl
Teheran
Soltanabad
Mara und Lydia
Ferganatal
Kamil ist arm
Geglückter Puppenverkauf
An Ebus Denkmal
Impressum neobooks
Das Messer
Paulo kommt nach Istanbul und trifft dort auf Yussuf, einen Onkel seines Schulkameraden Aydin, Yussuf ist früher ein angesehener Messerschmied gewesen, der aber sein Handwerk wegen der billigen Konkurrenz aus Ostasien an den Nagel gehängt hat.
Er begutachtete meine „Raichle“-Schuhe, sah sich genau deren Verarbeitung und die Sohle an und attestierte den Schuhen gute Qualität.
Ob ich denn alles zu Fuß machen wollte. Ich verneinte und sage, dass ich alle sich mir bietenden Verkehrsgelegenheiten nutzen wollte.
Ob ich denn kein Messer hätte, wollte Yussuf von mir wissen und ich sagte ihm, dass ich mit einem Messer nicht durch die Sicherheitsüberprüfung am Flughafen gekommen wäre.
Wenn ich zwei Tage Zeit hätte, könnte er mir ein Messer schmieden, sagte Yussuf dann.
Ich antwortete, dass ich vier Tage in Istanbul bleiben und ihm beim Schmieden eines Messers gern zusehen wollte.
Wieder hatte Yussuf den Glanz in den Augen, „gut“ sagte er dann, wir würden am nächsten Tag in den Großen Basar gehen und Messerstahl kaufen, er hätte einen alten Bekannten im Großen Basar, der sich auskannte und nicht betrügen würde.
Ich müsste für ein geschmiedetes Messer aber schon dreißig bis vierzig Euro ausgeben!
Ich willigte ein und entgegnete, dass ich gerne bereit wäre, für ein gutes Messer so viel Geld auszugeben.
Ich bekam ein eigenes Zimmer neben dem von Aydin und ging früh schlafen.
Aydins Onkel und Tante verließen am nächsten Morgen nach dem Frühstück zeitig das Haus.
Wir liefen zum Großen Basar, den wir nach zehn Minuten erreichten, es wimmelte von Touristen.
Die Händler waren alle auf die Touristen eingestellt und belagerten sie. Immer wenn sich eine Touristengruppe näherte, gingen sie auf sie zu und priesen ihre Ware an.
Oft hatten sie den typischen Touristenramsch im Angebot, viele Touristen fielen darauf herein und kauften zu völlig überzogenen Preisen.
Immer gaben die Händler den Touristen das Gefühl, gehandelt und ein gutes Geschäft gemacht zu haben.
Dabei machten sie selbst gut und gerne zweihundert bis dreihundert Prozent Gewinn.
Der Große Basar war ein fünfhundert Jahre altes Geschäftsviertel in Istanbul, er bestand aus einem Gewirr von überwölbten Gassen und Gässchen. In der Mitte befanden sich die Gold- und Silberhändler.
Eine Menge Cafes reihten sich aneinander.
Yussuf ging zielstrebig auf seinen Händler zu.
Mustafa führte seinen Stand schon in der dritten Generation, er handelte mit Messern und Schmuck, man konnte über ihn aber auch Rohstahl beziehen, so wie er zum Schmieden gebraucht wurde.
Er umarmte Yussuf herzlich und ging dann mit ihm in die hinterste Ecke seines Verkaufsraumes, dort kramte er ein Stück Rohstahl hervor.
Yussuf nahm das Stück in Augenschein und befand es für gut, man wurde schnell handelseinig.
Yussuf zahlte und ging mit Aydin und mir wieder hinaus, er freute sich über das gute Geschäft, das er gemacht hatte.
Wieder glänzten seine Augen, wahrscheinlich in Vorfreude auf seine Schmiedearbeit.
Zu Hause angekommen schickte er Aydin, Holzkohle kaufen. Er entfachte auf seiner alten Feuerstelle ein kleines Holzfeuer und schichtete, als es richtig brannte, Holzkohle darauf.
Die Esse zog immer noch gut. Den Blasebalg hatte man inzwischen elektrifiziert.
Yussuf leitete den Luftstrom vorsichtig auf die Holzkohle, bis sie weiß glühte. Dann legte er den Stahlrohling in die Glut und wartete, bis er die Schmiedetemperatur erreicht hatte. Anschließend nahm er den Rohling mit der Schmiedezange und legte ihn auf den Amboss.
Yussufs Bewegungen waren fast jugendlich und bestimmt, mit großer Eleganz schlug er mit dem Hammer auf den Stahlrohling und formte ihn nach seinem Willen.
Tack, tack, tack, der alte Arbeitsrhythmus war wieder zurückgekehrt.
In der Nachbarschaft wunderte man sich, dass Yussuf seine Schmiedearbeit wieder aufgenommen hatte. Aydin erklärte Neugierigen, was es damit auf sich hatte.
Yussuf war lange Zeit nicht ansprechbar, er schien in seiner Arbeit versunken.
Immer wieder legte er den Rohling ins Feuer, bis er rot glühte und schlug dann mit dem Schmiedehammer auf ihn ein.
Diese Tätigkeit dauerte Stunden.
Mit einem Mal legte Yussuf den Hammer zur Seite und wischte sich den Schweiß von der Stirn, er schickte Aydin los, für uns etwas zu essen zu kaufen.
Eine keine Arbeitspause würde ihm gut tun.
Immer wieder nahm er den Stahl in die Hand, er hatte ihn in einem Wassereimer abgekühlt, der Stahl hatte mittlerweile eine schöne Messerform.
Nach der Pause nahm Yussuf seine Hammertätigkeit mit unverminderter Intensität wieder auf, am frühen Abend war er fertig.
Er legte den Hammer zur Seite, wischte sich den Schweiß ab und setzte sich, etwas entfernt von der Feuerstelle, auf einen Stuhl.
Das Messer war in seiner Rohform fertig, es fehlten noch der Griff und die Scheide und es musste noch ein Endschliff gemacht werden. Das würde Yussuf am nächsten Tag erledigen.
Er wäre müde, sagte er und ließ sich, von Aydin gestützt, nach oben bringen.
Aydins Eltern wunderten sich, warum Yussuf so umtriebig wäre.
Aydin erklärte, dass er für mich ein Messer geschmiedet und den ganzen Tag am Amboss gestanden hätte.
Sie sagten nichts dazu, Aydins Mutter schüttete Yussuf einen Raki ein und setzte ihn in seinen Sessel, dann gab sie ihm seine Zigaretten.
Yussuf war mit sich und seiner Arbeit zufrieden.
Er würde am nächsten Tag drei Löcher in den Schaft bohren, um danach zwei Griffschalen an das Heft zu nieten.
Er trank genüsslich seinen Raki und rauchte eine Zigarette. Ich lobte ihn für die Standhaftigkeit, mit der er seine Arbeit verrichtet hatte und ich lobte das Messer, das er gefertigt hatte.
Nach vierzig Minuten war Yussuf eingeschlafen, sein ebenmäßiges Gesicht strahlte eine Zufriedenheit aus, wie sie nur ein guter Handwerker nach getaner Arbeit haben konnte.
Aydins Eltern führten Yussuf auf sein Zimmer und legten ihn ins Bett.
Aydin und ich gingen am Abend hinaus und liefen zur Galata-Brücke.
Ich sah vom Fähranleger in Eminönü hinüber nach Üsküdar, auf dem Bosporus herrschte reger Schiffsverkehr, die Fähren zogen unablässig zwischen den großen Schiffen hindurch, die vom Mittelmeer ins Schwarze Meer zogen und umgekehrt.
An der Galata-Brücke standen die Angler und warfen die gefangenen Fische in Plastiktüten, die sie vor sich hingestellt hatten.
Sie unterhielten sich ununterbrochen, die meisten Angler rauchten, vom Halic zog ein unangenehmer Geruch herüber.
Auf der anderen Seite der Galata-Brücke lag auf halber Höhe in Beyoglu der Galata-Turm.
Dort am Bosporus lag Europas Ostgrenze, in zwei Tagen würde ich nach Asien übersetzen und für lange Zeit alles hinter mir lassen.
Aydin und ich liefen am Halic entlang, das kurze Stück bis zur Yeni-Moschee.
Dann gingen wir wieder stadteinwärts in die Hamidye Caddesi.
Bis spät in den Abend hatten die Geschäfte geöffnet, der Trubel auf der Straße hatte kaum nachgelassen.
Aydin und ich gingen hoch und setzten uns eine Zeit in sein Zimmer. Er hatte einen PC und einen Fernseher.
Er zeigte mit die Spiele, die er auf seinen PC geladen hatte.
Ich fragte ihn, was er später einmal werden wollte, Aydin sagte, dass er das noch nicht genau wüsste, wahrscheinlich würde er aber irgendetwas in der Informatikbranche anstreben.
Er wollte studieren, aber nicht in Istanbul, vielleicht in Konya, dort gäbe es 8500 Studenten in sechzehn Fakultäten.
Aber zuerst müsste er seinen Schulabschluss machen, er schaltete den Fernseher an und stellte MTV ein.
Wie zu Hause, dachte ich und schaute mir ein paar Clips an.
Dann ging ich ins Bett.
Der nächste Tag stand wieder im Zeichen der Messerfertigung.
Yussuf war früh aufgestanden, was er aber immer tat.
Er hatte in seiner Werkstatt aus früheren Zeiten noch einen Ebenholzblock liegen, daraus hatte er immer seine Griffschalen hergestellt.
Er sägte und schliff mit der gleichen Behändigkeit, mit der er auch geschmiedet hatte.
Dann passte er die Griffschalen an, polierte hie und da noch ein bisschen und schlug drei Hohlnieten durch die Ebenholzgriffe und das Messerheft.
Ich nahm das Messer, es lag ausgezeichnet in der Hand, Yussuf sah mir an, dass mir das Messer gefiel, er war stolz auf seine Arbeit.
Er setzte sich noch eine halbe Stunde an den Schleifstein, dann war das Messer fertig.
Yussuf nahm ein Stück Leder und schnitt zwei Scheidenhälften daraus, mit einer Ahle stach er Löcher für die Naht aus.
Mit geübtem Griff nähte er aus den zwei Lederhälften eine Messerscheide zusammen, er heftete gleichzeitig eine Gürtelschlaufe daran.
Danach machte Yussuf ein feierliches Gesicht und händigte mir seine hervorragende Handwerksarbeit aus.
Ich zog meinen Hosengürtel durch die Lederschlaufe und steckte das Messer in die Scheide.
Mit einem Mal befiel mich ein Gefühl der Zufriedenheit, ich hatte mein Messer!
Natürlich könnte ich es nicht die ganze Zeit am Gürtel tragen, es würde mir gestohlen werden.
Ich gab Yussuf vierzig Euro, er war zufrieden.
Er setzte er sich in seinen Sessel und begann, auf mich einzureden, Aydin kam mit der Übersetzung kaum hinterher.
Ich sollte auf meinem Weg nach Osten unbedingt in Konya Station machen. Ich könnte von Istanbul-Haydarpascha mit der Anatolischen Eisenbahn bis nach Konya fahren, dann wäre ich schon ein gutes Stück nach Osten vorwärts gekommen.
Yussuf wünschte mir für meine Reise Allahs Segen und nannte mir die Adresse seines Bruders in Konya, da könnte ich übernachten.
Es hätte ihn sehr gefreut, noch einmal schmieden zu können.
Ich sollte ihm unbedingt schreiben, vielleicht sogar aus China!
Ein Lächeln überflog sein Gesicht, als er das sagte, wie auch immer das zu deuten war.
Kirmes in Leopoldsau
Rosi ist Lenis Tante und lädt ihre Nichte auf die alljährlich stattfindende Kirmes ein, wo sie einen halban Tag verbringen und kaum ein Fahrgschäft auslassen.
Am ersten Tag der Kirmes lud Rosi ihre Nichte Leni ein, mit ihr einen Nachmittag auf dem Volksfest zu verbringen.
Leni war begeistert und Rosi holte sie mit ihrem Käfer ab. Leni wollte zuerst einen Teil ihres Kommuniongeldes mit zur Kirmes nehmen, das redete ihr Rosi aber wieder aus, Sie wollte alles bezahlen.
Miriam steckte ihrer Tochter dann aber doch dreißig Euro zu. Lenis Schule endete um 13.15 h, die Kinder aus Leopoldsau hatten am Kirmesmontag schulfrei.
Leni machte schnell ihre Schulaufgaben und aß. Um 14.15 h kam Rosi und holte sie ab. Sie waren dann um 14.45 h auf der Kirmes.
Rosi versprach Leni:
„Wie bleiben bis zum Abend, gegen 19.00 h bringe ich Dich aber wieder nach Hause!“
Rosi hatte zugesagt, Leni spätestens um 19.30 h zu Hause abzuliefern.
Die Kirmes fand wie in jedem Jahrs auf den Donauwiesen statt. Sie war sehr groß, es gab viele Fahrgeschäfte.
Waren diese früher eher harmlos und lustig, so gab es in dieser Zeit Fahrgeschäfte, die einen das Gruseln lehrten. Aber Leni wollte mit ihrer Tante gerade die spektakulären Fahrgeschäfte ausprobieren. Auf manche durfte Leni wegen ihres geringen Alters noch gar nicht, oder sie musste von einer erwachsenen Person begleitet werden.
Rosi parkte bei sich zu Hause und ging anschließend mit Leni zur Donau hinunter. Man konnte die Kirmesmusik bis in die Stadt hinein hören.
Um 14.00 h fing der Kirmesbetrieb an. Es war eigens eine Donauwiese für Parkzwecke hergerichtet, für Auswärtige.
Sie mussten 3 Euro für das Parken bezahlen.
Um 15.00 h war noch nicht so viel los, es begann aber, voll zu werden.
Rosi und Leni hatten sich vorgenommen, so viele Fahrgeschäfte wie möglich mitzunehmen. Sie mussten sich ranhalten.
Gleich am Eingang gab es schon ein Kettenkarussell, das war zwar nicht sehr aufregend, aber für den Anfang genau das Richtige.
Kettenkarussells gab es auf der Kirmes schon seit ewigen Zeiten.
Dieses war noch recht neu und drehte ziemlich schnell. Man hob mit seinem Sitz ziemlich ab und drehte sich in großer Höhe im Kreis.
Leni versuchte, mit den Beinen den Sitz vor ihr zu berühren, schaffte das aber nicht. Auch hielt sie der Sicherungsbügel zurück, den alle umlegen mussten.
Rosi saß auf dem Sitz neben ihr und hielt die Ketten, an denen der Sitz hing.
Nach ungefähr zehn Runden wurde die Fahrt langsamer und das Karussell kam zum Stillstand.
Rosi und Leni stiegen ab und gingen zum nächsten Fahrgeschäft. Das war der Autoscooter.
Auch den Autoscooter gab es schon, so lange Rosi denken konnte. Er übte auf alle Fahrer eine merkwürdige Faszination aus.
Man zahlte 3 Euro, setzte sich in einen Wagen und fuhr seine Runden. Es kam darauf an, möglichst den Remplern der anderen zu entgehen. Junge Burschen hatten es besonders auf die Mädchen abgesehen, die sie nach Möglichkeit frontal rempelten. Das war nicht besonders schlimm, weil die Wagen mit einem umlaufenden Gummiring gepolstert waren, dennoch wurden die Körper stark durcheinandergewirbelt, was manchmal unangenehm war.
Am Autoscooter lief immer laute Techno-, Dance- oder Discomusik.
Auch wurden Nebelmaschinen betrieben, die die Fahrfläche verschleierten.
LED-Licht wurde computergesteuert eingesetzt.
Das alles machte den Autoscooter zu einer Hauptattraktion für die Jugend. Manche standen stundenlang am Rand und bewegten sich nicht.
Fahrten wurden wegen des hohen Preises nicht so oft gekauft.
Rosi und Leni sind ohne großes Gerempel davongekommen und verließen den Autoscooter wieder.
Sie kamen so langsam in Fahrt. Draußen gab es vor dem Autoscooter und dem Freifallturm einen Kokosnuss-Stand. Beide gingen sie hin und kauften sich gebrochene Kokosnuss-Stücke.
Kokosnüsse kannte man nur vom Weihnachtsteller und von der Kirmes. Die Kokosspalten schmeckten ausgezeichnet, blieben aber auch am Gaumen kleben. Also kaufte Rosi zwei Dosen Sprite.
Die nächste Attraktion war der Freifallturm. Diesen Turm gab es noch nicht so lange auf der Kirmes. Er erfreute sich einer großen Beliebtheit.
Rosi und Leni zahlten 5 Euro pro Person und setzten sich auf eine Bank, die rund um einen vierzig Meter hohen Turm angebracht war.
Es passten ungefähr dreißig Personen auf die Bank. Alle Personen wurden durch hydraulische Schulterbügel gesichert.
Als die Bank voll besetzt war, wurde sie an Stahlseilen hochgezogen. Langsam ging es hoch fast bis zur Turmspitze. Es lief sehr laute Musik, die ab und zu von Durchsagen des Bedieners unterbrochen wurde. Bis dieser plötzlich sagte: „Und jetzt festhalten!“ Dann fiel die Bank am Turm nach unten, wo sie kurz vor dem Ende durch starke Wirbelstrombremsen aufgefangen wurde.
Als sie zum Stillstand gekommen war, ging es gleich noch einmal hoch bis auf halbe Höhe, und wieder kam der Absturz.
Der freie Fall wurde von einem ohrenbetäubenden Gekreische begleitet, auch Rosi und Leni schrien.
Danach war Schluss, die Schulterbügel klappten hoch und beide stiegen aus, noch etwas benommen.
Sie schauten an dem Turm hoch und staunten über die große Höhe.
Von außen beobachteten sie ihre Nachfolger und sahen deren vom Kreischen verzerrte Gesichter.
Sie kamen anschließend zur Raupenbahn. Die Raupe war ein Fahrgeschäft, das Rosi auch von früher kannte.
Sehr laute Musik dröhnte aus den Lautsprechern. Es standen viele Jugendliche herum und hingen ab.
Die Jungen baggerten die Mädchen an, die meist zu zweit in die Fahrkabinen stiegen. Am Nachmittag kamen aber auch immer mehr Pärchen, die traditionell zur Hauptkundschaft der Raupe gehörten.
Die Raupe fuhr einfach im Kreis hoch und runter, gegen Ende der Fahrt senkte sich ein Stoffbalg über die Kabinen. Das war der Moment des Kuschelns und Knutschens, was wegen des Verdecks aber niemand sehen konnte.
Die wagemutigen Bediensteten standen auf der Außenkante der Wagen und kontrollierten die Fahrchips.
Früher trugen sie eine große Haartolle, die sie mit dem im Hosenbund steckenden Kamm permanent frisierten.
Sie schafften es auch, während der Fahrt abzuspringen und kamen sich vor wie Tarzan.
Rosi und Leni stiegen in einen Wagen, nachdem sie 2.50 Euro bezahlt hatten und gaben ihren Chip ab.
In einem Affenzahn ging es im Kreis herum, Leni wurde gegen Rosi gepresst.
Danach schloss sich das Stoffverdeck, und man hörte vereinzelte Schreie. Als es sich wieder öffnete, war die Fahrt zu Ende.
Rosi und Leni verließen die Raupe und kamen an eine Losbude. Rosi kaufte für jeden fünf Lose, Leni hatte tatsächlich einen Gewinn gezogen.
Der Losverkäufer gab ihr eine Kunststoffrose. Die hielt Leni während der ganzen Zeit in der Hand. Sie nahm sie später als Erinnerung mit nach Hause.
Rosi und Leni schlenderten weiter, sie kamen am Kinderkarussell vorbei, wo Eltern mit ihren Kleinen standen.
Dafür war Leni natürlich schon zu groß, Rosi musste an früher denken, als sie liebend gern auf die Feuerwehr ging und immer die Glocke läutete, während ihre Mutter und ihr Vater am Rand standen und sich unterhielten.
Sie erreichten den Schießstand, wo junge Männer versuchten, ihrer Freundin eine Puppe zu schießen.
Es wurde immer nachgeladen, immer wurden 2 Euro für vier Schuss hingelegt, bis dann irgendwann Schluss war und der Budenbesitzer dem jungen Mann einen Trostpreis hinlegte.
Die Freundin heuchelte große Freude und nahm den Preis an sich.
Rosi kaufte für Leni und sich eine Tüte gebrannte Mandeln. Das hatte sie immer schon getan, immer wenn sie auf der Leopoldsauer Kirmes war, kaufte sie gebrannte Mandeln.
Die waren wegen der harten und süßen Glasur natürlich schlecht für die Zähne, schmeckten frisch geröstet aber umso besser.
Danach gelangen sie an ein Fahrgeschäft, das man am besten mit nüchternem Magen bestieg, es hieß Break Dance.
Auf deutschen Kirmesveranstaltungen war es eine relativ neue Erscheinung.
Auf einer großen rotierenden Scheibe befanden sich vier oder sechs Gondelkreuze, an denen jeweils vier Gondeln befestigt waren
Die Drehscheibe und die Gondelkreuze wurde durch Elektromotoren angetrieben und die Gondeln dadurch in eine kombinierte Drehung versetzt.
Ähnlich wie die Drehscheibe waren die Gondeln schräg an den Gondelkreuzen befestigt, konnten sich aber frei um die eigene Achse bewegen.
Aufgrund der wilden und oftmals nur schwer vorhersehbaren und sich ständig ändernden Fahrtbewegung lehnte sich der Name dieses Fahrgeschäftes an den Breakdance-Tanzstil an.
Leni wurde schon vom Zuschauen fast schlecht. Aber sie wollte unbedingt auf den Break Dance.
Auch Rosi war nicht ganz wohl bei dem Gedanken, in dieser zuckenden Gondel sitzen zu müssen, kaufte aber zwei Chips und setzte sich mit Leni hinein.
Am Spätnachmittag bekam man noch bequem eine Gondel, abends rannten die Leute auf die sich noch drehende Scheibe und kämpften um die Gondeln. Viele mussten die Scheibe dann unverrichteter Dinge wieder verlassen. Es ertönte die Stimme des Rekommandeurs: „Nichts geht mehr! Bitte zurückbleiben!“
Dann setzte sich der Break Dance in Bewegung.
Man konnte wirklich nicht vorhersagen, wie sich die Gondeln bewegen würden, die ganze Sache verlief auch noch auf einer schiefen Ebene.
Mal gab es recht gemächliche Drehungen, dann wieder ein starkes Reißen und unglaubliche Beschleunigungen.
Rosi und Leni waren froh. als sie den Break Dance hinter sich lassen konnten. Sie hatten während der ganzen Fahrt nicht ein Wort miteinander gewechselt, beiden war etwas flau im Magen.
Sie sahen sogar jemanden am Rande der Scheibe sich übergeben.
Schnell gingen sie weiter.
Rosi fragte Leni:
„Ist mit Dir alles in Ordnung, sollen wir noch weiter machen?“ und Leni nickte mit dem Kopf und steuerte zielstrebig das Riesenrad an.
Dieser Klassiker einer jeden Kirmes war immerhin dreißig Meter hoch.
Rosi kaufte Chips und setzte sich mit Leni in eine Kabine.
Und schon setzte sich das Rad in Bewegung, bis es nach kurzer Zeit wieder stehen blieb.
Erst als alle Kabinen besetzt waren, fing es an, sich ständig zu drehen.
Toll war der Ausblick auf Leopoldsau, die Fahrt war kein Vergleich zum Break Dance.
Sie drehten ungefähr sechs Runden, als das Riesenrad zur Ruhe kam und die Kabine unten angehalten wurde.
Rosi und Leni stiegen aus. Es war mittlerweile 18.00 h geworden und Rosi mahnte zur Eile.
Leni war noch nicht müde, obwohl sie ein Fahrgeschäft nach dem anderen ausprobiert hatten.
Nebenan gab es den Dark Ride, was nur eine andere Bezeichnung für die alte Geisterbahn war. Leni zog sofort dorthin.
Es war an diesem Dark Ride nichts los, keiner von beiden wusste, was auf sie zukommen würde.
Sie fuhren in einen völlig dunklen Raum, in dem eine abscheuliche Musik lief, deren Klang durch spöttisches Lachen, durch Entsetzensschreie, durch unheimliche Rufe oder lautes Gebrüll unterbrochen wurde. Leni rückte ganz dicht an Rosi heran. Beide versuchten, durch weit geöffnete Augen zu erkennen, was um sie herum geschah.
Sie sahen aber nichts.
Plötzlich erklang direkt neben ihren Ohren ein infernalischer Schrei und im gleiche Moment flog ihnen ein feuchter Lappen ins Gesicht.
Sie erschraken zu Tode, Leni hielt sich an Rosi fest, die einen Arm um ihre Nichte legte.
Danach ging ein grelles Licht an, welches auf ein menschliches Skelett fiel, das sich auf sie zubewegte.
Leni war wie erstarrt, sie schmiegte sich eng an Rosi. Zum Schluss fuhr der Wagen an wilden Tieren vorbei, die brüllten und nach ihnen schnappten.
Sie waren beide froh, als sie die Fahrt des Grauens hinter sich gebracht hatten.
Zufrieden blickte der Betreiber in zwei aschfahle Gesichter.
Langsam löste sich bei Rosi und Leni der Kloß im Hals und sie liefen gut gelaunt weiter.
„Da will ich noch rein!“ rief Leni und zeigte auf den Round up, den Rosi auch schon von früher kannte.
Der Round up war ein klassischer Karuselltyp, bei dem die Fahrgäste wie in einer Zentrifuge durch die Fliehkraft an die Außenwand gedrückt wurden. Dabei stellte sich die rotierende Scheibe fast senkrecht.
Rosi und Leni klebten an der Drahtwand und schauen in die Mitte der Drehscheibe.
Die Drehgechwindgkeit war ziemlich hoch, jedenfalls kam sie einem so vor.
Erst als sie herabgesetzt und die Scheibe wieder in die Horizontale gebracht wurde, konnten sich die beiden wieder normal bewegen. Es war ihnen aber nicht schwindelig geworden.
Rosi sagte:
„Wir können noch ein Fahrgeschäft mitnehmen, danach müssen wir nach Hause!“
Leni entschied sich für ein absolut verrücktes Gerät, das auf der deutschen Kirmes noch neu war, den Top Spin.
Die Fahrgäste saßen auf einer circa zehn Meter breiten Bank, die zwischen zwei Tragarmen frei schwingend aufgehängt war. Die Tragarme wurden durch Elektromotoren in eine Drehbewegung versetzt und waren ihrerseits an breiten Ständern montiert.
Die ganze Geschichte konnte durch kreisförmig am Drehpunkt angebrachte Bremsen festgestellt oder gelöst werden. Dadurch konnte sich die Bank in maximaler Höhe überschlagen.
Das Fahrprogramm bestand aus verschiedenen Abfolgen von Hochfahren, Schaukeln und Überschlagen des Fahrgastträgers.
Rosi sagte:
„Anschließend müssen wir aber nach Weinlinden zurückfahren!“
Auf dieser Attraktion wurde beiden beinahe übel. Man wusste während der Fahrt nie, wo man sich gerade befand. Wieder und wieder gab es Überschläge, ab und zu sah man Leute mit offenen Mündern staunend am Rand stehen. Dann endlich war Schluss.
Rosi und Leni stiegen hinab und hielten sich gegenseitig, bis sie wieder zu Luft gekommen waren.
„Das war klasse, Tante Rosi!“ rief Leni.
Wo sie denn ihre Rose hätte, wollte Rosi wissen. Dann zog Leni die Kunststoffrose aus ihrer Bluse, wo sie sie schon vor längerem hineingesteckt hatte.
Zum Abschluss aßen beide eine Bratwurst und unterhielten sich über das Erlebte.
„Ich will auf jeden Fall noch einmal mit meinen Eltern auf die Kirmes!“, rief Leni.
„Was hat Dir denn am besten gefallen?“, wollte Rosi wissen.
„Das Beste war, dass ich mit meiner Tante zusammen soviel Spaß gehabt habe“, sagte Leni.
Rosi freute sich über das Kompliment.
Sie gingen zu ihrem Wagen und fuhren zurück nach Weinlinden. Rosi lieferte Leni pünktlich um 19.15 h zu Hause ab.
Sie setzte sich noch ein wenig mit Miriam zusammen, Leni aß zu Abend und erzählte von der tollen Kirmes.
Der Vluynbusch
Viele Leute nutzen den Vluynbusch, um zu entspannen, zu joggen oder einfach nur, um spazieren zu gehen, denn der Vluynbusch ist das einzige zusammenhängende Waldgebiet in der näheren Umgebung und hat in seinem Inneren eine Naturwaldzelle, die nicht von Menschenhand umgestaltet werden darf.
Der Vluynbusch ist ein Erholungsraum westlich von Neukirchen-Vluyn. Er ist ein Waldgebiet, zwar recht klein, aber ein zusammenhängender Wald, wie man ihn in der Umgebung sonst kaum findet.
Er wird begrenzt durch die Geldernsche Straße im Norden, den Littardweg im Osten, die Rayener Straße im Süden und den Bergdahlsweg und den Sandbruch im Westen.
Er ist drei Kilometer lang und an der breitesten Stelle einen Kilometer breit.
Im Jahre 2004 erging eine ordnungsbehördliche Verordnung über die Festsetzung des Naturschutzgebietes Staatsforst Rheurdt/Littard in der Gemeinde Rheurdt, Kreis Kleve, darin heißt es in § 2: „Das Gebiet... „befindet sich nördlich der K 9, südlich der L 474 zwischen der Landwehr und Littardschem Kendel (innerhalb des Kuhlenbogens), südlich von Rheurdt und nordöstlich von Schaephuysen. Das Gebiet ist überwiegend Staatsforst des Landes Nordrhein-Westfalen.“
Dieser Staatsforst Rheurdt/Littard ist ein Naturschutzgebiet, das zwischen Rheurdt und Neukirchen-Vluyn liegt und eine Fläche von 145 ha hat. Er ist ein geschlossenes Laubmischwaldgebiet.
Er wird durch Stieleichen-, Hainbuchenwälder und saure Buchenwälder geprägt, und hat einen sehr geringen Nadelholzanteil.
Das Kernstück des Naturschutzgebietes ist die fünfundzwanzig Hektar große Naturwaldzelle Littard.
In diesem Bereich findet keine Bewirtschaftung statt, sodass sich wild lebende Pflanzen und Tiere ungestört entwickeln können.
Der Staatsforst wird im Norden und Westen von einem Gruben- und Stillgewässersystem umgeben, das von ehemaligen Torfkuhlen stammt.
Mit diesem grenzt sich der relativ naturnahe Lebensraum von den umgebenden intensiv landwirtschaftlich genutzten Feldern ab.
Für den Naturschutz bedeutsam ist das Naturschutzgebiet hauptsächlich aufgrund der Ausdehnung seiner naturnah entwickelten Laubwaldgesellschaften.
Im Staatsforst leben der Schwarzspecht und, an zwei im Wald liegenden kleinen Teichen, der Eisvogel.
Eigentlich gehört noch ein kleines Stück nördlich der Geldernschen Straße zum Staatsforst, das ist aber wirklich nur ein kleines Stück.
In hohem Maße interessant ist aber die Naturwaldzelle, zu der man gelangt, wenn man vom Samanns Hof aus nach Westen durch den Wald läuft. In der Verlängerung erreicht man die Meenenkuhle und Rheurdt.
Die genaue Beschreibung der Naturwaldzelle lautet: „Wuchsbezirk - Niederrheinebene, Bestand - ungleichaltrige Stieleichen, Hainbuchen-Eschen-Mischwald mit Kirschen und einzelnen Birken, Erlen und Buchen, Geologie - Auenablagerung (Holozän) über Hochflutablagerung (Pleistozän/Holozän), zum Teil über Terrassenablagerung (Niederterrassen, Pleistozän), Bodenart - sandig-lehmiger Schluff bis toniger Lehm über carbonhaltigem lehmigem Sand, Nährstoffhaushalt - mäßig nährstoffhaltig bis nährstoffreich, Höhenlage - 30 Meter ü. NN., natürliche Waldgesellschaft - Stieleichen, Hainbuchenwald, Größe der Naturwaldzelle - 24.5 ha, Alter im Jahre 2005 - Eiche 125 bis 255 Jahre, Esche, Hainbuche und Kirsche 82 bis 132 Jahre....“
In der Bevölkerung heißt der Staatsforst schon seit jeher Vluynbusch. Er ist ein ausgesprochenes Naherholungsgebiet.
Man kann ihn auf unterschiedliche Art nutzen, es gibt die Spaziergänger, wie überall, Jogger, Fahrradfahrer, Reiter und Ruderer und im Winter auch Schlittschuhläufer.
Am Samannshof kann man Ruderboote mieten und auf den Teich, der ein Teil der Littardkuhlen ist, hinausrudern. Der Samannshof ist das Ausflugsziel par excellence. Er ist direkt an den Littardkuhlen gelegen und durch diese vom Wald getrennt. Der Littardweg führt immerzu am Wald entlang und ist zum Beispiel am 1. Mai dermaßen mit Fahrrädern überfüllt, dass man bei Samanns in einen Stau geraten kann.
Man kann bei Samanns sehr gemütlich draußen sitzen und etwas trinken. Ganz früher war die Küche bei den Vorbesitzern nicht empfehlenswert, inzwischen hat sich aber gute Kost durchgesetzt.
Ein Stück Apfelkuchen mit Sahne und dazu eine Tasse Cappuccino, das ist das größte.
Das Bötchenfahren ist sehr beliebt, und man geht im Winter oft aufs Eis.
Von Samanns aus kann man auch schön spazierengehen, man geht über die Kendelbrücke in den Wald. Schon bald sieht man da die Reitwege. Es wird im Vluynbusch viel geritten
Der Wald ist als Laubmischwald sehr angenehm, lichtdurchlässig, nicht so duster wie ein Nadelholzwald.
Man fährt schon mal mit dem Rad von Neukirchen zu Samanns. Das geht über die Felder nach Vluyn, nach Hochkamer auf die Hochkamerstraße, dann rechts ab in die Vluynbuschstraße, links ab in den Heisterweg bis zum Littardweg, dann ist man da.
Wenn man einen freien Platz draußen erwischt, setzt man sich hin und trinkt etwas.
Ansonsten geht man direkt auf den Bootssteg und leiht sich ein Ruderboot. Die Kinder haben dann meist Tüten mit altem Brot dabei und füttern die Wasservögel.
Durch den ganzen Vluynbusch läuft von Nord nach Süd ein Hauptweg, den kreuzt schon mal ein Reiter. Reiter sind gelegentlich hochnäsig und nehmen keine Rücksicht. Vielleicht liegt das an der erhöhten Sitzposition. Man bleibt dann eben stehen und lässt die Reiter passieren. Oder man trifft auf schnaufende Jogger, die mit hochrotem Kopf ihre Strecke ablaufen. Wenn man denen nicht Platz macht, rennen die einen glatt um, einige jedenfalls.
Im Vluynbusch gibt es Gelegenheit, alle heimischen Bäume anhand ihres Blatt- oder Stammesaussehens zu identifizieren und zu beschreiben.
Sehr leicht sind Stieleichen zu erkennen. Die Blattform ist charakterstisch. Der Name Eiche kommt von dem lateinischen Esca=Speise, was auf die Eichel als Schweinefutter hinweist. Die Eiche hat Blätter mit vielen Einbuchtungen, man nennt das wechselständig. Die Blattränder sind glatt oder gezahnt. Die Eichen bilden Eicheln als Früchte. Diese sind Nussfrüchte und in einen Fruchtbecher eingeschlossen. Die Eiche ist in Deutschland mit einem Anteil von neun Prozent am Bestand nach den Buchen der verbreitetste Laubbaum. Sie kommt vor allem in Mischwäldern vor. Sie benötigt mehr Licht als zum Beispiel Rotbuchen, sie bildet selbst offene lichte Kronen und steht gern allein.
Die Rotbuche ist der wichtigste deutsche Waldbaum. In Europa spielt auch die Orientbuche eine-wenn auch untergeordnete-Rolle. Die Blätter der Rotbuche stehen wechselständig und sind ganzrandig, gekerbt oder gezahnt. Aus den weiblichen Blühten bilden sich Bucheckern. Das sind dreikantige Nüsse, die zu zweit oder zu dritt in einem so genannten Achsenbecher sitzen. Das Buchenholz, wie auch das Eichenholz, das früher im Schiffbau Verwendung fand, wird im Möbelbau sehr geschätzt. Es wird entweder massiv verbaut, zum Beispiel für Stühle und Tische, oder als Furnier.
Die Schwarzerle ist eine in ganz Europa heimische Laubbaumart. Sie wächst gern in Wassernähe, sogar in Überschwemmungsgebieten. Sie wird bis zu achtundzwanzig Meter hoch und hat einen Stammdurchmesser von einem Meter. Sie erreicht ein Alter von hundert bis hundertzwanzig Jahren. Die Rinde ist borkig und dunkel, in kleine senkrechte Platten zerklüftet. Die Blätter sind langgestielt ohne Blattspitze, sie sind oval mit gesägten Rändern. Das Erlenholz wird im Instrumentenbau für den Massivholzkorpus von E-Gitarren und E-Bässen gebraucht.
Die Esche war 2001 Baum des Jahres. Sie gehört zu den Ölbaumgewächsen. Sie erreicht eine Wuchshöhe von vierzig Metern bei einem Stammdurchmeser von zwei Metern. Ihr Alter kann bis zu dreihundert Jahre betragen. Ihre Rinde besitzt im Alter eine graue längsrissige Borke. Sie hat gegenständige, bis zu fünfunddreißig Zentimeter lange Blätter. Die Esche hat in fortgeschrittenem Alter ein ausgesprochen starkes Lichtbedürfnis. Das Eschenholz ist sehr hart und elastisch. Es findet deshalb Verwendung beim Sportgerätebau-Schlitten, Speere, Bogen und in der Herstellung von Werkzeugstielen. Die Esche ist in ganz Europa, außer in Südspanien und Nordskandinavien beheimatet.
Die Ulme ist ein Laubbaum, den man schon seltener sieht. Sie ist im Vluynbusch kaum bekannt. Wegen des Ulmensterbens ist dieser Baum vom Aussterben bedroht. Ulmen sind in Mitteleuropa überall verbreitet und schon seit zehn Millionen Jahren hier ansässig. Die Ulmenblätter sind fünfzehn bis achtzehn Zentimeter lang, fünf bis neun Zentimeter breit, oval, spitz, oben dunkelgrün, unten heller bis weiß behaart. Der Blattrand ist doppelgezahnt. Das Holz der Ulme heißt Rüster. Es ist zäh, mäßig hart, stoß-und druckfest und gut bearbeitbar. Es wird zu Furnieren, Möbeln, Gewehrschäften, Parkett und Tafelungen verarbeitet
Die Pappel gilt als Baum von minderer Qualität. Ihre Standfestigkeit ist nicht sehr hoch. Pappeln werden fünfunddreißig bis fünfundvierzig Meter hoch. Der Stamm hat eine rauhe und graue Borke. Das spezifische Gewicht liegt mit 0.41 g/cm^3 bei dem der gemeinen Fichte. Die Pappeln gehören zu den am schnellsten wachsenden Gehölzen der gemäßigten Breiten. Es gibt in Deutschland die Schwarz-, Silber- und Zitterpappel. Pappeln werden für die Produktion von Holzpellets, für Brennstoff und als Einstreu für Tiere gebraucht. Die Industrie braucht Pappelholz für die Herstellung von Spanplatten. Auch in der Zellstoff-, Karton- und Papierherstellung findet Pappelholz Verwendung.
Birken sind leicht an ihren Stämmen zu erkennende Laubbäume. Sie werden bis zu hundertsechzig Jahre alt und sind in der ganzen nördlichen Hemisphäre verbreitet. Sie sind schnellwachsend und können nach sechs Jahren schon eine Höhe von sieben Metern erreichen. Sie werden bis zu dreißig Meter hoch. Bei vielen Birkenarten ist die Rinde auffällig hell bis weiß. Die Birke ist sehr anspruchslos und wächst auf nassen Böden wie in Heidelandschaften. Birkenpollen stellen ein hochpotentes Allergen dar, fünfzig Prozent aller Pollenallergiker sind gegen Birkenpollen allergisch. Da Birkenholz sehr weich ist, wird es kaum als Bauholz verwendet. Man macht aus Birkenholz Deichseln, Leitern, Fassreifen, Tische und Wäscheklammern. Auch als Brennholz eignet es sich wegen seines hohen Gehaltes an ätherischen Ölen hervorragend. Büschel aus Birkenholz werden in der Finnischen Sauna vom Badegast zum Abschlagen des Körpers benutzt. Die Rinde, Zweige und der Birkensaft finden vielfältige Verwendung in der Kosmetik und der Heilkunde. Der in vielen Gegenden Deutschlands aufgestellte Maibaum ist ein Birkenstamm, zu Fronleichnam wird der Prozessionszug durch mit Birkenzweigen geschmückte Straßen geführt.
Die Weiden bevorzugen überwiegend feuchte Böden, sie sind Laubgehölze als Bäume, Sträucher und Zwergsträucher. Es gibt dreißig Meter hohe Stämme und drei Zentimeter hohe Zwergsträucher. Weiden sind sehr ausschlagfreudig, weshalb sie auch als Kopfweiden genutzt werden. Ihre Blätter sind wechselständig, ihre Form reicht von kreisrund bis schmal. Weidenpflanzungen werden oft zur Bodenbefestigung angelegt. Die Weidenzweige, besonders die der Kopfweide lassen sich gut für die Herstellung von Flechtwerk verwenden, zum Beispiel für das Flechten von Körben, aber auch für die Ausfachung von Fachwerk. Früher wurden Weiden sehr häufig als Kopfweiden gehalten, um einen hohen Anteil an biegsamen Ästen für die Flechterei zu erhalten. Das Weidenholz ist als Bauholz zu weich, man nimmt es für Dübel oder Holznägel. In Europa haben Zweige mit Blütenkätzchen die Palmwedel ersetzt, die am Palmsonntag in der Kirche gesegnet werden. Die Weidenkätzchen werden daher oft auch Palmkätzchen genannt.
Manchmal kann man gegenüber der Einmündung des Bloemersheimerweges in die Hochkamer Straße eine Baumfällmaschine in Aktion sehen.
Das ist schon erstaunlich, wie ein einziger Mann am Steuer des Harvesters, wie der Holzvollernter korrekt heißt, die Fällung, Entastung, Schälung und Zerteilung einzelner Baumstämme durchführt.
Oft arbeiten Harvester in Kombination mit dem nachfolgenden Tragschlepper, dem Forwarder, der das abgearbeitete Holz abtransportiert. Wenn man sich einmal überlegt, wie viel Handarbeit ein solcher Harvester ersetzt, früher mussten die Stämme von Hand gefällt werden, in der Zeit vor der Motorsäge mit der Handbaumsäge, wozu zwei Personen nötig waren. Dann wurden die Stämme mit Äxten entastet. Es passierten viele Unfälle bei der gefährlichen Arbeit mit Axt und Säge.
Wenn diese Arbeit getan war, wurden die Stämme ganz früher mit sogenannten Rückepferden zu den Transportwagen gezogen.
Um einseitige Bodenverfestigung durch Maschineneinsatz zu vermeiden, legen die Harvester auf die Fahrspuren große Astbündel, auf denen sie fahren.
Die ganze Arbeit wird von nur einer Person erledigt, schneller, von höherer Ergiebigkeit, sicherer und billiger.
Vermutlich gehört die Schonung, in der der Arbeiter beschäftigt ist, zum Bloemersheimer Schloss. Man muss als Zuschauer sehr vorsichtig sein, denn der Arbeiter sieht einen nicht.
Bingöl
Paulo kommt auf seinem Weg zur Seidenstraße von Konya aus nach Bingöl, wo er mit Fuat bei dessen Eltern unterkommt und ein Erdbeben starken Ausmaßes erlebt.
Die Ziegen rannten wie verrückt hin und her und als Fuat das bemerkte, war es schon zu spät.
Die Erde bebte, zwanzig Meter vor uns tat sich eine gewaltige Erdspalte auf und hatte alle Ziegen verschlungen. Der Weidezaun war plötzlich nicht mehr vorhanden, wir waren vollkommen verschreckt und klammerten uns an den Aprikosenbaum.
Der Blick zum Hof verhieß nichts Gutes, das Wohnhaus war eingestürzt.
Fuat und ich wollten los rennen, als eine zweite Erdbebenwelle einsetzte.
Sie riss den Platz vor dem Hof auf. Der Hühnerstall verschwand mitsamt allen Hühnern, der Ziegenstall stürzt in sich zusammen.
Fuat schrie „Mama, Papa!“, nichts war zu hören.
Es herrschte eine gespenstische Stille. Der LKW stand völlig unversehrt auf seinem Platz vor der Hofanlage.
Fuat und ich standen vor den Trümmern des Hauses und riefen nach den Alten, wir räumten ein paar große Schuttstücke weg und fanden sie lebend, unter einem Türblatt, das einen sie schützenden Hohlraum abgedeckt hatte.
Fuat half beiden hoch und nahm sie in den Arm.
Völlig aufgelöst und sprachlos standen wir vor den Trümmern, es herrschte absolute Stille!
Wo war der Hund, man hätte ihn doch bellen hören müssen?
Nach einigem Suchen fanden wir den Hund von einem Trümmerstück erschlagen auf dem Hof liegen, er war tot.
Fuats Mutter fing an zu weinen.
Niemand konnte fassen, was passiert war. Es hatte zwei große Erdbebenwellen gegeben, jede hatte etwa fünf Sekunden angehalten.
In der Ferne hörte man die Sirenen von Krankenwagen und Polizei.
Fuat nahm seine Mutter in den Arm und sagte, dass sie doch alle froh sein sollten, überlebt zu haben.
Wir würden das Haus mit vereinten Kräften wieder aufbauen. Auch der Stall wäre schnell wieder aufgebaut.
Fuat beschloss, nach Bingöl rein zu fahren, um zu sehen, ob wir irgendwo helfen könnten.
Wir kamen bis zur Fuzuli Caddesi, wo sich eine gewaltige Erdspalte auftat und ein Weiterfahren unmöglich machte.
Was wir sahen, war schrecklich. Es stand kein Stein auf dem anderen, Menschen schrien um Hilfe, zum Teil lagen sie halb verschüttet und eingeklemmt unter Trümmern.
Ich sah auch völlig zerquetschte Tote, unbeschreiblich, jenes Elend!
Hunde hetzten kläffend durch die Straßen, Gasleitungen standen in Flammen, überall brannte es, es roch nach verkohltem Fleisch.
Da, wo die Feuerwehr fahren konnte, wurde gelöscht, viele standen auf der Straße und löschten mit Eimern, was natürlich gegen die lodernden Flammen nicht viel half.
Obwohl Bingöl Provinzhauptstadt war, gab es in der ganzen Stadt nicht die Hilfsmittel gegen eine solche Naturkatastrophe.
Ich ging mit Fuat und seinen Eltern soweit wie wir kamen und wir halfen, so gut wie wir konnten.
Nach zwei Stunden rückte Militär an, unterstützt von Hubschraubern begannen die Soldaten, die Stadt zu sichern und da, wo es möglich war, zu helfen.
Plünderungen mussten vermieden werden.
Bingöl war ein einziges Trümmermeer.
Wir schauten uns an, jeder hatte dreckverschmierte Kleidung an, die Gesichter klebten von Schweiß, es war inzwischen heiß geworden.
Fuat sagte, dass wir wieder zurückkehren sollten, wir könnten ohnehin nicht mehr helfen, auch hätten die Soldaten zu verstehen gegeben, dass wir unerwünscht wären.
Also fuhren wir wieder zurück.
Das Bild, das sich dort bot, war schrecklich, ein einziges Trümmerfeld, zerborstene Fenster und Türen, zersplittertes Holz, kaputtes Geschirr, lediglich die Mauern von Fuats Zimmer waren stehengeblieben und auch der alte Steinofen war relativ intakt.
Aber es gab nirgendwo ein Dach und es gab keine Möglichkeit, sich hinzusetzen.
Das war das Erste, was wir machten, wir bauten aus einem Türblatt, das wir mit Steinen abstützten einen Tisch, dann nahmen wir zwei Bohlen, stützen auch die mit Steinen ab und hatten zwei Bänke.
Wenigstens konnte man so am Tisch sitzen.
Fuat und ich suchten in dem Hausschutt nach noch brauchbaren Gegenständen und brachten alles, was wir fanden und was unversehrt war, zum Tisch, auch Cay.
Dann machten wir Feuer im Steinofen und baten Fuats Mutter, Cay zu kochen.
Wir fanden auch noch einige Baklava vom Vortag, nach dem ersten Tee und einem Stück Gebäck sah die Welt schon ganz anders aus.
Fuat sagte, dass er in Malatya anrufen und sich zwei Wochen Urlaub geben lassen würde.
Für die Urlaubszeit wollte er sich den LKW ausleihen, um den gröbsten Schutt wegzufahren.
Ich erklärte mich bereit, einige Tage zu bleiben und bei den Aufräumungsarbeiten zu helfen.
Fuat fuhr mit mir nach Mirzan, zwei Tonnen Sand und zehn Säcke Zement holen.
Als wir wieder zurück waren, ging es sofort an die Arbeit.
Mühsam wurde von Hand Speis gemischt und das Haus aus den Trümmern wieder aufgebaut.
Die Alten halfen, indem sie von den Steinen, die nicht kaputt waren, den Speis abschlugen. Das ging sehr leicht, weil man früher wohl nicht mit Zement gearbeitet hatte.
Ich reichte Fuat immer die Steine und den Speis, Fuat mauerte.
Am frühen Abend konnte man tatsächlich schon erste Erfolge sehen.
Fuats Mutter machte sich am Steinofen zu schaffen, sein Vater holte Lebensmittel aus der Vorratskammer, die einmal hinter dem Haus gestanden hatte und relativ unbeschädigt geblieben war.
Die Mutter backte Fladenbrot und briet Fleisch. Fast war alles so wie immer, wir saßen aber im Freien.
Fuat schlug über die Reste seines Zimmers ein Dach aus Folie, die er mit Balken beschwerte. Dort konnten die Eltern übernachten. Fuat schlief im LKW und ich würde in meinen Schlafsack kriechen und auf der Ziegenweide schlafen.
Es wurde schnell frisch und wir machten ein Feuer auf dem Hof.
Der Vater hatte Bier und Raki herbeigeschafft, das tat gut, sogar Fuats Mutter trank zwei Raki.
Das war die Zeit, wo alle einmal durchatmeten und dankbar waren, noch am Leben und gesund zu sein.
Ich war ziemlich müde, die Arbeit hatte mich doch angestrengt, Fuat hatte geschuftet wie zwei Arbeiter auf einmal.
Er hatte das Wohnzimmer bis unter die Fenster schon wieder hochgezogen.
Er hatte sich überlegt, das Haus nach energetischen Gesichtspunkten zu bauen. Er würde acht Zentimeter dickes Styropor vor die Klinker setzen und noch einmal die gleiche Wand dagegen bauen.
Dann würde er doppelt verglaste Fenster einsetzen und das Dach dämmen, er würde eine Fotovoltaikanlage installieren lassen und ein richtiges Badezimmer bauen.
Er würde dann eben mehrere Male kommen müssen und weiterarbeiten.
Auch eine Küche würde er seiner Mutter bauen, den Steinofen würde er aber bestehen lassen.
Ich verabschiedete mich, wusch mich am Brunnen, und legte mich auf der Ziegenweide in meinen Schlafsack, ein schönes Gefühl!
Ich dachte lange über die schrecklichen Ereignisse nach und musste immer wieder sagen, wie glücklich wir alle sein konnten, mit dem Leben davongekommen zu sein.
Am nächsten Morgen wurde schnell gefrühstückt, dann begruben wir den Hund.
Fuats Vater, Fuat und ich gingen durch das Gelände und begutachteten die Schäden, einige Bäume waren entwurzelt, kein Problem. Die beiden großen Erdspalten müsste man verfüllen, in jede würden mit Sicherheit fünf LKW-Ladungen Schutt passen.
Fuat bat mich, das zu übernehmen. Ich setzte mich hinter das Steuer des LKWs und fuhr mit dem Vater nach Bingöl. Direkt an der Fuzuli Caddesi war ein Bagger mit Aufräumarbeiten beschäftigt.
Fuats Vater bat den Baggerführer, unseren LKW voll Schutt zu laden, er bot ihm dafür eine Schachtel Zigaretten.
Wir fuhren tatsächlich zehnmal, dann waren die beiden Erdspalten verschwunden. Die oberste Schicht füllten wir mit Mutterboden auf, dann war nichts mehr zu sehen.
Fuat kam natürlich allein nicht so schnell voran, seine Mutter half ihm aber, so gut sie konnte.
Am Ende des zweiten Tages nach dem Erdbeben war jedenfalls eine Menge passiert und alle waren wieder zufrieden.
Fuats Mutter freute sich auf das neue Haus und auch der Vater war froh, den alten Kotten hinter sich gelassen zu haben.
Ob sie jemals wieder Ziegen züchten würden, wussten die Alten noch nicht.
Nach vier Tagen war das Wohnzimmer hoch gezogen und Fuat begann, das Dach aus einer Balkenlage zu errichten.
Er hatte längst Fenster in Auftrag gegeben, die ich mit seinem Vater abholen sollte.
Er hatte die Balkenlage verbrettert und oben und unten mit einer Styroporlage gedämmt.
Dann wurde das Dach mit Dachblechen abgedichtet und das Wohnzimmer war wieder bewohnbar.
Als nächstes erneuerte Fuat das Dach über seinem Zimmer nach der gleichen Methode.
Das Wetter war die ganze Zeit über gut, sodass die Arbeit voran ging.
Nach dem vierten Tag sagte ich, dass ich weiter wollte, wenn Fuat meine Hilfe nicht mehr benötigte.
Mein letzter Abend in Bingöl war angebrochen.
Fuat sagte, dass er mich mit dem LKW bis nach Ekinyolu bringen wollte, dort könnte ich in den Bus nach Van einsteigen. Er kannte Schleichwege, denn durch Bingöl wäre kein Durchkommen.
Noch einmal saßen wir am Abend zusammen und erzählten am Feuer, die Alten hatten das Unglück, das über sie gekommen war, verwunden.
Später erfuhren wir, dass das Erdeben eine Stärke von 7.2 hatte, also gewaltig war.
Bingöl lag in einem Erdbebengebiet, das letzte Beben hatte es dort 2003 gegeben, es hatte eine stärke von 6.4.
Nördlich der Anatolischen Platte verlief ein tektonischer Graben, alle Orte, die dort lagen, waren extrem gefährdet.
Am Ende des Grabens lag Istanbul, ein Beben jener Stärke in Istanbul wäre eine Katastrophe, nicht auszudenken, wie viele Menschenleben und welche Sachschäden das kosten würde!
Aber was sollte man dagegen tun? Die Stadt evakuieren?
Man konnte nur auf die Katastrophe warten, so schrecklich das auch war.
Das gleiche Schicksal blühte den Städten am Sankt-Andreas-Graben in Kalifornien.
Am nächsten Morgen verabschiedete ich mich von Fuats Eltern und dankte ihnen für alles. Fuats Mutter gab mir ein Lunchpaket mit, Sesamkringel, Ziegenkäse, Honig, Baklava und Pide.
Ich wünschte alles Gute beim Wiederaufbau des Hofes.
Dann fuhr ich mit Fuat nach Ekinyolu.
Der Blick auf Bingöl zeigte noch einmal die Verwüstung, die die Stadt getroffen hatte. Auch die kleinen Orte unterwegs waren zerstört.
Die Straße war heil geblieben, sodass der Bus fahren konnte.
Ich umarmte Fuat und sagte ihm, dass ich mich melden würde, er würde auf jeden Fall Post von mir bekommen. Wir hatten Schlimmes zusammen erlebt, das würde ich so schnell nicht vergessen.
Vielleicht käme ich mal zum Duschen in seinem neuen Badezimmer vorbei, scherzte ich.
Dann kam der Bus, Fuat hatte Tränen in den Augen, ich auch.
Wir winkten uns noch zu, bis der Bus hinter einer Kurve verschwand.
Ich dachte noch lange Zeit an das schreckliche Erdbeben, der Blick aus dem Busfenster zeigte die Schäden an den Häusern.
Ich holte meine Kladde aus dem Rucksack und schrieb die Erlebnisse der letzten Tage auf.
Teheran
Paulo gelangt nach Teheran und lernt dort die Studentengeschwister Daria und Arvid kennen, er nimmt an einer Party in deren Studentenwohnheim teil.
Wir nahmen wieder die U-Bahn in die Stadt und liefen dann noch ungefähr dreißig Minuten bis zum Wohnheim.
Der Junge, mit dem wir im Basar am meisten geredet hatten, hatte uns einen Zettel mit der Adresse geschrieben, sein Name war Arvid.
Die Namen der anderen mussten wir noch in Erfahrung bringen.
Als wir an dem Wohnheim ankamen, war fast alles ganz dunkel. Wir fanden aber hinein und mussten nur der Musik folgen.
Dann kamen wir in einen großen Partyraum, es waren bestimmt dreißig Personen dort versammelt.
Es waren auch viele Mädchen dabei und siehe da, ohne Kopftuch und Mantel sahen die richtig hübsch aus.
Es war eine ganz andere Szene als im Basarcafe, es gab Alkohol, es wurde getanzt und es wurde geknutscht, man traute seinen Augen kaum.
Arvid kam auf uns zu und hieß uns willkommen. Sofort bot er jedem von uns eine Dose Bier an, er sagte, wir sollten Musikwünsche äußern.
Wir gingen zu den CD-Ständern und fanden alles, was bei uns zu Hause auch auf Parties gespielt wurde.
Dann kamen auch die anderen aus dem Basarcafe und begrüßten uns.
Wir prosteten uns zu und riefen unsere Vornamen, wir riefen Jean-Jacques, Pierre, Steve und Paulo und hörten Arian, Sami, Farid und Amon. Auch die Mädchen nannten ihre Namen, Nina, Kira, Daria, Tara, Samira und Dilara.
Natürlich konnten wir uns die Namen nicht sofort alle merken.
Dann wurde getanzt, ich tanzte mit Daria und sagte ihr, dass ich Paulo wäre. Sie sah sehr gut aus und lachte mich an, ich lachte zurück, das wäre im Basar undenkbar gewesen. Wir tanzten sogar einen sehr engen Schmuseblues zusammen.
Daria rieb ihre Brüste an meinem Oberkörper, wir küssten uns.
Die anderen nahmen das zur Kenntnis, schenkten dem aber keine weitere Bedeutung.
Als wir zu Ende getanzt hatten, setzten wir uns zusammen und erzählten uns alles Mögliche. Darias Englisch war ganz in Ordnung, wir verstanden uns jedenfalls gut.
Steve und die beiden Franzosen unterhielten sich auch prächtig.
Die Musik war inzwischen mächtig laut geworden und Daria und ich setzten uns im Raum nach hinten, um uns unterhalten zu können.
Wir schauten uns ständig an, als Daria anfing, mich zu streicheln. Wir küssten uns und küssten uns und küssten uns.
Gegen Mitternacht erschienen plötzlich zehn Basiji, stellten die Musik leise und konfiszierten den Alkohol.
Sie schrieben die Namen aller Partygäste auf, nur Daria und ich, wir hatten uns hinten im Raum hinter einem Schrank versteckt und uns mit einer Decke zugedeckt.
Die Basiji waren alle um die fünfundzwanzig Jahre alt, sie kamen sich unglaublich wichtig vor, man war drauf und dran, ihnen Kontra zu geben, wir hielten uns aber zurück.
Wer der Verantwortliche jenes Festes wäre, wollten sie wissen.
Da trat Arvid hervor und fragte, was denn verwerflich daran wäre, eine Party zu feiern.
Der Anführer der Basiji, ein stämmiger Bursche mit Vollbart sagte, dass unsere Art von Musik mit dem islamischen Geist nicht vereinbar wäre, Alkohol wäre ohnehin verabscheuenswert und unser freizügiger Umgang mit den Mädchen wäre sexuell verwerflich.
Darauf wusste Arvid nichts zu antworten, er gab bereitwillig seinen Namen und seine Heimatadresse preis, er kam aus Qom, der heiligen Stätte der Schia.
Als der Anführer der Basiji hörte, dass Arvid aus Qom stammte, sagte er, dass er als Schiit doch erst recht wissen müsste, was er falsch gemacht hätte.
Arvid gab klein bei. Man würde seine Eltern in Qom benachrichtigen und ihnen mitteilen, was ihr Sohn in Teheran so triebe.
Die Ankündigung machte Arvid sehr betroffen und er schaute zu Boden.
Er beschloss, mit seiner Schwester Daria am nächsten Tag nach Hause zu fahren.
Ich brach am nächsten Morgen zum Bahnhof auf und wartete eine halbe Stunde in dem Cafe, in dem ich schon bei meiner Ankunft in Teheran gesessen hatte, danach kamen Daria und Arvid.
Wir begrüßten uns und schauten auf den Fahrplan. Wir mussten noch eine Stunde warten, bis der Zug nach Qom abfuhr.
Daria hatte ein Kopftuch um und einen schlichten Mantel an, der ihr bis über die Knie reichte.
Sie sah nicht gerade hässlich aus, aber am Vorabend hatte sie mir besser gefallen.
Daria bemerkte meine Blicke und sagte, dass sie in Qom alles wieder ablegen würde.
Wir gingen wieder ins Cafe zurück, wo wir die Wartezeit verbringen wollten. Arvid begann, von Qom zu erzählen.
Soltanabad
Auf seinem Weg nach Mashhad passiert Paulo Soltanabad, ein elendes Nest, wenn er nicht zufällig den Alten Adnan dort kennen gelernt und bei ihm übernachtet hätte.
Wir mussten über den Ausläufer des Elbrusgebirges, bevor wir fünfzig Kilometer weiter in Soltanabad ankamen.
Soltanabad war ein elendes Straßennest, wie auch die ganze Umgebung waren die Häuser in dem Rötlich-Braun gehalten, das sie schmutzig aussehen ließ.
Der Fahrer ließ mich an der Straßengabelung raus und verschwand nach links.
Da stand ich dann in dem Kaff an der A 83.
Ich machte, dass ich in den Schatten kam, den ich vor einem Haus an der Straßengabelung fand.
Plötzlich ertönte eine Stimme aus dem Haus, ich drehte mich um und sah einen alten Mann in seiner Haustür stehen, der offensichtlich von mir wissen wollte, was ich vor seinem Haus zu suchen hätte, ich verstand kein Wort von dem, was er da erzählte.
Ich ging zu ihm und zeigte ihm meine leere Wasserflasche, ich sagte „Wasser, Wasser“, was er verstand.
Er nahm die Flasche, ging hinter sein Haus an den Brunnen und füllte die Wasserflasche ganz auf.
Ich dankte ihm und setzte mich wieder an die Straße. Das Wasser war herrlich frisch und schmeckte sehr gut.
Ich habe in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass Wasser sehr wohl unterschiedlichen Geschmack haben kann.
Nach ungefähr einer Stunde öffnete sich die Haustür wieder und der alte Mann stand da und forderte mich auf, zu ihm zu kommen. Er hielt einen Teller in der Hand, auf dem offensichtlich Suppe schwappte.
Ich sollte sie probieren.
Er gab mir einen Löffel und ich probierte die Suppe.
Sie schmeckte ausgezeichnet, es war eine Hühnersuppe, die so raffiniert gewürzt war, dass der Hühnergeschmack zwar dominierte, gleichzeitig aber auch frische Kräuter wie Petersilie und Koriander zur Geltung kamen.
Ich gab dem alten Mann zu verstehen, dass ich die Suppe sehr gut fand.
Daraufhin lud er mich in sein Haus ein, ich sollte ihm beim Essen Gesellschaft leisten.
Ich folgte dem Alten also in sein Haus und stellte meinen Rucksack hinter die Tür.
Dann sagte ich, dass ich aus Deutschland käme, „Germany“ rief ich, „Germany!“
Da bekamen die Augen des Mannes ein Funkeln, auf seinem Bord im Wohnzimmer stand ein Foto von Schah Reza Pahlavi, wie er zusammen mit Bundespräsident Heinrich Lübke 1967 in Berlin war.
Das war zwar weit vor meiner Zeit, ich erinnerte mich aber an einige missliebge Begleitumstände des Schahbesuches.
Der alte Mann war wohl ein Kaisertreuer. Ich sagte „Schah Reza Pahlavi“ und zeigte dabei auf das Foto, das entsprach nicht ganz der Zufriedenheit des Alten, weil das h in Pahlavi wie das ch in Lachen ausgesprochen werden musste.
Er sagte mehrere Male den Namen in seiner korrekten Aussprache, und ich sprach ihn so lange nach, bis er zufrieden war.
Dann setzten wir uns an einen alten knarzenden Tisch, und der Alte holte den Topf mit der herrlichen Suppe. Er hatte auch frisches Brot, das wir zu der Suppe aßen, ein Festmahl.
Der alte stellte mit Genugtuung fest, dass es mir schmeckte, er schnitt weiteres Brot auf.
Nach dem Essen ging er mit mir wieder zu dem Bord und zeigte mir ein weiteres Foto, auf dem wohl seine Frau zu sehen war, die scheinbar tot war, er deutete jedenfalls so etwas an.
Daneben standen weitere Fotos, auf denen seine verheirateten Kinder mit ihren Familien zu sehen waren.
Der Alte war Großvater, seine Enkel waren auf den Fotos schätzungsweise acht bis zehn Jahre alt, es gab vier Enkel.
Er zeigte mir die Fotos mit einem gewissen Stolz.
Ich begann, mich in seiner Stube umzusehen.
Es war ein dunkler Raum und viel mehr als der knarzende Tisch, vier alte Stühle und eine windschiefe Kommode, auf der die Fotos standen, war in ihm nicht vorhanden.
Zwei Katzen liefen plötzlich durch das Zimmer und strichen dem Alten um die Beine. Mich beäugten sie misstrauisch.
Als ich meine Hand nach ihnen ausstreckte, fauchte die eine Katze, beide ließen sie sich aber von mir streicheln.
Der Alte führte mich herum, er hatte noch zwei Zimmer, das eine war sein Schlafzimmer, das andere war eine Art Gästezimmer, in dem seine Kinder mit seinen Enkeln schliefen, wenn sie mal zu Besuch kamen, überall lag Spielzeug herum.
Er bedeutete mir, mich auf dem Bett auszuruhen, er würde sich in seinem Zimmer auf sein Bett legen.
Das tat ich sofort und schlief ein.
Der Alte schlief auch, die Katzen sprangen auf mein Bett und legten sich zu meinen Füßen hin.
Nach ungefähr einer Stunde hörte ich den Alten herumfuhrwerken, er machte in der kleinen Küche, die nach hinten hin angelegt war, unser Essgeschirr vom Mittagessen sauber.
Ich ging zu ihm hin und bot meine Hilfe an, nahm ein Küchenhandtuch, das an einem Nagel in der Wand hing und trocknete die Sachen ab, die er gespült hatte.
Als wir fertig waren, bedeutet mir der Alte, ihm nach draußen zu folgen.
Wir gingen von der Küche aus in einen Hof, die Straße war hinter dem Haus bei weitem nicht mehr so laut wie vorne und in seiner Stube, die zur Straße hinausging und nur durch einfach verglaste Fenster gegen den Lärm geschützt war.
Der Hof war mit schlichten Betonplatten gepflastert, an der Seite standen Lämmerställe, in denen ich sechs Tiere zählte, ich glaubte, dass es iranische Lämmer waren.
Dann hatte der Alte noch einen Schuppen, aus dem er zwei Gartengeräte nahm und ging mit mir nach hinten über den Hof.
Wir kamen über die Höfe der Nachbarhäuser, überall grüßte der Alte die Bewohner und stellte mich vor, viele schienen verwandt mit ihm zu sein, er umarmte manche.
Wir gelangten auf eine Nebenstraße der A 83 und liefen diese entlang, bis sie nach zweihundert Metern im Nichts endete.
Es öffnete sich nach Süden hin die Wüstenebene, in die vorzudringen noch niemand gewagt hatte.