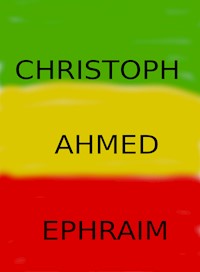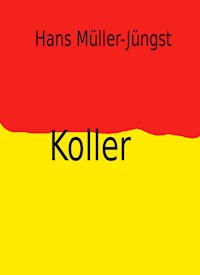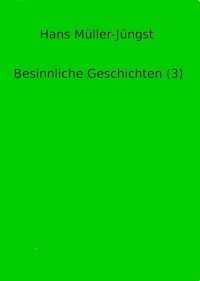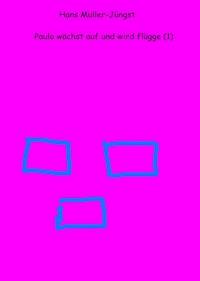Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Weil Andreas Glenbacher in seinem Heimartdorf Kregelbach von niemandem geachtet wird, beschließt er eines Tages, für immer in das Arginreich zu gehen, zu dem er vorher schon einmal Kontakt aufgemnommen hatte. Das Arginreich ist für die Menschen nicht wahrnehmbar und entsprechend weiß auch niemand von dessen Existenz. Es bietet für Menschen paradiesische Zustände und Andreas, der im Arginreich den Namen Albin annimmt, hat das Glück, mit der Königstochter zusammen zu kommen und wird Prinzgemahl. Albin durchlebt während seiner Zeit bei den Argin ein Martyrium bei einer Zauberin, der es beinahe gelingt, ihn von den Argin zu trennen. Am Ende wendet sich aber alles zum Guten und Albin lebt mit seiner Angebeteten Tola ein glückliches Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Müller-Jüngst
Das Märchen von Albin
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kregelbach
Andreas Glenbacher
Bei den Argin
Wanderung in Enare
Wieder zu Hause
Wanderung auf den Piz Boun
Im Reich Kedras
Tolpin
Kedras Tod
Am Lugasee
Angeln am Elem
Krönungsvorbereitungen
Die Krönung
Impressum neobooks
Kregelbach
Wenn im Wendlerbachtal Schnee gefallen war, wurde alles ganz still, Menschen, Tiere, alles, denn der Schnee hatte die willkommene Eigenschaft, eine lärmdämmende Decke über die Krachmacher zu legen, die sonst immer laute Geräusche von sich gaben. Besonders in Kregelbach, dem Ort, von dem in unserer Geschichte die Rede sein soll, hallte der Lärm immer durch die Hauptstraße, in der die Häuser eng beieinanderstanden und den Geräuschen eine Resonanzfläche boten, und auch die davor abzweigenden Nebenstraßen waren Schallverstärker.
Wenn bei Walters am Beginn der Hauptstraße einer vor die Tür trat und in Richtung Dorfzentrum jemanden rief, den er kannte, schallte der Ruf durch die gesamte Gemeinde und konnte von jedem vernommen werden, er pflanzte sich sogar die Berghänge hoch fort, die das Wendlerbachtal säumten.
Stand man oben auf dem Wolfskopf und schaute auf Kregelbach, so waren dort deutlich die Laute der Stalltiere zu vernehmen, auch das Gebell der kläffenden Hunde wurde dort hinaufgetragen und war gut zu hören. Der Wolfskopf bot einen hervorragenden Blick über das gesamte Wendlerbachtal, angefangen mit dem Durchbruch des Wendlerbaches durch die eiszeitliche Kalkformation, die dem Autofahrer nur eine sehr enge Passage gewährte, und wo die Straße sich nahe an den Berghang schmiegte bis zum ungefähr fünf Kilometer entfernten Talende, an dem der Wendlerbach an Breite zugenommen hatte, die Berge abgeflacht waren und das Tal in die Flussebene des Irm überging. Dort lag Irmstadt und es war alles anders, offener, weltzugewandter, dort spottete man über das Wendlerbachtal und seine hinterwäldlerischen Bewohner. Damit tat man ihnen sicher Unrecht, denn besonders die Kregelbacher zeigten sich der Gegenwart durchaus zugewandt, wenn auch nicht alle, so aber zumindest die Jüngeren, die auch schon einmal nach Irmstadt fuhren, zum Einkaufen oder an den Wochenenden zum Tanzen.
Früher war das nicht so ohne Weiteres möglich, weil die Straße noch nicht ausgebaut, und man noch nicht motorisiert war, damals spannten die Kregelbacher einen Wagen an, wenn sie nach Irmstadt zum Arzt mussten oder sonst etwas Dringendes in der Stadt zu erledigen hatten. Ein Besuch in der Großstadt war immer ein Tagesausflug, der schon lange im Vorfeld geplant werden musste, und der nur im Sommer zu bewerkstelligen war. Im Winter, wenn die holprige Straße auch noch mit Schnee bedeckt war, war kein Denken an eine Fahrt nach Irmstadt. Das wäre viel zu gefährlich gewesen, man hätte mit dem Wagen von der Fahrbahn abkommen und in den Wendlerbach fallen können oder die Zugtiere hätten sich auf dem unebenen Gelände verletzen können. Man hätte natürlich auf der zwölf Kilometer langen Strecke von Kregelbbach nach Irmstadt in den nächsten Ort laufen können, je nachdem, welchem Ort man sich näher fühlte, aber auch das war in dem tiefen Schnee nicht einfach, denn geräumt wurde nicht. Seit die Straße gebaut war und die Menschen Autos besaßen, war es ein Leichtes, nach Irmstadt zu gelangen, niemand von den jungen Leuten dachte an die Unannehmlichkeiten, denen sich die Menschen früher ausgesetzt sahen. Sie fuhren am Samstagabend in die Disco und gaben sich dem Vergnügen hin. Es gab auf der L 112 zwischen Kregelbach und Irmstadt viele gefährliche Kurven, die man nicht zu schnell nehmen durfte, wenn man nicht vor einem Baum landen wollte, so wie vor sechs Jahren, als Peter Rohrmoser, Daniel Schiffer, Marcel Mergentaler und Bernd Breitmeier von Irmstadt kamen und mit viel zu hoher Geschwindigkeit über die Landstraße nach Hause fuhren.
Alle vier hatten sie gerade ihren Führerschein gemacht und deshalb kaum Fahrerfahrung. Peter saß am Steuer und nahm die Kurven mit quietschenden Reifen, er und seine Freunde grölten und sangen im Auto. Immer wenn Peter auf eine Kurve zuschoss, bremste er kurz vorher ab und schleuderte praktisch durch sie hindurch, bis sie an die scharfe Kurve beim Holzeinschlag gerieten, wo der Wendlerbach eine kleinen Wasserfall hatte, nachdem er eine 90°-Kehre beschrieben hatte. Dort verlor Peter die Gewalt über seinen Wagen, nachdem er mit viel zu hoher Geschwindigkeit auf die Kurve zugerast war und das Auto nicht mehr beherrschen konnte, er schoss geradewegs vor einen Baum, der am Straßenrand stand. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der gesamte Motorblock aus seiner Verankerung gerissen und in die Fahrgastzelle gedrückt worden war. Daniel, Bernd und Marcel waren auf der Stelle tot, Peter überlebte den Unfall, wenn auch querschnittsgelähmt. Er saß im Rollstuhl und man konnte ihn gelegentlich durch Kregelbach fahren sehen, er fuhr schon mal zum Wolfsmüller und stellte sich neben dessen Sägewerk, das direkt neben der Mühle lag. Er schaute in die offene Sägehalle und sah, wie große Bandsägen die Baumstämme zu Brettern schnitten oder er beobachtete, wie schwere LKWs die Baumstämme anlieferten und auf dem Hof des Sägewerkes entladen wurden.
Peter war fünfundzwanzig Jahre alt und stand eigentlich in der Blüte seines Lebens, der Unfall hatte ihm alles genommen, was eine Perspektive für ihn hätte bedeuten können. Noch immer legten die Mütter der Getöteten frische Blumen an den Unfallort neben das Holzkreuz, das sie dort postiert hatten. Längst gab es Schilder auf der L 112, die auf die Gefährlichkeit der Kurven hinwiesen und die Geschwindigkeit auf der gesamten Strecke durch das Wendlerbachtal auf 60 km/h beschränkten, durch die Kurven durften sogar nur 40 km/h gefahren werden. Der Unfall damals erschütterte alle im Wendlerbachtal, auch die Bewohner von Anzhausen und von Gilsterdorf, Orte, die jeweils oberhalb bzw. unterhalb von Kregelbach lagen, aber noch bedeutend kleiner waren. Inzwischen hatte der Verkehr auf der L 112 doch beträchtlich an Intensität zugenommen, viele nutzten die Verbindung den Wendlerbach entlang, um von Irmstadt nach Waltershausen zu kommen oder umgekehrt. Die Alternative zu dieser fünfundzwanzig Kilometer langen Strecke wäre eine viel weitere Route über die Autobahn gewesen, die das Gebirge bei Kregelbach umging und die breiten Flusstäler nutzte. Für Kegelbach hieß das zunehmende Verkehrsaufkommen, dass die Dorfbewohner erstens unter stärkerem Verkehrslärm und erhöhter Luftverschmutzung zu leiden hatten und sich zweitens beim Überqueren der Hauptstraße vorsehen mussten.
Besonders die Kinder waren gefährdet, wenn sie auf dem Bürgersteig herumtollten und dabei auch schon einmal auf die Straße liefen, ohne auf den Verkehr zu achten. Es wurden deshalb die Stimmen derjenigen immer lauter, die eine Ortsumgehung eingerichtet wissen wollten, es gab längst Pläne für die Verwirklichung dieses Projektes. Sie sahen vor, dass eine Umgehung kurz vor dem Wolfsmüller nach Süden von der Hauptstraße abzweigte, sie lief über die Felder des Bauern Rohrmoser und träfe hinter dem Ort wieder auf die Hauptstraße. Der Wille beinahe aller Beteiligter war da, auch Rohrmoser würde verkaufen, allein die Genehmigungsbehörden bei Land und Kommune sperrten sich, weil sie erhebliche Kosten auf sich zukommen sahen. So würden die Kregelbacher noch eine ganze Zeit mit der Gefahrenquelle leben müssen. Sie hatten Schilder an der Straße aufgestellt, auf denen die Umgehung gefordert wurde. Wenn die Kregelbacher nicht nach Irmstadt oder Waltersausen zur Arbeit fuhren, betrieben sie Landwirtschaft, sie hielten in erster Linie Milchkühe und Schweine, wobei die Bauern Rohrmoser und Stegmüller die größten Landwirte waren. Neuerdings gab es im Ort eine Pferdezucht, die Familie Disch hatte den Schritt zur Anschaffung von zehn Reitpferden gewagt und viel Land gepachtet, auf dem sie ihre Tiere hielt.
An der Straße wies ein Schild mit der Aufschrift „Reiterferien bei Disch“ darauf hin, dass Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geboten wurde, zwei oder mehr Wochen ihrer Ferien bei Disch zu verbringen und ihre Reitkenntnisse zu vervollkommnen. Die älteste Tochter von Disch war Reitlehrerin und kümmerte sich um die Feriengäste, die die Tiere pflegen und die Ställe ausmisten mussten, aber das taten sie sehr gern. Die Alteingesessenen von Kregelbach sahen den Pferdehof von Disch mit Misstrauen.
„So etwas hatte es noch nie im Ort gegeben, warum muss denn jetzt ein Pferdehof zum Dorf gehören?“, fragten sie sich. Dischs kümmerten sich nicht um die griesgrämigen Alten und waren mit dem Pferdehof auf Anhieb sehr erfolgreich, die Eltern brachten ihre Kinder von weither und gaben sie praktisch nur bei Disch ab. Viele waren schon zum dritten Mal da, manche noch häufiger, man kannte sich, traf sich bei Disch wieder und hatte sich viel zu erzählen. Annette Disch, so der Name der Reitlehrerin, kannte inzwischen ihre jungen Reiterinnen, es waren beinahe ausschließlich Mädchen, die zum Reiten kamen und ritt die verschiedenen Reitwege mit ihnen ab. Meistens ritten sie den Wendlerbach entlang oder zu den Kalkfelsen und wieder zurück. Weniger Geübte nahmen bei Brigitte Disch, der jüngeren Schwester von Annette, Reitstunden auf dem Parcours auf dem Hof, in denen sie ihre Reithaltung festigten, bevor auch sie am Ausreiten teilnehmen konnten.
Bei Disch konnten zehn Reitkinder in fünf Doppelzimmern unterkommen, sie waren im Regelfall zwölf bis vierzehn, in Ausnahmefällen fünfzehn Jahre alt und machten überhaupt keine Probleme. Frau und Herr Disch kochten für die Kinder, die, was das Essen anbelangte, gar keine großen Ansprüche stellten. Sie bekamen morgens ein Frühstück mit Brötchen, die von der Bäckerei beim Wolfsmüller geliefert wurden, die meisten tranken eine Tasse Kakao dazu, anschließend ging es gleich zu den Pferden. Jedes Kind hatte für die Zeit der Ferien ein Tier, das nur ihm zugeordnet und für das es allein verantwortlich war. Morgens wurde eine Stunde und am Nachmittag noch einmal eine bis eineinhalb Stunden geritten. Vor dem Reiten am Morgen gab es eine ausgiebige Striegelstunde, danach wurde der Stall gemistet. Nach dem Reiten ließen die Kinder die Tiere ausschweißen, bevor sie sie wieder in die Ställe brachten und ihnen frisches Grünfutter und Wasser gaben. Es schloss sich eine zweistündige Mittagspause an, in der sich die Kinder hinlegten, bevor sie den Nachmittagsritt antraten. Nie trieben sie die Pferde, darauf achtete Annette, nur ganz selten kam es vor, dass sie in den Galopp wechselte und dann auch nur für ein kurzes Stück. Galopp durften nur die ganz Geübten reiten, für die anderen war diese Gangart zu gefährlich. Im Ort zweigte die Kirchgasse von der Hauptstraße ab, an der das Restaurant „Zur Sonne“ und das „Hotel Rösch“ lagen, das Hotel lag auf dem Kirchplatz, der gleichzeitig der Ortsplatz war, die „Sonne“ lag ein Stück davor.
Am Kirchplatz lag auch der kleine Supermarkt, der von Alfons Disch, dem Bruder der Pferdehofbesitzerin betrieben wurde und kaum noch Gewinne abwarf. Seit Langem fuhren die Kregelbacher nach Irmstadt oder Waltershausen, wenn sie größere Einkäufe tätigen mussten, dort gab es Aldi und andere günstige Discounter. Von der Kirchgasse aus gelangte man nach links zu Bauer Rohrmoser und nach rechts zu Bauer Stegmüller, die beide jeweils ein großes Bauernhaus ihr Eigen nannten. Die Häuser waren in einem sehr gepflegten Zustand und mit roten Bieberschwanzpfannen gedeckt. Die Zeiten, in denen vor der Haustür ein großer Misthaufen lag, waren endgültig vorbei. Hinter der Kirche durchfloss der Wendlerbach den Ort, an ihm entlang verlief die Wehrgasse, in der die winzige Grundschule lag, die von den wenigen Schulkindern besucht wurde, die es in Kregelbach noch gab. Aber die Tage der Schule waren gezählt, bald müssten die Kinder mit dem Bus zur Schule nach Irmstadt gefahren werden, was letztendlich billiger wäre, als der Erhalt des Schulgebäudes in Kregelbach und die Finanzierung der beiden Lehrkräfte, die es noch gab.
Die Besitzungen des Bauern Rohrmoser waren gigantisch und hatten sie im Laufe der Existenz der Familie in Kregelbach beständig durch Einheirat vermehrt, sie erfassten praktisch das gesamte Gelände südlich des Dorfes bis zum Eulenwald und waren durch eine gerade verlaufende Grenze vom Besitz des Bauern Stegmüller abgetrennt, Rohrmosers Land reichte bis an die Grenze von Anzhausen. Bevor die große Flurbereinigung durchgeführt wurde, hatte Bauer Rohrmoser auf der anderen Seite der Hauptstraße kleine Felder, die er aber verpachtet hatte, weil sie zum Teil mit seinen Maschinen nicht bewirtschaftet werden konnten. Nach der Flurbereinigung hatte er sein Land südöstlich von Kregelbach konzentriert und er trieb dort seine Kühe auf die Weiden. Rohrmoser hatte einen riesigen Milchbetrieb, zweimal täglich kam der LKW von der Molkerei in Waltershausen und holte die Milch ab, die das Vieh gegeben hatte. Täglich wurde mehrmals auf die Weide gefahren und Gras geschnitten, dazu benutzte Bauer Rohrmoser einen Mähbalken, den er an seinen Traktor montiert hatte und einen Selbstlader. Man konnte sich kaum vorstellen wie sich die Menschen früher abgeplagt hatten, als alles mit der Hand erledigt werden musste und die Männer das Gras stundenlang mit der Sense abmähten, bevor es die Frauen zusammenrechten und zu Bündeln aufstellten, anschließend wurde es mit dem Pferdewagen zum Heuschober gebracht. Heute wurde das Gras sofort vom Hänger aus im Stall den Kühen vorgelegt. Für den Winter wurde das Heu mit einem starken Sauger auf den Heuboden hochgeholt und dort mit einer beweglichen Rohrleitung dahin geblasen, wo man es haben wollte.
Handarbeit war lediglich an dem Sauger erforderlich, wenn man das Heu mit Gabeln vorlegte, wobei man aufpassen musste, dass einem der Sauger nicht das Werkzeug aus der Hand riss. Bauer Rohrmoser besaß auch zweihundert Schweine und hatte ursprünglich einmal vorgehabt, ganz auf Schweinemast umzustellen. Er ließ aber, als die Preise für Schweinefleisch einbrachen, die Finger davon und behielt seinen Milchbetrieb, allerdings brachte auch die Milch nicht mehr so viel, manch ein Milchbauer hatte seinen Hof schon aufgeben müssen.
Im Haus Rohrmoser lebten die Großeltern väterlicherseits, Frau und Herr Rohrmoser und Peter, der einmal den gesamten Hof übernehmen sollte, nun aber als Schwerpflegefall froh sein konnte, dass er allein mit seinem Rollstuhl ins Dorf fahren konnte. Zu Hause kümmerten sich vor allem seine Oma und seine Mutter um ihn, die ihn aus- und anziehen, waschen und manchmal auch füttern mussten. Peter hatte eine so starke Oberarmmuskulatur entwickelt, dass er sich allein auf die Toilette, ins Bett oder ins Auto heben konnte. Nachdem er lange Zeit auf das Autofahren verzichten musste, hatte ihm sein Vater einen behindertengerechten VW-Golf gekauft, bei dem alle Funktionen von Hand zu bedienen waren, Peter war gerade dabei, den Umgang mit dem Wagen zu lernen. Am Haus waren einige bauliche Veränderungen vorgenommen worden, so war für Peters Rollstuhl eine Rampe vor die Haustür gelegt worden, die er hochfahren konnte, diverse Türdurchlässe waren verbreitert worden, sodass er mit seinem Rollstuhl dort hindurchpasste.
Die Duschtasse im Badezimmer wurde entfernt und der Abfluss in den Boden versenkt, Peter konnte so mit seinem Rollstuhl in die Dusche fahren und sich dort auf einen Plastikstuhl hieven, auf dem er bequem duschen konnte. Ein Badewannenlift gestattete ihm den mühelosen Einstieg in die Badewanne und ein Treppenlift im Haus ermöglichte Peter das Aufsuchen seines Zimmers im ersten Stock. Bei allem unbeschreiblichen Unglück, das ihm bei seinem Autounfall widerfahren war, konnte er dennoch von Glück sagen, dass er aus begütertem Hause stammte und seine Eltern die finanziellen Belastungen, die mit den Umbauten und dem Autokauf verbunden waren, stemmen konnten. Die Eltern waren nach dem Unfall und dessen Folgen für ihren Sohn natürlich völlig am Boden zerstört und hatten anfangs noch Schwierigkeiten, mit Peters Behinderung fertig zu werden, nach und nach spielte sich aber ein Alltagsablauf ein, mit dem jeder der Rohrmosers leben konnte. Peters Mutter hatte sich einmal dabei ertappt, dass sie dachte, Peter wäre doch besser unter den Getöteten gewesen, mittlerweile war sie aber ganz davon ab und froh, ihr einziges Kind bei sich zu haben, sie liebte ihren Peter.
Bauer Rohrmoser hatte sich früher stark in die Gemeindepolitik eingemischt und war Mitglied im Gemeinderat, als man ihm einmal das Bürgermeisteramt angetragen hatte, lehnte er aber ab, weil er auf seinem Hof genug Arbeit hatte und sich nicht auch noch um die politischen Geschicke in seinem Ort kümmern konnte und auch nicht wollte. Er engagierte sich aber bei den Befürwortern der Ortsumgehung und mischte da in den vordersten Reihen mit, war aber angesichts leerer Kassen bei Land und Kommune natürlich auch machtlos. Er dachte an Peter, wenn er sich für die Umwelt einsetzte, Peter sollte ungestört und ohne Gefahr mit seinem Rollstuhl durch das Dorf fahren können. Das Verhältnis zu den Stegmüllers, Rohrmosers Nachbarn, war freundschaftlich, wenngleich auch nicht unbelastet. Beide Familien lebten schon seit undenklichen Zeiten in Kregelbach und es hatte einmal in grauer Vorzeit eine Hochzeit zwischen Anna Stegmüller und Alois Rohrmoser gegeben, die unter keinem guten Stern stand, und die Ehe wurde schon nach zwei Jahren wieder geschieden. Stegmüllers sagten, Alois wäre fremdgegangen und hätte Anna betrogen, Rohrmosers behaupteten, Anna hätte sich jedem hergelaufenen Lumpen hingegeben. So entstand ein Familienstreit, der so schnell nicht beigelegt wurde, bis man sich aber vor nicht allzu langer Zeit zusammensetzte und das Kriegsbeil begrub.
Herr Rohrmoser und Herr Stegmüller setzten sich schon mal in die Sonne und tranken dort zusammen ein Bier, sie sprachen dabei über die Entwicklung der Milchpreise, über die anstehenden Wahlen zum Vorstand im Bauernverband und andere Themen aus der Landwirtschaft, über ihre Familien redeten sie so gut wie nie, für beide war der alte Zwist beigelegt und sie wollten nicht wieder daran rühren. Der Besitz von Stegmüllers umfasste den Südosten bis fast zum Holzeinschlag, auch deren Ländereien reichten bis an den Eulenwald im Süden. Bauer Stegmüller hatte wie Bauer Rohrmoser einen Milchviehbetrieb, er hatte nur unwesentlich weniger Kühe als Bauer Rohrmoser, ungefähr hundertachtzig Stück, und auch er hielt nebenher Schweine, deren Anzahl sich um die sechzig bewegte. Stegmüllers hatten zwei Töchter, Gertrud und Maria, die aber nicht mehr in Kregelbach lebten, sondern nach Irmstadt und Waltershausen geheiratet hatten. Es hatte nie eine Beziehung zwischen Peter und einer der Töchter gegeben, so als wirkte die Scheidung von damals bis in unsere Zeit nach und legte sich wie ein Hindernis auf eine mögliche Annäherung. Der Unfall von Peter hatte den Stegmüllers sehr leid getan und sie boten unmittelbar danach ihre Hilfe an, man beließ es aber dabei, Peter gelegentlich vom Dorf nach Hause zu schieben, wenn man gerade selbst von dort unterwegs war, und man grüßte sich natürlich, wenn man sich begegnete. Auch Stegmüllers waren erklärte Befürworter der Ortsumgehung und die beiden Familienvorstände trafen sich schon einmal auf den anberaumten Sitzungen der Bürgerinitiative in der Sonne.
Andreas Glenbacher
Hinter der Kirche, direkt neben der Schule wohnte die Familie Glenbacher mit ihrem Sohn Andreas, der als Sonderling galt, weil Andres kleinwüchsig war und nicht sehr gut aussah, und wenn man ihn auf der Straße traf und ihn grüßte, schaute er mit ernstem Gesicht hoch und gab Grunzlaute von sich, anschließend lief er fort. Niemand hatte eine Erklärung für das Verhalten von Andreas, es interessierte aber auch nicht sonderlich. Andreas Familie lebte zurückgezogen in einem kleinen Häuschen, dessen Garten an den Wendlerbach grenzte. Zu den Glenbachers hatte eigentlich niemand so richtig Kontakt, und das auffällige Verhalten ihres Sohnes führten manche darauf zurück, dass er als Kleinkind einmal beinahe im Wendlerbach ertrunken wäre. Er hatte unbeaufsichtigt im Garten gespielt und war seinem Ball hinterhergelaufen, der in den Bach gefallen war, wobei der Bach eine Wassertiefe von maximal fünfzig Zentimetern hatte, was für Kleinkinder aber schon zu tief war. Andreas Mutter konnte ihn gerade noch rechtzeitig aus dem Wasser ziehen und ihn per Mund-zu-Mund-Beatmung wiederbeleben, bevor er ertrunken wäre. Da sein Gehirn für verhältnismäßig lange Zeit mit Sauerstoff unterversorgt gewesen war, glaubte man, Andreas hätte eine bleibende Behinderung davongetragen, ganz sicher war sich da aber niemand.
„Da geht der Glen“, sagten viele, wenn Andreas durchs Dorf stromerte, so leise, dass sie Andreas nicht hören konnten. Alfons Disch glaubte, auf seine Waren in seinem Geschäft besonders aufpassen zu müssen, wenn Andreas im Laden war, denn der Glen galt als merkwürdiger Typ, dem man alles zutrauen konnte, auch einen Ladendiebstahl. Bis dahin hatte der Glen aber immer sein Eis bezahlt, das er sich gelegentlich bei Disch kaufte. Der Glen war inzwischen einundzwanzig Jahre alt und wohnte noch immer bei seinen Eltern. Eine Schule hatte er zwar besucht, seinen Abschluss aber auf dem untersten Niveau gemacht. Zu einer Berufsausbildung hatte es nicht gereicht, niemand wollte ihn beschäftigen, nicht so sehr wegen seiner schlechten Schulleistungen, sondern wegen seines merkwürdigen Allgemeinverhaltens, man hielt den Glen für unberechenbar. Manchmal war der Glen für Tage nicht zu sehen und alle rätselten, wo er sich während seiner Abwesenheit wohl aufhielt, es ging das Gerücht, er hielt sich auf dem Wolfskopf auf und betrieb dort nachts eine Geisterbeschwörung. Man lachte darüber, ganz wohl war einem bei dem Gedanken daran aber nicht. Der Glen konnte ein ganz lieber Mensch sein, wenn er gut gelaunt war, lächelte er, und man konnte sein schief gewachsenes Gebiss sehen und die Warze, die auf seiner Nase wuchs, kam dabei besonders zur Geltung. Sein Kopf saß praktisch halslos auf dem Rumpf, und wenn der Glen mit seinen für seine Körpergröße viel zu langen Armen gestikulierte, glaubte man manchmal, eine Marionette vor sich zu haben.
Er hatte kleine flinke Augen, mit denen er ausgezeichnet sehen konnte und große abstehende Ohren, die ihn nicht schöner machten, mit denen er aber hervorragend hören konnte. Direkt am Haus der Glenbachers gab es eine uralte Eisenbrücke über den Wendlerbach, die so verrostet war, dass sie einzustürzen drohte, und wenn man über die Brücke lief, übertrugen sich die Schritte auf die Eisenkonstruktion und brachten sie zum Schwingen. Der Glen machte sich ein Vergnügen daraus, Leuten, die die Brücke überquerten, hinterher zu gehen und die Schwingungen damit zu verstärken, sodass die Leute ihre Schritte aus Angst beschleunigten und beinahe über die Brücke rannten. Der Glen hatte seine helle Freude dabei und musste über die ängstlichen Leute lachen, die wiederum sprachen Flüche über den Glen aus und wünschten ihm sonst was. Früher stand der Glen unter der Brücke und schaute den Mädchen, die über sie liefen, unter den Rock. Das hatte er sich aber abgewöhnt, nachdem der Brückenbelag erneuert und durch eine geschlossene Bretterabdeckung ersetzt worden war. Auf der anderen Seite der Hauptstraße gelangte man, wenn man von der Brücke kam, auf den Weg zum Wolfskopf, der in seinem unteren Teil bis zum Heligenhäuschen noch breit war und nicht sehr steil anstieg.
Der Glen liebte es, durch das Dorf zu stromern und die Leute zu necken, man sah es ihm nach, schüttelte den Kopf über ihn und ließ ihn gewähren, solange er niemandem ernsthaften Schaden zufügte. Manchmal saß er auf dem Kirchplatz und gaffte die Passanten an, die gelegentlich erschrocken waren über seine Dreistigkeit, was den Glen nur freute. Einmal setzte sich der Pfarrer zu ihm, um mit ihm zu reden und ihn dazu zu bewegen, doch auch einmal die Kirche zu besuchen und zu seinem Schöpfer zu beten. Als der Glen aber daraufhin so laut lachen musste, dass es über den ganzen Kirchplatz schallte, ging der Pfarrer schnell in sein Pfarrhaus und versuchte, sein Treffen mit dem Glen zu vergessen. Das „Hotel Rösch“ verfügte über eine eigene Metzgerei und immer, wenn gewurstet wurde, roch es über den gesamten Kirchplatz nach den Gewürzen, die an die Wurst kamen wie zum Beispiel Majoran. Wenn die empfindliche Nase des Glen diese guten Aromen aufnahm, ging er zu Rösch hinter das Haus, wo der Zugang zur Metzgerei lag und stellte sich dorthin. Er wartete dort so lange, bis ihn jemand bemerkte und ihm ein Stück frische und noch warme Fleischwurst gab, erst danach zog er wieder ab. Die Küche bei Rösch war bodenständig und gut, die Zimmer waren einfach, aber sauber und ordentlich, und die Übernachtung in diesem Hotel kostete nicht die Welt.
Das Haus stand schon seit zweihundert Jahren an seinem Platz und diente ganz früher den Durchreisenden als Unterkunft, schon damals lobten viele die gute Küche, was in alten Briefen schriftlich belegt war, die Briefe lagen im Gastraum hinter Glas und konnten von jedem Gast gelesen werden. Immer nach dem Kirchgang nahmen die Männer einen Frühschoppen bei Rösch, das wurde schon seit ewigen Zeiten so gemacht, und daran würde sich in absehbarer Zeit auch nichts ändern. Die „Sonne“ kam für den Frühschoppen nicht in Betracht, weil sie nicht wie Rösch direkt am Kirchplatz lag, man setzte sich bei schönem Wetter draußen vor das Hotel und ließ Bier kommen. Die Männer trugen feinsten Sonntagsstaat und waren herausgeputzt, die Frauen kümmerten sich in der Zeit zu Hause um den Sonntagsbraten und hofften, dass ihre Männer rechtzeitig zum Essen nach Hause kämen. Manche der Männer verpassten es, frühzeitig mit dem Biertrinken Schluss zu machen und wurden immer betrunkener, und wenn die anderen sie nicht dazu aufgefordert hätten, das Trinken einzustellen, wären sie irgendwann unter den Tisch gefallen. Man half ihnen nach Hause, wo ihnen eine Schimpfkanonade ihrer Ehefrauen sicher war. Das „Hotel Rösch“ verfügte über eine Kegelbahn, die auch ausgiebig, vor allem von der Dorfjugend, genutzt wurde. Man traf sich in der Woche für zwei, drei Stunden bei Rösch und kegelte, dabei ließ man sich Essen bringen und lobte regelmäßig den Koch.
Das Hotel war heute nicht mehr ausgelastet, der Betrieb reichte so gerade aus, um der Familie Rösch über die Runden zu helfen. Die älteste Tochter, Theodora, half im Hotel die Betten zu richten und alles sauber zu halten. Theodora war noch keine zwanzig und würde sicher aus Kregelbach wegziehen, wenn sie jemanden kennen lernte, der sie heiratete, ihr Herz hing nicht an dem elterlichen Hotel. Mitten auf dem Kirchplatz stand ein Kriegerdenkmal, das an die Gefallenen aus den beiden Weltkriegen erinnerte, niemand schenkte ihnen mehr Beachtung, am wenigsten die jungen Leute. Die ein Stück die Kirchgasse entlang gelegene „Sonne“ war auch schon alt und ein Restaurant für gehobene Ansprüche. Es kamen Gäste von außerhalb, um in der Sonne zu essen, besonders Wildgerichte, frische Forellen aus den umliegenden Gewässern und in der Saison auch frische Pilze waren die favorisierten Gerichte in der „Sonne“. Das Lokal hatte in seiner langjährigen Geschichte erst in den letzten Jahren einen radikalen Wandel erfahren, es war von einer Dorfgaststätte mit gutem Essen zu einem Genusstempel geworden. Man hatte aber die Dorfanbindung beibehalten und stellte dem Musikverein und der Bürgerinitiative für die Ortsumgehung Räumlichkeiten zur Verfügung. Überhaupt waren die Wirtsleute auf dem Teppich geblieben und trugen die Nasen nicht höher, nur weil ihr Restaurant jetzt ein Spitzenlokal geworden war. Sie waren beide Mitte dreißig, er war sowohl Mitglied im Musikverein als auch in der Bürgerinitiative, sie engagierte sich im Dorf, besuchte Alte und Hilfsbedürftige und nahm Besorgungen für sie vor.
Manchmal setzte sie sich einfach zu ihnen und redete mit ihnen über alles Mögliche, sie merkte, dass sie gut bei den Menschen ankam. Einmal im Jahr kamen alle zusammen, die wollten, um auf den Wolfskopf zu laufen und die Kapelle, die oben auf dem Gipfel stand, aufzusuchen und dort zu beten. Früher konnte man die Kapelle vom Tal aus sehen, sie war weiß und ein markanter Blickfang gewesen, heute verhinderten die inzwischen gewachsenen Bäume einen Blick auf das kleine Gotteshaus. Es fand sich immer eine Wandergruppe von fünfzehn bis zwanzig Personen ein, die sich an der Brücke über den Wendlerbach traf, die Hauptstraße überquerte und loslief. Zu der Wandergruppe gehörten regelmäßig die Wirtsleute aus der Sonne, die ihr Lokal für einen halben Tag geschlossen hielten, aber auch Herr Rösch, der Pfarrer, Rohrmosers und Stegmüllers. Glenbachers hatten noch nie teilgenommen, sie waren wohl auch schon zu alt für die Wanderung auf den Berg oder sie waren körperlich dazu nicht in der Lage. Die Wanderer trugen Rucksäcke, in denen sie eine Wegzehrung verstaut hatten, ein paar Hartwürste, gutes Brot, Bier und Wasser. Festes Schuhwerk war zwar nicht unbedingt erforderlich, aber es konnte zumindest im oberen Teil des Weges nicht schaden, jeder trug Wanderschuhe.
So lief die Gruppe an der Tankstelle und den Tennisplätzen vorbei den sanften Anstieg bis zum Heiligenhäuschen hoch. Dort blieb sie stehen und der Pfarrer sprach ein Gebet, er erflehte Gottes Segen für die Gruppe und dankte ihm für die Kraft, die er allen für den Aufstieg gegeben hatte. Unmittelbar nach dem Heiligenhäuschen begann der Wald und die Gruppe wanderte im Schatten der mächtigen Tannen, die dort standen und den typischen herzhaften Harzgeruch abgaben. Der Weg hatte sich inzwischen von einer gut befahrbaren schmalen Straße zu einem holperigen Steilanstieg gewandelt, in dessen Mitte eine Rinne vom herabstürzenden Regenwasser ausgewaschen war. Die Gruppe war bemüht, immer am Rand des Steilweges zu laufen, weil die Rinne in der Mitte viele Unebenheiten aufwies und man zu fallen drohte, wenn man stolperte. Hin und wieder jagte ein Stück Rehwild über den Weg und verschwand schleunigst im Dickicht des Waldes, das aus niedrigem Buschwerk und Farn bestand. Denn natürlich bewegte sich die Gruppe nicht sehr leise den Wolfskopf hinauf, sodass das Wild aufgeschreckt wurde und die Flucht ergriff, es waren auch viele Eichhörnchen und auch einmal eine Rotte Wildschweine mit Frischlingen zu sehen. Vögel sah man in dem dunklen dichten Tannenwald kaum, wohl aber hörte man sie, sie saßen in den Tannenkronen in der Sonne und zwitscherten ihre Lieder. Auf mehr als halber Höhe gab es eine Art Sattel und die Gruppe machte Halt, jeder setzte sich auf das weiche Moos und holte etwas zu essen und zu trinken aus dem Rucksack.
Die Wanderer waren eineinhalb Stunden bergan gestiegen und ziemlich müde von der Anstrengung, sie hatten von dort aus noch eine halbe Stunde zu klettern. Niemand sagt ein Wort, jeder kaute oder trank, und alle hörten auf die Stimmen des Waldes, die klar und deutlich zu vernehmen waren, beinahe wie in einem Kirchenschiff ertönten die Waldgeräusche. Nach einer ungefähr zwanzigminütigen Pause ging es weiter, deutlich langsamer als am Anfang, jeder schwitzte und rang nach Luft, die Luft war gut im Wald und erfrischte. Nach weiteren zwanzig Minuten steilen Anstiegs war die Kapelle in Sichtweite, sie lag friedlich auf der Gipfellichtung, still. Nachdem die Gruppe an der Kapelle angekommen war, setzte sich jeder in die Wiese vor der kleinen Kirche und schaute ins Tal oder über die Berge hinweg in die Ferne. Alle waren stolz auf sich, dass sie den Anstieg wieder einmal vollbracht hatten, und es wurde Bier geöffnet und mit Genuss getrunken. Danach betraten alle das Gotteshaus und bekreuzigten sich, jeder kniete vor dem Altar und sprach ein stilles Gebet, bevor man sich in das Kapellenbuch eintrug, man schrieb das Datum, ein, zwei kurze Sätze und seinen Namen. Dort oben war man von allem entrückt, zwischen Dorf und Gipfel lag der finstere Tannenwald wie ein hemmendes Bollwerk, das es zu überwinden galt, danach öffnete sich der Blick in die Weite und man wurde geradezu beflügelt.
Noch einmal setzte sich die Gruppe in die Wiese, die Stimmung war gelöst und der Pfarrer stimmte „Geh aus mein Herz und suche...“ an und alle sangen aus Leibeskräften und freuten sich ihres Lebens. Das Lied von Paul Gerhardt hatte im Original zwanzig Strophen, von denen aber nur drei gesungen wurden. Der Einzige, der textsicher war, war der Pfarrer, und der sang auch am lautesten. Danach ging es wieder talwärts und alle liefen frohen Mutes wieder in den Tannenwald, der sie aufnahm und nicht mehr loszulassen drohte, so dicht standen die Bäume, so bedrohlich hingen ihre dicken Äste über dem Weg, als wollten sie die Wanderer ergreifen, die sich unter ihnen hindurch bücken mussten. Der Rückweg dauerte insgesamt nur eine Stunde und als sie wieder an das Heiligenhäuschen kamen, liefen sie an ihm vorbei, überquerten die Hauptstraße und gingen über die Wendlerbachbrücke, die unter den schweren Schritten der Wanderer bedrohlich ins Schwingen geriet, ins Dorf. Sie kreuzten die Wehrgasse und liefen auf dem Kirchplatz am Denkmal vorbei geradewegs zur „Sonne“. Das Wirtsehepaar öffnete sein Lokal und wies den Koch, der gerade eintraf, an, das Essen für den Abend vorzubereiten. Anschließend zapfte die Wirtin für jeden, der wollte, ein Bier und schenkte den Frauen ein Glas Weißwein ein, der Wirt holte die Obstlerflasche und gab jedem, der wollte, ein Schnapsglas und goss es voll. Danach tranken alle auf die erfolgreiche Wanderung, die man im nächsten Jahr unbedingt wiederholen wollte.
Vor der „Sonne“ standen in der Kirchgasse einige Tische und Stühle, das Wetter war schön warm und die Wandergruppe saß draußen. Auch der Pfarrer trank einen Schnaps und ein Bier, mehr aber nicht, schließlich wollte der Gottesmann nicht als Säufer dastehen. Nach einer Stunde gemütlichen Erzählens und Trinkens löste sich die Wandergruppe wieder auf, und jeder ging zu sich nach Hause. Rohrmosers und Stegmüllers liefen ein Stück zusammen, bis sich kurz vor Erreichen ihrer Höfe ihre Wege trennten, und die einen nach links und die anderen nach rechts schwenkten. Der Glen machte sich an diesem Abend fertig für seine nächtliche Exkursion zum Wolfskopf, er traf sich in dem Tannenwald immer mit den Waldbewohnern, das machte er schon seit Längerem so, denn unter den Menschen hatte er keine Freunde. Er war auf dem Wolfskopf ein gern gesehener Gast und eine geachtete Persönlichkeit geworden und er hatte ein Auge auf Tola, die Tochter des Waldkönigs geworfen und wenn er sich nicht irrte, war auch Tola in ihn verliebt. Niemand in Kregelbach wusste etwas von den Beziehungen, die der Glen zum Wald am Wolfskopf unterhielt und von seinen Bekanntschaften dort. Seine Eltern wunderten sich nur manchmal, wenn er tagelang nicht zu sehen war und wenn sie ihn nach seiner Rückkehr fragten, sagte er bloß, auf Stellensuche in Waltershausen oder in Irmstadt gewesen zu sein, die Eltern beharrten nicht und ließen es bei seiner Antwort bewenden.
Was hätten sie auch sonst tun sollen, ihr Sohn war einundzwanzig und volljährig. Der Glen machte seinen Rucksack fertig und legte auch seinen Laptop bereit, denn er würde beim Waldvolk Computerspiele spielen, er hatte sich ein ganz neues Spiel heruntergeladen, die Leute beim Waldvolk waren Computerfreaks. Ohne sich von seinen Eltern zu verabschieden verließ der Glen gegen 19.30 h das Haus und schlich sich an der Tankstelle und den Tennisplätzen vorbei zum Heiligenhäuschen, dort blieb er stehen und drehte sich um, er schaute, ob ihm auch niemand gefolgt war und konnte keinen Menschen sehen. Als der Glen im Wald war, gab er seine gebückte Haltung auf und bewegte sich völlig frei und ungezwungen, der Wald war sein Zuhause, hier fühlte er sich geborgen und er lief strammen Schrittes bis zum Sattel hoch. Dort zweigte, nicht für jeden sichtbar, ein sehr schmaler Pfad ab, der einmal ein Saumpfad gewesen sein mochte, und der an seinem Anfang von Farn überwuchert war, weshalb man ihn nicht bemerken konnte. Nachdem der Glen in den Pfad eingebogen war und auf dem Wege war, das Reich des Waldvolkes zu betreten, stieß er einen Pfiff aus, einen ganz charakteristischen Pfiff, der aus nur acht Tönen bestand und als Erkennungsmelodie galt.
Unmittelbar danach vollzog sich ein Wandel in der Ausgestaltung der Umgebung, der Glen sah sich mit einem Mal in ein von der Sonne beschienenes Dorf versetzt, das zum Reich von König Joda gehörte, ein Reich, das für den Menschen normalerweise nicht zugänglich war, es entzog sich seiner Wahrnehmung. Es war nur dem zugänglich, dem Joda den Zutritt gestattete, so wie dem Glen, für den der Zutritt eine Art Belohnung war. Denn der Glen hatte vor nicht allzu langer Zeit einmal einem Argin, so der Name des Volkes von König Joda, geholfen, in sein Reich zurückzukehren, nachdem er es aus Versehen verlassen hatte und hinter einem Farn versteckt auf dem Sattel im Wald gestanden hatte. Der Glen war mit seinen Eltern zum Wolfskopf unterwegs, als er den Argin auf dem Sattel bemerkte, seine Eltern hatten davon gar nichts mitbekommen und waren weitergelaufen. Der Glen aber sah ihn hinter dem Farn und sprach ihn an und der Argin, der in etwa die Körpergröße des Glen hatte und auch wie ein Mensch aussah, war sehr verschreckt und schaute den Glen ängstlich an. Der wusste gar nicht, was er mit ihm anfangen sollte, denn sprechen konnte er nicht mit ihm, die Argin hatten eine eigene Sprache. Er war eine ganz besondere Erscheinung, so viel war dem Glen klar, und als der Argin hilflos um sich schaute und der Glen genau hinsah, konnte er den schmalen Pfad entdecken. Er nahm den Argin bei der Hand und lief mit ihm ein Stück den Pfad in den Wald entlang. Als er mit ihm eine Stelle erreichte, an der sich zwei mächtige Äste zweier riesiger Tannen kreuzten, stieß der Argin einen Pfiff aus, der aus acht Tönen bestand, die eine völlig fremd anmutende Melodie ergaben, die keiner Tonalität folgten.
Die acht Töne standen in Intervallen zueinander, die weder Sekunden noch Terzen oder Quinten waren, sie ergaben ein für Menschen vollkommen ungewohntes Klangbild. Nach der Tonfolge verwandelte sich die Umgebung und der Argin wurde in eine andere Welt aufgenommen, gleich danach änderte sich alles wieder und der Glen stand wieder in seinem Wald. Er rannte schnell seinen Eltern hinterher und sagte auf deren Nachfrage hin, wo er denn so lange geblieben wäre, dass er austreten gemusst hätte. Er hatte sich die Tonfolge gemerkt, die der Argin gepfiffen hatte und ließ sie sich immer wieder durch den Kopf gehen, damit er sie nicht vergaß. Wieder zu Hause, nahm er einen Zettel und notierte die Tonfolge in Notenlinien, nahm seine Blockflöte, die er noch aus seiner Kinderzeit bei sich im Zimmer liegen hatte und spielte die Töne nach, so lange, bis sie ihm in Fleisch und Blut übergegangen waren. Wenn er draußen war und durchs Dorf lief, summte oder pfiff er die Melodie nach und die Leute, die ihm begegneten, hörten, was er summte und schauten sich verstört nach ihm um, denn die Melodie musste einfach jedem fremd erscheinen. Der Glen behielt sein großes Geheimnis für sich, er erzählte niemandem von seiner Begegnung mit dem Argin und von dem versteckten Pfad, der auf dem Sattel des Wolfskopfes abzeigte.
Eines Tages machte sich der Glen wieder zum Sattel auf, teilte den Farn, der den Blick auf den Pfad verdeckte und lief zu den beiden mächtigen sich kreuzenden Tannenästen, stellte sich unter sie und pfiff die fremd anmutende Melodie. Sofort verwandelte sich der ihn umgebende Wald in ein liebliches von der Sonne beschienenes Dorf, in dem die Argin glücklich und zufrieden zusammenlebten und eigentlich keiner zielgerichteten Tätigkeit nachgingen, sondern sich nur zu vergnügen schienen. Als sie den Glen wahrnahmen, kam gleich der Argin auf ihn zu, dem er vorher die Rückkehr in das Jodareich ermöglicht hatte und nahm ihn bei der Hand, um ihn zu seinem Haus zu führen. Dort setzte er sich mit ihm hin und bot ihm etwas zu trinken an, das er nicht kannte. Es war ein grünlicher Saft, der von ihm unbekannten Früchten stammte und so gut und erfrischend schmeckte, wie er selten einen Saft getrunken hatte. Der Saft enthielt wohl auch eine Spur Alkohol, die aber nicht ausreichte, um den Glen betrunken zu machen. Er konnte sich mit einem Mal auch mit dem Argin verständigen, denn seine Sprache hatte sich mit dem Übertritt in das Jodareich ebenfalls gewandelt. Der Name des von ihm geretteten Argin war Tabor, und er war ein freundlicher Zeitgenosse. Auf die Frage des Glen hin wie alt er wäre, antwortete Tabor:
„Nach menschlichen Maßstäben bin ich ungefähr dreiundfünfzig“ und der Glen wunderte sich, denn danach sah Tabor wirklich nicht aus, eher nach zwanzig. Als der Glen seinen Saft getrunken hatte, stand er auf und sagte:
„Ich muss wieder zurück!“
Tabor fand es schade, dass er wieder gehen musste und brachte ihn zu der Stelle, an der er das Arginreich betreten hatte, pfiff die Melodie und der Glen war wieder in seinen heimischen Wald am Wolfskopf verschwunden. Er lief den Pfad bis zum Sattel entlang, um von dort ins Dorf zurückzulaufen. Er nahm sich vor, von dem Tage an den Argin öfter einen Besuch abzustatten und hüllte sich ganz in Schweigen, was sein Erlebnis bei seinen neuen Freunden anbelangte. Er sollte in der Folgezeit völlig mit seinem Leben in Kregelbach abschließen und bei den Argin eine neue Heimat finden, wenngleich er noch nicht so weit war, ganz bei ihnen zu bleiben, er hielt sich die endgültige Entscheidung noch offen. Er entfremdete sich immer mehr vom normalen Dorfleben, er ging ja auch keiner geregelten Beschäftigung nach und nahm auch nicht bei den Zusammenkünften im Heimatverein oder in der Bürgerinitiative teil. Er würde im Übrigen auch nicht so gern dort gesehen, denn der Glen war ein Sonderling, mit dem niemand gern etwas zu tun hatte. So machte er es sich zur Angewohnheit, abends loszuziehen und zum Sattel hochzulaufen, um von dort zu den Argin zu gehen. Immer nahm er zu seinen Unternehmungen seinen Laptop mit, um mit den Argin zu spielen oder andere Dinge mit dem Computer anzustellen. Oftmals war er tagelang weg, ohne dass einem Dorfbewohner das aufgefallen wäre und seine Eltern schauten ihn immer verwundert an, wenn er wieder auftauchte.
Er ließ sich immer eine neue Geschichte einfallen, die zur Erklärung für sein Fortsein herhalten musste und seine Eltern nahmen ihm die Geschichte regelmäßig ab. Wieder einmal wartete der Glen auf den Abend, an dem das Leben in Kregelbach zum Erliegen kam, legte seinen Laptop und ein paar Sachen zurecht und schlich sich gegen 19.30 h zum Sattel hoch. Niemand hatte bemerkt, wie er das Dorf verlassen und den Weg am Heiligenhäuschen vorbei genommen hatte. Der dichte Wald ließ kaum einen Lichtstrahl durch und der Glen hatte leichte Schwierigkeiten, den Weg zu sehen und darauf zu achten, dass er auf allzu holperigen Teilstücken nicht stolperte und hinfiel. Oben auf dem Sattel schwenkte er in den Pfad ab, lief bis zu den dicken Ästen vor, pfiff die schrille Tonfolge und gleich öffnete sich vor ihm die Zauberwelt, in der alles anders war als in Kregelbach, es umgab ihn eine Stimmung des Gelöstseins und es überfiel ihn ein starkes Glücksgefühl. Gleich kam Tabor auf ihn zu und begrüßte ihn, er nahm den Glen mit zu sich und holte seinen Laptop aus dem Haus. Draußen vor seinem schönen Haus gab es einen gepflegten Garten, der aber nicht wie die Gärten in Kregelbach fast ausschließlich aus Rasen bestand, sondern eine große Fülle blühender Blumen aufwies, von denen der Glen manche noch nie gesehen hatte. So gab es schwarz blühende Rosen mit sehr hohem Wuchs, die einen Duft von sich gaben, wie er ihn kaum beschreiben konnte.
Inmitten der Blumenpracht hatte Tabor einen Tisch mit vier Stühlen stehen, an den er sich mit dem Glen setzte. Der Glen zeigte Tabor sein neuestes Computerspiel, Tabor kannte es noch nicht und war sehr interessiert. Es handelte sich bei dem Spiel um eine Art dreidimensionales Schach, bei dem Menschen eigentlich vollkommen überfordert waren, zumindest brauchten sie Stunden, um eine Partie wenigstens halbwegs zu Ende zu spielen. Tabor verfügte als Argin aber über einen sehr ausgeprägten Intellekt, der es ihm ermöglichte, das dreidimensionale Schach auf Anhieb zu beherrschen. Er schlug den Glen innerhalb sehr kurzer Zeit nach Strich und Faden und der Glen bewunderte Tabor wegen seiner Fähigkeiten und gratulierte ihm, woraufhin Tabor lächelte und dem Glen zu verstehen gab, dass ihm das Spiel keine Schwierigkeiten bereitet hatte und er es ganz unterhaltsam fand. Gegenüber dem normalen zweidimensionalen Schach potenzierte sich der Schwierigkeitsgrad des Spiels beim dreidimensionalen Schach dadurch, dass man in Raumdiagonalen denken und seine Züge vollbringen musste, aber das bewältigte Tabor scheinbar mit links. Er holte nach dem Spiel wieder von dem sehr gut schmeckenden Saft und der Glen nahm einen tiefen Schluck, als plötzlich Tola an Tabors Haus vorbeilief und er sie rief. Tola war ein wunderschönes Mädchen und Tabor bat sie zu sich:
„Tola, ich habe einen Gast“ und als Tola den Glen sah, errötete sie leicht im Gesicht und der Glen sprang von seinem Stuhl hoch, um Tola die Hand zu geben. Sie setzte sich zu den beiden an den Tisch und Tabor gab ihr ein Glas Saft, Tola erzählte, dass sie auf dem Weg zu ihrem Vater, dem König, in den Palast wäre:
„Wenn ihr wollt, könnt ihr mich doch begleiten“, bot sie Tabor und Glen an. Die beiden sahen sich an und gaben ihr Einverständnis, sie tranken ihren Saft aus, Tabor brachte die Gläser ins Haus und sie liefen los. Beinahe alle Dorfbewohner saßen draußen vor ihren Häusern, tranken und unterhielten sich angeregt. Tola und Tabor grüßten sie alle, denn man kannte sich im Dorf natürlich und freute sich immer, wenn man sich sah. Dem Glen fiel auf, dass es bei den Argin scheinbar keine Alten gab und er fragte Tabor danach. Der erzählte:
„Die Argin werden natürlich auch alt, es ändert sich nur ihr Äußeres nicht und sie sehen bis zu ihrem Tod praktisch unverändert aus, sie sterben im Schnitt nach hundertfünfzig Menschenjahren, wenn ihre inneren Organe zu versagen beginnen.“ Die Argin erinnerten den Glen in ihren Togen an die alten Römer, alle trugen sie den kleidähnlichen Überwurf, der sehr bequem war und den Trägern ein Maximum an Bewegungsfreiheit einräumte. Die Togen reichten bis zu den Knien und wurden an der Hüfte durch einen Gürtel gehalten. Sie waren aus einer Art Leinenstoff gefertigt und sehr bunt gehalten, auf die Farbe wurde großer Wert gelegt, denn die Farbe war das einzige Unterscheidungsmerkmal bei den im Schnitt ansonsten völlig identischen Togen.
Bei den Frauen schien die Farbe ihrer Toga eine noch größere Rolle zu spielen als bei den Männern, Tolas Toga hatte die Farben grün, rot und gelb, worin sie schrill, aber durchaus angenehm aussah. Tolas Gang war fraulich, sie bewegte ihr Becken in einem wiegenden Hin und Her, während sie lief, und der Glen beobachtete sie dabei, er fand Tola hinreißend. Wenn die Argin nicht barfuß liefen, trugen sie, ebenfalls wie die alten Römer, von Lederriemen gehaltene Sandalen an den Füßen, wobei auch die Lederriemen in verschiedenen Farben gehalten waren und besonders die Frauen taten sich dabei wieder hervor. Tolas Sandalen wurden jeweils durch drei übereinanderliegende Riemen gehalten, die die Farben ihrer Toga hatten, grün, rot und gelb. Tolas Körper war sehr gut proportioniert und das wusste sie auch, sie bewegte sich beinahe provozierend und aufreizend, das empfand der Glen jedenfalls so. Die Arginfrauen hatten alle die gleiche Körpergröße, die Männer waren ein kleines Stückchen größer. Ihre Kindheitsphase, in der sie natürlich noch klein waren, dauerte offensichtlich nur sehr kurz. Tabor sagte:
„Die Argin sind ein Jahr lang (nach Menschenzeit) Kind, danach haben sie die Körpergröße aller anderen erreicht, die bei Männern bei 1.82 m und bei Frauen bei 1.76 m liegt.“ Der Glen nahm sich gegen die Argin mit seinen 1.78 m relativ klein aus.
Die Luft im Dorf war sehr angenehm weich und warm und sie roch lieblich, das war dem Glen schon bei seinem vorherigen Besuch aufgefallen, er konnte den lieblichen Geruch aber nicht zuordnen und fragte Tabor danach. Tabor antwortete:
„Der Geruch geht auf eine Honigart zurück, die bei den Argin sehr verbreitet ist, sie gewinnen den Honig aus dem Wald, es ist Tannenhonig, den sie allerdings unter Zugabe verschiedener Kräuter noch verfeinerten, sie benutzen den Honig zur Hautpflege und reiben ganze Körperpartien mit ihm ein.“ An Geräuschen war im Dorf, außer dem verhaltenen Lachen der Argin, das man ab und zu hören konnte, nichts zu vernehmen. Es gab keine Autos, man bewegte sich im Dorf zu Fuß, was kein Problem war. Dem Glen war warm geworden, und er entledigte sich seines Pullovers, den er die ganze Zeit anhatte und legte ihn in seinen Rucksack, wie gern trüge er doch so eine Toga wie Tabor, dachte er.
„Was macht ihr, wenn ihr einmal größere Strecken zurücklegen wollt“, fragte der Glen und Tabor antwortete:
„Zu diesem Zweck gibt vor jedem Dorf des Arginreiches einen Flughafen, auf dem senkrecht startende und landende Flugzeuge stehen, die man kostenlos benutzen darf und mit denen man die anderen Reichsteile erreichen kann.“ Das Dorf, in dem sich der Glen gerade aufhielt, wäre das Hauptdorf unter hunderten anderer Dörfer, die es im Arginreich gäbe und in ihm stünde der Königspalast, zu dem sie gleich kämen. Dem Glen fiel auf, dass viele Argin sich Waschbären hielten, sie waren Haustiere für sie und folgten ihnen aufs Wort, wie er beobachten konnte. Die Tiere sahen putzig aus, wie der Glen fand, er hatte Waschbären schon früher am Wolfskopf sehen können, sie kamen in den Wäldern um Kregelbach sehr häufig vor, aber domestiziert wurden sie von niemandem, den er kannte. Sie näherten sich am Dorfende einem größeren Gebäude, vor dem zwei uniformierte Argin Wache standen, es handelte sich dabei um den Palast, und als die Wachen Tola bemerkten, nahmen sie Haltung an und grüßten militärisch. Tola winkte aber ab und gab damit zu verstehen, dass die Wachen ihrem Erscheinen keine besondere Bedeutung beimessen sollten, woraufhin sie wieder rührten, was hieß, dass sie wieder in gelockerter Haltung vor ihren Wachhäuschen standen. Die drei liefen durch das Palasttor und gelangten in einen schönen Hof, der mit Blumenbeeten verziert war und Tola bemerkte, dass sie sich um die Blumenbeete kümmerte, wenn der Gärtner einmal keine Zeit hatte und sie ließ, sie hätte die Blumen in ihr Herz geschlossen. Tola öffnete die Palasttür von der Hofseite aus und sie kamen in eine Art Vorsalon, wo verschiedene Diener sie empfingen. Tola bedeutete ihnen aber, dass sie nichts brauchte und in diesem Moment auf ihre Dienste verzichtete. Plötzlich öffnete sich die Salontür und Joda betrat die Szene, Tola stellte ihrem Vater den Glen vor, und der hieß den Menschen herzlich im Arginreich willkommen.
Er bat die drei Besucher in den riesigen Salon und sich an den großen Mahagonitisch zu setzen, der im Salon prangte. Der König klatschte in die Hände und als ein Diener erschien, ließ er von dem grünen Saft und Kaffee kommen und als diese Dinge gebracht worden waren, forderte er seinen Besuch auf, zuzulangen. Joda fragte den Glen:
„Wie gefällt es Dir bei den Argin?“, und der Glen sagte:
„Ich bin überwältigt von so viel Einfachheit und Klarheit im Zusammenleben der Argin, was mir besonders gefällt ist die offensichtliche Zufriedenheit aller.“ Tola erläuterte:
„Es gibt bei den Argin keinen Neid und keinen Hass, weil niemand einen Mangel empfinden muss, deshalb gibt es bei uns auch keine Kriege oder sonstige gewaltsame Auseinandersetzungen.“ Sie saß neben dem Glen und schaute ihm ins Gesicht als sie das sagte, und der Glen wäre beinahe dahingeschmolzen, so schön fand er Tola. Sie hatte tiefbraune Augen und ein ebenmäßiges Gesicht, ihre Nase war zierlich und ihr Mund klein, sie hatte dunkles und recht kurzes Haar und von Tola ging ein betörender Duft aus, das war ein Parfum, wie es der Glen noch nie gerochen hatte. Nachdem sich alle ein wenig an dem Saft erfrischt hatten und der Glen auch eine Tasse Kaffee getrunken hatte, sagte Joda:
„Vielleicht fragt sich der Glen, warum es bei den Argin so etwas rückständiges wie einen König gibt, es muss ihn eigentlich gar nicht zu geben.
Die Argin brauchen keine Regierung, die ihr Leben in die richtigen Bahnen lenkt, es gibt im Arginreich auch keine geschriebenen Gesetze, an die sich jeder zu halten hätte, demzufolge gibt es auch kein Parlament, das als Gesetzgeber fungiert. Als Richtschnur für das Leben der Argin gilt ein moralisch-ethischer Kodex, der ihnen schon von Geburt an zu eigen ist, er wird ihnen quasi in die Wiege gelegt und von jedem unwidersprochen übernommen. Die Argin kommen mit einem hohen Intelligenzpotenzial auf die Welt und jeder kann eigentlich von Anbeginn seines Erwachsenenseins alles. Die Person des Königs ist vollkommen überflüssig.“ Joda sähe sein Amt als ein Relikt aus einer überkommenen Zeit an, in der es noch Regierungen und die anderen Teilgewalten gab, aber das wäre lange her. Die Argin wären sehr traditionsbewusst und liebten es, einen König und bald auch eine Königin zu haben.
„Ich beabsichtige, die Königswürde in zwei Jahren an meine Tochter zu übergeben, Tola ist im ganzen Reich bekannt und wird wegen ihrer Weisheit und ihrer Schönheit überall hoch geschätzt.“ Joda fuhr fort und sagte dem Glen:
„Überleg Dir doch, Bürger im Reich der Argin zu werden, Du bist herzlich willkommen, und ich könnte mir vorstellen, dass Dir ein Leben bei den Argin gefällt.“ Der Glen wurde leicht verlegen, als ihm der König das anbot, er hatte im Stillen selbst schon daran gedacht, Bürger bei den Argin zu werden und als auch noch Tola ihn darin bestärkte, Bürger im Arginreich zu werden, sagte der Glen, dass er darüber nachdenken wollte, und er bedankte sich für das freundliche Angebot, in Wirklichkeit hatte er sich aber schon längst entschieden. Es überkam ihn plötzlich eine Müdigkeit, die er darauf zurückführte, dass es bei ihm zu Hause tiefe Nacht war und er fragte, ob es bei den Argin denn nie dunkel würde. Tabor antwortete:
„Die Argin kennen Dunkelheit nicht, sie werden selbstverständlich auch müde und schlafen gelegentlich, dann ziehen sie sich zurück und legen sich hin oder sie schlafen bei sich vor dem Haus, Dunkelheit brauchen sie dazu nicht.“ Alles, was der Glen bis dahin bei den Argin erlebt hatte, überwältigte ihn und er fand es überaus überzeugend, er sah Tola an, und sie erwiderte seinen Blick mit ihrem unglaublichen Charme. Tabor und der Glen standen auf und verabschiedeten sich vom König und seiner Tochter, der Glen bedankte sich für die freundliche Aufnahme, und Tabor und er verließen den Palast wieder, sie liefen zu Tabors Haus und setzten sich bei ihm in den Vorgarten. Tabor goss beiden ein Glas Saft ein und der Glen sagte, dass er gern wüsste wie spät es im Moment bei ihm zu Hause wäre.
Tabor nahm daraufhin seinen Laptop und gab auf Google die Zeitumrechnung ein, es wäre beim ihm 8.00 h morgens, sagte er dem Glen. Der meinte, dass er nach Hause müsste und stand auf, er wollte sich aber schon bald wieder bei Tabor melden. Der Glen lief zu der Stelle zurück, an der er das Arginreich betreten hatte, pfiff die Erkennungsmelodie, und im selben Augenblick fand er sich auf dem Pfad zum Sattel unterhalb des Wolfskopfgipfels. Er trollte sich durch den dichten Tannenwald bergab nach Kregelbach und dachte unterwegs noch, wann er wohl einen Schlussstrich unter sein Leben im Dorf ziehen würde, wie sollte er das bloß machen? Sollte er einfach verschwinden, oder sollte er sich zumindest von seinen Eltern verabschieden? Er war sich nicht sicher, wie er sich verhalten sollte und würde abwarten, zuerst müsste er nach Hause und würde in seinem Zimmer nachdenken. Als er die alte Eisenbrücke über den Wendlerbach überquerte, sah er seine Mutter im Garten und rief ihr zu, die Mutter hob den Kopf und sah ihn fragend an, der Glen lief aber weiter und betrat sein Geburtshaus. Seine Mutter kam und fragte ihn:
„Wo hast Du denn bloß so lange gesteckt?“, und der Glen erfand wieder eine Geschichte, damit die Mutter zufriedengestellt war, und er seine Ruhe hatte. Wie er das hasste, immer lügen zu müssen, immer Geschichten ausdenken zu müssen, nur damit seine Eltern Ruhe gaben und nicht weiter nachfragten.
Der Glen ging auf sein Zimmer und legte sich auf sein Bett, er hatte sich gar nicht ausgezogen, lag auf dem Rücken und starrte an die Decke. Er hatte sein Fenster geöffnet und hörte die Kirchturmglocke 10.00 h schlagen, kurze Zeit später schloss er die Augen und schlief ein, er war doch sehr müde geworden während seines Aufenthaltes im Argindorf, was auch nicht weiter verwundern konnte, denn schließlich hatte er sich die Nacht um die Ohren geschlagen, obwohl es bei Tola und Tabor nicht dunkel geworden war. Der Glen schlief bis zum Mittag, als er vom Schlag der Kirchturmglocke wieder geweckt wurde. Er stand auf und machte sich frisch, bevor er ins Dorf lief. Auf der Wehrgasse war um die Mittagszeit nichts los, und der Glen trottete sie ganz langsam entlang, bis er aber hinter der Apotheke in den Weg zum Kirchplatz einbog und sich neben das Kriegerdenkmal auf eine Bank setzte. Er sah den Pfarrer eiligen Schrittes vorbeilaufen und in seinem Pfarrhaus verschwinden. Die Schule war wohl an diesem Tag schon früher aus als sonst, denn Schulkinder rannten auf den Kirchplatz und spielten dort Fußball, andere von ihnen gingen in den Supermarkt von Alfons Disch und kauften sich dort ein Eis. Peter Rohrmoser kam auf seinem Rollstuhl angefahren, sein Vater schob ihn zu Rösch, wo sich die ganze Familie draußen hinsetzte, als auch die beiden Stegmüllers erschienen und sich dazusetzten.
Und um die Gruppe zu vervollständigen, erschienen auch die Wirtsleute aus der „Sonne“, die beiden hatten keine Probleme damit, sich zu der Konkurrenz zu setzen.
Vermutlich war es so, dass sie sich dort alle als Bürgerinitiative trafen und über die Ortsumgehung sprachen. Der Glen beobachtete das Geschehen auf dem Kirchplatz und dachte, dass er in dem Ort fehl am Platze war, er war ja auch nirgends willkommen, und niemand redete mit ihm. Nach kurzem Überlegen fasste er den für sich wichtigen Entschluss, das Dorf am Abend zu verlassen und seinen Eltern einen Abschiedsbrief in den Briefkasten zu stecken, in dem er seine Gründe für sein Weggehen darlegen wollte. Er hatte dieses Vorhaben ja schon lange geplant, es nur nicht mutig genug durchgeführt, doch in diesem Moment war er sich sicher, auch den letzten Schritt zu gehen. Das war schon etwas Besonderes, wenn jemandem die Gelegenheit geboten wurde, sein Leben gegen ein anderes eintauschen zu können, das triste Dasein seines gewohnten Alltags gegen ein erfülltes Leben in Glück, Zufriedenheit und Achtung austauschen zu können. Der Glen dachte, dass ihm das Leben in Kregelbach keine Perspektive böte, und selbst wenn er nach Irmstadt oder nach Waltershausen ginge, was sollte er dort tun? Einen Beruf, mit dem er Geld für sich verdienen könnte, hatte er nicht, er wäre auf unabsehbare Zeit auf Leistungen des Sozialstaates angewiesen und das war keine schöne Aussicht für ihn. Auch wollte er seinen Eltern nicht länger zur Last fallen, sie wurden langsam älter und sie verließen die Kräfte, die sie bis dahin für ihren Sohn gebraucht hatten. Aber der Glen fühlte auch so etwas wie eine tiefe Sehnsucht, ein Gefühl, das er noch nie kennen gelernt hatte, es war die Sehnsucht nach Tola, einem Mädchen, das er anbetete, dem er hoffnungslos verfallen war.
In Kregelbach ein Mädchen kennen zu lernen, war für den Glen praktisch vollkommen aussichtslos, das lag zum einen daran, dass es in dem Dorf kaum Mädchen gab und zum anderen, dass der Glen nicht unbedingt dem gängigen Schönheitsideal entsprach. Dinge, die bei den Argin keine Rolle spielten, dort zählte weniger das Aussehen, sie sahen ja alle gleich aus, sondern vielmehr das, was der Einzelne zu leisten im Stande war, und das hatte der Glen doch mit der Rettung Tabors gezeigt, was er zu leisten im Stande war. Aber es gab da ja auch noch das völlig Andersartige, das der Welt der Argin anhaftete und das sie von den Menschen unterschied. Da waren die Unbeschwertheit, die Friedlichkeit und die Zufriedenheit, Dinge, die der Glen so in dieser Ausprägung wie bei den Argin noch nie erlebt hatte. Der Glen stand auf und lief mit einem Abschiedsblick auf den Kirchplatz nach Hause zurück, aber es musste kein endgültiger Abschied sein, er könnte jederzeit aus dem Arginreich nach Kregelbach kommen und zum Beispiel nach seinen Eltern sehen, allerdings täte er das inkognito. Doch zunächst galt es, den Abschiedsbrief zu schreiben, den er seinen Eltern zurücklassen wollte und er ging auf sein Zimmer und setzte sich an seinen Schreibtisch. Was sollte er seinen Eltern schreiben, ohne dass sie sich über seinen neuen Aufenthaltsort zu sehr sorgten, wie sollte er in Worte fassen, was er für seine Zukunft geplant hatte?
Er saß lange an seinem Schreibtisch und schaute zum Fenster hinaus, er beobachtete wie sich ein Schwarm von Staren in der Luft immer wieder neu formierte, um danach geschlossen in eine Richtung fortzufliegen. Der Glen schrieb schließlich:
„Liebe Eltern, macht Euch keine Sorgen, wenn ich für immer fortbleibe, ich bin an einen Ort gegangen, an dem es mit gut geht und wo ich Glück und Zufriedenheit erfahre, ich wünsche Euch Gesundheit und Wohlergehen, ich denke an Euch, Euer Andreas.“ Daraufhin packte er ein paar Sachen in seinen Rucksack und legte seinen Laptop zurecht. Er wartete, bis es 19.30 h war und verließ, sein Zimmer und sein Elternhaus für immer. Draußen vor der Tür öffnete er den Briefkasten und steckte den Brief durch den Schlitz. Danach lief er über die Wendlerbachbrücke, überquerte die Hauptstraße und ging bis zum Heligenhäuschen hoch, dort drehte er sich um und warf einen letzten Blick auf sein Dorf. Es war ein friedlicher Blick, der sich ihm bot, fast sah es so aus wie das Gemälde eines Romantikers, das Dorf, die Kirche, das Wendlerbachtal, die Berge. Aber er weinte dem Dorf keine Träne nach, sein Leben war bis dahin in dem Dorf kein Honigschlecken gewesen und er freute sich auf das, was ihn erwartete. Der Glen lief in den Tannenwald, der ihn in sich aufnahm, dessen große Bäume ihn mit ihren riesigen Ästen zu ergreifen und nicht mehr loszulassen drohten. Aber der Glen stieg unbeirrt bergan und bückte sich unter den Ästen hindurch, manche schob er mit einer beherzten Handbewegung zur Seite. Plötzlich sah er eine Waschbärenfamilie über den Weg huschen, als wollte sie ihn auf die Argin einstimmen, die sich die Waschbären als Haustiere hielten.