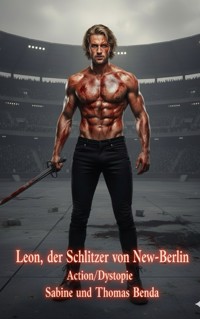4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schreiend erwachte Constance aus ihrem Traum. Georgina W. Washington, die neben ihr im Hotelzimmer in New Orleans lag, schreckte ebenfalls hoch. "Mensch, beruhige dich!", sagte sie und nahm die Schluchzende in den Arm. "Es war nur ein blöder Traum." "War es nicht! Sie konnte mich sehen!" "Wer konnte dich sehen?" "Diese Mama Polly, damals, in Louisiana! Sie … sie wusste, dass ich da bin … in meinem Traum!" Georgina schluckte einen Kloß weg. "Constance … du machst mir echt Angst."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sabine und Thomas Benda
Big House: Dunkle Rache
Ein fesselnder Mystery-Thriller unter der heißen Sonne Louisianas.
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Big House: Dunkle Rache
Prolog
1. Louisiana
2. Besuch vom Vater
3. Es lässt mich nicht los!
4. Big House
5. Ding-Dong
6. Wo man den Schlüssel hineinsteckt
7. Die ausgesprochene Wahrheit
8. Ein sehr eigenwillig formuliertes Testament
9. Die Heimat
10. Louisiana-Moos
11. Post-A-Bike
12. Wer ist es?
13. New Orleans
14. Mama Polly
15. Der Mantel
16. Hautfarbe und Herkunft
17. Die Sache mit dem Ohrring
18. Das Double-Comfort
19. Lästerlippen
20. Bist du überhaupt gläubig genug, Horatio?
21. So übel ist sie gar nicht
22. Nackte Tatsachen, Nachdenkliches und nächtliches Treiben
23. Es wird besser werden
24. Henry Willis und Homer Bones
25. Die Liste
26. Das ist alt
27. Blöd ist anders
28. Immobilienbüro Morrison and Sister
29. Grill House
30. Heute und jetzt
31. Aufgeschnitten
32. Vollmondgefühle
33. Sex
34. Der Sheriff
35. Das Geständnis
36. Der perfekte Tag
37. Küchentratsch
38. Verwandtschaftsbesuch
39. Dialog am Morgen
40. Blutlinien
41. Stinkende Flatulenz
42. Der Besuch der Auswärtigen
43. Jetzt wird‘s Zeit!
44. Wir müssen reden
45. Ganz viel Wasser
46. Hitziges und nächste Schritte
47. Bürden
48. Es gibt keine Besseren
49. Sheriff Middles Einfall
50. Der Käfig
51. Die Fotografie
52. Der letzte Ständer
53. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt
54. Power-Chox und Rooibos
55. Ausradiert
56. Des Pudels Kern: Etwas kommt ans Tageslicht
57. Feierabend
58. Der Abschied
59. Vorbereitungen
60. Die Sache mit der Stricknadel
61. Eine gravierende Tatsache
Epilog
Über die Autoren:
Impressum neobooks
Big House: Dunkle Rache
Mystery-Thriller
Sabine & Thomas Benda
IMPRESSUM
© 2025 Sabine Benda, Thomas Benda
Korrektorat und Lektorat: Sabine Benda
Coverdesign: Sabine Benda
Sabine und Thomas Benda
Josef-Schemmerl-Gasse 16
A-2353 Guntramsdorf
E-Mail: [email protected]
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Hinweis der Autoren: Unsere Bücher sind nur für Erwachsene geeignet!
23.08.2025
Prolog
2017
Der Wecker spielte die Instrumentalversion der Nationalhymne, und Georgina W. Washington rieb sich verschlafen die Augen. Sie musste sich sputen, denn die Vorlesung bei Professor Kellerman war schon um 10:00 Uhr. Als angehende Journalistin wollte sie nichts versäumen, was mit Kellerman und seinen geistreichen Vorträgen zu tun hatte.
Georgina putzte sich die Zähne, nahm ein schnelles Frühstück zu sich und radelte eine Viertelstunde später Richtung Universität.
Nachdem sie ihr Fahrrad angekettet hatte, nahm sie immer drei Stufen auf einmal in das Gebäude. Andere Studenten ließ sie links liegen oder sie kamen ihr entgegen.
Das Schwarze Brett, schoss ihr ein Gedanke durch den Kopf, denn die junge Frau suchte einen Job, da das Leben in New York City nicht gerade billig war.
Weibliches Model für seriöse Aktmalerei gesucht – diese Anzeige sprang ihr förmlich ins Auge. Daneben stand eine Handynummer mit dem Namen: Constance Mercier.
Des Nachmittags stand Georgina W. Washington vor einem Backsteingebäude in einer netten Seitenstraße der City. Auf dem Klingelknopf vor ihr stand der Name: Constance Mercier. Sie klingelte, und wenige Sekunden später hörte sie eine Frauenstimme aus der Sprechanlage fragen: »Ja, wer ist da?«
»Hallo, Miss Mercier«, antwortete Georgina in einem charmant klingenden Tonfall. »Mein Name ist Georgina W. Washington. Wir haben miteinander telefoniert. Ich komme wegen der Aktmalerei.«
1857
Sina, die Sklavin, rannte. In ihrer linken Hand hielt sie das silberne Besteckmesser, von dessen Klinge Blut auf den Teppichboden tropfte. Die nackte Sklavin hörte die johlenden Männer, wie sie sich gegenseitig anfeuerten, sie zu finden. Sie hetzte die breite Treppe zur Eingangshalle hinunter. Blut triefte an ihren Schenkeln in wirren Bahnen entlang, während sie keuchend die Stufen nach unten hetzte. Auf halber Treppe kam ihr Spencer, einer der Diener, entgegen. Der Mann versperrte ihr den Weg. Sina blieb stehen. Ihre Augen trafen sich.
»Es hat keinen Sinn, sich dem Master zu widersetzen, das weißt du«, riet er ihr wohlwollend. Dennoch schien er bereit zu sein, sie zu packen. Oben hörte man die trampelnden Männer, die sie suchten. Türen knallten.
Die junge Frau streckte das Messer von sich und richtete es auf den Diener. »Spencer, lass mich vorbei! Der Master und seine Freunde werden mich schänden, wenn sie mich zu fassen bekommen. Sie deutete auf das Blut an ihrem Unterleib. »Das hat mir der widerliche Pfaffe angetan!«
Spencer weitete die Augen. »Pater Morrison? Du redest Unfug, Sina! Er ist ein Mann Gottes. Niemals würde er sich an einem Weibe vergreifen – und an einer Schwarzen schon gar nicht!«
Sina brüllte: »Gerade weil ich schwarz bin, scheint der Pfaffe vergessen zu haben, wer er ist. Morrison denkt weniger an Gott als an seinen eigenen stinkenden Schwanz!«
»Flucht ist kein Ausweg!«, beharrte der Diener. »Die Häscher werden dich finden. Es macht alles nur schlimmer. Erdulde es lieber …«
»Bist du des Teufels?«, herrschte sie ihn an.
»Da unten ist sie!«, rief einer der Männer, die Sina verfolgten.
Sina geriet in Todesangst und wollte an Spencer vorbei, der ihr noch immer den Weg versperrte. Er hielt sie am Arm zurück. Sie stieß mit dem silbernen Messer zu und traf mit der Klinge seinen Bauch. Der Diener blickte entsetzt. Dann sackte er schreiend zu Boden.
»Sie hat den Diener getötet!«, hallte der Satz durch das Big House des Plantagenbesitzers.
Sina riss das Messer aus dem sterbenden Mann. Tränen schossen ihr in die dunkelbraunen Augen. »Es ... es tut mir leid …«, flüsterte sie.
Dann floh sie aus dem Eingangsbereich des Herrenhauses in die schwüle Nacht hinaus.
Die Felder, dachte die junge Sklavin gehetzt beim Rennen. Dort kann ich mich vor ihnen verstecken!
Sina rannte.
Die Männer, sieben an der Zahl, versammelten sich um den niedergestochenen Diener.
»Mein Gott, der Mann verblutet«, sagte einer von ihnen, der Willis hieß und ein Stadtrat war.
»Wir können nichts mehr für ihn tun«, sagte Adam Erasmus Mercier, dem das Big House und die dazugehörigen Baumwollplantagen gehörten.
»Unsinn, er lebt noch!«, meinte Pater Morrison.
»Dann sag ihm schnell tröstende Worte, Herbert!«, herrschte ihn der Plantagenbesitzer an. »Das fotzige Weibsstück darf uns nicht entkommen!«
Später verteilte er Gewehre an seine Freunde und wies einige Aufseher an, die Jagdhunde zu holen.
Der Mond schien hell über den Baumwollfeldern … und Sina rannte um ihr Leben.
1. Louisiana
Die Wärme der Mittagssonne und das satte Tiefblau des wolkenlosen Himmels irritierten sie. Kein Windhauch war zu spüren, rein gar nichts. Das war seltsam. Die junge Frau, deren golden glänzendes Haar die bloßen Schultern wie ein zärtlicher Wasserfall bedeckte, blickte an sich herab.
Erstens: Wo stehe ich hier? Und zweitens: Wieso habe ich nichts an? Das ist mehr als peinlich!
Constance Mercier verstand die Welt nicht mehr – eben noch in ihrer teuren Loft-Wohnung in New York City mit ihrem schnuckeligen One-Night-Stand, einer bezaubernden Asiatin namens Nicky, an der Seite, und nun?
Wenn das ein Traum ist, dann ist es ein verdammt realistischer! Sie schaute sich um. Und was sind das hier für seltsame Pflanzen voller weißer Watte? Richtig: Baumwolle! Klasse, ich stehe nackt in einem Baumwollfeld! Die 28-jährige malende Künstlerin, die seit geraumer Zeit versuchte, mit ihren Werken in Öl und Acryl in der Millionenmetropole mehr schlecht als recht Fuß zu fassen, hatte als eisern bekennende Städterin schon vieles erlebt und gesehen. Ungekämmte Baumwollfasern, die pflückbereit warteten, gehörten jedoch nicht dazu. Das einzig Pflanzliche, mit dem sie sich bisher beschäftigt hatte, waren frische Salate oder selbstgedrehte Joints bei irgendwelchen schummrigen Partys von gleichgesinnten Kreativen der Szene. Heute Abend hatte sie dort die attraktive Nicky kennengelernt und mitgenommen.
Heute Abend?Jetzt stehe ich in der prallen Mittagssonne, die mir glitzernde Schweißperlen aus der zarten Haut treibt! Also: Wo ist mein geliebtes Manhattan hin? Wo ist mein grüner Central Park? Wo ist die niedlich blank rasierte Scham von Nicky? Was soll das hier? Wache ich bald auf und lache darüber?
Ein satter Knall ließ die Frau zusammenzucken. Raben spritzten aus den Baumwollpflanzen in die Höhe und zogen schimpfend davon. Wieder knallte es.
Gewiss kein Schuss, weder Pistole, Revolver noch Gewehr!
Die blonde Frau erkannte dies sofort, da sie seit ihrer Volljährigkeit in einem elitären Schießclub Mitglied war, der von ihrem Vater, einem Multimillionär der New Yorker High Society, geleitet wurde.
Erneut war das Knallen zu vernehmen.
Nein, so klingt nichts, was einen Lauf verlässt! Viel zu leise, dennoch … nicht ungefährlich!
Sie beschloss, dem knallenden Geräusch zu folgen, wollte in ihrem Traum unbedingt herausfinden, um was es sich dabei handelte.
Die Baumwollfasern liebkosten ihre nackten Schenkel, während sie behutsam durch die weißen Reihen wandelte. Die körnige Erde pikste bei jedem Schritt in ihre schuhverwöhnten Fußsohlen.
Wann bin ich das letzte Mal barfuß gelaufen?
Constance hatte es schon als kleines Kind vermieden, in den Hamptons im blütenreichen Anwesen ihrer Eltern ohne Schuhe zu laufen. Natur war für die New Yorkerin etwas, das sie sich gerne im Fernsehen zum Entspannen anschaute.
Es ist der blanke Hohn, dass ausgerechnet ich einen solchen Traum habe!
Unversehens endete das Baumwollfeld und sie blickte eine kleine grüne Anhöhe hinauf. Einige Schafe fraßen dort gemütlich saftig aussehende Grashalme. Sie kauten eintönig und beachteten die nackte Frau nicht, ließen sich scheinbar durch nichts aus der Ruhe bringen.
Habe ich jemals Schafe in Wirklichkeit gesehen?
Constance kamen die putzigen Enten in den Sinn, die im Sommer am Ufer von The Pond watschelten, diesem kleinen See im Central Park, den man von der 59. Straße aus sehen konnte.
Das Knallen unterbrach ihre Gedanken. Diesmal schrie jemand kurz schmerzvoll auf. Augenblicklich ahnte Constance, was sie da hörte, aber noch nicht sehen konnte. Die Ahnung ließ Furcht in ihrem pochenden Herzen erwachen. Das Gefühl fraß sich rasend schnell durch ihren nackten Leib.
Da wird jemand ausgepeitscht! Der Stimme nach … ein Mann!
Einem inneren Drang folgend hetzte die blonde Frau die Anhöhe hinauf.
Wann bin ich je einen Hügel hinaufgerannt?
Sie dachte absurderweise an die Anmeldung in einem Fitnessstudio in der City, die sie monatlich verschob und für die sie immer wieder eine weitere wackelige Ausrede fand.
Constance keuchte ziemlich, als sie mit Seitenstechen oben ankam und eine Ansammlung von Holzhütten erblickte, die um ein heruntergekommenes Farmhaus standen.
Weiter weg konnte sie ein riesiges Herrenhaus mit Veranda und prachtvollen weißen Säulen erkennen.
Ich bin eindeutig in den Südstaaten! In dieser gottverdammten Zeit vor dem Bürgerkrieg! Oh God bless America … and me!
Dann erkannte sie eine Gruppe von zusammengeketteten Sklaven, die auf dem staubigen Boden um einen Holzpfahl hockten, an dem ein blonder Jüngling festgebunden war, der von einem schnauzbärtigen Mann in Hemdsärmeln ausgepeitscht wurde. Dem Hemdsärmeligen konnte man seine sadistische Wesensart deutlich ansehen. Er hatte eine dünne Lederpeitsche in der rauen Prankenhand, die er schwungvoll ausholte und auf den breiten, zerschundenen Männerrücken des Blonden niederzischen ließ.
Das Knallen der Bestrafung zerriss die schwüle Luft. Der Mann am Stamm schrie, als das Leder seine Haut blutig zerfetzte. Lange würde er die gnadenlose Tortur nicht mehr durchhalten können, das war klar.
Constance, die in ihrem Traum von keinem Menschen beachtet wurde, hörte Hufgetrampel, das rasch näherkam. Sie blickte in die Richtung. Vom Herrenhaus kommend galoppierte ein muskulöser Rappe, auf dessen Rücken eine blonde junge Frau in einem weißen Sommerkleid hockte und eine Gerte in der Hand hielt. Schon von weitem brüllte sie: »Parker! Hören Sie sofort damit auf!«
Das schwarze Pferd wieherte und bäumte sich kurz strampelnd auf, als die Frau ankam. Sie sprang behände vom Rücken des Rappen und raste wie eine Furie auf den Mann mit der Peitsche zu.
»Ich befolge nur Anweisungen, Lady Beverly. Ihr Vater hat mir …« Im nächsten Moment wurde er von zwei Hieben der Reitgerte unterbrochen, die in sein schwitziges Gesicht sausten. Im Zorn schlug sie ein drittes Mal zu. Parker ließ daraufhin seine Peitsche fallen. Einige Sklaven verfolgten mit großen Augen der Verwunderung das Schauspiel, das sich ihnen bot. Eine Herrin züchtigte einen Aufseher. So etwas sah man nicht alle Tage. Nein, eigentlich bekam man so etwas niemals zu sehen.
Lady Beverly herrschte Parker an, der seine Striemen auf den Wangen mit seinen Fingerspitzen befühlte. »Und nun mach meinen Bruder los, ehe ich völlig vergesse, dass ich eine Lady bin!«
Mit finsterem Blick zog der schnauzbärtige Aufseher ein Messer, das an seinem Gürtel steckte, und begegnete den Augen der entschlossenen jungen Frau.
Angespanntes Schweigen erfüllte die dramatische Szenerie zu dieser Mittagszeit.
Dann schnitt Parker den blonden Jüngling am Holzstamm los, der sofort stöhnend auf die Knie sackte. Beverly kniete sich zu ihrem Bruder hinunter und half ihm, sich aufzusetzen.
»Ich … ich danke dir, Schwesterherz«, stöhnte er. »Vater … Vater wird toben, wenn er erfährt, was du getan hast.«
»Keine Sorge, Joshua«, tröstete ihn Beverly. Schließlich schaute sie den Aufseher an. »Wie viele Peitschenhiebe sollte er erhalten?«
Parker senkte reumütig den Blick. »Zwei Dutzend, Lady Beverly. Das war die Anweisung des Masters.«
Beverlys blaue Augen schauten streng. »Wie viele davon hat Joshua schon ertragen müssen?«
»Neun Hiebe«, antwortete der Mann. »Ich werde Ihrem Vater melden müssen, dass …«
Die Lady hob ihre Gerte hoch und zeigte auf den Aufseher. »Du wirst meinem Vater berichten, dass du die Bestrafung ordentlich in der vorgegebenen Anzahl durchgeführt hast.«
Parkers wettergegerbtes Antlitz zeigte Furchen des Entsetzens. Er flehte fast: »Wenn er erfährt, dass ich ihn belogen habe, wird seine Wut gegen mich gnadenlos sein, Lady Beverly!«
Beverly schaute ihn kalt an. »Wenn du ihn nicht belügst, wirst du deines Lebens nicht mehr sicher sein! In ganz Louisiana findet sich in diesen Tagen immer irgendein nichtsnutziger Handlanger für einen preiswerten Meuchelmord.«
Der Aufseher nickte.
»Und jetzt komm und hilf mir, meinen Bruder zu versorgen! Seine Wunden müssen gesäubert und verbunden werden.«
»Louisiana!«, schrie Constance Mercier, als sie aus dem Traum erwachte.
Eine verschlafen wirkende Asiatin, die neben ihr auf dem breiten Bett lag, schaute sie verwundert an. Es war Nicky, Constances Bettgespielin für diese Nacht.
»Wow, hast du mich erschreckt! Was träumst du für einen Mist?« Nicky deutete durch das Dachfenster der Loft-Wohnung. Im Hintergrund konnte man Hochhäuser bei Nacht erkennen.
»Wir sind nicht in den Südstaaten – das ist Big Apple!«, sagte sie heiter. »Ganz sicher, Süße!«
Constances Herz pochte ihr bis zum Halse. Vor ihrem inneren Auge konnte sie noch immer das blonde Geschwisterpaar sehen, diesen ausgepeitschten gutaussehenden Joshua und seine mutige, wunderschöne Schwester Beverly. Das Gefühl der Vertrautheit, das dabei in ihr erwuchs, konnte sie sich nicht erklären. Noch nicht.
2. Besuch vom Vater
Der Rolls-Royce fuhr an den Gehsteig heran.
Geoffrey Mercier, der gutgelaunt auf der Rückbank saß, wischte über das Display des Tablets und studierte die neuesten Bilanzen. Das laufende Geschäftsjahr 2017 übertraf seine Erwartungen. Auch der Aktienkurs seines Technologieunternehmens DIGIT-BETTER wies nicht die minimalsten Einbrüche auf.
»Sir, wir sind angekommen«, informierte ihn Hastings, der Chauffeur.
»Danke, Hastings! Ich werde eine Stunde bei meiner Tochter bleiben. Sie können inzwischen Mittagspause machen.« Der Geschäftsmann blickte auf seine teure Schweizer Armbanduhr. »Holen Sie mich um 01:00 Uhr ab. Gegen 01:30 Uhr habe ich einen Termin in der Hauptfiliale.
»Sehr wohl, Sir!«, entgegnete der Chauffeur. »Beste Grüße an Constance!« Hastings hatte Constance schon als Kindergartenkind durch Manhattan chauffiert.
»Werde ich gerne ausrichten.«
Geoffrey Mercier richtete seinen Krawattenknoten und fragte: »Wird’s so gehen, Hastings?«
Der Chauffeur schmunzelte. »Hat Constance Ihnen beim letzten Mal wieder unerwünschtes Feedback gegeben?«
Geoffrey nickte. »50 muss man werden, um von seiner erwachsenen Tochter wegen Farbzusammenstellungen bei der Kleidung kritisiert zu werden.«
»Meine Mary ist ebenfalls so. Also, ich kann an dem Knoten und an der Farbwahl nichts aussetzen, Sir.«
»Wir Männer sind uns immer schnell einig. Doch wie wird das wohl die Frau Künstlerin bewerten?«
»Sie liebt Sie, Sir! Und Sie lieben sie! Keine zu locker gebundene Krawatte mit zweifelhaftem Muster kann so eine Vater-Tochter-Basis zerstören.«
»Aha, Sie denken also doch, dass die Farbe nicht zu meinem Anzug passt? Ja?«
»Nun … ich würde ein Männerauge zudrücken.« Er deutete auf seinen eigenen Schlips, der dunkelblau war. »Meine Krawatte passt eine Spur besser zu Ihrem Anzug.«
»Macht es Ihnen was aus?«
»Nein, natürlich nicht, Sir«, entgegnete der Chauffeur, und die beiden Männer tauschten rasch ihre Krawatten.
»Perfekt!«, sagte Hastings. »Und nun viel Spaß bei Ihrer Tochter!«
Geoffrey Mercier stieg aus und zog sich seine Anzugjacke glatt. Dann stieg er die drei Stufen hinauf.
In welch ursprünglicher Wohngegend die Kleine doch wohnt – typisch Künstlerin!
Schließlich betätigte er den Klingelknopf an dem roten Backsteinhaus.
»Oha, endlich hast du mal Geschmack bei deinen Krawatten bewiesen, Dad!«
»Ja, auch reiche Leute lernen noch«, bemerkte er schmunzelnd und umarmte sie.
»Mmmh, du duftest gut«, lobte die Blondhaarige und zwinkerte ihrem Vater verschwörerisch zu. »Kenne ich sie?«
»Immer willst du mich verkuppeln«, beschwerte er sich.
»Mom wollte es doch so!«, stellte Constance klar. »Sie hat es sogar ausdrücklich in ihrem Testament erwähnt. Nach ihrem Tod sollst du wieder ein glücklicher Mann werden. Das schließt Beziehungen mit ein. Und Mom ist seit zehn Jahren tot. Zudem bist du noch in einem akzeptablen Alter für die Lady ab 40 aufwärts. Kohle hast du auch. Also, wie heißt sie?«
»Sandra.«
Constance stutzte. »Klingt jung. Oh Gott, sie wird doch nicht jünger als ich sein, oder?«
»Sandra ist 45«, beschwichtigte der Vater die Tochter. »Sie ist Anwältin.«
»Dein Typ?«
»Mein Typ.«
»Also attraktiv, kurvenreich – und mit stabilen finanziellen Mitteln?«
»Alles abgecheckt«, bestätigte Geoffrey. »Ich habe sie zufällig auf einer Wohltätigkeitsgala kennengelernt – und sie gründlich durchleuchten lassen. Sie ist nicht auf mein Geld aus, garantiert.«
Die Blondhaarige schnaufte absichtlich theatralisch und lachte. »Okay, ich dachte schon, dass mein Erbe in Gefahr sei!«
Der Vater schaute sich in dem Maleratelier um, das sich in einer sonnenlichtdurchfluteten Ecke von Constances Loft-Wohnung befand. »Sehr schöne Bilder. Verkaufst du auch etwas – oder malst du nur?«
»Ein Galerist ist an meinen sinnlich stimmenden Akten interessiert. Ansonsten … gehen die Geschäfte so blendend schlecht wie bei fast allen namenlosen Künstlern, die im Big Apple ums tägliche Überleben kämpfen müssen.«
»Gut, dass du einen reichen und verständnisvollen Vater hast.«
»Gut, dass ich einen superlieben Vater habe. Mit meiner Kohle komme ich schon klar, Dad. Willst du einen Single Malt?«
»Huch, es ist noch nicht mal Mittag, Kleines.«
Die Tochter spitzte die Lippen. »Ach, spielt jetzt bei Whiskey die Tageszeit eine Rolle?«
»Normalerweise schon. Bitte nur zwei Finger breit – ohne Eis, ohne Wasser.«
»Dad«, schmunzelte sie. »Ich bin keine Barkeeperin. Ich kenne dich seit 28 Jahren.«
Constance bereitete die Whiskeygläser vor.
Der Vater nahm sein Glas. Sie prosteten sich zu.
»Am Telefon sagtest du mir«, kam er zum Thema, »dass du mich etwas Familiäres fragen möchtest. Was ist es, Schatz?«
Die Tochter druckste ein wenig herum. »Etwas … worüber du nicht gerne sprichst, aber es hängt mit einem Traum zusammen, den ich hatte.«
»Mit einem Traum?«
»Ja, Dad, und ich weiß, dass dir meine Frage nicht gefallen wird, weil sie unsere düstere Ahnen-Vergangenheit betrifft.«
Geoffrey Mercier atmete tief durch. »Du meinst …?«
»Ja, ich spreche von den Südstaaten … von Louisiana … während dieser ganz abscheulichen Zeit damals.«
3. Es lässt mich nicht los!
Inzwischen war es Nachmittag geworden. Eine Zeit, in der das Tageslicht in der Atelier-Ecke der Loft-Wohnung nicht mehr optimal war.
Constance Mercier blickte auf die Leinwand auf der Staffelei. Bis auf die paar Skizzenstriche, die sie vor Stunden mit einem Kohlestift gemacht hatte, war nichts zu sehen. Eigentlich hatte sie eine Landschaft malen wollen. Nein, keine Landschaft, sondern ein endloses Baumwollfeld mit einer nackten Frau. Ihr Traum hatte sie inspiriert, doch irgendwie war der kreative Funke nicht übergesprungen. Constance beschloss, es für heute sein zu lassen, und steuerte den Kaffeeautomaten in ihrer Küche an. Während sie sich einen Cappuccino zubereitete, fiel ihr Blick auf die beiden benutzten Whiskeygläser auf der Küchenzeile. Das Gespräch mit ihrem Vater war stockend verlaufen. Wirklich Neues hatte sie nicht erfahren können. Wie immer war es ihm unangenehm gewesen, über seine Vorfahren vor dem Bürgerkrieg zu sprechen. Heute hatte Constance zum ersten Mal erfahren, dass dieser Adam Erasmus Mercier, ein durch und durch patriarchischer Plantagenbesitzer und ein tyrannisch veranlagter Mann gewesen war. Ein herrischer Kerl, der nicht nur seine bedauernswerten Sklaven und schlecht bezahlten Bediensteten, sondern auch seine Familie entsprechend streng behandelt hatte. Constance schauderte bei dem Gedanken, dass ein wenig Blut dieses ekelhaften Mannes durch die Adern ihres gutherzigen Vaters und durch ihren eigenen emanzipierten Frauenkörper floss.
Verständlich, dass Daddy das Thema gerne umgeht! Über einen brutalen Sklavenhalter in der Ahnenreihe spricht man nicht gerne! Schon gar nicht, wenn man ein angesehener Geschäftsmann und Multimillionär ist, der auf Wohltätigkeitsveranstaltungen und auf der politischen Ebene der New Yorker High Society ein gerne gesehener und sehr respektierter Mann ist!
Im Internet standen sehr wenige Informationen über die Familie Mercier in Louisiana.
Daddy hat bestimmt brisante Details löschen lassen!Er hat den Einfluss hierzu, ganz gewiss! Außerdem hat er endlos viele hochqualifizierte Spezialisten aus aller Welt in seinem Technologieunternehmen beschäftigt!
Constance hatte ihrem Vater Geoffrey von dem eindringlichen Traum erzählt. Es hatte ihn sichtlich erstaunt. Allerdings hatte er das Thema schnell abgehandelt und ihr den Rat gegeben, die Vergangenheit ruhen zu lassen, besonders dann, wenn etwas über 160 Jahre her war.
Sicherlich will er mich vor irgendetwas bewahren!Oder möchte er etwas geheim halten?Vielleicht beides?
Die Frau runzelte nachdenklich die glatte Stirn, erinnerte sich, dass schon zu Lebzeiten ihrer an Krebs verstorbenen Mutter die alten Südstaaten-Geschichten kaum erwähnt worden waren. Als Kind hatte man Constance ein klein wenig davon erzählt. Nein, nicht erzählt, eher vage angedeutet und schnell verdrängt. Sie nippte am Cappuccino, wollte die nebulöse Vergangenheit gedanklich zu den Akten legen.
Ich bin eine moderne Frau des 21. Jahrhunderts und lebe im Herzen von New York City! Die damaligen Südstaaten können mir gestohlen bleiben – und die jetzigen ebenfalls! Und warum sollte ich mich mit diesen verstaubten und versteinerten Familiengeschichten beschäftigen?
Dennoch ließ Constance dieser Louisiana-Traum nicht mehr los, und sie ahnte, dass dieser ausgepeitschte Joshua und seine temperamentvolle blonde Schwester, diese Lady Beverly, bestimmt Ahnen von ihr waren. Doch weshalb träumte sie von ihnen, obwohl sie von beiden noch nie etwas gehört hatte?
Der Türsummer summte, ließ die Bilder von den schönen blonden Geschwistern wie Seifenblasen zerplatzen. Constance sah auf die Kuckucksuhr, die neben dem Kühlschrank an der Wand hing. Sie hatte diese nicht-amerikanische, analog funktionierende Kuriosität mit dem bisweilen nervigen Holzvögelchen hinter dem Türchen und diesen eindrucksvollen Gewichten in Tannenzapfenform bei einer Europa-Reise vor wenigen Jahren erstanden. Sie bildete sich hin und wieder stolz ein, dass es nicht viele Künstlerinnen im Big Apple gab, die solch eine solide Handarbeit aus dem fernen deutschen Schwarzwald mit Echtheitszertifikat besaßen.
Wieder summte es monoton an der Eingangstür.
Großer Gott – heute ist Dienstag!
Ihr wurde es siedend heiß. Gleichzeitig war sie verärgert über ihre Nachlässigkeit.
Ich habe Georgina vergessen!
Schnell rannte Constance zur Tür und betätigte die Sprechanlage.
»Hallo, wer ist da?«, fragte sie, obwohl sie es ahnte.
»Sag mal, pennst du?«, fragte eine rauchige Frauenstimme barsch. »Lass mich endlich rein! Hier sind ein paar Kappenträger auf der Straße, die haben eindeutig unkeusche Absichten!«
»Will ich nicht wissen – und bitte bring keinen mit!«, unterbrach Constance sie heiter. Dann drückte sie den Türöffner. »Komm hoch!«
Ich habe 30 Sekunden – sie ist gut zu Fuß!
Constance checkte ihr Aussehen im Spiegel ab.
Himmel, ich habe Kohlestift am Kinn!
Sie wischte die feine Schmutzspur rasch weg, ordnete ihr blondes Haar und ihren Busen im Büstenhalter, zog das Lippenrot nach und freute sich auf Georgina W. Washington.
4. Big House
Herbert Morrison, ein aristokratisch wirkender Immobilienmakler mit Stirnglatze, ließ sich seine innere Freude nicht anmerken. In den letzten Jahren war es selten vorgekommen, dass er ein so lukratives Geschäft in dieser Größenordnung abgeschlossen hatte, doch der Verkauf des prachtvollen Herrenhauses, das historisch betrachtet ein sogenanntes Big House war, stimmte ihn mehr als glücklich. Bei der fünfstelligen Maklerprovision, die er dafür bekam, gab es keinen Grund zur Unzufriedenheit. Lange hatte Morrison einen geeigneten Käufer gesucht und schließlich in dem Millionärssohn Horatio Heaven finden können. Heaven, ein attraktiver, schwarzhaariger Dreißiger mit einem Winner-Lächeln zum Wegschmelzen, hatte sich trotz des Familienreichtums einen eigenständigen Namen als Fotomodel für Herrenunterwäsche gemacht. Es gab sicherlich keine Frau zwischen der Ost- und Westküste der Vereinigten Staaten, die nicht beim Anblick seines durchtrainierten Körpers sehnsüchtig seufzen würde.
Der Makler und der Millionärssohn saßen in Rattansesseln auf der frisch restaurierten Rundum-Veranda des Hauses und genossen die Aussicht auf das gepflegte Anwesen. Vor ihnen auf einem runden Beistelltisch mit einer weißen Marmorplatte standen zwei Gläser mit eisgekühlter Zitronenlimonade, daneben lag der 30-seitige Verkaufsvertrag.
Einige Handwerker, die im Inneren des Hauses mit Sanierungs-, Umbau- und Restaurierungsarbeiten beschäftigt waren, unterhielten sich lautstark. Eine rothaarige Frau schien es sich herauszunehmen, ihnen Anweisungen zu erteilen, denen sie missmutig nachgingen. Von einer Städterin nahmen die einheimischen Männer ungern Befehle entgegen. Dementsprechend sahen ihre langen Gesichter aus.
»Oha«, schmunzelte Morrison fast schon übertrieben. »Ich gehe beim Tonfall Ihrer Verlobten davon aus, dass sie in einer Führungsposition arbeitet.«
»Nein, sie ist nur schön anzusehender Schall und Rauch«, witzelte Horatio Heaven. »Tanya ist die Tochter eines betuchten Senators. Beruflich hat sie sich noch nicht entschieden, außer dass sie ihr Medizinstudium abgebrochen hat.« Verschwörerisch flüsternd hängte er an: »Ihr wurde bewusst, dass sie kein Blut sehen kann. Bei einer Autopsie einer Unfallleiche ist sie dann kurzerhand einem Brechreiz und Schwächeanfall erlegen. Sie war wochenlang das Gesprächsthema Nummer eins unter den Medizinstudenten.« Horatio lächelte schief. »Glücklicherweise sind wir Kinder von reichen Vätern, die gerne für das seelische und leibliche Wohl ihrer Brut sorgen.«
»Dann haben sich Attraktivität und Reichtum gefunden?«
»Nicht ganz«, bemerkte Horatio Heaven. »Liebe und Sex stehen im Vordergrund.«
Man hörte Tanya durchs Herrenhaus einen Befehl an die Arbeiter schreien.
»Und ich mag Frauen, die wissen, was sie wollen.«
Der Makler nickte. »Ich verstehe, was Sie meinen.« Morrison deutete auf die Vertragsunterlagen. Humorvoll fragte er: »Und haben Ihre Anwälte die Papiere geprüft und einen versteckten Haken finden können?«
»Nein … sauber getippt«, entgegnete Horatio ein wenig salopp. »Nur eine Frage noch, Mr. Morrison.«
»Gerne, Mr. Heaven«, sagte der Immobilienmakler rasch und verdrängte routiniert einen Schatten der Besorgnis, der über sein Gesicht huschte.
»Sie sagten mir, dass die Gemeinde Standsville das Haus jahrzehntelang als Museumsstätte nutzte. Hat der ursprüngliche Eigentümer das Big House an die Stadt verkauft?«
Der Makler räusperte sich: »Ähm … darüber gibt es keine Aufzeichnungen mehr. Die Gemeinde Standsville hatte eine Brandkatastrophe. Das Ganze ist über 100 Jahre her. Alle Dokumente sind damals den Flammen zum Opfer gefallen. Es ist schwierig, aus dieser Zeit …«
»Dann weiß man nicht, ob es noch einen Erben der ursprünglichen Familie gibt?«
»Mr. Heaven, man weiß nicht einmal, wessen Familienbesitz es ursprünglich war. Eventuelle Geburtsregister aus der Gemeinde wurden beim Brand vernichtet oder sind im Laufe der Zeit … verschollen.«
»Verschollen?«
»Anders kann ich es nicht ausdrücken. Jedenfalls hat die Gemeinde das Big House über ein ganzes Jahrhundert lang verwaltet und später als Museum der Landesgeschichte genutzt. Es gab nie irgendwelche Ansprüche von außerhalb. Ich habe dies alles rechtlich prüfen lassen. Keine Sorge, es gibt keine bekannten Nachfahren, die sich für diesen wunderschönen Besitz interessieren.« Der Makler nahm einen Schluck Zitronenlimonade und meinte dann: »Das liegt vielleicht auch an den düsteren Ammenmärchen, die sich um das Haus ranken.«
Horatio Heaven zeigte sein Winner-Lächeln und winkte ab. »Ja, ich habe davon gehört! Ich kann mit diesem übernatürlichen Kram nichts anfangen.« Wieder schnauzte seine Verlobte im Haus einen Handwerker an. »Und meine Tanya glücklicherweise auch nicht.«
»Wann steht Ihre Heirat an, Mr. Heaven – wenn ich fragen darf?«
»Wenn die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. Unsere Eltern planen eine Glamour-Hochzeit in unserem neuen Big House im kommenden Sommer – mit Protz, Pomp und Gloria!«
»Noch ist es nicht Ihr Haus, Mr. Heaven«, meinte der Immobilienmakler geschäftstüchtig und deutete auf die Vertragspapiere.
Horatio langte in die Innentasche seiner Anzugjacke und holte einen Kolbenfüller heraus.
»Welch schönes Stück!«, schmeichelte Morrison.
»Ja«, sagte der Millionärssohn. »Ein Unikat zu meiner Volljährigkeit. Das Ding hat eine hochwertige Goldspitze. Damals haben meine erfolgsverwöhnten Eltern noch geglaubt, ich hätte Interesse, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten.« Horatio lächelte. »Meine eigenen Pläne waren mir wichtiger. Glücklicherweise ließen sie mich wählen. Nun … ein Vorteil lag dabei auf meiner Seite. Ich bin der einzige Sohn.«
Horatio unterzeichnete schwungvoll die Papiere.
»Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Eigentum!«, jubelte Makler Morrison beinahe und dachte an seine eigenen Kontoauszüge im nächsten Monat. »Sie werden den Kauf sicherlich nicht bereuen, Mr. Heaven.«
Drinnen im Haus krachte etwas ganz entsetzlich, dann polterte es.
Kurze Zeit war nichts zu hören. Dann schrie eine Frauenstimme erst schmerzvoll, dann wütend.
»Das klingt ernst«, sagte Horatio Heaven. »Ziemlich ernst!«
5. Ding-Dong
»Nehmen Sie die gottverdammte Uhr von mir runter!«
Tanya Taylors klare Befehlsstimme raunzte durch die Empfangshalle des Herrenhauses. Als Horatio Heaven, ihr Verlobter, und Mr. Morrison, der Immobilienmakler, hereinkamen, standen einige zumeist schaulustige Handwerker in einem Halbkreis, die sich ein Lachen nicht verkneifen konnten. Auf dem glatten Marmorboden zu ihren Füßen lag eine attraktive, jedoch ziemlich energische Rothaarige in einem farblich passenden Kleid, deren ansehnliche Beine von einer mächtigen Standuhr bedeckt waren. Zwei Männer in blauen Latzhosen, die wegen der üppigen Muskulatur wandelnden Kleiderschränken ähnelten, wuchteten die Uhr aufrecht. Ein sattes Ding-Dong war zu vernehmen.
»Himmel, wie ist das passiert?«, fragte Horatio seine Verlobte, die wie die glotzenden Kerle ihre Knie begutachtete. Glücklicherweise gab es keine offensichtlichen Verletzungen, jedoch waren Hämatome nicht auszuschließen. Doch diese zeigten sich oftmals später.
»Von uns war keiner in der Nähe der Uhr«, sagte ein älterer Handwerker sogleich. Der Mann war der Leiter der Truppe und strahlte eine beruhigende Fachkompetenz aus.
»Keiner in der Nähe?«, keifte Tanya und ließ sich von ihrem Verlobten auf die Beine helfen. Zornig trat die Rothaarige gegen den tiefbraunen Uhrenkasten. Abermals antwortete die Standuhr mit einem Ding-Dong. »Das Drecksding ist doch nicht von alleine auf mich gefallen, oder?«
»Tanya, was genau ist passiert? Erzähl mal!«
Seine Verlobte ließ die hellgrünen Augen giftig funkeln. »Was passiert ist? Ein leichtsinniger Arbeitsunfall – das ist passiert! Und der eingeschworene Haufen hier will es vertuschen!«
Ein gemeinsames Raunen des Widerstands entrann den Kehlen der beschuldigten Männer.
»Miss Taylor«, wehrte sich der Bauleiter. »Keiner befand sich bei Ihnen. Seit Stunden scheuchen Sie meine Männer und mich durch das Big House! Und glauben Sie mir, bei Ihrer keifenden Art sucht bestimmt niemand freiwillig Ihren Kontakt!«
Die Handwerker lachten leise, aber hörbar; nur einer hielt sich scheu im Hintergrund.
»Horatio, tu was!«, forderte Tanya aggressiv und Hilfe suchend.
Der jedoch sagte nur: »Glücklicherweise ist dir ja nichts Ernsthaftes zugestoßen, Tanya …«
»Man hat eine Uhr auf mich fallenlassen!«, herrschte sie.
»Kann nicht sein!«, hielt der Bauleiter dagegen. Er deutete auf die gegenüberliegende Wand. »Das Ding steht normalerweise an der Stelle dort. Sehen Sie den staubigen Umriss am Verputz?«
Alle schauten hin. Es war eindeutig, dass dort, in ungefähr sechs Meter Entfernung, die Uhr ihren ursprünglichen Platz hatte. Doch … wer hatte sie durch die Empfangshalle bewegt?
Seltsam ist das schon, dachte Horatio, doch er zweifelte an Tanyas Beschuldigung. »Liebes, wie gesagt: Erzähl uns doch mal, was vorgefallen ist! Wo bist du gestanden? Hast du die Uhr auf dich … zukommen sehen?«
»Horatio, willst du mich verarschen?«, schleuderte sie ihm entgegen, und die Handwerker raunten wieder, hofften auf einen verbalen Schlagabtausch unter den beiden Verlobten. »Man hat versucht, mich mit dem Ding zu ermorden!«
»Eben wirst du ein wenig hysterisch, Liebes!«, tat der Mann es ab.
»Nein, werde ich nicht! Ich stand mit dem Rücken zur Uhr, hörte ein Schaben … und als ich mich umdrehte, sah ich nur noch das große Ziffernblatt vor meinen Augen. Und das riesige Drecksteil von Uhr hat mich zu Boden gerissen und begraben!« Sie deutete mit einem schwungvollen Fingerzeig auf die Handwerker. »Irgendwer … hat die Standuhr auf mich geschoben oder geworfen!«
»Ein Witz!«, sagte der Leiter der Handwerkertruppe streng. »Eine völlig haltlose Beschuldigung! Keiner meiner Männer hat Ihnen etwas getan, Miss! Aber Sie können gerne eine Anzeige machen, wenn Sie darauf bestehen!«
»Das wird nicht notwendig sein!«, riss Horatio das Gespräch an sich.
»Das wird – was nicht?«, schrie Tanya, konnte nicht glauben, dass ihr eigener Verlobter sich gegen sie stellte. »Du hilfst denen, nicht mir?«
»Eigenartig ist das Ganze schon«, unterbrach Mr. Morrison, der Makler, das Streitgespräch. »Sehen Sie!«
Auf dem Marmorboden waren eindeutig Schleifspuren zu erkennen, als ob jemand die schwere Standuhr bewegt hatte.
»Von selbst hat sie das wohl nicht getan, oder?«, kommentierte Tanya die Ratlosigkeit der Männer. »Und ich habe das Teil bestimmt nicht durch die Halle geschleift, um es auf mich selbst zu werfen!« Sie blickte Horatio mit zusammengekniffenen Augen an. »Oder glaubst du, ich habe meinen Verstand verloren, hä?«
Alle schwiegen, dann ein sattes Ding-Dong, das unter diesen seltsamen Umständen unheimlich wirkte.
»Da ist was kaputtgegangen!«, meinte ein Handwerker mit Sommersprossen. Er zeigte auf die Rückseite des fast zwei Meter hohen Uhrenkastens. Am oberen Rand hatte sich ein Stück Holz gelöst.
»Ist wohl durch den Sturz passiert«, meinte ein anderer Mann. »Das kriegt man mit einem guten Nagel und einem Hammer wieder hin. Keine große Sache.«
Ding-Dong.
Tanya war zusammengezuckt und empörte sich: »Das olle Ding nervt!«
»Wartet!«, sagte der Bauleiter und fasste intuitiv in den Holzspalt an der Rückwand.
»Was erwarten Sie?«, stichelte die rothaarige Frau. »Denken Sie, in dem antiken Ding sind Goldmünzen versteckt?« Mit gerümpfter Nase hängte sie an: »Die können Sie mir dann gleich als Schmerzensgeld geben.« Tanya schaute ihren Verlobten an. »Horatio, hast du die Papiere schon unterschrieben?«
»Ja, Liebes.«
»Alles, was sich in der Uhr befindet, gehört dann sowieso meinem Verlobten, klar?«, stellte sie arrogant fest.
»Hat jemand mal eine Flachzange?«, fragte der Bauleiter. »In dem Holzspalt steckt etwas, aber ich komme nicht ran.«
Man reichte ihm eine Zange. Sekunden später holte er etwas heraus. Es war ein altertümlicher Schlüssel, der Rost angesetzt hatte.
»Ich fühle mich wie in einem Wimmelbildspiel«, witzelte Morrison, der Makler.
Horatio Heaven nahm den Schlüssel entgegen. »Wo ein Schlüssel ist …«
»… gibt es auch ein Schloss«, ergänzte einer der Handwerker. »Das hat mein Großvater immer gesagt … meinte aber im übertragenen Sinne etwas anderes.«
Einige Handwerker lachten.
In diesem Moment polterte wieder etwas. Diesmal kam das Geräusch vom ersten Stock.
»Ist da oben noch einer Ihrer Kollegen?«, wollte Horatio wissen.
»Nein, Sir, alle Mann sind hier unten«, gab der Bauleiter zu verstehen. »Oben ist niemand mehr.«
Wieder drang ein Gerumpel an ihre Ohren. Dann hörte man eine mechanische Spieluhr sanft eine Melodie spielen.
Gut, dass der Kaufvertrag unterschrieben ist, dachte Morrison, der Makler.
»Hier spukt es wohl?«, fragte einer der Handwerker verdutzt.
»Daran glaube ich nicht«, konterte Horatio. »Oder glauben Sie, ich hätte mir sonst ein altes Herrenhaus gekauft?«
Der sommersprossige Mann meldete sich: »Meine Großeltern sagen, dass diese alten Häuser alle irgendeinen Geist im Gebälk haben. Meist irgendeine arme Seele, die während der Sklavenzeit ums Leben gekommen ist. Hier in der Gegend haben sich früher schlimme Geschichten zugetragen, Sir!«
»Ammenmärchen«, quittierte Horatio knapp die gruselige Vermutung des Mannes. »Im Jahr 2017 gibt es keine Geister mehr.«
Der Sommersprossenmann bekreuzigte sich. »Und diesem Geist hier ist klar, dass wir im Jahre 2017 leben?«
Schweigen. Dann erstarb die Spieluhr.
Ding-Dong.
Diesmal erschreckten alle gemeinsam. Alle … außer Horatio Heaven.
»Wie ich bereits sagte: Ich glaube nicht daran«, beharrte Horatio. »Ich bin ein moderner …«
Dann hörten sie vom oberen Stockwerk ein Baby schreien.
»Was … was ist das?«, fragte Tanya und hatte einen besorgten Tonfall in der Stimme, der auf Angst hindeutete.
»Das ist eindeutig ein Baby«, erklärte Morrison, der Makler, verdutzt das Offensichtliche.
»Okay … dafür gibt es sicherlich eine Erklärung«, meinte Horatio Heaven.
»Und welche?«, zischte Tanya.
»Schauen wir nach«, antwortete er, steckte den rostigen Schlüssel in die Hosentasche und übernahm mutig die Führung.
Manche der einheimischen Männer gingen nicht gerne mit, um nachzuschauen.
6. Wo man den Schlüssel hineinsteckt
Das ehemalige Plantagenhaus, das man in den Südstaaten Big House nannte, hatte im geräumigen oberen Stockwerk 25 Zimmer, drei komfortable Suiten, zwei Salons für den Empfang von Besuchern und eine beschauliche Bibliothek zu bieten. Einige reiche Unternehmer der Gemeinde Standsville hatten das zwischenzeitlich als Museum genutzte Gebäude vor der Verkaufsabgabe an das Maklerbüro Morrison and Sister in seinen ursprünglichen Zustand als Wohnresidenz umgestalten lassen. Den letzten Feinschliff im Erdgeschoss erledigte seit drei Wochen die kleine, zuverlässig arbeitende, ortsansässige Handwerkertruppe, die sich gerade ziemlich angespannt wegen des Babyschreiens hinter Horatio Heaven, dem Neu-Eigentümer, die breite Treppe hinauf wagte.
Oben angekommen hörte das Baby auf. Nein, es hörte nicht einfach auf. Es war in ein freudiges Jauchzen übergegangen, das irgendwie noch unheimlicher klang als das Schreien.
»Es muss eine sachliche Erklärung dafür geben«, beharrte Horatio weiterhin. Als Sohn eines millionenschweren Reeders hatte er eine akademische Ausbildung genossen. Übernatürlichen Dingen, die andere in Angst und Schrecken versetzen konnten, trat er rational entgegen.
Geister oder Hokuspokus waren für ihn schlicht schaurige Humbug-Geschichten, um kleinen Kindern das Fürchten zu lehren. Er selbst war als Kleinkind eher mit Börsennachrichten aufgewachsen als mit irgendwelchen fantasievollen Schauer-Märchen.
Die Männer und Horatios Verlobte Tanya schritten langsam über den dunkelroten Teppichboden, der so dick war, dass er jedes Schrittgeräusch verschluckte.
Das Babyjauchzen war nun in ein zufriedenes Brabbeln und Glucksen übergegangen.
Morrison, der Makler, meinte: »Es kommt von dort – aus der Bibliothek.«
Der Sommersprossenmann unter den Handwerkern bekreuzigte sich wieder.
»Können Sie das lassen?«, zischte Tanya ihn an. »Sie machen mich nervös.«
»Ich bin gläubig«, verteidigte sich der junge Mann.
»Ihr Problem«, antwortete sie taktlos und verachtend.
»Tanya, halte dich bitte zurück!«, maßregelte Horatio sie.
»Ich bin eben Atheistin!«
»Der Mann ist es eben nicht, aber er atmet dieselbe Luft wie du! Die Luft in meinem Haus!«
Tanya wollte etwas entgegnen, aber in Anbetracht der vielen männlichen Augen, die sie anschauten, verkniff sie sich einen weiteren Kommentar.
Das vermeintliche Baby hinter der doppelflügeligen Bibliothekstür machte gerade ein entspannt klingendes Da-da-daa.
»Lasst uns hineingehen!«, sagte Horatio und umfasste die schmiedeeiserne Türklinke. Schwungvoll öffnete er beide Türflügel, und es präsentierte sich ihnen eine gemütlich eingerichtete Bibliothek mit meterhohen Regalen, in denen mehrere 100 Bücher aufgereiht standen. Eine gemütliche Sitzecke mit Chesterfield-Möbeln befand sich neben einem offenen Kamin, der wegen des Sommers nicht brannte.
Ein Baby war nicht zu sehen, aber weiterhin zu hören.
Nun bekreuzigten sich nicht nur der Sommersprossenmann, sondern noch drei weitere Männer.
Plötzlich gab es nur noch Stille.
Die Männer und die Frau verharrten gespannt, erwarteten etwas Neues, etwas Unerwartetes, das jedoch nicht eintrat.
Noch nicht.
»Und jetzt?«, fragte Morrison, der Makler, nachdem sie eine Minute regungslos geblieben waren.
»Kein Baby«, sagte Tanya, was ein unnötiger Kommentar war.
»Was auch immer«, meinte Horatio. »Es hat uns hierher geführt … in die Bibliothek.«