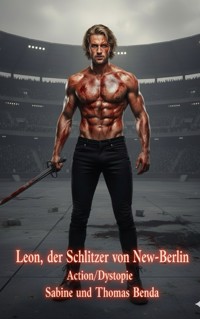4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mercy, die Straßenritze
- Sprache: Deutsch
Meine lieben begrenzt Denkenden! Hochzeit an Weihnachten für Mercy und Thomas? Hochzeitsglocken-Bimm-Bamm? Nope, ich sage nur: Dumm gelaufen! Das einzige Läuten, das man hören kann, ist das Läuten, das das Ende der Menschheit einläuten wird! In Manhattan wird dieser Krieg Hell gegen Dunkel ganz offensichtlich für alle. Es wird sooo himmlisch schön mitanzusehen, was wir der ehemaligen Sandrina Rossi und jetzigen Tara Wilcox aufgebürdet haben. Die Signora wird sich ziemlich beweisen müssen, dass sie in unserem Team mitspielen darf. Aber auch Estelle, Mercy und Lydia werden auf ihre Art und Weise den Bösen zeigen, wo die Hellen ihren Mittelfinger haben! Euer Samuel, der Erste Gärtner Gottes
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sabine und Thomas Benda
Mercy, die Straßenritze – Buch 10 – Der Multimilliardär und die Hure
Ein 25-teiliges Serien-Genre-Crossover – ein himmlisch-höllisches Epos – eine unvergessliche Geschichte
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Jailhouse Shit
2. Familie Bowlers
3. Wohlig warm
4. Was geht hier ab?
5. Im Wein liegt keine Wahrheit
6. Kuh im Nachthemd
7. Sicherheit geht vor
8. Miteinander und ineinander
9. Übermüdet und ausgelaugt
10. Ich, du, wir und die anderen beiden
11. So viele wie möglich
12. Mehr als Smalltalk im Schlafgemach
13. Geschichten
14. Seelen-Dingens
15. Einer, der Jeff heißt
16. Zermatscht
17. Voll tiefstem Respekt und guter Gefühle
18. Toleranz
19. Im Salon der Knochen
20. Zweibeinige und Vierbeinige
21. Füße hochlegen
22. Einer vor dem Blut
23. Schlaflos in New York
24. Not macht erfinderisch
25. Wortspiel
26. Lampenfieber
27. Der Page, der nichts mochte
28. Protz und Oberflächlichkeit
29. Von früher her
30. Näschen pudern
31. Das sieht nicht gut aus
32. Wenn es langsam voll wird
33. Plus fünf Dollar Trinkgeld
34. Rangalov
35. Lauf, Sandrina, lauf!
36. Volle Dröhnung!
37. Glasscheibe
38. Folge dem Falken!
39. Der Anfang vom Ende
40. Der magische Moment und die kalte Tatsache
41. Sichtbar für alle
42. Wenn zwei sich gegenüberstehen
43. Das Dunkle verdeckt das Helle
44. Ein wahrlich teuflisches Problem
45. Mittelfinger
46. Beten ist immer wichtig
47. Stoppschild
48. Wunder
49. Vermischtes
50. Ganz neue Gefühle
51. Tock-tock-tock
52. Sehr viel Blut und Bloody Mary
53. Himmlische Stimmen
54. In problematischer Anzahl
55. Zwölf an der Zahl
56. Pisse
57. Wir lieben unsere Gina!
58. Mit Herz, Hand, Verstand und Seele
59. Gespräche
60. Sammy und Debby
61. Go-go-go!
62. Zwei Frauen, eine Italienische und ein "Dong"
63. Von Herausforderungen und Bestimmungen
64. Wenn man sich braucht
65. Wenn man die Spannungsschraube anzieht
66. Es war einmal ...
67. Zweischneidiges
68. Wut, Ehre und Mut
69. Paul Gerhard Altfeldt
70. Versteckspiel
71. Schottisch, gläubig und täubisch
72. Great Treasures
73. Richtspruch und Abmachung
74. Eine prägende Begegnung
75. Dreamteam
76. Hymnen in der Stille
77. Kelch-Kurier
78. Hürden und Herausforderungen
79. Genug der Worte - nun die Taten
80. Hände an Füße, Seite an Seite
81. Möglichkeit B
82. Sonnenfinsternis
83. Baby-winke-winke und schlimme Erkenntnisse
84. Bitch
85. Kekse
86. Reue, Schmerz und Feierabend
87. Sarah Dumpling
88. Blitzlichter
89. 80 Dollar und fünf Jahre
90. Letzte Worte
91. In einer kühlen Neujahrsnacht
92. Hochzeitsreise
Über die Autoren:
Impressum neobooks
1. Jailhouse Shit
Todestrakt.
Ein mittellanges Wort, das den Arbeitsbereich von Woody Bonner knapp umschrieb.
Todestrakt.
Für die Häftlinge, die sich dort befanden, war es die letzte Station ihres üblen Lebens.
Todestrakt.
Hier wartete man auf die Ankunft des Schnitters, wenn das Gift im Blutkreislauf alles Organische ausschaltete, wenn man hinüberging in etwas nie Dagewesenes und nie zuvor Erfühltes.
Todestrakt.
Wer hier einsaß und seinem körperlichen Ende entgegenblickte, hatte es nach irdischem Strafmaß des Staates verdient zu sterben.
Reue und Scham waren Gefühlsregungen, die sich bei den Insassen des Todestraktes nicht zeigten. Selbst die Tatsache, dass im angrenzenden Nachbarstaat keine Todesstrafe verhängt wurde, ließ die Gefangenen im Zellenblock C74 völlig kalt.
Woody Bonner, ein breitschultriger Mittfünfziger, dessen schleppende Gangart zur Trostlosigkeit des Todestraktes passte, ging der Vollzugsarbeit als Wärter seit 23 Jahren gewissenhaft nach.
Der Familienvater, der eine akribische Leidenschaft für das Sammeln von ausländischen Briefmarken hatte, sprach im Verwandten-, Freundes- oder im Bekanntenkreis wenig über seine Aufgaben. Dies hatte einen persönlichen Grund: Der Mann wollte die Welt außerhalb des Gefängnisses nicht mit Geschichten über den menschlichen Unrat aufgeilen, den er tagein und tagaus bewachte. Woody fand, dass sich die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten zunehmend selbst verrohte, und dieser allgegenwärtigen Sensationslüsternheit trat er beharrlich schweigend entgegen und nährte sie nicht noch zusätzlich. Diese Süchtigen sollten sich lieber an den Nachrichten und an der Medienüberreiztheit des Internets bedienen, aber nicht an seiner Arbeit im Vollzug.
Die Lebensgeschichten der auf die Vollstreckung wartenden Mörder, die gefühllos stumpfsinnig auf die tödlichen Injektionen warteten, waren im Einzelfall nicht nur grausam verstörend und unvorstellbar böse. Nein, es gab schlicht kein brauchbares Adjektiv im Vokabular, das die Bluttaten der im Block C74 hockenden Männer ausreichend beschreiben konnte.
»Selbst der Teufel würde diese gottverdammten Seelen aus der Hölle wieder hinausrotzen!«, hatte Woody vor einigen Jahren einem Neuling unter den Wärtern polemisch vulgär erklärt. Nachdem der Neue eine Woche im Todestrakt gearbeitet und sich mit den Untaten der Inhaftierten vertraut gemacht hatte, musste er Woody recht geben.
Priester und Geistliche jeglicher Art hatten sich schon ewig nicht mehr im Block C74 blicken lassen. Ramirez war einer der Letzten gewesen. »Wenn Sünder so dunkel und böse geworden sind, verschwende ich nicht meine Zeit mit guten Worten. Diese Monster hier haben wahrlich den alttestamentarischen Zorn Gottes verdient. Schon in der Nähe dieser Dämonen zu sein, befleckt alles Reine.«
Ja, Woody Bonner erzählte wenig von seiner Arbeit im Todestrakt und von den Menschen, mit denen er zu tun hatte.
»Und dieser Pfaffe Ramirez hat damals wahre Worte gesprochen«, sagte er oft, wenn er mit Kollegen im Pausenraum saß, an einem lauwarmen und viel zu stark aufgebrühten Kaffee nippte und tratschte. »Dieser Unrat in den Zellen hätte niemals auf Erden wandeln dürfen. Solche Boshaftigkeit und Bösartigkeit sind zu nichts nütze. Nur zu dem, anderen das Verderben zu bringen. Doch der Tod durch den Henker löscht alle Spuren, hoffentlich.«
Es war Pause.
Woody Bonner befand sich im karg möblierten Erholungsraum der Wärter und knipste den roten Schalter der verdreckten Kaffeemaschine an. Heißes Wasser röchelte mühsam in die randvolle Filtertüte.
Pat und Will, Wärter-Kollegen, altgedient wie er, würden in Kürze zu einem schnellen Kartenspielchen auftauchen. Woody nahm sich vor, die verlorenen zehn Dollar wieder zurückzugewinnen. Seine Ehefrau Bessy durfte selbstredend nichts von dem monetären Zeitvertreib wissen. »Bessy würde mir die Hölle heißmachen!«, hatte er seinen Kollegen-Kumpanen unzählige Male erzählt. Bessy war eine gute Ehefrau, doch sie verabscheute Kartenspiele, bei denen es um Geld ging. Dafür mochte Woody ihren Hang zu Bingo-Abenden im Gemeindezentrum nicht besonders. So hatte jeder seine Eigenarten und Vorlieben. Ansonsten führten sie eine gute Ehe, auch noch nach über 25 Jahren. Samstags wurde Woody ohne Mühe steif, und seine Bessy kam ebenfalls auf ihre Kosten, seit sie ihm vor Ewigkeiten die feuchten Spielereien mit der Zungenspitze erklärt hatte. Ja, Bessy und Woody, das passte. Besser als bei anderen in ihrem Freundeskreis.
Der Alarmton schrillte entsetzlich grell, und Woody erschrak fürchterlich, denn es war eine unerwartete Premiere. Im Todestrakt, im Gefangenenblock C74, hatte es noch niemals einen Alarm gegeben. Jedenfalls nicht in Woodys Dienstzeit während der letzten 23 Jahre.
Schritte und laute Rufe auf dem Flur ließen den Mann endlich reagieren. Er zog seine Dienstwaffe, was ebenfalls noch nie nötig gewesen war, und lief aus dem Pausenraum hinaus.
Einige Wachleute, bewaffnet mit Gewehren, stürmten an ihm vorbei. Woody schloss sich ihren schnellen Schritten an, versuchte keuchend mitzuhalten. Erst jetzt wurde dem Mann bewusst, wie unsportlich er geworden war. Pat und Will, füllig an Leib wie Woody, erwarteten ihn am Eingang zum Todestrakt.
»Wer hat den Alarm ausgelöst?«, schnauzte Woody Bonner seine beiden Kollegen an. »Gab es einen Ausbruchsversuch?«
Pat Barell stützte sich schnaufend an der rauen Flurwand ab. Seine Raucherlunge brannte wie Feuer. Japsend sagte er: »Ich habe den Knopf gedrückt.« Blasshäutig und mit glitzernden Schweißperlen verziert blickte der Schweinsnackige in Woodys fordernde Augen. »Sie sind weg, Woody!«, sagte er und spuckte aufgeregt Speichel beim Sprechen.
»Wer ist weg?«
»Alle. Alle sechs!«
Woody Bonner blickte rasch den Flur entlang. Die massiven Stahltüren zu den Einzelzellen sahen allesamt verschlossen und unversehrt aus. Durch die engen Fenster in den Zellen konnte kein erwachsener Mann entkommen sein, und wenn ja, wäre er im zehn Meter tiefen Gefängnishof aufgeschlagen.
»Willst du mich verarschen?«, blaffte Woody Pat ärgerlich an.
»Nein, tut er nicht!«, bestätigte Will Morris mit weit aufgerissenen Augen. »Wir haben es eben auf den Monitoren der Videoüberwachung gesehen. Die Zellen sind wirklich leer!«
Woody Bonner wies zwei Männer an, mit den Gewehren Stellung zu beziehen. Dann befahl er einem weiteren Wächter, der an einer Schalttafel am gegenüberliegenden Ende des Ganges stand, die Zellentür 1 zu entriegeln.
Nach einem mechanischen Klacken riss Woody die Stahltür energisch auf, zeitgleich zielten zwei Gewehrläufe ins Zelleninnere.
Außer der spartanischen Einrichtung war nichts zu erblicken. Kein Mensch.
Auf der Schlafpritsche türmte sich ein frischer tiefbrauner Haufen Exkremente.
In allen anderen fünf Zellen des Todestraktes zeigte sich das gleiche Bild: keine Häftlinge, dafür stinkende Scheißhaufen.
Wie gebannt starrten Woody Bonner und seine Wärter-Kollegen in die verwaisten Zellen.
»Wie ... wie ist das möglich?«, stotterte Pat herum, wollte eine Erklärung für das Unfassbare finden. »Was ist da nur geschehen?«
Woody Bonner spitzte ernst seine Lippen.
»Sie haben nochmal geschissen - und dann hat der Teufel sie geholt.«
2. Familie Bowlers
New York City
»Ja. Jetzt wisst ihr die ganze Geschichte. Vollkommen alles.«
Es war 05:00 Uhr am Nachmittag, und die beiden Geschwister Bowlers, ein wenig blass um die Nase herum und ziemlich aufgewühlt in ihrem Inneren, saßen auf dem bequemen Chesterfield-Sofa im Wohnzimmer ihrer Eltern.
Weihnachten stand vor der Tür - und nicht nur das.
Die Hochzeit von Mercy Bowlers und Thomas Bendermann war auf den 21.12.2016 datiert, also in drei Tagen, und die endlos vielen Vorbereitungen liefen bereits seit über einer Woche auf Hochtouren. Bendermann hatte eigens dafür ein 50-köpfiges Team zur Planung und zur Gestaltung engagiert.
Alle Beteiligten, besonders die dem Brautpaar nahestehenden Menschen, zeigten sich im Hinblick auf das bevorstehende Ereignis angespannt und zutiefst aufgeregt. Wegen Bendermanns Popularität im New Yorker Geschäftsleben und in der noblen Highsociety galt die Hochzeit jetzt schon als das Medienspektakel des Jahrzehnts.
Just in dieser stressigen Zeit hatte sich eine Mutter, nämlich Madeleine Bowlers, berufen gefühlt, endlich reinen Tisch zu machen und ihren beiden Kindern die Geschichte ihres schlimmen Unfalltodes als 15-Jährige und ihre darauffolgende wundersame Auferstehung in allen Einzelheiten zu erzählen.
Vater Mathew, bekleidet mit einem weißen Poloshirt und weißer Jeans, wirkte bei diesem Gespräch wie ein Mediziner aus dem St. Peter’s Memorial Hospital und nicht wie ein Lehrer für Geschichte. Er saß neben seiner Gattin Madeleine auf einem zweiten Chesterfield-Sessel und blickte in die gebannten Gesichter seiner Tochter und seines Sohnes. »Möchtet ihr vielleicht einen Scotch auf den Schrecken hin?«
Doch die Frage verpuffte unbeantwortet im Raum, und Mathew goss sich selbst ein Glas nach.
»Mom, du warst so richtig tot?« Marc Bowlers, der die Frage halb flüsternd gestellt hatte, hielt sich eine flache Hand vor den Mund, erschrak scheinbar selbst wegen seiner Worte. »Ich meine, nicht nur scheintot, oder so?«
Madeleine sah den Lockenkopf an und lächelte so vertrauenerweckend, wie sie als Mutter lächeln konnte. »Der Lastwagen hat das Taxi mit voller Wucht erwischt - und mein Genick war zerschmettert«, erklärte sie mit sachlicher Stimme. »Gewiss war ich tot, mein Sohn. Mausetot.«
»Was für 'ne abgefahrene Story!«, entfuhr es Tim Schmitt auf Englisch.
»Halt deinen Mund, Tim! Das ist eine Familienangelegenheit!«, schnauzte Marc seinen inneren Begleiter auf Deutsch an. Durch die wundersame Verbindung der beiden Seelen in einem Körper konnten beide die Muttersprache des anderen fließend sprechen und verstehen.
Tim räusperte sich und sprach aus Marcs Mund: »Entschuldigt bitte meine vorlaute Art, aber immer, wenn ich sowas Übernatürliches höre, dann fühle ich mich in meinem Zustand nicht so alleine.«
»Das will jetzt keiner wissen, Tim!«, mahnte Marc ein weiteres Mal, und der früh Verstorbene hielt sich verbal zurück und dachte sich seinen Teil.
Mercy Bowlers, die mit ihren wirr hochgesteckten Haaren und einer pinkfarbenen Jogginghose nach allem aussah, nur nicht nach einer Auserwählten Gottes, war geplättet und erheitert zugleich.
Mom ist auferstanden ... wie einst Jesus, durchzuckte es sie absurderweise.
Aber Madeleine Bowlers, attraktiv, streng religiös, Workaholic und Kunstdesignerin aus New York, war natürlich nicht der Sohn Gottes.
Mercy befand sich wegen der spannenden Muttergeschichte seit einer Stunde in einer Knabbersucht. Bruder Marc, der in seinem kükengelben Sweater ziemlich niedlich wirkte, reichte ihr schon die zweite Schüssel Kartoffelchips hin. Wieder griff die Blondine zu, schob sich eine Handvoll davon in den Mund und knabberte sie aufgeregt weg.
»Und diese Gräfin, diese Margarete von Weinstadt, vollstreckt wirklich Todesurteile im Namen des Herrn?«, fragte sie fasziniert nach.
»Sie heißt Weystedt, nicht Weinstadt«, bemerkte Tim rasch und schwieg sofort wieder.
»Ja, Mercy! Sie ist eine unsterbliche Vollstreckerin.« Mutter Madeleine nippte an ihrem Glas Rotwein. »So unglaublich, wie das auch klingen mag.«
»Oh, was ist hier nicht alles unglaublich«, bemerkte Mathew daraufhin leise und frönte seinem Sinn für trockenen Humor.
In Marc drängte eine andere Frage. »Und diese Margarete hat dich und Dad gewissermaßen rekrutiert?«
»Welch interessante Bezeichnung! Und dies aus dem Munde eines Gitarristen«, fühlte sich der Vater angesprochen. »Aber du hast recht, Sohn. Man kann wahrlich von einer Rekrutierung sprechen.«
»Dann habt ihr vor, dem Ruf nach Hidsania zu folgen?« Mercy konnte sich das in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen. Für die junge Frau waren die Eltern mit New York so sehr in Verbundenheit wie die Freiheitsstatue selbst.
»Selbstverständlich werden wir das tun«, antwortete Madeleine. »Ich muss für das, was ich in jungen Jahren als Geschenk erhalten habe, einen Ausgleich schaffen und nun meinen Beitrag leisten.«
»Gut ausgedrückt«, warf Mathew ein.
Fröhlich lachte die Frau in die Richtung ihres Ehemannes. »Und euer Dad unterstützt mich dabei. Umgekehrt würde ich das natürlich ebenfalls tun.«
»Bis dass der Tod uns scheidet«, fügte der Mann als humorvoll dahingesagte Bemerkung an.
Madeleine Bowlers sah ihre beiden Kinder an. »Wir wollen unmittelbar nach der Hochzeit Estelle Brukner in Hidsania einen Kennenlern-Besuch abstatten.«
»So bald schon?« Der lockenköpfige Marc war von der neuartigen Spontanität seiner Eltern völlig überrascht. Die angesprochenen Lebenspläne von Madeleine und Mathew machten ihn fast atemlos. Normalerweise präsentierten sich beide Elternteile gerne als granitartige Balancetypen der Premiumklasse.
»Oh, unsere wilde Entschlossenheit erstaunt die jüngere Generation«, witzelte Madeleine, was gerade Mercy sehr gefiel, die ihre Mutter als beinhart konservativ kannte. »Ja, wir reisen nach den Hochzeitsfeierlichkeiten, wenn das möglich ist, mit Estelle Brukner und ihrem Prinzen, diesem beeindruckenden Hidsaa, nach Hidsania. Wir wollen uns ein Bild vor Ort machen.«
Mathew räusperte sich. »Woher weißt du, dass Prinz Hidsaa beeindruckend ist?«, hakte er schließlich ruhig nach.
»Internetrecherche und weibliche Neugier«, antwortete seine Frau und knuffte ihn liebevoll in die Seite. Madeleines Blick richtete sich auf die Tochter, die hastig letzte Chipsreste aus der Schüssel pickte. »Da Estelle und Hidsaa noch vor deiner Hochzeit in New York eintreffen werden, glaubst du, Kleines, dass wir, dein Dad und ich, einige private Worte mit ihnen wechseln dürfen?«
»Macht euch deswegen keine Gedanken, Mom. Estelle ist, wenn man die übernatürliche Seite ausblendet, ein stinknormaler Mensch.«
Mathew, ein akkurat denkender und handelnder Lehrer, wollte auf Nummer sicher gehen. »Müssen wir auf eine besondere Etikette bei ihr achten?«
»Besondere Etikette?« Mercy Bowlers lachte jugendlich frech wie lange nicht mehr. »Nein, Daddy! Definitiv nicht! Im Augenblick legt sie auf diesen abgehobenen Nonsens keinen Wert. Und vergesst nicht, sie kommt ja ursprünglich von hier, aus New York.« Mercy strahlte Madeleine und Mathew an. »Begegnet ihr einfach auf Augenhöhe, dann wird alles gut klappen.«
Mercy Bowlers war überglücklich im Kreis ihrer Lieben zu sitzen.
Es war ein bemerkenswertes Jahr gewesen – und alles andere als gewöhnlich und langweilig. Ein Jahr voller Gefahren und Wunder. Viele Gedanken und Erinnerungen schwirrten durch ihren blondhaarigen Kopf.
Und ja, endlich befand sie sich vor der Hochzeit mit dem viel älteren Geschäftsmann Thomas Bendermann. So wie es ein wichtiger Teil ihrer Prophezeiung war, die sie von Estelle Brukner erhalten hatte.
Hochzeit.
Heirat.
Mercy war sehr aufgeregt, aufgewühlt, hin- und hergerissen, von Gefühlen ergriffen und gleichzeitig kämpferisch stark wie niemals zuvor in ihrem Leben.
Sie fühlte diese unbeschreibliche Macht in sich, die wie eine innere Verbündete zu ihr gehörte und sie niemals mehr verlassen würde.
Sie fühlte sich wie Mercy Bowlers eben, wie eine Auserwählte Gottes.
Und sie stand nach der Vernichtung von Betty Nothing wieder ganz oben und mittendrin in ihrem komplex komplizierten Leben, das sie so sehr liebte.
Es fühlte sich gut für sie an.
Ja, das tat es.
Heute, drei Tage vor der Hochzeit und den blutigen Ereignissen, die den Glauben an das Gute und an das Böse für viele Menschen weltweit auf eine dramatische Art und Weise stärken würden.
3. Wohlig warm
Königreich Hidsania, am anderen Ende der Welt
Im SPA-Bereich, im ehemaligen Lustgarten-Gebäude, war es - bedingt durch die dicken, weißen Mauern - angenehm kühl. Draußen, im wunderschön angelegten Palastgarten, brutzelte die gleißende Mittagssonne gnadenlos vom wolkenlosen Himmel herab. Selbst die Äffchen, überwiegend Kapuziner, die Prinz Hidsaa aus dem fernen Argentinien nach Hidsania importieren ließ, trauten sich nicht aus dem wohltuenden Schatten der Palmen oder gammelten müde zwischen den dichten Laubbüschen an der Ostseite des spiegelglatten Flamingo-Sees.
Nara, die Leibdienerin von Estelle Brukner, entzündete einige aromatisch riechende Duftkerzen und kümmerte sich um die Dekorationen mit bunten Blütenblättern auf dem kalten Marmorboden. Ein süßlich sinnlicher Duft strömte sachte durch die Wellness-Räumlichkeiten. Heute war der Wohlfühl- und Entspannungstag für alle Frauen des Anwesens, auch für die Bediensteten.
Nachdem die Dienerin rosa Badesalze in die Whirlpools gegeben hatte, schritt sie in einen kleinen Nebenraum. Dort schärfte sie die Klinge eines edel aussehenden Rasiermessers an einem Riemen, der an der Wand befestigt war. Danach bereitete sie einige Porzellanschälchen mit Schaum vor und überprüfte den Zustand und die Geschmeidigkeit der verschiedenen Rasierpinsel. Manche Damen bevorzugten nämlich härtere andere wiederum weichere Borsten beim Einschäumen des Intimbereiches. Estelle Brukner nannte diese Hygieneecke scherzhaft den FR-Bereich, wobei das FR für freiwillige Rasur stand.
Ein schriller Falkenschrei und ein fröhliches Babyjauchzen rissen Nara aus ihren Gedanken und ihren Pflichten. Sie verließ rasch den Nebenraum, um nachzusehen, und ließ die Rasur-Utensilien dort zurück. Ein ungewöhnliches Bild zeigte sich der Dienerin, das ihr ein Lächeln entlockte und das sich ebenfalls in ihren Augen widerspiegelte.
Toran, der prächtig kraftvoll aussehende Wüstenfalke, hockte auf dem hellen Marmor des Bodens und trippelte mit seinen messerscharfen Krallenfüßen über die glatte Oberfläche. Das klackende Geräusch, das er dabei verursachte, schien ihm sehr viel Freude zu bereiten. Neben ihm stand Yamina, in ein zart violettes Gewand gehüllt und mit offenen Haaren, die ihr bis zur schmalen Taille reichten. In ihren Armen wiegte sie einen fröhlich glucksenden Wonneproppen, ein Baby. Firesaa weitete freudig ihre tiefbraunen Knopfaugen, als sie Nara wahrnahm, und jauchzte erneut, diesmal ein Begrüßungsjauchzen.
»Du bringst Toran in unseren geschützten Frauenbereich mit?«, witzelte die Leibdienerin freundlich mit Yamina. »Du weißt doch, dass es Männern nicht gestattet ist, den SPA zu betreten!«
Die schöne Algerierin schaute zuerst auf ihren Falken und dann auf Nara. »Mein Falke hat eine Sondergenehmigung vom Prinzen erhalten, auf Lebenszeit!«, gab sie ausgelassen einen Witz als Antwort zurück. »Außerdem«, fügte sie keck an, »ist Toran nur an Mäuschen und nicht an wirklichen Mäusen interessiert.«
Yaminas Blick fiel auf die dekorative Wickelkommode. Bedienstete hatten sie vor wenigen Tagen hier aufgebaut. Dieses fürsorgliche Entgegenkommen des Prinzen erleichterte der Pflegemama die Teilnahme an den ausgiebigen Wellnesstagen.
»Himmel!«, hörten sie hinter sich eine durchdringende Frauenstimme. »Wer hat den großen Geier hereingelassen?« Den dreisten Satz, mit einem schottischen Akzent versehen, hatte natürlich Fay Fraser von sich gegeben. Die Rothaarige trug einen leichten, kurzärmeligen Frotteebademantel, der ebenso smaragdgrün wie ihre leuchtenden Augen war.
»Liebste Fay«, erinnerte Yamina die Frau in säuselndem Tonfall. »Bedenke immer, dass Toran kein gewöhnlicher Vogel ist. Er kann dich sehr gut verstehen. Hubertus erzählte mir, dass er alle Sprachen der Welt beherrscht, selbst die ungewöhnlichsten Dialekte, wenn dies notwendig sein sollte.«
Fay blickte den Greifvogel an, der ihrem Blick prüfend standhielt, und deutete eine Verbeugung an. »Verzeih mir, du wundersamer König der Lüfte.« Toran stieß darauf einen scharfen Falkenschrei aus und bewegte nickend sein Köpfchen. Er hatte die Entschuldigung angenommen.
Die gebürtige Schottin streifte den Bademantel ab und schlenderte nackt zu einem Whirlpool. »Hubertus?«, fragte sie nach. »Ist das nicht auch Püppchens Engel?« Bei der Bezeichnung Püppchen hatte sie Firesaa freundlich zugezwinkert und sie dabei liebevoll angelächelt. Das Baby quittierte dies mit einem niedlichen Glucksen.
Yamina legte Firesaa auf die Wickelablage und kontrollierte ihre volle Windel. »Ja, Hubertus Allmenhausen ist der Schutzengel meiner Kleinen.« Strahlend schob sie nach: »Außerdem ist der Gute mein Sprachlehrer in Sachen Oxford-Englisch - für besonders fremdsprachenresistente Menschen!«
»Ach was, Süße«, lobte Fay. »Hat er echt geil hingekriegt - und du ebenfalls!« Die Schottin tauchte ihren mit frechen Sommersprossen verzierten Körper tiefer ins warme Wasser und legte ihren Nacken auf den Rand des Whirlpools. »Engel können mir im Augenblick echt gestohlen bleiben!«, sagte sie plötzlich düster und verstimmt klingend.
Nara sagte etwas auf Hidsanisch aus dem Nebenraum.
»Was meint sie?«, hakte Fay nach, schaute Yamina fragend an, die ein wohlriechendes Öl auf dem zarten Babypopo verteilte und diesen in eine frische Windel hüllte.
»Nara meint«, übersetzte Yamina, »dass du dankbar für die Engel sein musst.«
Fay zog eine Trotzschnute und verunstaltete damit ihr schönes Antlitz. »Nara hat gut reden!«, nörgelte die Rothaarige los. »Die Gute ist eben nicht mit Samuel zusammen, der ganz offensichtlich fremdgeht und mich hemmungslos betrügt!«
Yamina weitete ihre braunen Augen und rief etwas auf Französisch in den Nebenraum, um Nara entsprechend zu informieren, die nicht so gut Englisch verstehen konnte. Nara veränderte daraufhin ihre Stimmlage ins Jammervolle und Zornige, und ein paar Mal konnte man deutlich das Wort merde, verstehen, als sie im Nebenraum mit sich selbst zeterte.
»Nara meint ...«, wollte Yamina übersetzen.
»Danke, Yamina! Meine Französischkenntnisse reichen für das Wort Scheiße aus!«, entgegnete Fay Fraser gereizt und schmollte dann wieder äußerst weiblich in Mimik und Blick.
»Hast du Beweise, dass Samuel eine andere Frau fickt?«, fragte Yamina ziemlich unverblümt und war über sich selbst erschrocken, dass sie auf diese direkte Art danach gefragt hatte.
»Klar doch, meine Liebe!«, schnaubte es Schottisch gefärbt. »Sam wirkte in letzter Zeit so dermaßen geschlaucht, wenn er auf mir war. Da habe ich ihn direkt danach gefragt, und er hat mir sehr direkt geantwortet.« Fay fletschte ein wenig und zeigte makelloses Zahnweiß. »Und du weißt ja, wie direkt diese Himmelsboten mit Nachrichten an die Sterblichen sein können, oder?«
Yamina sagte nichts darauf. Sie selbst hatte mit Samuel, dem Gärtner, bisher kaum etwas zu tun gehabt. Auch mit Bharati und Stephanie, den Engeln der Exekutive, war es nie mehr als Smalltalk gewesen. Nur mit Hubertus Allmenhausen hatte sich die Algerierin oft und lange unterhalten. Und Hubertus war stets galant in Wortwahl und Betonung gewesen. Yamina schaute Fay ins Gesicht. »Wer ist sie? Kennst du die Frau persönlich?«, fragte sie, hatte gedankenlos ihre Berbersprache benutzt, korrigierte sich jedoch gleich und wiederholte die Fragen auf Englisch.
»Das ist es ja, was mich am meisten ankotzt!«, blökte Fay ungehalten. Sie patschte dabei zweimal mit den flachen Händen ins Whirlpool-Wasser, dass es auf den Boden spritzte. Toran wurde dabei ein wenig nass und meckerte mit einem kurzen Schrei. »Sie ist eine Engelsfotze!«, zischte Fay vulgär zwischen den Zähnen hindurch.
Yamina erbleichte. »Du solltest nicht in dieser Weise über einen Engel sprechen, Fay!«, ermahnte sie die Schottin und warf ihr einen strafenden Blick zu. »Das ist Sünde! Und Schlimmes zieht immer Schlimmes nach sich!«
»Ich fühle mich aber angepisst!«
»Es bringt dir aber nichts, deshalb widerlich vulgär zu werden, Fay!«, warf Yamina scharf zurück. »Beschmutze dich nicht noch mehr mit negativen Worten! Und mich auch nicht!«
Smaragdgrüne Augen veränderten ihren Glanz im Zorn. »Ach, ich beschmutze mich und dich, ja? Irgendeine himmlische Schlampe greift sich meinen Sam und zieht ihn sich rein und ...!«
»Du vergreifst dich maßlos im Ton!«, brüllte Yamina Fay ärgerlich an. »Du entehrst dich mit diesem Verhalten und jeden, der dir zuhört!«
Im Nebenraum wetterte Nara ebenfalls auf Hidsanisch und auf Französisch im Wechselspiel.
»So?« blaffte Fay. »Ich entehre dich?« Die Schottin fühlte sich nun zusätzlich provoziert. »Bist du jetzt etwas Besseres als ich, weil du den ehrenwerten Limhaa heiraten wirst, hä? Du bist doch auch nur eine ganz gewöhnliche ...!«
»Lala-lalalaaa-dada-dadadaaa!«
Nara stürzte erstaunt aus dem Nebenraum. Fay und Yamina sahen die kleine Firesaa mit offenen Mündern an. Wieder formte das Baby die melodischen Laute und sah die drei Frauen dabei fröhlich an. »Lala-lalalaaa-dada-dadadaaa!« Nachdem schönen Singsang jauchzte Firesaa und gluckste herzhaft zum Abschluss.
»Sag mal?«, fragte Fay Fraser überrascht nach. »Ist Püppchen nicht noch zu klein für sowas?«
Yamina streichelte dem Baby übers Köpfchen und wiegte die Kleine sanft in ihren Armen. »Ja, das ist ziemlich ungewöhnlich!« Die Algerierin küsste Firesaa auf beide Wangen.
»Firesaa kann schon eine richtige Melodie singen?«, fragte Nara auf Hidsanisch. »Wer hat ihr das beigebracht?«
»Ich bin ebenfalls völlig erstaunt darüber«, antwortete Yamina ihr auf Französisch. »Das hat Püppchen bisher noch niemals gemacht.« Die Pflegemama strahlte das Baby an, das sofort zurückstrahlte.
»Oh, die Kleine ist früh dran«, meinte Nara. »Gutes Zeichen!« Nach diesen Worten verschwand die Dienerin wieder im Nebenraum.
Verwirrt saß Fay Fraser im Whirlpool. »Also, was wollte ich gerade sagen?« Sie wusste es nicht mehr, hatte den sprichwörtlichen Faden verloren.
Yamina half ihr nach. »Du warst komplett am Ausrasten und wolltest mich bitterböse beleidigen.«
Fay weitete ihre smaragdgrünen Augen. »Grundgütiger! Nein, das wollte ich gewiss nicht!«, wehrte sie sich sichtlich betroffen. »Ich würde dir doch niemals etwas Schlimmes sagen. Wir sind doch Freundinnen.«
»Doch«, beharrte Yamina. »Das wolltest du, meine Liebe - und zwar ziemlich ungerecht und ziemlich heftig. Du hattest maßlosen Zorn und Wut in dir, Fay. Schon vergessen?«
Die Rothaarige runzelte die Stirn. »Seltsam«, erklärte sie. »Ich erinnere mich wieder an meine Sätze. Aber es scheint so, als sei mein Zorn verflogen.« Fay lächelte verwirrt über das Rätselhafte. »Als hätte jemand meinen Zorn einfach fortgenommen.«
»Lala-lalalaaa-dada-dadadaaa!«, sang Firesaa ein weiteres Mal und jauchzte schließlich glücklich dabei.
Und Fay Fraser wurde es ganz warm ums Herz. Wohlig warm.
4. Was geht hier ab?
Norditalien
»Bist du sicher, dass dein Käfer nicht schlappmacht?«
Vor zwei Stunden hatten sie Arthur McFadden an einer schlichten Waldkreuzung abgesetzt, und Sandrina hoffte sehr, dass sich ihr Freund auf dem sicheren Zufahrtsweg zum Schloss der Contessa di Stefano befand. Er hatte ihr nach einem tränenreichen und sehr gefühlvollen Abschied versprochen, gleich eine Textnachricht zu schreiben, wenn er das Ziel erreicht hatte.
Ein Jahr.
Ein ganzes Jahr würden sie sich nicht mehr sehen, berühren und lieben können. Obwohl das mit dem Sehen in den Zeiten von Webcam-Übertragungen eigentlich nur eine Wortfloskel war. Sandrina dankte dem Erfindungsreichtum der Menschen. Zum Glück gab es Smartphones, die machten eine vorübergehende Trennung um einiges erträglicher.
»Mein Wagen«, sagte die Gräfin gutgelaunt, »knatterte schon vor deiner Geburt diese Hänge hinauf und hinab, meine Liebe. Ich besuche die Contessa regelmäßig.«
Sandrina fragte sich, was Unsterbliche unter dem Wort regelmäßig verstanden. Kurz dachte die Italienerin an ihre Eltern Chiara und Michele. Giuseppe Fredi, der ebenfalls von der geheimnisvollen deutschen Gräfin von Weystedt rekrutiert worden war, hatte die Rossis nach Monza begleitet. Dort würden sie auf Margarete und Sandrina warten, denn es gab noch eine kleine Angelegenheit in den norditalienischen Wäldern zu erledigen.
Über diese kleine Angelegenheit hatte die Gräfin bisher beharrlich geschwiegen.
»Magst du Rotwein?«, fragte Margarete unerwartet. Eine Frage, die Sandrina Rossi überaus amüsierte.
»Ebenso gut kannst du eine Italienerin fragen, ob sie katholisch getauft ist«, antwortete die Blondine schlagfertig.
Die weißhaarig bezopfte Margarete lächelte sanft. »Sehr gut. Das erleichtert das Kommende sehr.«
Nun war Sandrina gespannt. »Wäre dies nicht ein guter Zeitpunkt, um mich einzuweihen?«
»Nein, noch nicht«, meinte die Gräfin knapp und beließ es dabei.
Ein Ping signalisierte eine Textnachricht. Sandrina schaute auf das Display ihres Smartphones: Arthur war sicher im Schloss angekommen.
30 Minuten später erreichten sie die ersten Häuser eines Bergdorfes. Der Käfer knatterte in die Ortsmitte. Der Kirchturm zeigte 16:00 Uhr an; die Glocke schlug gerade. Trotz der beißenden Kälte waren Einwohner unterwegs. Sandrina konnte auch einige Autos in den Seitenstraßen erkennen. Auf den roten Ziegeldächern sah man Strommasten.
Grazie, wir sind in einer zivilisierten Gegend, dachte Sandrina erleichtert. Weiter im Norden gab es noch das eine oder andere Dorf ohne Stromversorgung. Das war hier - glücklicherweise - nicht der Fall. Doch was wollte die Gräfin hier? Gab es in dem Ort einen Todsünder, den sie im Namen Gottes hinrichten wollte?
Margarete von Weystedt parkte den Käfer auf einem mit Schotter bedeckten Parkplatz an der Kirche und schaltete den Motor ab. Die Gräfin zeigte auf ein Häuschen im ländlichen Stil, das unmittelbar neben dem winzigen Dorffriedhof stand. Breite Risse zierten die Frontseite des Fachwerkhauses. Drinnen brannte Licht, da es in der Novemberzeit schon früh zu dunkeln begann.
»Das ist unser Ziel!«, erklärte Margarete freudig.
»Willst du dort drin jemanden hinrichten?«
»Um Himmels willen! Wie kommst du auf sowas, meine Gute? Nein, wir sind wegen dir hier!«
»Wegen mir?« Sandrina war nun völlig verwirrt.
Margarete gurtete sich ab. »Komm, Sandrina! Wir haben nicht ewig Zeit, und wir wollen deine Eltern und Giuseppe nicht unnötig auf uns warten lassen. Außerdem gehen die Dorfbewohner hier sicherlich früh zu Bett. Avanti, Signora!«
Die beiden Damen kletterten aus dem Auto und gingen zu dem Fachwerkhaus. Über dem abgenutzten Klingelknopf stand der Name Lino.
Wer oder was war ein Lino?
Margarete läutete. Sekunden später hörte sie schnelle Schritte von innen zur Eingangstür laufen.
Ein sportlicher Typ, analysierte Sandrina das Laufgeräusch.
Ja, du hast recht, bestätigte Diana, ihre innere Lehrmeisterin, in ihrem Kopf. Signora, der Bewohner ist ein Mann - etwa Mitte 20 - und gut trainiert dazu! Wahrscheinlich ein schmucker Bergbauernsohn, um sich anzulehnen, witzelte die Dämonin in Sandrina. Naja, hoffe ich zumindest!
Schwungvoll wurde die Tür geöffnet. Im Türrahmen erschien ein kleinwüchsiger Mann, deutlich über 80 Jahre alt. Er hatte beidseitig ein Hörgerät und eine dicke Brille.
Das kann nicht sein, erschrak Diana, und Sandrina dachte dasselbe.
»Ich grüße dich, lieber Lino!«, flötete Margarete von Weystedt zur Begrüßung. Der Kleinwüchsige nickte wortlos, dann beäugte er Sandrina Rossi.
»Das ist die, Lino, die deinen Wein kosten wird«, meinte die Gräfin und stellte Sandrina vor. »Das ist die Erwartete, die Signora Sandrina Rossi.«
Sandrina lächelte den Alten zögerlich an, der sie noch immer ernsten Blickes musterte.
»Willkommen in meinem Haus!«, sagte Lino plötzlich mit einer sehr warm klingenden, freundlichen Stimme. »Der Rotwein steht bereit.«
Was geht hier ab?, dachte Sandrina. Was für ein Film läuft hier?
Sandrina Rossi sollte bald zufriedenstellende Antworten auf diese beiden Fragen erhalten. Denn sie waren am Ziel angekommen.
Bei Lino.
Und Lino war anders.
Ganz anders.
5. Im Wein liegt keine Wahrheit
Im offenen Kamin knackten rotglühende Holzscheite. Angenehme Wärme durchflutete Linos Esszimmer, in dem sich deutlich der ländliche Stil der Region widerspiegelte.
Sandrina Rossi, Margarete Gräfin von Weystedt und der kleinwüchsige Greis saßen an einem rustikalen, rechteckigen Tisch, auf dem eine offene Rotweinflasche ohne Etikett und ein edles Weinglas standen.
Keiner sprach ein Wort; selbst Diana, die für ihre oftmals nervigen Kommentare bekannt war, schwieg geduldig und war wie Sandrina sehr gespannt darauf, was nun kommen würde.
»Sie sollten wissen, dass es eine Lüge ist«, sagte Lino unvermittelt und blickte dabei die Signora an.
Die Blondhaarige schaute ungläubig und fragend zugleich und hakte auf Italienisch nach: »Von welcher Lüge sprechen Sie, Signor Lino?«
»Dass im Wein die Wahrheit liegt. Ich finde nämlich, er kann kräftig lügen«, antwortete der Alte mysteriös. Schließlich ergriff er flink und behände die Weinflasche und goss das Weinglas halbvoll. Rasch schob er es Sandrina zu und stellte die Flasche in die Tischmitte zurück.
Huch, wie flott der Alte eingegossen und serviert hat, ließ sich Diana zu einer Bemerkung hinreißen.
Kein Mittachtziger ist so zielsicher und schnell, dachte auch Sandrina.
Was stimmte hier nicht?
Margarete lüftete das unglaublich klingende Geheimnis, das Sandrina zuerst für einen Scherz hielt. »Lino ist ein sehr fleißiger Weinbauer, Sandrina. Und er ist 35 wie du!«
Ach du Scheiße, entfuhr es Diana.
»Nie und nimmer«, sprach Sandrina ihren Gedanken aus.
»Doch. Es ist wahr«, lächelte der kleinwüchsige Alte verschmitzt. »Und ich bin natürlich kein Zwerg. Im Frühjahr bin ich 1,90 Meter groß.« Er grinste kurz. »Im Herbst, nach der Weinlese am Hang, bin ich ein paar Millimeter kleiner. Wegen der schweren Arbeit.«
Sandrina provozierte ein wenig: »Lassen Sie mich raten, Lino. Unsterblich sind Sie sicherlich auch, nicht wahr?« Die blonde Signora blickte augenzwinkernd die deutsche Gräfin an. »Unsterblich wie Margarete, oder?«
»Leider nicht. Ich bin nur ein besonderer Mensch wie ihr Freund Arthur ebenfalls.«
Glotzblick der Signora. »Sie sind ein Engelskind?«
»Richtig«, bestätigte der Greis. »Mein Vater ist ein ehemaliger Gärtner, und meine Mutter, die leider vor zehn Jahren verstarb, war eine Bäuerin. Vater lebt noch im Oberdorf. Er ist mittlerweile 75.«
»Aha«, meinte Sandrina. »Gärtner und Bäuerin. Und wer von beiden ist nun der Engel?«, fragte sie und konnte sich ein freches Lächeln nicht verkneifen.
»Ein Gärtner ist die Bezeichnung für einen sehr mächtigen Engel im Himmel«, klärte Margarete das Missverständnis auf. »Die Gärtner sind dem Herrn direkt unterstellt.«
Der alte Lino strahlte Sandrina aus seinen grauen Augen an. »Ja, ich bin besonders, und man hat mir ein besonderes Talent als Weinbauer in die Wiege gelegt.«
Sandrina schaute auf das gefüllte Weinglas. »Si, Signor. Sie machen Rotwein«, sagte sie trocken.
»Richtig«, erklärte Lino weiter. »Normale Weine für den Markt da draußen. Andere Weine für die Hellen.«
Wieder betrachtete Sandrina das halbgefüllte Weinglas vor ihr auf dem Tisch. »Und dieser Rotwein ist bestimmt ein besonderer, oder?«
»Molto bene, Signora! Er ist wahrlich ein Tropfen für spezielle Anlässe.« Er hob den Zeigefinger in die Höhe, was irgendwie mahnend aussah. »Und ein einziges Glas genügt.«
Das nervt langsam, maulte Diana in Sandrina. Wann lässt der Kauz die Katze aus dem Sack, was das Ganze hier soll?
»Wann lassen Sie endlich die Katze aus dem Sack, Signor?«, wiederholte Sandrina fordernd.
Lino sah Margarete an. »Willst du - oder soll ich?«
»Ich übernehme das gerne für dich, lieber Lino!« Die Gräfin zeigte auf das Weinglas. »Ich mache es kurz und knapp, da die Zeit drängt, und wir beide noch nach Monza fahren müssen.« Sie strahlte mit ihren hellblauen Augen. »Lino ist in Wirklichkeit ein großgewachsener und bemerkenswert attraktiver Mann.«
Sandrinas ungläubiger Blick fiel automatisch auf den alt aussehenden Zwergwüchsigen mit den schlohweißen Haaren und den tiefen Falten im hageren Gesicht. »Linos spezielle Weinsorten können optische Illusionen dieser unglaublichen Art und Weise hervorrufen - und anderes mehr.«
»Optische Illusionen?«, fragte Sandrina skeptisch nach. »Aber ich habe doch noch keinen einzigen Schluck davon getrunken? Wie kann ich mir sein Aussehen einbilden?«
»Es ist andersherum«, erklärte Margarete. »Derjenige, der trinkt wird für andere zur Illusion. Das ist der Trick! Und sogar zu einer perfekten Illusion. Selbst die Stimme ist veränderbar.«
»Si«, bestätigte der Alte dies. »Mir sind unzählige Dinge möglich, wenn ich meine Rebsorten kreuze.«
Sandrinas Gehirn arbeitete auf Hochtouren. »Wie lange hält das an?«
Der Zwergwüchsige lachte erheitert. »Oh, für Sie, Signora, werde ich immer der alte Zwerg sein. Ich habe den Wein, den ich vor wenigen Stunden getrunken habe, daraufhin mit Zusätzen abgestimmt.«
Sandrina Rossi blickte Margarete von Weystedt an. »Wie siehst du ihn?«
»Groß. Ein ziemlich heißer Typ«, antwortete Margarete lockerherzig, was gar nicht zu einer edlen Gräfin passte. »Wäre ich jünger, könnte ich schwach werden.«
»Grazie für das Kompliment!«, freute sich der Alte und lachte der Gräfin fröhlich zu.
Langsam ließ Sandrina das Unglaubliche an sich heran. »Das heißt also, dass die Dorfbewohner Sie in Ihrer richtigen Erscheinung sehen, Signor? Nur ich sehe die Illusion, stimmt das?«
»Sie haben es erkannt«, schmunzelte der Greis. »Ich will doch meine junge Gattin nicht erschrecken.«
»Sie ... Sie sind verheiratet?«
»Aber natürlich, Signora! Ich bin 35 und Italiener - ich darf verheiratet sein! Und vier Bambini habe ich ebenfalls.«
In Sandrinas Augen blitzte eine Frage auf, doch der Alte kam ihr zuvor. »Meine Familie befindet sich in Rom. Meine Frau besucht dort ihre Schwester.«
Erneut starrte Sandrina das Weinglas an, konnte allerdings die Puzzleteile in ihrem Geist noch nicht zusammenfügen. Was sollte das hier wirklich?
Als hätte Margarete ihre Gedanken gehört, erklärte sie: »Die aufwändige kosmetische Gesichtsoperation, um dein Aussehen für andere zu verändern, können wir hier bei Lino mit einem Schluck Wein durchführen. Deswegen sind wir hier.« Die Gräfin lachte belustigt. »Das spart Thomas Bendermann jede Menge Geld ein. Und du musst nicht extra nach Kuba fliegen, um dich unters Messer zu legen. Linos Wein ist besser und schmerzloser als das.« Margarete grinste. »Kein Fahnder wird dich mehr erkennen können, Sandrina. Die meistgesuchte ehemalige Auftragskillerin der Dunklen kann sich dann unerkannt und furchtlos unter den Menschen aufhalten. Niemand wird dich mehr finden. Niemals mehr.«
Du heilige Scheiße, wie krass ist das denn?, entfuhr es Diana.
»Du heilige Scheiße!«, flüsterte Sandrina unüberlegt.
»Auf solche dummen Formulierungen«, mahnte die Gräfin, »verzichtest du bitte zukünftig. Du bist jetzt den Hellen zu Diensten, meine Liebe. Und Scheiße ist niemals heilig.«
Sandrina ignorierte den Hinweis, war viel zu aufgeregt. Mit großen Augen sah sie Lino an, und wieder war er schneller. »Ich habe Ihren Wein sehr gut mit Zusätzen verfeinert und perfekt abgestimmt. Das bedeutet, dass Sie sich als Sandrina in jedem Spiegel sehen können - und ebenfalls jeder, der sie aus vollem Herzen liebt.«
Sandrinas Herz hüpfte. »Dann werde ich für Arthur und meine Eltern ...?«
»Si, Signora. Für diese drei Menschen werden Sie optisch und stimmlich unverändert Sandrina bleiben. Das ist mein Geschenk an Sie, an eine überaus attraktive Italienerin.« Humorvoll ergänzte er: »Nur die Sucht nach Schokolade und Süßkram wird erhalten bleiben. Da konnte ich leider nichts machen. Das ist Ihre Bürde.«
»Grazie«, antwortete Sandrina ausgelassen. »Damit kann ich leben.«
»Noch Fragen?«, wollte der kleinwüchsige Alte wissen.
»Si, Signor Lino. Bleibe ich für alle blond?«
»Selbstverständlich. Blond und blauäugig und wunderschön. Die Veränderungen betreffen hauptsächlich Gesicht, Stimme, Zähne und Fingerabdrücke. Alles, was Sie als Gesuchte identifizieren könnte, wird vom Wein modifiziert. Und das auf Lebenszeit. Vertrauen Sie mir. Ich bin ein hervorragender Winzer.«
»Eine Frage noch, Signor. Wird mir Diana, meine innere Lehrmeisterin, erhalten bleiben?« Sandrina ging mit dieser direkten Frage davon aus, dass Lino von ihrer Dämonin wusste. Das Informationsnetzwerk der Hellen war bestimmt lückenlos und übernatürlich gut über den gesamten Erdball verbreitet. Und die Italienerin sollte mit dieser Annahme recht behalten.
»Ihre Diana«, sagte der Alte, »steht Ihnen weiterhin zur Seite. Ein Leben lang wird sie das tun.«
Grazie, Grazie, Grazie, jubelte Diana im Inneren und dankte Gott dafür.
»Noch was«, erwähnte die Gräfin. »Wenn du dich entschließt, den Wein zu trinken, wirst du ab heute Tara heißen. Tara Wilcox, Engländerin. Signora Sandrina Rossi wird heute endgültig zu den Akten gelegt.«
Damit war alles gesagt.
Sandrina Rossi ergriff ohne weitere Worte das Glas Rotwein und stürzte es einfach hinunter. »Was für ein guter Tropfen!«, sagte sie, dass ihre smaragdgrünen Augen vor Freude strahlten.
Und Tara Wilcox war geboren.
Ganz einfach.
Einfach so.
6. Kuh im Nachthemd
»Ich sehe darin aus wie eine trächtige Kuh im Nachthemd!«
Im Jahre 2016 gab es Frauen, denen es egal war, was herumstehende Menschen von ihnen dachten. Frauen, die mitten im Leben standen. Frauen, die es gerne auf den Punkt brachten und mit der oft zitierten Tür ins Haus fielen. Frauen, wie Lydia van Bush.
»Und ich denke, dass du wieder eine Spur zu selbstkritisch bist, Liebes.«
Im Jahre 2016 gab es Männer, denen es nicht egal war, was herumstehende Menschen von ihnen dachten. Männer, die mitten im Leben standen. Männer, die eine starke soziale Kompetenz in sich trugen und irgendwie besonders waren. Männer, wie Karl Wisemeyer.
Eine Shoppingtour in der New Yorker Fifth Avenue konnte eine langwierige und kräfteraubende Abenteuerreise sein. Nach der zehnten (!) Boutique für die Lady von Welt hatte Karl Wisemeyer aufgehört, die Anzahl der besuchten Geschäfte zu zählen. Seit fünf (!) Stunden waren die schwangere Lydia van Bush und er im vorweihnachtlichen Einkaufsrummel zugange. Er selbst hatte schon in der ersten Stunde des stressigen und recht zweifelhaften Einkaufsvergnügens einen passenden Anzug nebst Schuhen finden können.
Ich bin ja - dem Himmel sei Dank! - kein Weib, dachte er immer wieder, ohne es laut auszusprechen.
»Und dann noch in Weiß!«, hörte er Lydia lautstark wehklagen, nein, eigentlich lautstark protestieren. »Wie bescheuert ist denn der Einfall? Eine Hochzeit, zu der auch die Gäste in weißen Klamotten erscheinen sollen! Sind wir jetzt alle jungfräulich geworden, oder was? Na ja, Mercy ist es ganz gewiss nicht!«
Die Verkäuferin, ein schmalhüftiges Etwas mit kastanienbraunen Haaren und von geringer Körpergröße, die neben der Schwangeren geduldig wartete, wirkte ein wenig verloren. Sie tat Karl fast leid. »Ich finde, das Kleid steht Ihnen gut«, ließ sich die verloren Wirkende zu einer unüberlegten Bemerkung hinreißen.
Oh, oh, wie gut, dass Liddi zwar eine göttliche Auserwählte ist, doch ihre Blicke nicht töten können, durchzuckte es Karl, als er bemerkte, wie furchteinflößend seine Verlobte die Schmalhüftige anvisierte.
»Sagen Sie, Miss«, meinte Lydia scharf, »sind Sie sicher, dass Sie Ahnung von Ihrem Job haben?«
Die Angeblaffte wurde rotbackig und bleich im rasenden Wechselspiel innerer Gefühle. »Aber«, fragte sie und lächelte unsicher, »ist nicht alles im Leben Geschmacksache?«
Lydia zeigte auf die Seiten des weißen Kleides. »Reiben Sie sich die Glotzer sauber! Sehen Sie, wie die Nähte hier spannen? Ich bekomme ja Atemnot!« Um das Gesagte zu untermauern, stöhnte sie übertrieben los.
»Nun ja«, wiegelte die Verkäuferin ab und versuchte, einen freundlichen Ton beizubehalten. »Sie sind eben ein wenig schwanger, Miss van Bush.«
Lydia stutzte kurz, strahlte dann übers ganze Gesicht, als hätte man ihr eine riesige Freude bereitet. »Sie kennen mich?«
»Wir sind New Yorker«, meinte die Frau zögerlich. »Wer kennt Sie nicht?« Lächelnd fügte sie an: »Ich habe alle Ihre Hits auf meinem Smartphone. Die kommen besonders gut beim Joggen!«
»Legal gekauft - oder im Netz geklaut?«, kam es aus Lydia wie aus der Pistole geschossen. Sie hatte in den letzten Jahren enorme finanzielle Einbußen durch Internet-Piraterie erlitten.
»Aber natürlich gekauft!«, antwortete die Verkäuferin ehrlich wie ein kleines Kindergartenkind. »Ich würde nie und nimmer etwas Ungesetzliches tun und ein Verbrechen begehen!«
Lydia hob eine Augenbraue an und biss verbal nach: »So? Mir solch einen Fummel anzudrehen, in dem ich wie ein ulkiger Schneemann wirke, ist definitiv ein Verbrechen! Für mich jedenfalls!«
Karl fühlte nun, dass Lydia noch eine andere Wut in sich pflegte. Die langwierige Shoppingtour alleine konnte es unmöglich sein, dass sie so überaus garstig und angepisst Fremden gegenüber reagierte.
»Sie meint es nicht so«, half Karl Wisemeyer der Verkäuferin, die wiederholt rot und bleich im Gesicht wurde.
»Natürlich meine ich es so!«, motzte Lydia mit wilden Augen ihren Karl an. »Was mischst du dich eigentlich ein, wenn zwei Ladys über Kleider reden, hä? Als Mann hast du da sofort die weltbekannte Arschkarte gezogen, mein Guter!«
Oh ja, sie hat gewiss noch andere Probleme! Womöglich mit mir? Und es zeigt sich beim Klamottenkauf!
Dennoch riss Karl der Geduldsfaden, der sich bei Sozialkompetenten und bei Netten, wie er einer war, besonders dick anfühlte. »Jetzt reg dich mal ab, Süße! Die Miss hat dir nichts getan. Du bist eben in der 15. Woche. Da ist es mit stilvollem Kleidertragen und mit Promenieren nicht mehr so einfach! Punkt!«
Lydias Blick sprach Bände, die jenseits des Jugendschutzes waren. Hinter diesen Augen loderten Gedanken und Worte, die jeden in Salzsäulen erstarren lassen konnten. »Erstens«, schnaubte sie ungebremst. »Ich bin in der 16. Woche. Und zweitens halt dich raus, okay? Sonst kannst du dir später selbst einen blasen!«
Karl Wisemeyer entschied das zu tun, was er in dieser verbal brisanten Situation für richtig hielt. Was Lydia in Wirklichkeit beschäftigte, konnte er später noch ergründen. »Ich glaube, ich lasse die beiden Ladys alleine in der Findungsphase. Haben Sie eine Kundentoilette, Miss?«
Wieder glühte die Schmalhüftige rotbackig auf. »Nein, Sir. Tut mir leid. Normalerweise sind die Kunden nicht so lange bei uns in den Geschäftsräumen.«
Jetzt wurde Karls markant männliches Gesicht von purer Fassungslosigkeit geprägt. So etwas hatte er in einem exklusiven und sündhaft teuren Modegeschäft in der Fifth Avenue nicht erwartet.
»Siehst du, Schatz?«, säuselte Lydia zynisch. »Hier verkaufen sie Nachthemden für Kühe und haben nicht mal ein gescheites Klo zum Pissen! Komm, lass uns gehen! Es gibt noch andere Läden in der City.« Kurz blickte sie die verschüchterte Verkäuferin an, hatte plötzlich Mitgefühl trotz des Grolls. »Das geht nicht gegen Sie, Miss. Ich muss in letzter Zeit mit vielen Dingen klarkommen.« Dann rauschte Lydia in die Umkleidekabine, um wieder die eigene Kleidung anzuziehen.
Wusste ich es doch, dass sie noch ein anderes Problem hat, dachte Karl Wisemeyer.
7. Sicherheit geht vor
»Ich denke nicht«, erklärte Ansgar Gradener, »dass deine vorgesehenen fünf Sicherheitsleute ausreichen werden. Ich habe mir heute Morgen das Gebäude nochmal angesehen. Das komplette Kirchenschiff und der riesige Altarbereich sind alles andere als einfach abzuschirmen.« Er machte eine kurze Gedankenpause. »Und bei den 500 geladenen Gästen auf den Kirchenbänken und den vielen Pressevertretern an den Seiten solltest du beim Thema Sicherheit nicht nachlässig sein.«
Thomas Bendermann, in einem cremefarbenen Sakko und einem krawattenlosen weißen Hemd, saß an seinem antiken Schreibtisch im Arbeitszimmer seiner New Yorker Penthouse-Wohnung und hörte aufmerksam zu. Sein Enkelsohn, der gleichzeitig sein persönlicher Assistent und Bodyguard war, hatte einen Laptop aufgeklappt, auf dessen Bildschirm die Baupläne und die Grundrisse der Woodruf Church dargestellt waren. Ansgar zeigte darauf. »Wir sollten auf jeden Fall einige Männer in den Reihen der Kirchenbänke positionieren. Zusätzlich vier weitere an den jeweiligen Ausgängen. Die Empore und der Orgelbereich stellen ebenfalls ein Sicherheitsrisiko dar.« Ernst schaute er seinen Großvater an. Ein Blick, an dem man klar erkennen konnte, dass er sorgfältig über das Sicherheitskonzept nachgedacht hatte, um das Risiko einer Gefahrensituation zu minimieren.
Der grauhaarige Geschäftsmann schaute ihn dennoch mit amüsiertem Gesicht an, hielt wohl das berufsbedingte Sicherheitsdenken seines Enkels für überzogen. »Dir ist aber schon klar«, sagte er verschmitzt blickend, »dass ich nur Thomas Bendermann und nicht der Präsident der Vereinigten Staaten bin?«
Ansgar Gradener verzog keine Miene, konnte den unnötigen Scherz seines Großvaters nicht gutheißen. »Es mag ja sein, dass du die ehemaligen Mitglieder des Syndikats ausgetrickst und unter Kontrolle hast, Grandpa«, erklärte der Schwarzhaarige in dem weißen Kaschmirpulli. »Dennoch solltest du niemals die potentiellen Gefahren von anderer Seite unterschätzen.«
Bendermanns Lippen bildeten einen Strich, ehe er fragte: »Du sprichst von den Möglichkeiten der Dunklen?«
»Richtig. Denn trotz des geweihten christlichen Schauplatzes, kann das Böse immer Wege finden.« Ansgar rief sich die Bilder des Anschlages in Dubai in Erinnerung: die Attacke in der Lobby-Bar eines Luxushotels. »Wenn du dabei gewesen wärst, Tom, als Cooper und Miller damals durchdrehten. Nur zwei Maschinenpistolen haben innerhalb weniger Augenblicke ein Blutbad und ein unbeschreibliches Chaos angerichtet.«
Jetzt wurde auch Thomas Bendermann besorgter, erinnerte sich an die schrecklichen Bilder, die tagelang über den Bildschirm flimmerten. Ansgar ging noch weiter, um die Erinnerungen Bendermanns aufzufrischen. »Laut Mercy haben die Dunklen sogar die große Flugzeugkatastrophe verursacht, die unzähligen Menschen das Leben gekostet hat.«
»Ja. Unsere Kleine hat mir davon erzählt. Angeblich ist ein sogenannter Shitface dafür verantwortlich zu machen.« Thomas Bendermann goss sich Scotch nach. Sein Enkel lehnte ein weiteres Glas wortlos mit der Hand ab.
»Sie haben eine Linienmaschine zum Absturz gebracht, Tom. Nur um in der darauffolgenden Feuerhölle Mercy und Lydia in ihre Gewalt zu bekommen.« Ansgar zeigte erneut auf den Gebäudegrundriss der Kirche. »Bei der Hochzeitszeremonie präsentieren sich alle drei Auserwählten regelrecht auf einem Serviertablett.« Ansgar biss sich nervös auf die Unterlippe, wirkte nun ziemlich angespannt, hatte enorme Sorgen in sich, besonders um Mercy Bowlers.
»Wie sieht eigentlich die Prophetin die Sicherheitslage in der Woodruf Church? Ist Estelle Brukner ebenso besorgt wie du?«
Ansgar atmete erschöpft aus und ließ sich in den Ledersessel vor dem Schreibtisch fallen. »Sie vertraut meinem Konzept - und den himmlischen Kräften.«
»Oha, höre ich da einen zynischen Gottlosen sprechen? Welche himmlischen Gäste sind denn zu erwarten?« Thomas Bendermann beugte sich ein wenig zu Ansgar hin. »Und werden sie unsichtbar sein?«
»Alle werden unsichtbar sein«, informierte ihn Ansgar. »Bharati und Stephanie werden selbstverständlich zugegen sein. Selbstredend Samuel höchstpersönlich, der sogenannte Gärtner. Und natürlich bringt Estelle ihre eigenen vier Engel mit.«
Bendermann unterbrach Ansgars Aufzählung. »Die Prophetin besitzt eigene Engel?«
»Frag nicht, Grandpa! Ich weiß auch nicht mehr. Zusätzlich stellt uns Estelle ihre neue Sicherheitschefin, eine Engländerin, eine gewisse Tara Wilcox, an die Seite.« Bendermann nickte ernst. Nur er wusste, wer diese Tara in Wirklichkeit war, und er wollte seinen Enkelsohn nicht unnötig beunruhigen.
»Und was ist mit Karl Wisemeyer?«, fragte er stattdessen.
»Stimmt. Den hatte ich völlig vergessen. Karl kommt ebenfalls bewaffnet zur Kirche. Ein zusätzlicher Bodyguard unter den Gästen kann nicht schaden. Er hat übrigens zusammen mit mir die Sicherheitsmannschaft im Vorfeld gecheckt und deren Kenntnisse als sehr gut bestätigt.« Genervt klingend ergänzte Ansgar: »Und natürlich wird Karls Schutzengel, die liebreizend aggressive Alexandra, ebenfalls unsichtbar anwesend sein.« Als ob er deshalb eine Belastung verspüren würde, sagte er: »Diese Alex ist auch mein Schutzengel. Die Einwechselspielerin für Toby.«
Thomas Bendermann verschluckte sich an seinem teuren Scotch und hüstelte lachend. »Was höre ich da? Karl und du, beide Personenschützer, ihr habt den gleichen Engel an eurer Seite?«
»Lass gut sein, Grandpa!«, entgegnete Ansgar. »Spar dir den Spott! Und ja, diese Alexandra beschützt auch mich - und sie hasst Atheisten abgrundtief!«
Thomas Bendermann schmunzelte. »Ich weiß nicht, ob ich dich deswegen bedauern oder beglückwünschen soll, mein Junge! Gott lässt die Gottlosen wirklich behüten? Für mich ist das wahrlich ein Wunder.«
»Sehr witzig, Tom«, entgegnete Ansgar trocken. »Vielleicht haben sie ihn ja bei der Entscheidung außen vorgelassen!«
Bendermann ignorierte die letzte flapsige Bemerkung, tat sie erneut mit verschmitztem Schmunzeln ab. Auch er hatte übersinnliche Begegnungen gehabt, als er in einem mysteriösen Koma gelegen hatte. Eine Begegnung mit zwei verstorbenen Frauen: Mara und Gwen. Die beiden Verstorbenen hatten ihn gewarnt. Beide hatten ihn gebeten, nein, definitiv aufgefordert, sein eigenes Leben zum Guten hin zu verändern. Seitdem glaubte Thomas Bendermann viel grundlegender an diese übernatürlichen Ereignisse.
»Also, wie stehst du dazu, Grandpa?«, riss ihn Ansgar aus seinen Gedanken. »Vertraust du mir? Stocken wir die Sicherheitsmänner auf - wenigstens während der Kirchenzeremonie?«
Thomas Bendermann trank sein Glas leer und stellte es hart auf die Ablage seines Schreibtisches. »Gut. Nimm so viele Leute, wie du für notwendig erachtest.« Ohne Humor in der Stimme und sichtlich von Ansgars Bedenken überzeugt, sagte er abschließend: »Du hast freie Handhabe. Mach die Hochzeit völlig sicher - für alle Anwesenden!«
Damit war alles gesagt. Für den Augenblick jedenfalls.
8. Miteinander und ineinander
Zwei glimmende Zigarettenspitzen hockten sich in der schicken Apartmentküche gegenüber. Der Aschenbecher in der Mitte des Tisches war halbvoll mit Kippen. Ein aufgeklapptes Fenster entließ den blauen Dunst auf die Straßen New Yorks. Die Küchenuhr, ein analoges Ding mit den Pyramiden von Gizeh auf dem Ziffernblatt, zeigte die Mittagszeit an.
In zwei Stunden war Schulschluss, und Ansgar Gradener würde seinen zehnjährigen Sohn Tobias am Campus mit dem Auto abholen. Er wollte nicht, dass der Kleine die öffentlichen Verkehrsmittel benutzte, obwohl dieser in Wirklichkeit ein 2.000 Jahre alter Ex-Engel war. Für die anderen da draußen war er schlicht ein normaler Junge, was er jetzt auch war. Wenn man die werktätige Verkehrslage in der City berücksichtigte, blieben dem Mann und der Frau noch 60 Minuten.
Dem Mann und der Frau.
Ihm und Mercy.
Er hatte sich dazu durchgerungen, ihr alles zu erzählen, was notwendig war.
Alles.
Alles über ihn und Valeria.
Valeria Cruz, Mercys Freundin, die Studentin und die Straßenritze, wie Mercy eine gewesen war.
»Ich sehe es deinem verdatterten halbherzigen Machoblick an, dass dir die Sache wirklich peinlich ist«, stellte die Blondhaarige unbeschwert, fast schon lockerlippig fest, wie es ihrer Wesensart gerecht wurde, dem Leben zu begegnen.
»Eher Reue«, meinte er und drückte die Fertiggerauchte im Ascher aus. »Mein weiblicher Engel - die garstige Neue! - hat dabei ganze Arbeit geleistet.«
»Gräm dich nicht! Wirklich. Und schon gar nicht wegen mir. Du standest mehr oder minder unter dem Einfluss der Dunkelflüsterer.« Mercy hatte ein bitteres Lächeln im linken Mundwinkel. »Glaube mir, du willst nicht wissen, wie ich mir als Fotzen-Betty meine Zeit vertrieben habe.«
»Kann man das vergleichen?«
»Hm. Irgendwie schon«, philosophierte die Blondhaarige in dem pinkfarbenen Schurwollpullover. »Unter normalen Umständen wären uns diese Dinge und Ereignisse niemals passiert.« Mit einem befreienden Mercy-Lächeln fügte sie an: »Wir waren beide Opfer der Umstände.«
Wie dankbar er ihr für diese Sätze war. So unendlich dankbar.
Sie schwiegen kurz, musterten sich intensiv, hielten beide den Blick des anderen aus.
»Ich liebe dich abartig tief«, flüsterte sie, obwohl sie in nur drei Tagen Ansgars Großvater, Thomas Bendermann, heiraten würde. »Und diese Liebe wird immer so begierig und tief sein.«
»So?«, fragte er ein wenig scheu nach, ließ sie dabei nicht aus den Augen. »Wird sie das wirklich sein? Immer?«
»Aber klar doch!«, rief sie beinahe jugendlich ungestüm. »Du bist ein wesentlicher Faktor meiner Prophezeiung. Estelle hat es mir damals auf dem Dach des Palastes klipp und klar gesagt. Und ich spüre, dass dies wirklich so ist.«
Die Sanftheit in ihren blauen Augen hatte er sich lange herbeigesehnt. Nun war sie zurück. Hier. Hier in seiner Apartmentküche. Und nichts hatte sich zwischen ihren beiden Herzen verändert. Im Gegenteil. Das Gefühl füreinander und zueinander schien noch durchdringender zu sein, als vor den wilden Lebensepisoden mit Betty Nothing und Valeria Cruz.
»Ich werde Thomas heiraten, doch du wirst immer die Liebe meines Lebens bleiben. Meine einzige wahre Liebe.« In einem absichtlich prophetisch klingenden Tonfall hängte sie an: »Dich, Ansgar, werde ich lieben bis zu meinem letzten Atemzug und darüber hinaus!«
Ansgar Gradener lächelte sie spitzbübisch an, obwohl er wegen Mercys Liebeserklärung überglücklich und froh war. »Ach? Und das weißt du wirklich jetzt schon?«
»Sicherlich«, antwortete sie sogleich. »Und ich weiß noch einiges mehr über uns beide, aber ich darf nicht darüber sprechen.«
»Wieso?«, reizte er sie absichtlich und grinste. »Geht es dann nicht in Erfüllung?«
Die Frau warf den Kopf in den Nacken und lachte kehlig. Wie sehr er dieses unwiderstehliche Lachen vermisst hatte.
»Nein«, erklärte sie immer noch halb lachend. »Ich darf dir nicht mehr sagen, weil dich dieses Wissen vielleicht um den Verstand brächte.«
Er krauste bewusst die Stirn. »In deiner Gegenwart«, gab er unverblümt zu, »ist mein Verstand eh nicht zu gebrauchen.«
Frech zwinkerte sie. »Wenn wir gleich wie die Tiere miteinander ficken, muss ich dich bitten, ein Kondom zu benutzen.«
»Wir machen gleich ... was?« Ansgar glaubte nicht, was er da gehört hatte. »Wie kommst du darauf, dass wir jetzt miteinander vögeln?« Entgeistert blickte er sie an. »Drei Tage vor deiner Hochzeit mit Tom?«, entfuhr es ihm abschließend.
»Weil ich feucht und heiß auf dich bin!«, meinte sie unbeschwert und schaute ihn mit diesen typischen Jägerinnen-Augen an, die er gut kannte. »Wenn du mich nicht gleich fickst«, flehte sie in einem gespielten Jammerton, »knallen bei mir alle vorhandenen Sicherungen durch! Und ich kann für deine Sicherheit nicht garantieren!«
Einen Augenblick später fegte sie über den Tisch und verbiss sich regelrecht in seine überraschten Lippen. Dann war es wie immer. Zungen wühlten und kämpften miteinander, wollten beherrschen und erregen. Ansgar wurde es heiß und kalt - und schließlich nur noch erregend heiß. Die lange angestaute Leidenschaft glich der Eruption eines aktiven Vulkans und entlud sich hemmungslos und allumfassend in einem beiderseitigen Rausch.
Als sie sich gegenseitig die Kleidung vom Leib zerrten, sich dabei unbändig liebkosten und wollüstig antrieben, fühlten sie endlich wieder, wie sehr sie sich begehrten, wie sehr sie sich liebten, wie sie ohne den anderen nicht sein konnten. Fordernd presste er seinen Unterleib zwischen ihre zarten Schenkel. »Das Kondom«, hauchte sie und lächelte ihn rotbackig an. »Ein Ratschlag meines Engels.« Kurz hielt er inne, und sie sah sein verdutztes erregtes Gesicht direkt über ihrem. »Du musst noch etwas wissen, Schatz«, erklärte sie sanft. »Ein wahres Wunder ist bei meiner Rettung geschehen.« Neugierig geworden unterbrach Ansgar die Welle der rasenden Lust, wollte unbedingt hören, was seine Liebste zu erzählen hatte, obwohl seine fast schon schmerzhaft starre Männlichkeit sehnsüchtig glänzte und triefte. »Was meinst du, Mercy?«
»Stephanie meinte, dass Karls Sperma nicht nur Betty vernichtet hat.« Ein zauberhaftes Strahlen umspielte ihre blauen Augen. »Es hat mich auch geheilt.«
Ansgar Gradener verstand die rätselhafte Andeutung sofort. Wegen der brutalen Vergewaltigung durch den Psychopathen Benjamin Micker war Mercy unfruchtbar geworden.
»Du meinst ...?« Ansgar war völlig perplex, als ihm die Tragweite gänzlich bewusst wurde.
»Yes, Mr. Gradener! Miss Bowlers ist wieder im Geschäft! Wir müssen uns vorsehen, denn Kinder sind jetzt nicht dran!« Sie schmunzelte herzallerliebst. »Noch nicht.« Ausgelassen küsste sie den Überraschten und war überglücklich ihm wieder nahe zu sein. Herzenstief und seelennah.
Er wollte noch weitere Informationen von ihr erfahren, kam jedoch nicht mehr dazu zu fragen, da er Mercys Mund spürte, wie er sich angenehm unbeherrscht um seine Festigkeit bemühte.
Nachdem er das Kondom übergezogen hatte, fickten sie in allen machbaren schweißtreibenden Stellungen. Und während Mercy Bowlers das zweite Mal erbebte, spürte sie, dass sie den falschen Mann heiratete.
Doch das war gleichgültig.
Denn so waren sie nun mal, der Plan und die Prophezeiung.
Nach 30 Minuten ergoss sich Ansgar Gradener hemmungslos, und sie kam ein weiteres Mal dabei.
Oh ja, zwei Liebende, zwei Unentschlossene, zwei unentschlossene Seelen und eine gnadenlos gefühlsstarke Liebesbeziehung.
Und ja, Mercy Bowlers, die Auserwählte, wusste vielmehr Einzelheiten über diese Liebesgeschichte als der schweißnasse und aushechelnde Ansgar Gradener.
Doch sie durfte es ihm nicht verraten.
Ihre Freundin Estelle, die inoffizielle Prinzessin von Hidsania und die Prophetin des Herrn, war in dieser Hinsicht ziemlich streng und eindeutig gewesen.
Sehr eindeutig und sehr streng.
»Ich liebe dich, Ansgar«, flüsterte sie zufrieden.
»Und ich liebe dich, Mercy«, antwortete er ehrlich.
Und dann kuschelten sie liebevoll miteinander und ineinander, denn sie hatten noch ein wenig Zeit, bevor Tobias Gradener abgeholt werden musste.
9. Übermüdet und ausgelaugt
Prinz Hidsaa, der Regent von Hidsania, war müde - und das schon am frühen Vormittag.
Dunkle Augenringe zierten das markant geschnittene Gesicht des Herrschers. Er hatte bis 02:00 Uhr nachts mit Investoren und Architekten via Webcam konferiert.
Der Plan, touristische und schulische Zentren in der Wüste zu bauen, gedieh und wurde von allen Beteiligten stetig vorangetrieben. Dank Samuel, dem Gärtner Gottes, und dessen himmlischer Entschlossenheit, moderne Wohn- und Ausbildungsmöglichkeiten für zukünftige FISH-Gläubige zu schaffen, waren in dem staubtrockenen Baugebiet auf wundersame Weise Wasserquellen erschlossen worden. Und das in einem Wüstenabschnitt, in dem wohl seit Entstehung der Erde kein Regentröpfchen mehr gefallen war. Nun gab es dort ein halbes Dutzend Oasen mit sich rasch ausbreitender Vegetation. Man sprach bereits von einem Wunder in Hidsania, was es richtigerweise auch war. Vor allem die internationale Sensationspresse stürzte sich wie wild auf dieses Thema und pflegte damit werbewirksam den Bekanntheitsgrad der neuen Prophetin Estelle Brukner, die offiziell ein bevorzugter Gast von Hidsaa war.
Es klopfte an der Tür zum Arbeitszimmer des Prinzen.
Hidsaa zog sich schnell den prunkvoll mit Edelsteinen verzierten Turban über, um wenigstens wie ein stilvoll gekleideter übermüdeter Mittdreißiger auszusehen. Er hatte die traditionelle Kopfbedeckung wegen einer pochenden Migräne abgenommen. »Herein!«, rief er auf Französisch zur Tür.
Limhaa, sein persönlicher Assistent und Vertrauter, trat ein und deutete eine Verbeugung an. Der mittelgroße schwarzhaarige Mann mit dem gepflegten Oberlippenbärtchen blieb vor dem gläsernen Designer-Schreibtisch stehen. »Verzeiht mir die Störung, werter Prinz«, begann er aufgeregt. »Aber wir haben unerwartete Gäste auf dem Anwesen.«
»Welche unerwarteten Gäste?« Der Prinz war irritiert. Hatte er ein Treffen mit Geschäftspartnern in seinem randvollen Terminplaner übersehen?
Seit Estelles Rückkehr aus der Vorhölle schien einfach keine Ruhe mehr in den zuvor gemächlichen Alltag in Hidsania einzukehren. Hidsaa hoffte ebenfalls inständig, dass es sich bei dem überraschenden Besuch nicht um irgendwelche Leute vom Film und Fernsehen handelte. Wie die beiden selbstverliebten amerikanischen Produzenten, die in der letzten Woche hier unangemeldet aufgetaucht waren und Estelle die Vorzüge eines eigenen Videokanals im Internet schmackhaft gemacht hatten. Seit ein paar Tagen geisterte die Prophetin deswegen digital durch die konsum- und medienorientierte Internetgesellschaft und machte eigens Werbung für sich und FISH. Als positive Wirtschaftsentwicklung für das Wüstenland hatte sich durch die Werbepräsenz die Anzahl der Besucher und Touristen in Gasmoo, der Hauptstadt von Hidsania, erheblich vergrößert. Die wenigen vorhandenen Hotels waren nun stetig ausgebucht beziehungsweise überbucht.
Mit Estelles Bekanntheitsgrad wuchs auch zeitgleich das Begehren der Presse, vor allem der Regenbogen-Presse, etwas Intimes über die Prophetin zu erfahren. Hidsaas strenge Sicherheitsleute hatten erst gestern erste Paparazzi verjagt, die mit Kameras bewaffnet am Schutzwall, der das Anwesen umgab, herumgelungert waren. Scheinbar hatten die unverfrorenen Medienmenschen gehofft, Estelle Brukner in privaten Momenten zu erwischen und für die Ewigkeit abzulichten.