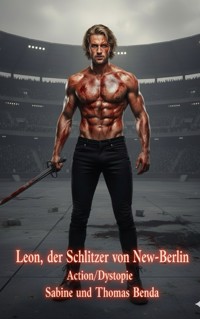4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mercy, die Straßenritze
- Sprache: Deutsch
Meine lieben begrenzt Denkenden! Tobias Gradener gerät in Gefahr. Und was eine sogenannte Werkstatt damit zu tun hat, das müsst ihr schon selbst lesen. Eines ist sicher: Autos werden dort nicht repariert. Nun haben wir sie endlich, eine befristete Kooperation zwischen den Hellen und den Dunklen, da wir einen gemeinsamen Feind haben, der den Unglauben schüren will und sowohl Gott als auch dem Teufel ins Antlitz rotzen möchte. Diese gottverdammten und teufelsverfluchten Togen müssen verschwinden, damit wieder die alte Ordnung zwischen Gut und Böse hergestellt werden kann. Und von diesem Mina-Mädchen mit ihren Fähigkeiten haben wir sicherlich noch einiges Höllisches zu erwarten. Euer Samuel, der Erste Gärtner Gottes
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sabine und Thomas Benda
Mercy, die Straßenritze – Buch 15 – Die Togen und die Hure
Ein 25-teiliges Serien-Genre-Crossover – ein himmlisch-höllisches Epos – eine unvergessliche Geschichte
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Apfel und Wurm
2. Daphne und der Sumpfmann
3. Nachrichtensondersendung
4. Vicconas Balameste
5. Engelsdialog im Paradies
6. Die Sache nach dem Pikser
7. Krisensitzung im Eis
8. Jody Turner, Amerikanerin und Studentin
9. Gedankenaustausch unter Engelskolleginnen
10. Schlimmer noch
11. Weder zu früh noch zu spät
12. Spekulationen – nichts Greifbares
13. Der alte Autor
14. Vor langer Zeit geplant und beschlossen
15. Der wichtige Weltkrieg
16. Kooperation oder Federn lassen
17. Werkstatt
18. Das Ärgernis und der Master
19. So was von gönnen
20. Ein Gespräch unter Freunden
21. Machen wir uns nichts vor
22. Teambildung
23. Wusaatee!
24. Die Pisse des Hirnfurzes
25. Luftgeschwader
26. Schweiß
27. Versöhnung
28. Vermischtes Blut
29. Wo es nach Tod stinkt
30. Die mutige Gefährtin von Y’bot Rene’Darg
31. Requiem
32. Zusammentreffen
33. Zwickmühle und Sackgasse
34. Süßer Kerl
35. Glauben wir daran?
36. Komische Gefühle
37. Ein kleines Geschenk
38. #Fuckthetogas
39. Angélique und Mina legen los!
Über die Autoren:
Impressum neobooks
1. Apfel und Wurm
Sie waren verbreitet auf der Welt und jede Küstenstadt hatte mindestens einen vorzuweisen: einen Hafen.
Schiffe, Möwen, Hektik und Gestank, dazu waren sie Knotenpunkte des Handels – ja, Häfen boten einiges – und sie brachten nicht immer das emsige Leben, sondern oftmals auch den gnadenlosen Tod.
Cliff Warner liebte es, am Hafen zu arbeiten. Wo andere die Nase rümpften und sich wegen der vielfältigen Gerüche abwandten, blühte der stämmige Mann aus Maine regelrecht auf. In seiner Freizeit war er ein umgänglicher Familienmensch und guter Nachbar mit einem gepflegten Vorzeige-Garten vorm abbezahlten zweistöckigen Wohnhaus. Er mochte Baseball und alte Cartoon-Klassiker, die ihn an seine wohlbehütete Kindheit erinnerten. Seine Vorliebe für Rockmusik aus den 1980er-Jahren teilte jeder in der Familie. Selbst seine Ehefrau, eine heitere Mittdreißigerin, die Leiterin in einem Kindergarten war, akzeptierte Cliffs Musikgeschmack, obwohl sie eher der Klassik aus Europa zugeneigt war.
Von einer weiteren Vorliebe, nämlich einsame Rucksacktouristinnen, die hin und wieder im großen und unübersichtlichen Hafengebiet herumlungerten, spurlos verschwinden zu lassen, wusste selbstredend niemand.
Kein Mensch hegte den geringsten Verdacht, dass der gutaussehende Familienvater seit Jahren heimlich eine krankhafte Perversion auslebte, die ihm seine inneren Dämonen zuflüsterten.
»Cliff, da ist eine weitere Ladung angekommen«, sagte Karlson, ein breiter übelriechender Kerl, der ihm zum Löschen der Fracht zugeteilt worden war.
Karlson soff nicht nur maßlos, sondern fickte gerne Straßenmädchen, wie er die Prostituierten gerne benannte. Der Mann gab seinen Lohn so schnell aus, wie er hereinkam.
Für Cliff Warner war dieser Primitivling, der wohl skandinavischen Ursprungs war und auch schon wegen irgendwelcher Delikte im Knast gesessen hatte, ein unsauberer und lauter Unmensch. Doch man konnte sich seine Kollegen nicht immer aussuchen.
»Müssen die Kisten noch auf den Transporter gestapelt werden, der gegen Mittag nach Manhattan fährt?«, wollte Cliff wissen.
»Ja«, bestätigte Karlson. »Wir müssen die komplette Scheiße noch vor der Mittagspause durchgezogen haben.« Der unangenehme Mann kratzte sich zwischen den Beinen. Als Cliff ihn dabei beobachtete, trafen sich ihre Blicke, und der Primitivling meinte nur: »Sackflöhe. Muss ich mir wohl am Wochenende eingefangen haben!« Ein widerliches Lachen folgte, was in ein Hüsteln überging. Eine Alkoholfahne wehte Cliff entgegen.
»Wir sollten es gleich angehen!«, drängte Cliff Warner. »Ich habe mir bei Maggie einen Beef Burger reserviert. Die macht doch die besten Burger an den Docks.«
Maggies Fastfood-Stand war ein beliebter Treffpunkt der Hafenarbeiter.
Karlson blickte auf seine goldene Armbanduhr, eine billige Imitation aus einem Ramschladen. »Dann müssen wir uns sputen! Auf jetzt! Setz deinen Arsch aus Maine in Bewegung!«, witzelte er derb.
Als sie am Frachtschiff ankamen, war dort – trotz der sengenden Hitze, die über der Stadt lastete und die Luft zum Flimmern brachte – eine regere Betriebsamkeit als sonst zu erkennen. Cliff zählte mindestens fünf Einsatzfahrzeuge des NYPD und einen Wagen der Gerichtsmedizin. Innerlich erstarrte er ein wenig. Konnte es sein, dass die Polizei wegen seiner halbjährlichen Vorliebe für Rucksacktouristinnen hier war? War man ihm auf die Spur gekommen?
Er sah, wie Polizisten Absperrbänder zogen, um die Schaulustigen vom Schiff fernzuhalten. Die Betty Seagull war vor zwei Stunden eingelaufen. Sie hatte eine lange Fahrt aus dem Orient (mit Zwischenstopps in Vietnam und Japan) hinter sich. Die Frachträume waren übervoll mit Importgütern, die auf das Entladen warteten.
»Das könnt ihr vorerst vergessen«, hörten Cliff Warner und sein Kollege Karlson den schweinsnackigen Bud sagen, der ihnen keuchend entgegenkam. Der Arbeiter mit den glitzernden Schweißperlen auf dem von der Sonne geröteten Gesicht hatte eine glimmende Filterlose im unrasierten Mundwinkel, während er sprach.
»Die Bullen haben das Schiff komplett gesperrt! Es gab einen Toten!«
»Also … einen Mann?«, fragte Cliff und versuchte, so gut es ging, unaufgeregt zu klingen.
»Ja, ein Matrose aus Japan. Den hat man wohl beim Zwischenstopp angeheuert.«
»Was ist passiert?«, wollte Karlson wissen und steckte sich ebenfalls eine Zigarette an.
»Kann ich euch nicht sagen – soll aber eine eklige Sache sein!«
Ein Matrose, dachte Cliff Warner erleichtert. Dann geht es nicht um mich!
»Ich ziehe meine Pause vor«, sagte er ruhig. »Hier kommen wir ja im Augenblick eh nicht zum Zug!«
Die beiden anderen Hafenarbeiter nickten ihm zu. Dann gierten sie wieder zum abgesperrten Tatort hin, um nichts zu verpassen.
Dämliche Gaffer, fluchte Cliff innerlich im Weggehen. Dass er selbst einer war, der den einsamen Rucksacktouristinnen interessiert zusah, wenn sie japsten und ihn aus immer größer werdenden Augen fassungslos anstarrten, während er sie mit einem stabilen Tau langsam erdrosselte, kam ihm dabei nicht in den Sinn. Dem Mann gelüstete es nach einem leckeren Burger von Maggie.
Detective Eric Odey gelüstete es gewiss nicht nach einem leckeren Beef Burger, als er sich in einem blutbesudelten Gang im Frachtraum der Betty Seagull umsah.
Auf dem Metallboden, der einem schmierigen See aus Blut glich, lag ein unvollständiger toter Mann. Dem Matrosen fehlte das halbe Gesicht.
»Und was haben wir, Barney?«, fragte Odey den leitenden Forensiker, der mit Latexhandschuhen bestückt am Boden kniete. Der pausbackige Mann sah den Detective kurz an und widmete sich wieder seiner Arbeit.
»Oh, heute ohne Partner, Odey?«, fragte er.
»Hat Dünnschiss!«, antwortete der Polizist und ging einem Fotografen aus dem Weg, der ein Bild vom Fundort schoss.
»Dünnschiss ist echt scheiße«, sagte Barney, hielt kurz inne und meinte dann: »Oder sollte ich sagen: Ist echte Scheiße?« Schließlich lachte er selbst über seinen niveaulosen Witz, und Eric Odey war wieder in seiner polemisch geprägten Meinung bestätigt, dass die durchschnittliche Intelligenz der pausbäckigen Forensiker, zwischen 40 und 60 Lebensjahren, rapide nachließ. Vielleicht sind die Lösungsmittel im Labor schuld, mutmaßte Odey zynisch, wenn er freitags in einer stark von Polizisten frequentierten Feierabend-Kneipe hockte.
Wieder schoss der Fotograf ein Bild.
»Sind Sie bald damit durch?«, drängte der Polizist.
»War die letzte Aufnahme, Sir! Sieht krass zum Kotzen aus!«
Odey setzte seinen Rottweilerblick auf. »Wer hat Sie um ein Statement gefragt, Ryan?«
»Ich heiße Brian, Sir!«, entgegnete der Fotograf, hatte ein unterwürfiges Zögern im Blick, das Odey auf den Tod nicht ausstehen konnte.
»Scheißegal, wie Sie heißen!«, zischte der Detective giftig und drehte sich wieder dem Forensiker zu.
»Vielleicht sollten wir die Jungs von der Seuchenbekämpfung einschalten«, meinte Barney, während er mit einem Wattestäbchen schleimige Reste von den Wundrändern des unvollständigen Japaners tupfte.
»Die Seuche soll ich einschalten?« Odey war überrascht.
»Naja«, meinte der Forensiker beim Eintüten. »Diese internationalen Frachter können immer mal was einschleppen.«
Eric Odey zeigte auf den halben Kopf des Matrosen. »Du denkst, dass der Ursprung von der Scheiße da, eine Krankheit ist?« Der Detective sprach nicht weiter. Es war einfach zu unglaublich für ihn.
»Zugegeben«, meinte Barney, während er wiederholt mit einer handlichen Stablampe über Blut, Schleim und Knochenreste leuchtete. »Der Fuck hier sieht – verdammt noch mal – nach einem Gewaltverbrechen aus. Doch es gibt keine schlüssigen Indizien zu finden.« Barney zeigte auf den blutbesudelten Gang und die Wände. »Keine offensichtlichen Anzeichen eines Kampfes. Scheinbar war der Japse alleine.«
»Scheiß auf deinen Rassismus!«, bellte Odey ihn fast an.
»Seit Pearl Harbor traue ich denen nicht!«, meinte der Forensiker trocken als Verteidigung.
Nur dass du locker 30 Jahre nach Pearl Harbor geboren wurdest, du Idiot, dachte sich Eric Odey seinen Teil und schüttelte innerlich den Kopf.
»Was sind das für Wischspuren?«, meinte er schließlich, weil er etwas am Boden entdeckt hatte. »War das der Fotograf mit seinen Latschen?«
Barney leuchtete hin. »Nope, die waren schon vorhin da! Komisch, was?«
Allerdings, überlegte Odey. Feine wellenförmige Blutspuren zeigten sich auf dem geriffelten Metall am Boden, als hätte sich etwas fortbewegt.
Seuche!
Da war es dieses Unwort, das Menschen in haltlose Panik versetzen konnte.
Eric Odey beschloss, medizinische Unterstützung anzufordern, um gegebenenfalls Schlimmeres zu verhindern – nicht, dass noch etwas Unangenehmes in die Vereinigten Staaten eingedrungen war.
Auf einem Metallträger über Odey, Barney und der Leiche des Japaners hockte zusammengerollt eine weiße Schlange im Schatten, der sie voll und ganz verbarg. Das Reptil züngelte ruhig, denn die beiden Männer passten nicht in ihr Beuteschema. Sie waren zwar laut und ordinär in der Ausdrucksweise, doch sie gehörten eindeutig zu den Hellen. Die Weiße beschloss, den Frachtraum nach einem kurzen Schläfchen unentdeckt zu verlassen. Wenn sie Glück hatte, würde sie außerhalb des Schiffes auf andere Menschen treffen, die sie heimlich belauern und töten konnte. Nur böse mussten diese Menschen sein.
Dies war der Tag, an dem die erste weiße Schlange, ein Kind der Venoma, der Großen Mutterschlange der Alten Drus, New York und damit die Ostküste Amerikas erreicht hatte. Man könnte auch schwarzhumorig formulieren: Der Big Apple hatte nun seinen ersten Wurm!
2. Daphne und der Sumpfmann
Hidsania, zur Mittagszeit
»Was macht Blanche? Schläft sie immer noch?«
Daphne, das menschliche Orakel, hatte Arthur McFadden aufgesucht. Der dicke Mann ruhte gerade in einem Liegestuhl im Schatten eines neongelben Sonnenschirms. Er hatte heute seinen freien Tag.
»Ich habe ihr ein Terrarium gebaut. Sie steht nun im Wohnzimmer – und schaut gerade Football!«
Die blondhaarige Frau nahm ihren Strohhut vom Kopf und hockte sich neben Arthur in einen bequem aussehenden Gartenstuhl.
»Die Schlange interessiert sich für Sport?«
»Sie schon – ich nicht!«, sagte Arthur grinsend und klatschte sich auf seinen dicklichen Bauch. Er blickte Daphne an. »Kommen Geoffrey Marcher und Stephanie mit der Übersetzung der Dru-Bücher voran?«
Marcher, der Chronist und Autor von FISH, und die Engelsfrau hatten sich die Kopie dieses einzigartigen Buchs über die Alten Drus vom Sektionschef aus der Vorhölle zu Herzen genommen, um diese Schriften in eine geeignete Sprache zu übersetzen. Man wollte hinter das Geheimnis der Schlangen und der Großen Mutterschlange, der Venoma, kommen. Daphne war in dieses Projekt integriert. Sie stöhnte leidvoll.
»Schwierig und träge – wir kommen nur schleppend voran!«
Arthur spitzte nachdenklich die Lippen.
»Warum fragt ihr nicht diesen Sektionschef? Laut Mina kann doch ihr Versorger als einziger Dunkler diese vergessene Dru-Sprache lesen, oder? Liegt es dann nicht nahe – im Zeichen der Kooperation – den höllischen Dunkelmann zu bitten?«
»Nun«, entgegnete das Orakel, schmunzelte über Arthurs Lockerheit im Umgang mit Worten. »Geoffrey und Steph wollen nicht – ich zitiere – wegen jeder Kleinigkeit laut das Wort Kooperation rufen. Der brennende Ehrgeiz treibt die beiden voran, einen eigenen Übersetzungscode zu entwickeln. Die steigern sich da gerne bis zum Geht-nicht-mehr rein! Deswegen bin ich bei dir – ich brauchte mal eine Pause!«
Arthur McFadden schüttelte seinen Kopf und stöhnte nun ebenfalls. »So eine bescheuerte Zeitverschwendung von den beiden! Und währenddessen verbreiten sich die weißen und schwarzen Schlangen lustig über den gesamten Erdball, killen irgendwelche Menschen und vermehren sich dabei! Mein Bericht über Blanche, den ich auf die Homepage gesetzt habe, erhält kaum spürbare Resonanz. Denkst du nicht auch, dass die Menschen bei dem Schlangenthema mit Blindheit geschlagen sind?«
»Ich sehe das genauso wie du, Art!«, pflichtete die Frau ihm bei.
»Und was machst du dagegen? Du gehörst doch zu diesem Dru-Projekt?«
»Noch nichts!«
»Ach? Und wann endet dieses Noch nichts?«
Daphnes hübsches Gesicht bekam plötzlich ganz offensichtliche verschwörerische Gesichtszüge.
»Geoffrey Marcher wird nächste Woche mit einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus nach Gasmoo eingeliefert werden. Natürlich weiß er das noch nicht! Er wird dort ein paar Tage bleiben. Das ist der Zeitpunkt, an dem ich den Ehrgeiz von ihm und Steph lahmlegen werde und den Gedanken einstreue, den Sektionschef zurate zu ziehen. Laut meinen Eingebungen wird Stephanie dem Ganzen aufgeschlossen gegenüberstehen.« Daphne grinste. »Außerdem kennt sie den Sektionschef bereits persönlich – seit dieser nächtlichen Psychopathen-Beseitigung in New York!« Als sie Arthurs fragenden Blick sah, ergänzte sie: »Ich meine, als dieser Benjamin Micker unschädlich gemacht wurde. Steph hat den Sektionschef ja zuvor aufgesucht – wegen des Schwertes!«
»Puh!«, stöhnte Arthur. »Wie gut, dass ich hier nur der Sumpfmann aus Florida bin und nicht alles wissen muss, Daphy! Ich hole mir eine Limo. Willst du auch eine?«
»Gerne, Art! Wo steckt eigentlich Tara?«
»Mit Samothaa und Jolande in Paris.«
»Lass mich raten«, sagte Daphne. »Janina Quandaluu hat ihnen ein rotes Fähnchen gebracht, nicht wahr?«
Janina, die Engelsfrau, war für die Garde als Aufklärungsengel weltweit unterwegs, um Feinde der Hellen aufzuspüren und zu benennen. Besondere Krisenfälle waren ein rotes Fähnchen auf der Weltkarte in Taras Arbeitszimmer.
Arthur runzelte die Stirn.
»Ein knallrotes Fähnchen! Scheinbar gibt es da eine unangenehme Sekte, die in irgendwelchen Katakomben unterhalb von Paris haust – und Unschuldige ermordet! Sie nennen sich die Ausweider.«
»Ich will das jetzt lieber nicht so genau wissen!«, wehrte Daphne das Gehörte ab und lächelte sanft. »Ich habe noch nichts gegessen!«
»Dann bring ich dir noch frische Sandwiches zur Limo mit!«, stellte Arthur klar, wie es seiner praktischen Art entsprach, Lösungen zu finden. Er schlurfte Richtung Küche davon.
»Ich wusste, dass du das sagen würdest!«, rief das Orakel ihm nach und lachte vergnügt.
3. Nachrichtensondersendung
Im Hintergrund flimmerte eine Nachrichtensondersendung über mysteriöse Schlangenangriffe in New York City über den Screen, doch davon bekamen der Mann und der Vogel nichts mit. Sie saßen gemeinsam am Esszimmertisch des beschaulichen Apartments im Palastanwesen von Hidsania.
»Wie geht es Gustavo?«
Der Erste Hüter von FISH war in einer ernsten Unterredung mit einer weißen Taube aus Italien. Emilia pickte zuerst drei Körner und trank ein wenig Wasser aus einem Porzellanschälchen, das ihr Johannes Buttmanner bereitgestellt hatte. Seit Monaten war die intelligente und extrem redegewandte Taube eine Kurierin zwischen Hidsania und der Vorhölle, also zwischen Johannes und dem Doppelagenten Gustavo, dem ehemaligen Koch der Contessa Gina di Stefano. Gustavo hatte nach einem geplanten Selbstmord die Hölle betreten, um dort für die Hellen tätig zu werden. Johannes Buttmanner, der früher als Lugerius ebenfalls unter den Dunklen gelebt hatte, war hierbei sein großes Vorbild. Johannes versorgte Gustavo mit den notwendigen Informationen, damit der sich im Reich des Bösen zurechtfinden konnte und nicht auffiel. Emilia war die Botin für diese wichtigen Informationen. Eine Konstellation, die seit Monaten einwandfrei funktionierte.
»Gustavo ist unauffällig und hat sich hervorragend eingelebt!«, gurrte die Taube. »Er hat alle Aufnahmetests mit Bravour bestanden, obwohl diese sich als ziemlich heikel erwiesen hatten. Er schafft jetzt keine Leichen mehr zu den Moruunz, sondern ist als Schlachter in der Leichenfabrik aufgestiegen. Und er trägt jetzt eine Kutte und muss nicht mehr nackt herumlaufen!« Emilia gurrte fröhlich. »Gustavo ist jetzt ein anerkannter Dunkler und genießt gleichzeitig den Schutz vor Alteingesessenen, den Novizen nicht haben.«
Johannes nahm einen Schluck gesüßten Minztee zu sich.
»Das klingt ja sehr vielversprechend! Hat Gustavo schon Kontakt zum dortigen Widerstand aufgenommen, zu den Undergroundern?«
»Nein, Johannes, so weit sind wir noch nicht gediehen!«
»Ich hoffe, dass er sich in den Strukturen der Vorhölle zurechtfinden wird. Man kann dort nicht jedem vertrauen, selbst wenn sie alle Dunkle sind!«
»Unser Koch ist sehr anpassungsfähig und umsichtig! Gustavo kommt klar, Johannes! Er ist Italiener, um uns muss man sich wirklich keine Sorgen machen!«
Im Hintergrund flimmerte eine Nachrichtensondersendung über mysteriöse Schlangenangriffe in New York City über den Screen, doch davon bekamen der stöhnende Mann und die seufzende Frau nichts mit.
Missionarsstellung: Mercy Bendermann und Ansgar Gradener schätzen hin und wieder Althergebrachtes, weil man sich dabei in die wollenden Augen schauen und problemlos zum bissigen Knutschen übergehen konnte. Als er spürte, dass sie so weit war, saugte er gierig an ihrem Hals und löste damit ihren Höhepunkt aus. Beim dritten weiblichen Brüllen ergoss er sich heiß in ihre haarlose Ritze und füllte sie bis zum Überlaufen mit seinem Samen voll.
»Das war so was von überfällig!«, sagte er und wälzte sich von ihr.
»Du solltest zwischendurch mal wichsen«, riet sie ihm schmunzelnd. »Du hast ja die Menge eines Mittzwanzigers abgespritzt!«
»Wichsen? Mach ich doch!«, sagte er frech und küsste sie zärtlich auf die vollen Lippen. »Sonst wäre es noch mehr an Masse!«
»Nicht auszuhalten!«, überzog sie theatralisch. »Ist ja jetzt schon eine wahre Überschwemmung! Ich muss mich schnell abduschen, Schatz!«
Ansgar sah ihr nach.
»Geiler Hintern!«
»Ich weiß!«, antwortete sie keck und verschwand im Badezimmer.
Sekunden später hörte er, wie die Dusche angestellt wurde. Er griff zum Smartphone auf dem Nachttisch. Eine Nachricht von Tobias blinkte ihm entgegen:
Wir sind ein paar Tage auf Sepia Prime. Alex denkt uns hin. Liebe Grüße senden Toby und Jody.
Ansgar grinste.
Diese Jody hat es ihm wirklich angetan!
Im Hintergrund flimmerte eine Nachrichtensondersendung über mysteriöse Schlangenangriffe in New York City über den Screen, doch davon bekamen der Mann und die Frau nichts mit. Sie, eine blonde Frau, die eine nackte Auserwählte Gottes war, lag auf dem breiten Doppelbett, während er, ein mächtiger Prinz, ihren Nacken mit ätherischen Ölen massierte.
»Oh, das tut gut, mein süßer Gebieter!«, lobte sie seine Fingerfertigkeit und schnurrte liebevoll.
»Wenn du weiterhin wie eine Palastkatze schnurrst, kann ich mich nicht mehr konzentrieren und wünsche mir meinen Lustgarten zurück!«, witzelte er.
»Idiot!«, sagte sie unernst.
»Wenn schon, dann: prinzlicher!«, korrigierte er sie schmunzelnd.
»Dann eben prinzlicher Idiot!«, ergänzte sie. »Die einzigen Damen, die noch von deinem ehemaligen Lustbereich übrig sind, sind Fay und ich! Und die gute Fay ist nun eine freche Büro-Maus und wird zudem von Samuel himmlisch bedient!«
»Ach?«, wunderte sich der Prinz. »Ihr redet über Sex?«
»Natürlich! Fay und ich sind Freundinnen! Und Freundinnen verraten sich solche intimen Dinge – besonders bei einem Joint!«
Prinz Hidsaa glotzte entgeistert.
»Ihr raucht Gras? In meinem Palast?«
»Nie würde ich dich wegen eines Verstoßes deiner Hausordnung in Verlegenheit bringen, mein Gebieter! Fay und ich kiffen hin und wieder heimlich im Palmenhain! Keine Seele sieht uns da!«
»Im Palmenhain?«
»Ja, Hidsaa! Da traut sich doch keiner mehr hin, seit es diesen Togen dort erwischt hat – und … seit bekannt wurde, dass dort eine Gardisch aus der Vorhölle entstiegen ist.«
»Ihr raucht Marihuana in meinem Palmenhain? Du weißt, dass es in meinem Land strenge Gesetze bei Drogenbesitz gibt?«
»Deswegen«, sagte die Prophetin mit einem absichtlich neunmalklugen Unterton in der Stimme, »rauchen wir die Beweise schnell weg – und habe jede Menge Spaß dabei!«
»Du bist unmöglich …«
»Hast du mir oft gesagt – ja, ich glaube es langsam, Liebster!«
Geschwind drehte sich die blonde Frau auf den Rücken, damit der Prinz ihren vollen Busen sehen konnte.
»Du hast so kräftige Hände, und ich frage mich gerade …?«, sagte sie, verstummte und schnurrte schließlich wie ein Kätzchen.
Das ließ sich der Prinz natürlich nicht zweimal sagen, denn seine Videokonferenz mit europäischen Investoren startete erst in einer halben Stunde.
Im Hintergrund flimmerte eine Nachrichtensondersendung über mysteriöse Schlangenangriffe in New York City über den Screen, davon bekamen der Mann und die Frau am Frühstückstisch nichts mit. Karl Wisemeyer tippte auf seinem PC-Tablet eine E-Mail an Tabitha Parkins. Er hatte der Elfjährigen vor einigen Jahren in Dubai das Leben gerettet. Von ihr hatte Karl die unheilvolle Prophezeiung erfahren, dass er sterben würde, wenn er die erwachsene Tabitha ein zweites Mal retten sollte. Mit dieser Bürde lebten die Wisemeyers, verdrängten sie so gut es möglich war, denn Tabby, wie sie von ihnen freundschaftlich genannt wurde, war ja noch ein Kind – und zum Erwachsensein fehlten noch einige Jahre.
»Mommy, Daddy!«, bestürmte der kleine Sohn Tim plötzlich den Frühstückstisch. »Es gibt gefährliche Schlangen in New York!«
Lydia schaute auf, legte die Tageszeitung mürrisch zur Seite und meinte: »Ach, Tim, wir sind doch in der City – nicht im Dschungel!«
»Es gibt aber Tote!«, ließ sich der Kleine nicht beirren. »Komm schnell! Ein Mann im Fernsehen redet davon!«
Lydia ging zu ihrem Sohn, und Karl fiel ein, dass Tabby vor einigen Wochen ebenfalls in einer E-Mail von weißen und schwarzen Schlangen geschrieben hatte, die in Sydney einige Touristen getötet hatten.
Seltsam, dachte er und nippte an seinem schwarzen Kaffee. Hat Arthur mit seiner wilden Geschichte doch recht?