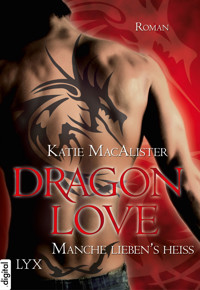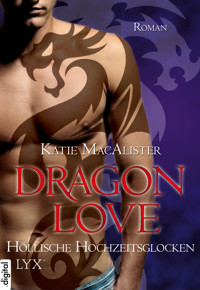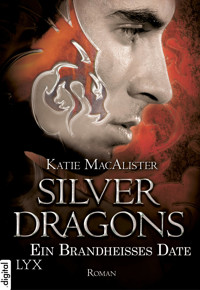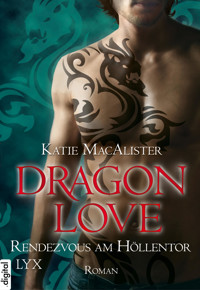9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Black-Dragons-Reihe
- Sprache: Deutsch
Aoife Dakar wird zufällig Zeugin eines übernatürlichen Mordes, doch niemand glaubt ihren Erzählungen. Als sie an den Tatort zurückkehrt, um nach Beweisen zu suchen, begegnet sie einem vorlauten Dämonenhund und einem herrlich nackten Mann, der sich nicht nur in einen Drachen verwandeln, sondern auch göttlich küssen kann. Aoife findet sich plötzlich in einer fantastischen Welt wieder, die gleichzeitig so aufregend wie furchteinflößend ist. Und sie lernt, dass man sich beim Spiel mit Drachen auch ordentlich die Finger verbrennen kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem Buch123456789101112131415161718Die AutorinDie Romane von Katie MacAlister bei LYXImpressumKATIE MACALISTER
Black Dragons
Ein Flirt mit dem Feuer
Roman
Ins Deutsche übertragen von Theda Krohm-Linke
Zu diesem Buch
Wie desaströs ein Date enden kann, musste Aoife Dakar am eigenen Leib erfahren: Beim Besuch auf dem Jahrmarkt wird sie unfreiwillig Zeugin eines Mords, bei dem sich das Opfer mysteriöserweise in Rauch auflöst. Niemand will Aoife glauben – und obwohl sie genau weiß, was sie gesehen hat, wird die junge Frau in die Psychiatrie eingewiesen. Zwei Jahre später ist Aoife als geheilt entlassen … und stolpert abermals kopfüber ins Chaos. Nicht nur überfährt sie einen Hund, der sprechen kann und sich ihr als Jim vorstellt, sie findet zu allem Überfluss auch einen nackten (und absolut umwerfenden) Typen bewusstlos am Strand. Kostya behauptet, er sei ein Drache und brauche Aoifes Hilfe. Denn Aoife ist der Schlüssel, um einen Fluch zu brechen, der auf dem Drachenvolk lastet. Doch sie muss aufpassen: Kostya ist eine solch heiße Versuchung, dass sich Aoife nur allzu leicht die Finger daran verbrennen kann …
1
Vor zwei Jahren
Arvidsjaur Center für geistig Verwirrte
Eingangsgespräch: geleitet von Dr. Kara Barlind
Übersetzung ins Englische
Anmerkung Dr. Barlind: Das ist das Gespräch, das ich bei Einlieferung mit Patientin A auf Wunsch ihrer Familie geführt habe. Patientin A zeigte deutliche Anzeichen von Schizophrenie und gab nur widerwillig zu, dass ihre Geschichte eher einem Fantasy-Film als dem realen Leben entsprach. Sie hatte jedoch das große Bedürfnis, ihre Geschichte zu erzählen. Dazu ermutigte ich sie in der Hoffnung, dass dies der Genesung zuträglich sein möge.
GESPRÄCH:
Dr. Barlind: Guten Tag, Miss A. Wie geht es Ihnen?
Patientin A: Mir ist es schon besser gegangen, und mein Name ist Aoife, nicht Miss A. Es ist ein irischer Name, und er wird Ii-fe ausgesprochen.
Dr. Barlind: Entschuldigung, Aoife. Manche Patienten ziehen es vor, in unseren Berichten anonym zu bleiben, aber ich werde vermerken, dass Sie lieber bei Ihrem Namen genannt werden möchten. Wollen Sie uns erzählen, was Ihren Bruder und Ihre Schwester dazu bewogen hat, Sie in unsere Obhut zu geben?
Patientin A (schaudernd): Darüber möchte ich lieber nicht nachdenken, aber ich nehme an, wenn jemand etwas unternehmen soll, bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen zu erzählen, was gestern Abend passiert ist. Es war doch gestern Abend, oder nicht?
Patientin zeigt deutliche Anzeichen von seelischer Belastung, und ich bestätige ihr, dass sich der auslösende Moment gestern Abend zugetragen hat.
Patientin A: Okay, gut, ich dachte schon, ich wäre auch hier mit der Zeit etwas durcheinandergeraten. Allerdings kann ich Ihnen versichern, dass das nicht so abgedreht ist, wie es sich anhört. Wo soll ich anfangen?
Dr. Barlind: Wo immer Sie mögen.
Patientin A: Ich denke, alles hat mit dem Date angefangen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass etwas so … Merkwürdiges … passieren würde. Ich meine, Terrin sah absolut normal aus. Und vor allem hat er auf mich nicht den Eindruck gemacht, er könnte sterben und nach Belieben wiederauferstehen.
Patientin A schaudert erneut und reibt sich die Augen, als wollte sie auf diese Weise Bilder aus ihrem Kopf vertreiben, hört aber auf damit, bevor sie sich selbst verletzt.
Dr. Barlind: Dann fangen Sie doch am besten mit Ihrer Verabredung mit diesem Mann an.
Patientin A: Ja. Das Date. Zuerst war alles ganz normal. Nicht gerade durch die Decke, aber ganz nett …
»Ist die Band nicht toll?«
Bässe wummerten um uns herum, hingen schwer in der Abendluft und weckten in mir ein Verlangen. Sexueller Natur.
»Was?«, brüllte mein Date, da ich ihn sonst über dem Lärm der schwedischen Band auf der Bühne nicht gehört hätte.
Ich schaute ihn an. Ich kannte Terrin erst seit ein paar Tagen. Ich war ihm auf dem GothFaire-Jahrmarkt begegnet, wo wir beide in einer Schlange anstanden, um uns aus der Hand lesen zu lassen. Wir waren ins Gespräch gekommen und hatten uns schließlich für das Konzert verabredet.
»Ich sagte, die Band ist toll. Findest du nicht auch?«, schrie ich ihm ins Ohr. Wir hüpften in der dichtgedrängten Menge im Takt zur Musik, als ob das stetige Hämmern des Schlagzeugs ein Urbedürfnis nach Bewegung in uns weckte. Ich machte mir ein bisschen Sorgen, ob es Terrin wirklich gefiel, nicht weil er dafür zu alt sein könnte – er schien etwa im gleichen Alter zu sein wie ich, Mitte dreißig –, sondern weil er irgendwie etwas von einem Buchhalter an sich hatte. Er war die Nettigkeit in Person – alles an ihm war angenehm: seine gutmütigen braunen Augen, seine akzentfreie Stimme, seine kurz, aber nicht zu kurz geschnittenen braunen Haare und sein unauffälliges Gesicht. Er sah aus wie ein absolut solider, unauffälliger Spießer.
Ich hingegen war alles andere als unauffällig. Zumindest in ethnischer Hinsicht.
»Es ist ganz schön betörend, oder?«, antwortete er in der gleichen Lautstärke.
»Betörend?«, brüllte ich.
»Der Zauber der Musik, meine ich. Selbst hier, am Rand der Menge, spürt man ihn.«
Ich starrte ihn an. Was zum Teufel meinte er damit? Vielleicht war es ein Fehler gewesen, mich mit ihm zu verabreden, aber ich hatte gedacht, dass bei einer öffentlichen Veranstaltung wie der GothFaire schon nichts passieren könnte. Ich hatte mich bestimmt verhört. »Ich habe die Band noch nie gehört, und ich wohne seit meiner Kindheit hier in der Gegend, aber sie sind gut. Anders. Die Musik macht mich …« Ich brach ab, nicht weil mir schon der Hals vom Schreien wehtat, sondern weil ich zögerte, das seltsame Gefühl preiszugeben, das mich überkommen hatte.
Terrin wirkte zwar wie ein netter, normaler Mann, aber ich wollte es nicht riskieren, etwas zu sagen, das schlimme Konsequenzen heraufbeschwören konnte.
»Geil?«, fragte er, wobei er sich weiter im Takt zur Musik bewegte.
Ich riss die Augen auf. Hatte er gemerkt, dass mich plötzlich das Verlangen überkam, ihn zu küssen? Ihn zu berühren? Seine Haut auf meiner zu spüren …? Verstört schob ich diese Gedanken beiseite. Terrin mochte ja ein netter Kerl sein, aber deshalb brauchte ich mir noch lange nicht vorzustellen, wie er mich berührte und umgekehrt. »Äh …«
»Ist schon in Ordnung«, schrie er, legte einen Arm um mich und zog mich an sich. Er lächelte mich an, aber in seinen Augen stand nichts weiter als freundliches Interesse. Vertrau mir, schienen sie zu sagen. Ich bin ein korrekter Buchhalter. »Kein Grund, verlegen zu sein. Du kannst dich dem Drang sowieso nicht widersetzen.«
Ich schmiegte mich kurz an ihn und atmete den Geruch von Seife, Shampoo und nettem Mann ein. Die Schlampe in mir fiel beinahe in Ohnmacht, aber mein Gehirn merkte an, dass nichts an ihm so besonders war, das seinen Kommentar gerechtfertigt hätte.
»Äh … ja.« Es kostete mich mehr Überwindung, als ich gedacht hätte, mich von ihm loszureißen. Gott sei Dank schien er nicht beleidigt zu sein. Er lächelte nur nichtssagend und ergriff meine Hand.
Wir lauschten der Band bis zum Ende des Songs, dann schlug er vor, wir sollten uns den Rest des Jahrmarkts anschauen.
»Ich habe das meiste schon gesehen«, sagte ich zu ihm, als wir das große Zelt verließen. Es stand am Ende des Geländes, auf dem die Verkaufsstände und Attraktionen der GothFaire u-förmig angeordnet waren. Ich zeigte auf das Schild, das neben dem Zelteingang hing. »Die Zaubervorführung habe ich heute schon gesehen. Herregud, das war vielleicht toll. Hast du die Magier auch gesehen? Sie sind Vater und Sohn, und bei diesem Trick mit den Eiern habe ich echt Gänsehaut bekommen.«
»Herregud?« Terrin runzelte verwirrt die Stirn.
»Oh, Entschuldigung, das ist ein schwedischer Ausdruck. Es heißt so viel wie Du lieber Himmel oder Oh mein Gott.«
»Ich dachte, du wärst Amerikanerin«, sagte Terrin. Er hielt mich immer noch an der Hand, als wir über den Hauptgang des Jahrmarkts schlenderten. Es waren immer noch einige Leute unterwegs, um sich die Zukunft voraussagen oder aus der Hand lesen zu lassen oder sich die Zeit mit den gruseligen Dingen zu vertreiben, die der Jahrmarkt zu bieten hatte.
»Ja, das bin ich auch. Mom ist aus Irland und mein Dad aus dem Senegal. Er hat meine Mom kennengelernt, als er in New York Architektur studiert hat. Sie hat Harfe im Central Park gespielt; er kam vorbei und blieb stehen, um ihr zuzuhören. Er sagte immer, er habe sich auf den ersten Blick in sie verliebt.« Ich schwieg. Insgeheim fragte ich mich, warum ich ihm so viel über meine Familie erzählte.
»Und wie bist du dann hierhergekommen?«, fragte er und machte eine weit ausholende Geste, die wahrscheinlich eher ganz Schweden als nur die GothFaire umfasste.
»Dad hat bei IKEA gearbeitet. Und nein, ich weiß nicht, wie man die Möbel zusammenbaut. Bei solchen Dingen habe ich zwei linke Hände.«
Er hob meine Hand und tat so, als bewundere er sie. »Ich finde deine Hände wunderschön. Also, was möchtest du jetzt gerne machen? Aus der Hand haben wir uns ja schon lesen lassen. Warst du schon bei der persönlichen Zeitreise-Beratung? Ich habe mir sagen lassen, sie sei sehr gut.«
Ich sah zu dem Stand, auf den er zeigte. »Nein, das ist nicht so mein Ding. Ich bin völlig zufrieden mit dem Hier und Jetzt.«
»Ah, eine Traditionalistin. Dann lass mal sehen. Piercings?«
Wir blickten beide zum Körper-Piercing-Stand. Dann sahen wir uns an.
»Keine Piercings.« Terrin zog die Lippen zusammen.
Ich lachte. »Ja, ich stehe auch nicht auf Schmerzen oder darauf, kleine Dinge durch meine Körperteile stechen zu lassen. Ich habe es gerade so hingekriegt, mir mit sechzehn Ohrlöcher stechen zu lassen.«
Terrin blieb vor einem rot-schwarz gestrichenen Stand stehen. »Hmm. In einer halben Stunde gibt es eine Einführung in Dämonologie. Das könnte interessant sein.«
»Ach, Dämonen«, sagte ich, verzog ein wenig das Gesicht und ging weiter. »Darüber bin ich schon lange hinaus.«
»Wirklich?« Er warf mir einen überraschten Blick zu. »Du hast ja ungeahnte Tiefen, meine Liebe.«
»Ja, irisch-senegalesische Amerikanerinnen, die in Schweden leben, sind in der Regel sehr tiefgründig. Was ist das?« Ich zeigte auf ein Schild mit einer Kamera. Wir blieben vor dem Stand stehen, damit ich die Aufschrift lesen konnte. »Was ist denn eine Seelenfotografie?«
»Vermutlich eine Umschreibung für ein Aura-Foto, aber das ist nur eine Vermutung.«
»Oh, ich glaube, darüber habe ich mal was gelesen. Ein gemeinsames Foto wäre doch lustig, oder?« Ich schenkte ihm ein gewinnendes Lächeln, aber dann bekam ich plötzlich Bedenken, ich könnte den Eindruck erwecken, dass ich an etwas wie eine Aura glaubte. »Ich meine, nicht dass es so etwas wirklich gibt, oder so.«
»Fotografien?«
»Nein, Auren.«
Er reichte dem gelangweilten Teenager, der vor dem Stand an der Kasse saß, Geld und hielt zwei Finger hoch, um anzuzeigen, dass wir zusammen fotografiert werden wollten. »Dann überrascht es mich allerdings, dass du ein Foto haben möchtest.«
»Oje«, ich warf ihm einen konsternierten Blick zu, »bin ich jetzt ins Fettnäpfchen getreten?« Er wirkte zwar nicht beleidigt oder verärgert, aber ich wusste ja auch nicht, wie sich ein so ruhiger, unemotionaler Typ verhielt, wenn er sich aufregte. »Du glaubst an Auren, stimmt’s?«
»Es ist schwierig, an etwas nicht zu glauben, wenn du es schon gesehen hast.« Er hielt den langen, schwarzen Vorhang zur Seite, damit ich das Zelt betreten konnte. Vor uns stand eine altmodische Kamera auf einem dreibeinigen Stativ, so ein Ding mit großen viereckigen Glasplatten und einem mächtigen Ziehharmonikabalg, wie aus einem Stummfilm. Eine Frau saß gerade auf einer niedrigen Bank und ließ sich fotografieren. Der Fotograf, ein kahlköpfiger kleiner Mann mit einem karottenfarbenen Haarkranz und einem kunstvoll gezwirbelten Schnurrbart, stand hinter seiner Kamera und sagte ihr, sie solle an etwas Schönes denken.
Wir setzten uns in den behelfsmäßigen Wartebereich.
»Hast du wirklich schon mal eine Aura gesehen?«, fragte ich Terrin leise.
Er nickte. »Auf Fotos, ja. Mit bloßem Auge kann ich sie leider nicht erkennen.«
»Oh.« Ich entspannte mich. Schlagartig ging es mir besser. Vorsichtig formulierte ich meinen nächsten Satz. »Ich habe einmal auf einer Website einen kritischen Artikel darüber gelesen, wie Leute so etwas machen, weißt du. Bevor der Film entwickelt wird, kann man es so drehen, dass hübsche Halo-Effekte um den Kopf des Fotografierten entstehen, und vor allem bei digitalen Aufnahmen ist das natürlich supereinfach.«
Er zog leicht die Augenbrauen hoch, und ich merkte schon, dass es ihm nicht gefiel, wie ich seine Aura-Fotos schlechtmachte. Hastig versuchte ich, meine Aussagen zu relativieren – es war ja nicht nötig, dass ich den Abend ruinierte, indem ich die spaßbefreite Skeptikerin gab. »Aber viele Leute sind ganz begeistert davon, sogar Fachleute! Und sie richten ja auch keinen Schaden an, oder? Schließlich ist es ja nur ein Foto.«
»Ja, in der Tat.« Er schwieg einen Moment und musterte mich mit mildem Interesse. »Ich finde es merkwürdig, dass du die GothFaire besuchst, da du ja nicht so besonders an solche Dinge wie Auren zu glauben scheinst.«
»Soll das ein Witz sein?« Ich stieß ein kurzes, bitteres Lachen aus. »Hier in Nordschweden führen wir nicht gerade das aufregendste Leben. Wenn du in die nächste Stadt fahren willst, bist du stundenlang mit dem Zug unterwegs, und außer Wasser, Schnee, Angeln und so gibt es hier nicht viel Interessantes. Und die meiste Zeit ist es sowieso so kalt, dass du nicht viel anderes machen kannst, als mit einem Buch und einer Flasche Brandy am Kamin zu hocken. Als Rowan – das ist mein Bruder – mir sagte, dass es hier so hoch im Norden einen Jahrmarkt gibt, da wollte ich mir das natürlich nicht entgehen lassen. Ich war an allen drei Tagen hier.«
»Ah, jetzt verstehe ich, welchen Reiz die Veranstaltung für dich hat.«
Der Fotograf winkte uns zu sich, nahm die Tickets, die Terrin ihm reichte, und wies uns an, uns auf die Bank zu setzen.
Steif saßen wir nebeneinander, während der Fotograf eine Platte herauszog und eine andere hineinschob.
»Nicht, dass ich das, was andere Leute glauben, nicht respektieren würde«, sagte ich zu Terrin. »Jeder kann glauben, was er will, und ich mache mich ganz bestimmt nicht lustig, wenn jemand tatsächlich an Dämonen, Auren oder Zeitreisen glaubt. Ich meine, es ist eben eine Glaubenssache. So wie im Film immer Musik spielt, wenn Leute singen. Da weißt du auch, dass da eigentlich kein Orchester ist, aber du glaubst es trotzdem, um dir den Spaß daran nicht zu verderben.«
Der Fotograf gab uns die Anweisung, wir sollten uns leicht einander zuwenden und dann in die Kamera schauen.
»Ja, das scheint mir eine vernünftige Einstellung zu sein«, stimmte Terrin mir zu.
»Bleiben Sie so etwa sieben Sekunden lang«, sagte der Fotograf und verschwand unter dem schwarzen Tuch, das über der Kamera hing.
»Aber du glaubst, dass ich unrecht habe?«, sagte ich, wobei ich weiterlächelte.
»Nein, unrecht nicht, es fehlt dir eher an Wahrnehmung.«
Die Kamera klickte, und der Fotograf tauchte wieder auf. Er nahm eine andere quadratische Glasplatte und schob sie in die Kamera. Ich blickte Terrin an. »Mir fehlt es an Wahrnehmung? Du hältst also das ganze Zeug hier auf der GothFaire für real?«
»Ja.« Dieses Eingeständnis schien ihm nicht weiter unangenehm zu sein. Sein Gesichtsausdruck war so freundlich und gelassen wie zuvor.
»Bleiben Sie bitte so.«
Wir hielten die Pose. Ich wartete, bis der Fotograf ein weiteres Mal aus den Tiefen des Kameraumhangs aufgetaucht war, und stand auf, als er uns sagte, wir könnten unsere Bilder in einer Viertelstunde abholen. Wir verließen das Zelt gerade, als ein älteres Paar eintrat.
»Und du glaubst also auch daran?«, fragte ich und zeigte auf den Stand neben uns.
»An die Weissagungen aus der Kristallkugel? Ja, natürlich. Hast du dir schon einmal die Zukunft aus der Kristallkugel voraussagen lassen? Das ist faszinierend, echt faszinierend.«
»Ich habe mir vorher noch nie wahrsagen lassen, und als ich den ersten Tag hier war, habe ich die Dame, die das macht, gefragt, wie das überhaupt geht.«
»Schade, dass der Stand zuhat, sonst würde ich dich zu einer Sitzung einladen.« Wir schlenderten über den Jahrmarkt. Mir fiel auf, dass Terrin nicht mehr meine Hand ergriff, und ich fluchte im Stillen, weil ich ihm so viele Fragen über das, woran er glaubte, gestellt hatte.
Und trotzdem … ach verdammt, wenn ich eine Beziehung mit ihm eingehen wollte, dann musste ich doch wissen, ob wir zueinanderpassten. Deshalb wies ich mit dem Kinn auf einen Stand rechts von uns und fragte: »Kommt dir das nicht auch ein bisschen wie Harry Potter vor?«
»Meinst du die Amulette und Talismane?« Er überlegte. »Ich weiß, was du meinst, aber dafür mache ich eher die Popkultur verantwortlich als die Frau, die diesen Stand mit magischen Dingen zum Anfassen führt.«
»Äh … ja.« Dazu hätte ich vieles sagen können, schluckte es aber lieber herunter.
»Der Beweis ist überall hier, meine Liebe, du musst ihn nur sehen wollen. Da zum Beispiel …« Er wies auf etwas hinter mir. Ich drehte mich um und sah einen großen Mann mit schulterlangen schwarzen Haaren, der über den Mittelgang offensichtlich auf dem Weg zum Parkplatz war. Neben ihm ging ein anderer, ebenfalls dunkelhaariger Mann, der sich ständig umschaute, als suche er jemanden. »Das sind Drachen.«
Ich hörte auf, den Körperbau des ersten Mannes zu bewundern, und blickte Terrin verblüfft an. »Was ist mit ihnen?«
»Diese beiden Männer«, sagte Terrin und wies erneut auf die beiden Männer in Schwarz, »sind Drachen. Schwarze Drachen. Sie könnten aber auch Ouroboros sein, allerdings bin ich über die Geschehnisse im Weyr nicht mehr so auf dem Laufenden, seit er zerstört wurde.«
»Und ein Weyr ist …?«
»Die Vereinigung der Drachensippen.«
»Ja, natürlich. Du behauptest also …« Ich brach ab und wies kopfschüttelnd auf die beiden Männer, die gerade hinter den Ständen verschwanden. »Du behauptest also, dass diese beiden Männer – diese beiden völlig normal aussehenden Männer – Drachen sind? Du meinst, Drachen im Sinn von schuppiger Haut, Flügeln und Schwänzen, die im Mittelalter Jungfrauen gefressen haben?«
»Die Jungfrauen-Opfer sind ja schon vor langer Zeit abgeschafft worden«, sagte er sanft. »Aber um deine Frage zu beantworten: Ja, es sind Drachen.«
»Sie haben aber ausgesehen wie Männer«, erwiderte ich.
»Wenn du die Wahl hättest, als Mensch oder in Drachengestalt herumzulaufen, wie würdest du dich entscheiden?«
Das sah selbst ich ein. »Okay. Ein Punkt für dich.«
»Es gibt also wesentlich mehr als das, was sich an der Oberfläche zeigt. Das Gleiche gilt für Auren.«
»Ach, komm«, sagte ich, weil ich mal wieder meinen Mund nicht halten konnte. Mir wurde immer klarer, dass er als Freund für mich ganz bestimmt nicht infrage kam. Es war ja sein gutes Recht, zu glauben, was er wollte, aber ich sah schon unzählige Auseinandersetzungen und Diskussionen über unsere unterschiedlichen Standpunkte auf mich zukommen. Gegensätze mögen sich ja anziehen, aber das bedeutete noch lange nicht, dass sie auch harmonisch miteinander leben konnten.
Er zwinkerte mir zu und holte aus den Tiefen seiner Jeanstasche einen Ring in Gold und Elfenbein hervor, den er mir auf der Handfläche hinhielt. »Du glaubst mir immer noch nicht, hm? Vielleicht kann ich das ändern. Möchtest du ein bisschen Magie sehen, Aoife? Echte Magie?«
Ich betrachtete den Ring, der auf seiner Hand lag, dann blickte ich ihm in die Augen, aus denen er mich immer noch amüsiert anschaute. »Du hast einen Zauberring.«
Ich konnte meine Ungläubigkeit nicht verbergen.
»Ja, genau. Und höchstwahrscheinlich hat ebendieser Ring die Drachen angelockt. Du kannst ihn gerne berühren, wenn du möchtest. Er schadet dir nicht – seit er neu gemacht wurde, hat er – wie soll ich sagen? – seinen eigenen Kopf entwickelt. Du kannst ihn nicht benutzen, wenn er es nicht wünscht, und bis jetzt hat er nur für wenige Personen eine gewisse Zuneigung erkennen lassen. Dazu gehören sein ursprünglicher Schöpfer und die Frau, die ihn neu geformt hat, aber sie möchte ihn nicht benutzen und hat ihn mir zur Aufbewahrung übergeben. Ich habe versucht herauszufinden, ob er einfach inaktiv ist oder eher wählerisch in Bezug auf die Personen, auf die er reagiert.«
Natürlich nahm ich den Ring. Ich liebe Schmuck, und er sah so alt und abgetragen aus, dass ich ihn mir gerne einmal genauer ansehen wollte. Allerdings erwartete ich nicht, dass sich in dem Moment, in dem ich ihn berührte, tatsächlich etwas Magisches ereignete.
Und so war es dann auch.
»Ich gehöre vermutlich nicht zu den besonderen Leuten«, sagte ich und fuhr mit dem Finger über die Außenseite des Rings. So wie es aussah, war er aus Elfenbein und an den Rändern in Gold eingefasst. Er hatte keine Gravur, und es war auch keine Zeichnung in das Elfenbein eingeritzt, aber er fühlte sich in der Hand gut an. »Will denn die Person, die ihn ursprünglich angefertigt hat, ihn nicht zurück?«
»Der Urheber?« Ein Anflug von Erheiterung glitt über Terrins Gesicht. »Ich bin sicher, dass er ihn nur zu gerne wieder in seinen Besitz bringen würde, aber das wäre nun wirklich nicht klug.«
»Ach ja?« Ich schob den Ring auf den Finger und bewunderte ihn. »Er ist nicht so auffällig, oder?«
»Nein, er sieht ganz normal aus«, sagte Terrin. Er blickte über meine Schulter, als hinter mir jemand leise aufschrie. Da hinter mir das Piercing-Zelt lag, dachte ich mir nichts dabei. »Aber er ist trotzdem äußerst gefährlich.«
»Und warum wollen ihn diese beiden Männer, die du für Drachen hältst, haben, wenn er so böse ist?«
»Der Ring an sich ist nicht böse; es ist der Benutzer, der darüber entscheidet, ob er für einen guten oder einen bösen Zweck benutzt wird. Und alle Drachen, nicht nur die der schwarzen Sippe, haben nach dem Ring gesucht, seit der Weyr zerstört wurde. Aber das ist eine lange Geschichte, zu lang, um sie dir jetzt zu erzählen.«
»Oh-oh.« Ich streckte meine Hand aus und betrachtete den Ring. »Da ich mich nicht in Luft aufgelöst habe, als ich den Ring über den Finger geschoben habe, verstehe ich nicht ganz, was daran magisch sein soll.«
Terrin schmunzelte. »Es ist kein Tolkien-Ring. Seine Magie ist … einzigartig. Sowohl für den, der ihn benutzt, als auch für das, wofür der Ring benutzt werden will.«
Ich blickte auf den Ring und erwartete beinahe, dass ein kleines Augenpaar meinen Blick erwidern würde. »Wow, das ist … unheimlich.«
»Wie ich schon sagte, es ist einzigartig.«
»Auf jeden Fall ist er hübsch. Ich hoffe nur«, sagte ich und begann den Ring abzuziehen, »dass es kein Elfenbein von einem Elefanten oder so ist. Ich glaube fest an Karma, und ich möchte mir nicht vorstellen müssen, was mir Schlimmes passiert, weil ich einen Ring aus totem Elefant bewundert habe.«
»Elfenbein? Oh nein, es ist nur Horn.« Einen Moment lang war das Zwinkern wieder in seinen Augen. »Von einem Einhorn, und ich kann dir versichern, dass das fragliche Einhorn sein Horn für diesen Zweck freiwillig hergegeben hat.«
»Na gut«, knurrte ich und zog den Ring vom Finger. Ich wollte ihn Terrin gerade zurückgeben, als ein markerschütternder Schrei durch die Abendluft gellte, so laut und schrill, dass er deutlich über der hämmernden Musik zu hören war.
2
Terrin war schon losgerannt, bevor ich zu der Erkenntnis gekommen war, dass jemand in ernsthaften Schwierigkeiten steckte. Zum Glück dauerte es nicht lange, bis mein Verstand einsetzte, und ich lief hinter ihm her. Ich hatte zuerst gedacht, der Schrei käme aus dem Dämonenzelt, ich merkte jedoch schnell, dass er von der großen Wiese hinter dem Zelt kam, die als Parkplatz diente. Zwei andere Personen rannten ebenfalls in diese Richtung – ein großer blonder Mann, der nur aus Muskeln zu bestehen schien, und eine kleine ältere Frau mit weiß gesprenkelten Haaren. Ich überholte die Frau, aber der Mann war weit vor mir. Als ich um das Zelt herumlief und zur Wiese kam, stolperte ich, und wenn die Frau mich nicht am Arm gepackt hätte, wäre ich hingefallen.
Vor uns standen, erhellt von einer kleinen tragbaren Lampe, vier Reihen von Autos. Terrin stand vor der ersten Reihe einem großen, dünnen Mann gegenüber, der eine Art Schwert schwang. Auf dem Boden zwischen Terrin und dem Mann lag eine Frau, und bevor ich richtig begriff, was geschah, hob der dünne Mann die Arme, sodass das Schwert vor dem Abendhimmel schimmerte, und ließ es dann auf Terrins rechte Schulter heruntersausen. Er schlug ihm fast komplett den rechten Arm ab. Ich stand da, entsetzt und völlig benommen. Vor mir schien sich der Boden aufzutun, und ich musste mich nach Leibeskräften zusammenreißen, um nicht auf der Stelle in Ohnmacht zu fallen.
Der verstümmelte Terrin fiel auf die Frau.
Der blonde Mann, der vor mir gewesen war, stürzte sich auf Terrins Angreifer, und eine Sekunde lang sah ich etwas Silbernes zwischen ihnen aufblitzen. Dann war der Schwertmann auf einmal verschwunden und hinterließ nur dicken schwarzen Rauch, der schwer in der Luft hing, bevor er sich schließlich auflöste. Ich blieb wie angewurzelt stehen, obwohl eine Stimme in meinem Kopf schrie, ich müsse etwas unternehmen, um Terrin zu helfen.
Die alte Dame ging an mir vorbei zu der Stelle, wo Terrin leblos auf dem Boden lag, leicht gekrümmt über einem dunklen Teich von Blut, das aus seinem Körper sickerte. Der blonde Mann bückte sich und hob die Frau auf, die unbeweglich auf der Erde gelegen hatte.
Ich sank auf die Knie, weil meine Beine mich nicht mehr trugen, und beobachtete ungläubig, wie der Mann mit der Frau auf den Armen auf mich zutaumelte. Die alte Dame ging neben ihm und redete mit starkem Akzent schnell auf ihn ein. »Bring sie in meinen Wohnwagen, Kurt. Sie ist nicht verletzt, nur benommen. Aber es war dumm von ihr, mit dem Dämon alleine fertig werden zu wollen. Schließlich ist sie ja keine Hüterin …«
Sie würdigten mich keines Blickes, als sie an mir vorbeigingen, und ich starrte ihnen kurz nach.
»Hey«, versuchte ich zu rufen, aber meine Stimme war nur ein heiseres Krächzen. Ich räusperte mich und versuchte es noch einmal. »Hey, ihr könnt nicht einfach so gehen. Mein Freund braucht Hilfe.«
Mittlerweile war das Paar fast schon wieder mitten auf dem Jahrmarkt, und offensichtlich konnten oder wollten sie mich nicht hören, weil sie immer weitergingen.
Mir wurde übel, als ich das betrachtete, was von Terrin übrig geblieben war. Ich wusste, dass ich irgendetwas tun musste – vielleicht war er ja gar nicht tot. Vielleicht war er nur bewusstlos? Vielleicht konnte man seinen Arm wieder annähen.
Bei dem letzten Gedanken musste ich mich übergeben. Ich beugte mich vor und brachte alles heraus, was ich gegessen hatte, bevor die Band gespielt hatte. Als sich mein Magen wieder beruhigt hatte, krabbelte ich zu der Stelle, wo Terrin lag, und berührte vorsichtig seinen Hals.
Er war noch warm, aber ich fühlte keinen Puls.
Irgendwie kam ich wieder auf die Beine und stolperte instinktiv zurück zu den Lichtern und dem Lärm des Jahrmarkts, dorthin zurück, wo andere Leute sich um die Situation kümmern und den Albtraum beenden konnten.
Als ich am nächstgelegenen Stand ankam – der mittlerweile geschlossen hatte –, war ich völlig außer Atem. Alle Stände am Mittelgang waren zu. Nur aus dem großen Zelt drang noch Musik, aber weit und breit war kein Mensch zu sehen. Die einzigen Lebewesen waren ein paar Krähen, die an verschüttetem Popcorn und anderem Abfall pickten.
Mit zitternden Händen zog ich mein Handy aus der Tasche und wählte die Notrufnummer. »Da liegt ein Mann … ein Freund … Ein Typ hat ihn mit einem Schwert erschlagen und ist dann in einer Rauchwolke verschwunden«, sagte ich zu der Frau in der Notrufzentrale. Mein Hals war so zugeschnürt, dass ich nur krächzen konnte. Jedes einzelne Wort tat weh.
»Rauch?«, wiederholte die Frau.
»Ja, schwarzer Rauch. Erst war er da und dann nicht mehr.«
»Menschen lösen sich nicht in Rauch auf, Madam.«
»Der Mann schon. Können Sie bitte die Polizei hierher schicken?«
»Wo sind Sie?«, fragte die Frau.
Ich sagte es ihr und erklärte, der Mord habe sich auf dem Parkplatz ereignet.
»Sind Sie sicher, dass Ihr Freund tot ist?«
»Ja«, krächzte ich.
»Hat sonst noch jemand diesen angeblichen Angriff gesehen?«
»Angeblich? Er war nicht angeblich! Es ist direkt vor meinen Augen passiert. Hören Sie, mir ist ja klar, dass sich das merkwürdig anhört, aber der Typ mit dem Schwert hat meinen Freund angegriffen, und dann machte es puff!, und weg war er! Verschwunden! Noch zwei weitere Leute haben es gesehen. Würden Sie also bitte die Polizei herschicken? Wer weiß, wo dieser Irre ist, und mein Freund liegt tot auf der Erde und hat keinen Puls und … und …« Ich brach in Schluchzen aus.
Die Frau versicherte mir, dass sie sofort medizinische Hilfe und die Polizei schicken würde, und fragte, ob ich so lange am Telefon bleiben möchte. Ich sagte Nein und legte auf, hielt allerdings das Handy so fest umklammert, als wäre es ein Rettungsring. Ich wischte mir das Gesicht (und auch die Nase, muss ich leider gestehen) am Jackenärmel ab und wünschte mir verzweifelt, ich könnte den Tag noch einmal von vorne beginnen.
Als ich Blaulicht in der Ferne sah, setzte ich mich wieder in Bewegung. Weit hinter der Weide, die während des Jahrmarkts als Parkplatz benutzt wurde, sah ich einen Krankenwagen und zwei Streifenwagen durch das lang gezogene Tal auf mich zukommen. Ich ging zurück an die Stelle, wo Terrin niedergestreckt worden war, um den Krankenwagen gleich dorthin dirigieren zu können.
Terrin war nicht mehr da.
Ich schaute mich nach allen Seiten um, das Herz schlug mir bis zum Hals, und die Augen traten mir beinahe aus den Höhlen, so sehr strengte ich mich an, ihn zu finden. »Er war doch hier«, sagte ich laut und rannte die Reihe der Autos entlang. Dann blieb ich stehen und rannte noch einmal in die andere Richtung. »Ich weiß, dass er hier war. Genau hier. Oh mein Gott, der Mörder ist bestimmt zurückgekommen!«
So fand die Polizei mich – an den Autoreihen auf und ab rennend und vor mich hin plappernd. Ich schnappte mir den erstbesten Polizisten und zerrte ihn zu der Stelle, wo auf dem Boden immer noch Terrins Blut zu sehen war. »Da! Es war genau da! Und jetzt ist er weg!«
Der Polizist und sein Kollege untersuchten den Boden. Der Krankenwagen fuhr vor, und die Sanitäter eilten herbei.
»Haben Sie gesehen, wie jemand den Körper weggeschafft hat?«, fragte einer der Polizisten.
»Nein! Es muss der Mörder gewesen sein. Wahrscheinlich hat er sich zurückgepufft, den armen Terrin in Stücke gehackt und ist mit Terrins Einzelteilen im Rucksack geflohen!«
Die Polizisten und die beiden Sanitäter starrten mich an. »Zurückgepufft?«, fragte schließlich einer der Polizisten.
»Er hat sich in schwarzen Rauch aufgelöst, nachdem er Terrin niedergeschlagen hat«, sagte ich und rang vor Verzweiflung die Hände. Warum suchten sie nicht endlich den Parkplatz nach Anzeichen für den Mörder ab? »Es muss doch eine Blutspur geben, der Sie folgen können.«
Der zweite Polizist zog sein Notizbuch heraus. »Würden Sie den Verstorbenen bitte beschreiben?«
»Ich nehme an, bevor er in Stücke gehackt worden ist, oder?« Ich holte tief Luft und versuchte, mein Gehirn, das sich wie irre im Kreis drehte, in den Griff zu kriegen. »Er war etwa drei Zentimeter größer als ich, Mitte dreißig, schmächtig, braune Haare und Augen, kantiges Kinn, goldgeränderte Brille. Seine Haare lichteten sich schon, aber nicht sehr, nur ein bisschen. Äh …« Ich versuchte mich zu erinnern, was er angehabt hatte, aber ich sah immer nur Blut und einen abgetrennten Arm vor mir. »Er trug ein hellblau kariertes Hemd, eine blaue Sportjacke, Jeans und schwarze Schuhe.«
Der Polizist notierte sich die Beschreibung. »Hatte er irgendwelche Tätowierungen oder Narben? Trug er auffälligen Schmuck?«
»Nein.« Plötzlich fiel mir der Ring ein, den ich in der Hand gehalten hatte, als Terrin ermordet wurde. Unwillkürlich fuhr meine Hand zu meiner Hosentasche. Anscheinend hatte ich ihn geistesabwesend dort hineingesteckt. Zumindest war er in Sicherheit – obwohl es jetzt zu spät war, ihn zurückzugeben. »Er sah einfach nur aus wie ein netter Typ.«
»So wie der Herr da?«, fragte der erste Polizist und wies über meine Schulter.
Ich drehte mich um, und die Welt hörte auf, sich zu drehen. Zumindest meine Welt. Neben dem nächstgelegenen Stand standen Terrin und der blonde Mann, der die Frau weggeschleppt hatte, und unterhielten sich angeregt.
Ich trat einen Schritt auf ihn zu, wobei ich mich fragte, ob gerade die ganze Welt verrückt geworden war. Terrin sah kein bisschen so aus, als täte ihm sein Arm weh – geschweige denn, dass er ihm beinahe abgehackt worden wäre.
»Das … das ist er«, hörte ich mich sagen.
»Der Mann da ist das Opfer?«, fragte der Polizist.
Ich trat einen weiteren Schritt auf Terrin zu. »Ja, das ist er. Nur … er ist ja gar nicht tot. Aber er war tot. Er hatte keinen Puls, und sein Arm war fast ab, aber jetzt ist er es nicht mehr …«
In diesem Moment blickte Terrin in meine Richtung und sah mich. Er lächelte und hob grüßend die Hand, bis er die Polizisten und den Krankenwagen hinter mir sah. Sein Lächeln erlosch, und ich marschierte auf ihn zu.
»Du lebst«, sagte ich zu ihm. Die Polizisten und Sanitäter waren direkt hinter mir.
»Ja.« Er schaute mich verwirrt an. »Sollte ich nicht?«
»Du bist doch gerade getötet worden. Von diesem großen dünnen Mann mit dem Schwert.« Ich tippte ihm auf die Schulter, die verletzt worden war. Sie fühlte sich vollkommen unversehrt an.
Terrin blinzelte, dann lächelte er strahlend über meine Schulter hinweg. »Guten Abend, Officer. Gibt es ein Problem?«
»Diese Dame behauptet, sie seien verletzt worden. Sehr schwer verletzt worden.«
»Das stimmt auch«, warf ich ein. »Er war tot.«
»Ganz offensichtlich nicht«, sagte der Polizist und warf mir einen merkwürdigen Blick zu.
»Ich weiß doch, was ich gesehen habe.« Ich wandte mich an den blonden Mann, mit dem Terrin geredet hatte. »Sie waren doch auch da. Sie haben doch gesehen, was passiert ist. Sagen Sie ihnen, dass der Schwert-Typ Terrin getötet hat und in einer Rauchwolke verschwunden ist.«
Blondie schürzte einen Moment lang die Lippen, dann schüttelte er den Kopf und sagte etwas auf Deutsch. Einer der Polizisten stellte ihm eine Frage in derselben Sprache, und Blondie antwortete auf Schwedisch. »Ich habe keinen Toten gesehen. Einer meiner Kolleginnen ging es nicht gut, und ich habe sie zu ihrem Wohnwagen begleitet. Das ist alles.«
»Sie lügen!« Ich muss zugeben, dass ich nahe daran war zu schreien, aber ich war auch mit Recht empört. Ich zeigte auf Blondie und Terrin. »Sie lügen beide. Ich weiß doch, was ich gesehen habe.«
Polizist Nummer zwei konsultierte sein Notizbuch, während Polizist Nummer eins die Sanitäter davon abhielt zu fahren. »Sie haben gesagt, Sie sahen, wie dieser Herr hier niedergeschlagen wurde, wobei sein Arm fast komplett vom Körper abgetrennt wurde, und dass sein Körper in einer großen Blutlache lag. Sie behaupten auch, sein Angreifer hätte sich in einer Rauchwolke aufgelöst.«
Letzteres betonte er spöttisch. Ich ließ mich jedoch nicht beirren. Ich marschierte zu der Stelle, wo Terrin zu Boden gestürzt war und wies auf den feuchten Fleck im Gras. »Sehen Sie. Genau hier. Sehen Sie das? Das ist Blut. Sein Blut, als er getötet wurde.«
»Ich bin nicht tot, Aoife«, sagte Terrin sanft. Er spähte über meine Schulter auf den Boden. »Das sieht aus, als ob jemand Fruchtpunsch verschüttet hätte.
»Hören Sie, ich weiß nicht, was hier vor sich geht«, sagte ich zu dem Polizisten, der seinem Partner leise etwas zumurmelte. »Ich habe keine Ahnung, ob dieser Terrin vielleicht ein Duplikat oder so etwas ist, aber ich habe doch keine Halluzinationen gehabt. Ich habe gesehen, wie er getötet wurde. Dieser blonde Mann hat es auch gesehen, ganz gleich, was er jetzt behauptet. Offensichtlich versuchen sie, irgendetwas zu verschleiern, aber da mache ich nicht mit, verstehen Sie? Ich weiß schließlich, was ich gesehen habe.«
»Beruhigen Sie sich«, sagte Polizist Nummer eins und ergriff mich am Arm. »Es hat ja keinen Zweck, dass Sie sich so aufregen. Sie sehen doch, dass ihr Freund gesund und munter ist.«
»Das ist nicht mein Freund!«, schrie ich. Ich war völlig frustriert, weil niemand mir zuhörte. »Das ist ein Betrüger. Oder sein Zwillingsbruder. Oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall ist er nicht der Mann, der direkt vor meinen Augen getötet wurde!«
»Ich glaube, Sie sollten jetzt mit uns kommen«, sagte der Sanitäter und ergriff mich am anderen Arm. »Sie sind aufgebracht, und wenn Sie ein bisschen Abstand zu der Sache gewinnen, werden Sie bestimmt wieder ruhiger.«
»Ich bin völlig ruhig«, sagte ich und stemmte meine Absätze in den Boden, um nicht von ihnen zum Krankenwagen geschleppt zu werden. »Und ich glaube auch nicht, dass ich nicht weiß, was ich tue. Sie halten mich für irre, oder? Nun, das bin ich nicht. Die beiden da sind es!«
In diesem Moment holte mich der zweite Sanitäter ein, was blöd war, weil er meinen Lauf in die Freiheit unterband.
Ich möchte die nächsten Stunden nicht im Detail wiedergeben, weil sie über alle Maßen schrecklich und frustrierend waren. Je mehr ich protestierte und erklärte, die Wahrheit zu sagen, desto weniger glaubten mir die Menschen um mich herum.
Die Leute in dem Krankenhaus, zu dem man mich gebracht hatte, waren alle sehr nett, aber keiner von ihnen hörte mir zu, und vor allem glaubten sie mir nicht. Sie spritzten mir etwas, wonach sich mein Gehirn anfühlte wie Sirup, und steckten mich ins Bett in einem Zimmer mit vergitterten Fenstern. Am nächsten Morgen erschienen meine Schwester Bee und mein Bruder Rowan. Ich erklärte ihnen, was passiert war, und verlangte meine Freilassung.
»Es tut mir leid, Aoife, aber der Arzt sagt, du hättest einen Nervenzusammenbruch gehabt«, sagte Bee zu mir. »Er meinte, es wäre nicht gut, wenn du jetzt alleine bliebst.«
Rowan schlug ihr auf den Arm. »Das durftest du ihr gar nicht sagen.«
»Nervenzusammenbruch?« Ich saß auf der Bettkante, nur in meiner Unterwäsche und dem Krankenhaushemdchen. Am liebsten wäre ich auf der Stelle nach Hause gegangen, um mich in meinem eigenen Bett zusammenzurollen. »Ich hatte keinen Nervenzusammenbruch. Ich habe eine Mordverschwörung gesehen! Es klingt zwar alles unwirklich, aber ich weiß doch, was ich gesehen habe.«
»Es war tatsächlich unwirklich, was du angeblich gesehen hast«, erwiderte Bee kopfschüttelnd. »Das kannst du nicht gesehen haben. Du musst es dir eingebildet haben. Hast du davor irgendetwas gegessen? Vielleicht hat dein Date dir Drogen verabreicht.«
»Drogen?« Ich bedachte sie mit einem Blick, der besagte, wie lächerlich ihre Vermutung war. »Ich stand nicht unter Drogen. Ich habe in Terrins Gesellschaft weder etwas gegessen noch getrunken. Das kannst du schon einmal von deiner Liste der Möglichkeiten streichen. Akzeptiere doch einfach, was ich dir erzähle.«
»Dass du gesehen hast, wie sich ein Mann in Rauch aufgelöst hat?« Rowan blickte mich zweifelnd an. »Aoife, das gibt es einfach nicht.«
»Holt mich hier heraus, dann beweise ich es euch schon«, bat ich. »Wir gehen zur GothFaire, und ihr könnt euch die Stelle selber anschauen. Wahrscheinlich gibt es ja nicht viel zu sehen, aber dann steht ihr wenigstens schon einmal da, wo ich gestanden habe, und könnt euch mit eigenen Augen davon überzeugen, dass ich so nahe dran war, dass ich mich gar nicht geirrt haben kann.«
Sie warfen einander vielsagende Blicke zu, und zu meinem Entsetzen schüttelte Bee den Kopf. »Wir haben lange mit dem Arzt gesprochen, und er glaubt wirklich, dass es dir guttut, wenn du eine Weile mit Leuten zusammen bist, die wissen, wie sie mit solchen Situationen umgehen müssen. Du wirst sehen, in ein paar Tagen bist du wieder auf dem Damm.«
Angstvoll sah ich sie an. »Du willst damit nicht sagen … du meinst nicht …«
»Wir unterschreiben die Papiere, um dich in eine entsprechende Einrichtung überweisen zu lassen. Sie heißt Aardvark Center für geistig Verwirrte.«
»Arvidsjaur Center für geistig Verwirrte«, korrigierte Rowan sie.
»Ist doch egal. Der Arzt sagt, es sei wirklich nett da und sehr modern, und wir besuchen dich auch, sobald sie es erlauben.«
»Ich bin nicht verrückt!«, heulte ich. »Das könnt ihr mir nicht antun! Ich habe doch nur gesehen, wie ein Mann gestorben ist und ein anderer Mann sich in Rauch aufgelöst …«
»Aoife, Liebes, das ist zu deinem eigenen Besten«, sagte Bee mit beruhigender Stimme.
Rowan sah zum Glück etwas weniger sicher aus. »Ich weiß nicht, Bee – sie einfach so wegzusperren kommt mir auch ein bisschen … hart vor.«
»Sehr hart«, sagte ich voller Panik. Ich musste hier heraus, weg von den beiden, damit ich in aller Ruhe überlegen konnte, wie ich meinen Fall ruhig und überzeugend vorbrachte.
»Wenn sie vielleicht ein paar Wochen bei dir in Venedig bleiben könnte …«, schlug Rowan vor.
Bee warf ihm einen Blick zu, den ich nicht deuten konnte, und schüttelte leicht den Kopf. »So ist es am besten, wirklich. Hier wird sie gut versorgt.«
In diesem Moment brannten bei mir die Sicherungen durch. Ich wusste nicht, warum meine Schwester unbedingt wollte, dass ich eingesperrt wurde, oder warum sie mir nicht glaubte, als ich ihr erzählte, was ich erlebt hatte, aber ich wollte mich auch nicht mehr mit ihr darüber streiten. Ich rannte zur Tür.
Natürlich war es das Falscheste, was ich tun konnte, und als die Krankenschwester mir erneut eine Sirup-Spritze verpasste, waren Rowan und Bee bereits gegangen. Am nächsten Tag wurde ich in den Süden in die Klapsmühle gebracht.
Mir ist es egal, was die anderen sagen. Ich weiß, was ich gesehen habe.
3
»Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist, Bee.«
Meine Schwester, die gerade ein paar Kleidungsstücke in einen Koffer warf, blickte auf. »Dich allein zu lassen? Dr. Barlind hat gesagt, du seiest absolut in der Lage, allein zu …«
»Natürlich macht es mir nichts aus, allein zu bleiben. Zwei Jahre Intensivtherapie haben Wunder bewirkt«, sagte ich fröhlich lächelnd, um ihr zu vermitteln, dass ich auf keinen Fall mehr irre war.
»Dass ich nach Afrika gehe?«
»Nein, das halte ich natürlich für eine gute Idee. Du wirst allen diesen Menschen helfen, an frisches, klares Wasser zu kommen.«
Sie schüttete ihre Unterwäscheschublade komplett in den Koffer und blickte sich dann im Zimmer um. »Ich weiß sowieso nicht, warum du unbedingt hier wohnen willst, wirklich nicht. Rowan kommt erst in zwei Monaten zurück, und dann bist du hier ganz alleine.« Sie blickte aus dem Fenster. Hinter einer struppigen Hecke blickte man auf graubraunen Sand, der sich am bläulich grauen Wasser entlangzog. Ein paar Möwen flogen am Himmel auf der Suche nach Futter, und selbst durch die Isolierverglasung der Fenster konnte ich ihre hohen, durchdringenden Schreie hören. »Das würde ich ja meinem schlimmsten Feind nicht wünschen.«
»Das kommt daher, weil du mittlerweile ein Stadtmensch geworden bist, Miss Venedig.« Ich rieb meine Arme und blickte auf das endlose Meer. »Mir gefällt die Einsamkeit an der schwedischen Küste. Vor allem nachdem ich zwei Jahre mit vierzig anderen Personen zusammengewohnt habe. Hier kannst du dir selber beim Denken zuhören.«
»Du hast Glück, wenn du über dem ständigen Möwengeschrei überhaupt etwas hörst. Aber ist ja egal, du brauchst mir nicht zu sagen, wie gerne du hier bist. Das weiß ich ja. In der Hinsicht kommst du nach Daddy.« Sie schwieg und blickte auf das Familienfoto, das auf ihrer Kommode stand. Dann wandte sie sich wieder ihrem Koffer zu. »Versprich mir, dass du mich anrufst, wenn es wieder einen … Zwischenfall gibt, ja?«
»Es wird keinen Zwischenfall geben«, sagte ich, richtete mich auf und lächelte sie strahlend an. Im Stillen mahnte ich mich, das Lächeln ein bisschen herunterzuschrauben, da Bee wesentlich mehr wahrnahm als Dr. Barlind. Bee wusste immer ganz genau, wenn ich ihr etwas vormachte, und ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass sie ihre Reise absagte, um den Babysitter für mich zu spielen.
»Nein, natürlich nicht. Ich verstehe trotzdem nicht, warum Dr. Barlind darauf besteht, dass du dich deinen inneren Dämonen stellst, indem du noch einmal auf diesen komischen Jahrmarkt gehst, auf dem alles angefangen hat. Oh!« Sie warf mir einen aufmerksamen Blick zu, und mir brach innerlich der Schweiß aus. »Deshalb hast du gesagt, du hältst es für keine gute Idee, oder? Also da stimme ich dir zu. Das führt für dich nur zu Problemen.«
Erneut rieb ich mir die Arme und drehte dem Strand den Rücken zu. Im Gegensatz zu meinem Bruder und meiner Schwester, die beide Großstadtmenschen waren, konnte ich stundenlang an unserem Strand spazieren gehen. »Nein, das macht mir keine Probleme … Schließlich drehe ich nicht gleich wieder durch, wenn ich auf den Jahrmarkt gehe, und ich kann schon verstehen, was Dr. Barlind meint, wenn sie sagt, ich solle mich meinen persönlichen Dämonen stellen. Sie hat viel Erfolg mit diesen kathartischen Erfahrungen, und sie glaubt daran, dass niemand geheilt werden kann, bevor er sich nicht seinen Problemen stellt. Ehrlich gesagt habe ich aber überhaupt keine Lust, noch einmal auf die GothFaire zu gehen. Stell dir mal vor, irgendeiner erinnert sich daran, dass ich die Frau war, die durchgedreht ist? Ich würde ja vor Scham im Erdboden versinken.«
Bee zuckte mit den Schultern. »Und wenn schon. Was interessiert uns das? Du kennst sie doch gar nicht.« Sie packte ihre Toilettenartikel ein. »Soll ich die Reise absagen und den nächsten Monat lieber hier mit dir verbringen? Vielleicht ist es ja einfach zu viel verlangt, dass du so kurz nach deiner Entlassung hier alleine …«
»Nein«, unterbrach ich sie mit fester Stimme. »Mir geht es gut. Wirklich. Dr. Barlind hätte mich bestimmt nicht gehen lassen, wenn es anders wäre, oder?«
»Mmm«, sagte Bee nachdenklich. Sie packte alles in ihren Kulturbeutel und zog den Reißverschluss zu. Dann schaute sie mich an. »Aoife, du bist ein kluges Mädchen. Wenn du der Meinung bist, du brauchst nicht auf den Jahrmarkt zu gehen, dann lass es auch. Warum willst du all diese unangenehmen Erinnerungen aufwühlen? Bei allem gebotenen Respekt für Dr. Barlind, aber wichtig ist einzig und allein, dass du jetzt außer Gefahr bist.«
»Ich war nie in Gefahr«, widersprach ich, schwieg aber dann. Ich holte tief Luft und dachte an Dr. Barlinds Lieblingsausspruch: Denk lieber zweimal nach, bevor du einmal sprichst. Wenn ich jetzt zu viel Wirbel machte, würde Bee ihre Reise absagen, und ich brauchte unbedingt Zeit für mich, um die Überreste meines Lebens wieder einzusammeln. Ich wollte nicht noch einmal auf die GothFaire, ich wollte das Gesicht des blonden Mannes, der gelogen hatte, nicht noch einmal sehen, und ganz bestimmt wollte ich nicht noch einmal an die Stelle, wo ich gesehen hatte … nein, es war besser, daran nicht mehr zu denken.
»Aoife?«, fragte Bee.
»Du hast recht«, sagte ich. Wenn ich sie mit dieser kleinen Notlüge davon abhalten konnte, ihre Reise abzusagen, war es in Ordnung. Der Gedanke an zwei wundervolle einsame Monate war in meinen Augen das größte Geschenk. »Ich bin sicher, für meinen Geistesfrieden wäre es besser, die GothFaire zu meiden.«
Sichtlich erleichtert lächelte sie mich an und tätschelte mir auf diese herablassende Art, die große Schwestern manchmal an sich haben, die Wange. »Braves Mädchen. Oje, hast du auf die Uhr gesehen? Wenn ich jetzt nicht endlich aufbreche, kriege ich meinen Flug nicht mehr.« Sie umarmte mich und küsste mich auf beide Wangen. »Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Oder Rowan. Du weißt ja, wie lieb wir dich beide haben.«
»Ich euch auch«, sagte ich und ging mit ihr zum Auto. »Pass gut auf dich auf. Lass dich nicht kidnappen, weil du Moms Seite der Familie Dads Seite vorziehst.«
»Ha, als ob das so wäre! Ich knutsche dich!«
Winkend fuhr sie los. Ich ging wieder ins Haus zurück, machte die Tür hinter mir zu und seufzte erleichtert über die wundervolle Stille. Wirklich, es gab keinen idealeren Ort als dieses Haus, das mein Vater gebaut hatte, als er mit uns nach Schweden gezogen war.
»Du fehlst mir«, sagte ich zu dem Familienbild, das vor sieben Jahren aufgenommen worden war. Es war das letzte gemeinsame Foto gewesen. Meine Mutter strahlte in die Kamera, mit ihren roten Haaren und Sommersprossen sah sie aus wie das stereotypische irische Mädchen, während die sanften braunen Augen und die schokoladenbraune Haut meines Vaters Wärme und Liebe vermittelten. Tränen traten mir in die Augen, aber ich blinzelte sie weg. »Dr. Barlind sagt, Trauer ist zwar in Ordnung, aber man soll nicht daran festhalten, und wenn man seine Gefühle zum Ausdruck bringt, kann man sie loslassen. Also mache ich das. Ich bin traurig. Ich vermisse euch beide. Und ich bin wütend, dass ihr in den Senegal geflogen seid, obwohl ihr wusstet, dass es gefährlich ist. Ich bin wütend auf die Männer, die euch getötet haben, und noch wütender auf die Politiker, die die Situation zu verantworten haben. Aber vor allem liebe ich euch, und ich wünschte, ihr wärt hier, damit ich mit jemandem reden könnte.«
Das Foto antwortete mir nicht – wie sollte es auch? Das wäre verrückt gewesen, und ich war nicht verrückt. Bei dem Gedanken musste ich laut lachen, um die kleine Stimme in meinem Kopf zu übertönen, die mich darauf hinwies, dass die Wahrheit tief in meiner Psyche verborgen lag, ganz gleich, wie oft ich zu Dr. Barlind gesagt hatte, ich hätte mich vor zwei Jahren geirrt und sei nicht ganz bei Verstand gewesen, ganz gleich, wie oft ich allen erzählt hatte, der Aufenthalt im Arvidsjaur Center habe mir gutgetan und ich sei seitdem wie neugeboren.
»Ich höre dir nicht zu«, sagte ich zu dieser Stimme. Einer der Nebeneffekte der Therapie war, dass ich jetzt laut mit mir selber redete. Dr. Barlind sagte, es sei vollkommen normal, und wenn ich es unterdrückte, würde ich aufhören, mit meinem emotionalen Ich zu kommunizieren, und genau das sei die Ursache für die meisten Probleme auf der Welt. »Ich bin völlig normal und überhaupt nicht seltsam, und ich will nicht über Dinge nachdenken, die unmöglich sind, deshalb ist es nicht ratsam, Ärger heraufzubeschwören.«
Das gefiel der Stimme nicht, aber wenn ich etwas in den letzten zwei Jahren gelernt hatte, dann, mich von der Stimme in meinem Kopf nicht herumkommandieren zu lassen. Deshalb ging ich jetzt auch barfuß in mein Zimmer und betrachtete den kleinen Koffer, der auf einem Stuhl lag. Darin befanden sich die Dinge, die ich aus dem Arvidsjaur Center mitgebracht, aber noch nicht ausgepackt hatte. Da lag der Koffer und bereitete mir fast Qualen, weil er bedeutete, dass ich zwar die kleine Stimme in meinem Kopf ignorieren, aber nicht so tun konnte, als ob die Realität nicht existierte.
»Gut. Du kannst auch gleich den Mund halten«, beschied ich ihm. Mit hoch erhobenem Kopf öffnete ich den Koffer und holte die Tasche mit den Taschenbüchern heraus, die Bee mir während meines Aufenthalts ständig mitgebracht hatte. Als Nächstes räumte ich die Schlafanzüge und den Morgenmantel heraus, den man mir gegeben hatte, gefolgt von der Hose und der Bluse, die ich vor zwei Jahren angehabt hatte, als sie mich in die Klapsmühle gesteckt hatten.
Unter diesen Sachen lag ein kleiner cremefarbener Umschlag, auf dem in Druckbuchstaben sorgfältig mein Name und mein Einlieferungsdatum vermerkt waren. Darin befand sich der Inhalt meiner Taschen an jenem Tag – Führerschein, ein bisschen Geld, Schlüssel und der Schmuck, den ich getragen hatte. Ich legte Kette und Ohrringe in meinen Schmuckkasten und betrachtete dann stirnrunzelnd den übrig gebliebenen Gegenstand.
Es war ein Ring.
»Terrins Ring«, sagte ich und stieß ihn mit dem Finger an. Ich hatte ihn ganz vergessen, aber hier lag er und sah aus wie ein ganz normaler Ring.
Er hat magische Kräfte, hatte Terrin gesagt. Einen Moment lang überwältigten mich die Erinnerungen an jene schreckliche Nacht, und ich schloss die Augen, aber ich hatte die Stimme in meinem Kopf nicht zwei Jahre lang ignoriert, ohne gewisse Tricks zu lernen.