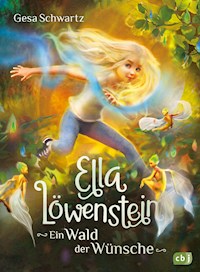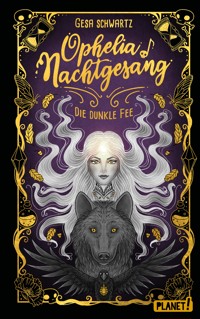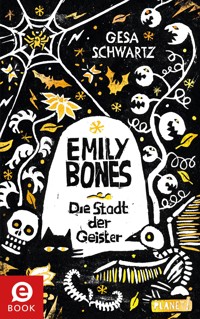3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Für seine Träume muss man kämpfen!
Als Farbratte Ferdinand aus der Sicherheit einer New Yorker Zoohandlung in den Untergrund gerät, eröffnet sich ihm eine ganz neue Welt voller Abenteuer und Gefahren. Er erfährt, dass fünf verfeindete Rattenclans die Stadt unter sich aufgeteilt haben. Sie alle sind Ninjas und verfügen nicht nur über ausgeklügelte Kampftechniken, sondern auch über besondere Waffen und Fähigkeiten.
Ferdinand brennt darauf, in den Feuerclan aufgenommen zu werden, der für die stärksten Kämpfer berühmt ist. Doch das ist kein leichtes Ziel, denn zuerst muss er beweisen, wer er ist: eine Hausratte – oder ein Krieger.
Spannende Tierfantasy mit einer heldenhaften Ratte, die sich in einem gefährlichen Abenteuer beweisen muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2023 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Dieses Werk wurde vermittelt durch dieAVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München (www.ava-international.de). Alle Rechte vorbehalten Umschlagillustration & -gestaltung sowie Kapitelvignetten: Melanie Korte ah · Herstellung: AW Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-26782-7V002www.cbj-verlag.de
Die Clans
Der Clan des Feuers:
Nach den Liedern der Unterwelt entstammen die stärksten Krieger dem Feuerclan. Sind sie erfahren genug, ihr meist ausgeprägtes Temperament zu zügeln, gehen sie oft als Sieger aus Kämpfen hervor. Das Gebiet des Feuerclans erstreckt sich im Westen von New York City.
Der Clan des Wassers:
Die Mitglieder des Wasserclans sind Meister der Tarnung und ausgezeichnete Schwimmer. Sie beherrschen den Süden der Unterwelt. Ihre besondere Gabe ist ihre große Intuition, und sie sind berühmt für ihre Magier. In Kämpfen ahnen sie die Handlungen ihrer Gegner oft voraus. Der Clan des Wassers ist seit Langem der größte Widersacher des Feuerclans. Ihre Mitglieder werden von diesem verächtlich Nebelkrähen genannt.
Der Clan der Steine:
Die Mitglieder des Steinclans zeichnen sich durch überragende Klugheit aus. In Kämpfen handeln sie taktisch und sind damit häufig überlegen. Sie herrschen im Osten.
Der Clan des Sturms:
Als einziger Clan hat sich der Sturmclan hauptsächlich oberirdisch angesiedelt und regiert den Norden der Stadt. Diesem Clan entspringen die größten Künstler, Erfinder und Konstrukteure. Denn die besondere Gabe des Sturmclans ist die Vorstellungskraft. Sie verfügen über die besten Waffen aller Clans.
Der Clan der Nacht:
Der gefährliche Nachtclan existiert unsichtbar vor allen anderen und wird gefürchtet. Über ihn gibt es kaum verlässliche Informationen, aber umso mehr düstere Lieder, die von seinen grausamen Taten erzählen.
Teil 1: Hinab in die Finsternis
Wild und frei
Drei, zwei, eins – jetzt!
Ferdinand stieß sich mit der Kraft seiner Hinterbeine ab. Er sprang durch das winzige Loch im Deckel seines Käfigs und landete zielsicher auf dem Glasrand. So leise wie möglich huschte er über die Gehege der Kaninchen und Meerschweinchen. Diese waren lächerlich schreckhaft. Wenn mitten in der Nacht eine Ratte in ihren Stall plumpste, brachten sie Ferdinands schönen Plan garantiert mit einem entsetzten Quieken zum Scheitern. Aber solange er vorsichtig war, gab es keinen Grund zur Sorge. Um diese Zeit schliefen die meisten Bewohner von Joe’s Pet Shop. Ferdinand jedoch dachte gar nicht ans Schlafen. Er hatte Besseres vor.
Mit einem geschickten Sprung setzte er über das Goldfischbecken hinweg, kletterte an der Außenseite des Frettchenturms entlang und schaute hinüber zu Hardy und Helga, den beiden Chinchillas. Sie waren wie er selbst nachtaktiv, aber sie würdigten ihn keines Blickes. Ferdinand achtete nicht weiter auf sie. Chinchillas lebten in ihrer eigenen kleinen Welt, das wusste er. Und sie waren ungeheuer arrogant.
Er reckte sich in die Höhe und zog sich auf den schmalen Sims vor den Terrarien. Diese Ecke des Ladens ließ sein Herz schneller schlagen. Der verfluchte Sims war der schnellste Weg zu seinem Ziel, doch als er jetzt an den gläsernen Käfigen vorbeilief, fühlten sich seine Beine an wie aus Blei. Ferdinand sah aus dem Augenwinkel den Schatten einer Spinne über das Glas huschen. Aber die Achtbeiner waren nicht das Schlimmste. Hier roch es nach Leichen. Und das schmeckte Ferdinand überhaupt nicht. Er hielt den Blick starr geradeaus gerichtet. Da vorn war der Tresen. Jetzt war es nicht mehr weit.
Das Fauchen war nicht lauter als ein Flüstern, aber Ferdinand sprang vor Schreck in die Höhe. Mit rasendem Herzen wandte er den Blick und schaute in das Auge einer Schlange.
Riesenhaft ragte der Schädel von Arthur, der Boa Constrictor, vor Ferdinand auf. Er wirkte so reglos, als wäre er aus Stein. Aber dahinter lag ein mächtiger Körper und Ferdinand wusste, wie viel Leben darin steckte. Er hatte es ein ums andere Mal beobachtet, wenn seine Artgenossen von diesem Maul verschlungen worden waren. Und er dachte mit Schrecken daran, wie Arthur sich einmal aus seinem Terrarium befreit hatte.
Er war gefährlich nah an Ferdinands Käfig gelangt, bevor Joe ihn wieder eingefangen hatte. Ferdinand hatte das Zischen der Schlange nicht vergessen. Und jetzt, da sie einander ansahen, wurde ihm eines klar: Auch Arthur erinnerte sich noch ganz genau daran, wie nah er seiner Leibspeise schon gekommen war.
Ferdinand setzte seinen Weg fort. Früher hatte allein der Gedanke an diese verdammte Schlange ihn vor lauter Panik zu einer kleinen haarigen Statue gemacht. Inzwischen war das vorbei. Ferdinand hatte hart daran gearbeitet, seine Angst in den Griff zu bekommen. Er war immer wieder so nah wie möglich an Arthurs Käfig herangeschlichen. Manchmal war die Schlange blitzschnell auf ihn zugeschossen. Das hatte ihm einen Heidenschreck eingejagt. Und er war noch immer sehr wachsam, wenn er sich in Arthurs Nähe wagte. Aber sein Training hatte sich bezahlt gemacht. Er traute sich jetzt problemlos an den Käfig heran. Ganz im Gegensatz zu …
»Ferdinand!«
Im letzten Moment hielt Ferdinand das Gleichgewicht und verhinderte einen Absturz in den Käfig von Evelyn, einem überaus bissigen Opossum. Mit finsterer Miene schaute er zu seiner eigenen Behausung zurück. Nicht nur Schlangen machten ihm das Leben schwer. Auch sein Mitbewohner Kornelius brachte ihn regelmäßig an den Rand eines Nervenzusammenbruchs.
»Was tust du da?«, fragte Kornelius jetzt. Er hatte sich hinter der Glasscheibe auf die Hinterbeine gestellt, wodurch sein massiger Körper aussah wie eine ziemlich haarige Kartoffel. »Du weißt doch, dass wir im Käfig bleiben sollen!«
Ferdinand setzte seinen Weg fort. »Als wenn ich mich schon jemals daran gehalten hätte.«
»Irgendwann wird Joe dich dabei ertappen. Du landest in Arthurs Käfig und dann …«
»… dann habe ich es wohl nicht besser verdient, wenn ich mich von einem Zweibeiner erwischen lasse. Außerdem bin ich auf einer Mission. Und du weißt doch, dass ich noch nie ein Problem damit hatte, zu teilen.«
Ferdinand stellte amüsiert fest, dass die Sorge in Kornelius’ Blick von großem Appetit verdrängt wurde. »Aber sei vorsichtig«, flüsterte er noch, als würde hinter jedem Käfig eine ungeheure Gefahr lauern.
Ferdinand kletterte an einem Stapel mit Körnerfutter kopfüber nach unten. Dieses dämliche Pappfutter stank sogar durch die Verpackung hindurch mörderisch. Ferdinand schüttelte sich. Und so was sollte er essen, tagein, nachtaus? Da hatte der gute Joe die Rechnung aber ohne ihn gemacht!
Seine Krallen verursachten kaum ein Geräusch, als er über den Boden zum Tresen lief. Im Zickzack ging es die Streben des Hockers aufwärts, von dem Joe den lieben langen Tag missmutig aus der Glastür seines Ladens schaute und auf Kundschaft wartete. Mit den Vorderpfoten zog Ferdinand sich hinauf. Ein letzter Sprung – und er landete in einer halb geöffneten Schublade. Schnell tauchte er in die Dunkelheit und grub die Nase in eine Tüte Kartoffelchips. Dieser Geruch! Schmatzend machte er sich über die Chips her. Geschmacksexplosionen statt Langeweile auf der Zunge, das war die Devise! Er schnappte sich die Tüte und huschte damit zu Kornelius zurück.
»Hier«, flüsterte er und warf ein paar Krümel durch das Loch. »Besser als der Körnerfraß.«
Kornelius zögerte wie jedes Mal, wenn Ferdinand mit irgendwelchen verbotenen Leckereien um die Ecke kam. Und wie immer machte er sich dann mit entfachtem Appetit über die Köstlichkeiten her. »Hey, Ferdi«, meinte er zwischen zwei Bissen.
Ferdinand hasste es, wenn man ihn Ferdi nannte. Aber er wusste, dass Kornelius es nicht böse meinte, daher hockte er sich auf den Deckel des Käfigs, schaute auf die Straße und machte nur: »Hmhm?«
»Glaubst du, dass wir eines Tages wirklich in Arthurs Käfig landen?«
Die Angst in Kornelius’ Stimme ließ Ferdinand den Blick wenden. Als er seinen Mitbewohner so dasitzen sah, klein und pummelig und mit einem halb aufgefressenen Chipskrümel zwischen den Pfoten, bekam er Mitleid. »Du bestimmt nicht«, sagte er aufmunternd. »Du bist so süß und puschelig, dich wird bestimmt bald ein Kind aussuchen und dich bis ans Ende deiner Tage mit Chips füttern.«
»Das wäre schön«, murmelte Kornelius verträumt. Er schaute auf den Krümel zwischen seinen Krallen, als würde er darin eine rosige Zukunft sehen.
Ferdinand seufzte leise. Wie leicht Kornelius glücklich zu machen war. Bei ihm selbst war das nicht ganz so einfach.
Sein Blick schweifte wieder hinaus auf die Straße. Ihm war schon klar, dass er eigentlich wie Kornelius davon träumen sollte, von einem netten Menschen gekauft zu werden und ein gemütliches Leben zu führen – so, wie es alle anständigen Ratten taten. Aber trotz der Chips, die eindeutig ein gutes Argument waren, stellte er sich ein solches Leben schrecklich langweilig vor. Er träumte von etwas ganz anderem.
Wenn er nur daran dachte, welche Abenteuer jenseits der Glastür darauf warteten, von ihm bestanden zu werden! Aber weiter als bis zu Joes Tresen war er noch nicht gekommen. Dabei hatte er es sich oft vorgestellt, einfach heimlich hinter Joe aus der Tür zu flutschen, wenn er abends abschloss. Doch irgendetwas hatte ihn immer zurückgehalten. Und es waren nicht die Horrorgeschichten gewesen, die Kornelius ihm mit blühender Fantasie über die Stadt dort draußen erzählt hatte.
Er betrachtete sich selbst im Spiegel des Vogelkäfigs. Eine kleine grauweiß gefleckte Ratte mit einem störrischen Fellbüschel auf dem Kopf. Eine Farbratte, wie die Kinder der Zweibeiner sie sich als Spielkameraden wünschten. Vielleicht war er ja doch nicht mehr als das? Womöglich war er gar nicht so furchtlos, wie er es sich selbst gern weißmachte?
Ein Knirschen zerriss die Luft. Erschrocken fuhren die Vögel aus dem Schlaf. Sie zwitscherten aufgeregt durcheinander und die Meerschweinchen gaben ein Quiek-Konzert. Ferdinand reckte sich in die Höhe und erkannte eine dunkle Gestalt vor dem Laden. Im selben Moment gab Kornelius eine Folge von Lauten von sich, die ungefähr klang wie Ach-herrje-oh-nein-oh-jemine. Der Fremde trat gewaltsam gegen die Tür. Krachend flog sie auf. Die anderen Tiere erwachten, lautes Stimmengewirr erfüllte die Luft.
Nur Ferdinand saß reglos da. Aus dem Augenwinkel bemerkte er, wie der Einbrecher zur Kasse stürzte. Aber vor allem sah er die Tür. Die weit geöffnete Tür. Wie oft hatte er sie angestarrt, als sie noch verschlossen gewesen war? Wie oft hatte er sich vorgestellt, durch einen kleinen Spalt zu entkommen? Ein Windstoß fuhr durch den Laden und stob Ferdinand ins Fell. Unzählige Gerüche breiteten sich vor ihm aus. Und plötzlich wusste er, dass er niemals mehr durch diese Tür gehen würde, wenn er es jetzt nicht tat.
Mit einem Satz sprang er von seinem Käfig und lief auf die Tür zu. Die Stimmen der anderen Tiere wurden noch lauter. Es war, als würde sich die Aufmerksamkeit aller nur auf ihn richten. Kurz vor der Schwelle blieb Ferdinand stehen und schaute zu Kornelius zurück.
Er hatte erwartet, dass sein Mitbewohner ihn voller Angst und Sorge ansehen würde, denn er konnte dessen Anspannung riechen. Aber Kornelius stand nur da, hoch aufgerichtet an der Glasscheibe des Käfigs, und blickte mit stiller Zuversicht zu ihm herüber. Und da begriff Ferdinand, dass Kornelius nicht aus Feigheit in seinem Käfig blieb. Sondern weil er wirklich davon träumte, bei einem Menschen zu leben – so wie Ferdinand davon träumte, hinaus in die Welt zu ziehen. Sie sahen einander an. Zum ersten Mal schienen sie sich wirklich zu verstehen. Dann drehte Ferdinand sich um, und mit einem kräftigen Satz sprang er hinaus in die Nacht.
Der Wind griff nach seinem Fell, die Stadt roch wild und frei. Ein Kribbeln jagte durch Ferdinands Körper, als er die Straße hinablief, so schnell, dass sein Schatten an der Wand Freudentänze vollführte. Noch nie hatte er sich so lebendig gefühlt wie in diesem Moment. Und eines wusste Ferdinand genau: Das war erst der Anfang!
Shadow
Der Wind war rau und kalt und großartig. Ferdinand hatte keine Ahnung, wohin er lief, und es kümmerte ihn auch nicht. Er war nur froh, endlich draußen zu sein, den Schritt gewagt zu haben und durch die Nacht zu rennen. Unter dem gigantischen Himmel, der sich über ihm spannte – schier unendlich und mit funkelnden Glitzerlichtern übersät. Vorbei an grellen Schaufenstern und dröhnenden Straßen. Zwischen den Füßen der Zweibeiner hindurch, die ihn gar nicht wahrnahmen. Hüpfend über die Gitter von Abwasserkanälen und durch Schwaden aus unterschiedlichsten Gerüchen.
Überhaupt roch alles so groß. Der Regen auf dem Asphalt. Die Abgase der Höllenmaschinen auf den Straßen. Gebratenes Fleisch. Und dann der Wind, der die Schreie von Krähen mit sich trug und den Duft unzähliger anderer, die waren wie Ferdinand: frei.
Und dann war da ein Rauschen, dunkel und gewaltig. Ferdinand stockte der Atem, als er die Bäume hörte, die sich hinter einer leuchtenden Straße in den Nachthimmel hoben. Ferdinand musste an die Postkarten denken, die Joe über seiner Kasse hängen hatte: Bilder von Bergen und Seen und Wäldern. Jede Nacht hatte Ferdinand die Karten angestarrt und sich vorgestellt, wie es wohl wäre, diese Orte kennenzulernen. Und nun lag er vor ihm: ein Wald.
Ohne nachzudenken rannte er über die Straße geradewegs darauf zu. Er wurde vom Fahrtwind der Höllenmaschinen mitgerissen und kugelte über den Asphalt. Bestialischer Gestank ließ seine Lunge brennen. Aber er schaffte es auf die andere Seite.
Mit einem Freudenhüpfer sprang er in den Wald hinein. Natürlich wusste er, dass es der Central Park war. Immerhin lebte er seit er denken konnte in New York City. Aber trotzdem kam ihm die Anlage riesig vor. Der Sand knirschte unter seinen Krallen. Überall im Unterholz hörte er Stimmen, die nur darauf zu warten schienen, ihn kennenzulernen. Am liebsten hätte er laut gerufen. Und da bemerkte er den Schatten, der ihm folgte.
Sofort war jede Ausgelassenheit in Ferdinand wie weggeblasen. Sein Fell sträubte sich. Er witterte. Der Geruch, der in seine Nase stieg, versetzte ihn in höchste Alarmbereitschaft. Und da konnte er ihn auch schon sehen: den verfluchten Kater, der ihm nachhuschte. Er wäre lautlos gewesen, wie Killer es zu tun pflegen, wenn er nicht eine alberne Klingel um den Hals getragen hätte. In bemerkenswerter Überheblichkeit fixierte er Ferdinand. Wahrscheinlich tat dieses Katzenvieh nichts anderes, als extra für ihn zubereitetes Futter zu fressen, sich kraulen zu lassen und hin und wieder ein Beutetier zu fangen. Ferdinand schnaubte wütend. Er war keine Beute! Und er würde nicht vor jemandem weglaufen, der in einem Körbchen zu Füßen eines Zweibeiners schlief. Ferdinand machte sich so groß wie möglich und blieb mitten auf dem Weg stehen.
Der Kater hielt ebenfalls inne. Er schnüffelte irritiert, als würde er sich vergewissern wollen, dass ihm tatsächlich eine Ratte gegenüberstand und kein Wolf. Dann knurrte er abfällig und setzte zum Sprung an.
Ferdinand wich ihm so schnell aus, dass der Kater über seine Vorderläufe stolperte. Verdattert fuhr er herum. Offenbar hatte er sich diesen Fang leichter vorgestellt. Ferdinand meinte ein Klirren zu hören, als der Kater die Krallen ausfuhr. Die Trägheit wich aus dessen Blick. Ganz tief in diesem verhätschelten Katerkörper war sie also noch, die Wildheit. Und Ferdinand hatte sie geweckt. Jetzt hörte das Spiel auf. Jetzt begann der Kampf.
Der Kater schoss vor. Im letzten Moment rollte Ferdinand sich zur Seite, wich den Pranken aus, die auf ihn niedersausten, und rappelte sich wieder auf. Nun kamen ihm die Trainingseinheiten vor Arthurs Käfig zugute. Ohne sie wäre er binnen eines Krallenhiebs ein hysterisches Rattenhäufchen gewesen. So aber sauste er zu einer Parkbank und versteckte sich geschickt zwischen den Streben. Der Kater wurde immer wütender. Außer sich schlug er auf die Bank ein, während Ferdinand unbemerkt an der Lehne aufwärts kletterte. Und dann, gerade als der Kater zu ihm herumfuhr, landete Ferdinand mit einem gezielten Sprung auf dessen Rücken.
Sein Fell roch nach Parfum und Pizza. Hatte Ferdinand es doch gewusst: Er hatte einen Weichkater erwischt! Mit aller Kraft hielt er sich an dem fauchenden Biest fest – und grub seine Zähne so tief er nur konnte in dessen Flanke. Sein Gegner jaulte auf. Ferdinand schmeckte Blut. Wilder Triumph flutete durch seinen Körper. Er hatte einen Kater verwundet, verdammt noch eins! Er hatte einen Kater gebissen!
Die Pranke erwischte ihn mit voller Wucht. Ferdinand überschlug sich mehrfach. Er schluckte Erde und Sand, bis er am Fuß eines Baums liegen blieb. Er spürte einen Kratzer von einer Katerkralle an der Seite und roch sein eigenes Blut. Alles drehte sich. Das Knurren, das unaufhaltsam näher kam, raubte ihm den Atem. Die Augen des Katers glühten in der Dunkelheit. Ferdinand fühlte jeden Knochen im Leib. Er lag da wie ein zertrümmertes Stück … Beute …
Dieses Wort trieb ihn auf die Beine. Er würde nicht einfach am Boden kauern und sich fressen lassen. Er würde dieser verfluchten Katze im Hals stecken bleiben! Er sträubte sein Fell. Der Kater sprang auf ihn zu – und wurde von einem schwarzen Blitz getroffen. Mit enormer Wucht kugelte er ins Unterholz, und da erkannte Ferdinand, dass es kein Blitz war, der den Kater erwischt hatte, sondern … eine Ratte?
Ferdinand hatte sich nicht getäuscht. Es war eine männliche Ratte, die nun vor dem Kater landete. Aber jemanden wie ihn hatte Ferdinand noch nie gesehen. Er war dunkelgrau, abgesehen von einem weißen Zeichen auf der Stirn, das an einen Stern erinnerte. Seine Krallen funkelten in der Nacht. Und er trug nicht nur ein Tuch vor Mund und Schnauze sowie einen dunklen Kampfanzug mit Gamaschen und Kapuze, sondern hielt auch zwei Schwerter in den Pfoten.
Ferdinand glaubte zu träumen. Aber er spürte noch immer den Striemen, den die Katzenpranke in seinem Fleisch hinterlassen hatte – und er sah, wie die fremde Ratte kämpfte. Mit wirbelnden Schwertern schlug sie auf den Kater ein, der offenbar überhaupt nicht mehr wusste, wie ihm geschah. Er hieb nach seinem Gegner, aber er hatte keine Chance. In blitzartiger Geschwindigkeit sprang die Ratte durch die Luft und zog ihm ihre Waffen quer über die Nase.
Laut fauchend bäumte der Kater sich auf und floh in die Nacht. Die Ratte jedoch landete ohne jedes Geräusch und schaute ihrem Opfer reglos nach. Ferdinand hielt den Atem an. Diese Ratte dort drüben hatte ihm gerade das Leben gerettet. Diese Ratte war ein Krieger.
Das Gewebe seines Anzugs verursachte kein Geräusch, als der Fremde seine Waffen daran abwischte und sie in einen Halfter auf seinem Rücken steckte. Ferdinand nahm den Geruch von Blut wahr, einzelne Tropfen hatten den Sand verfärbt. Die Ratte selbst jedoch konnte Ferdinand seltsamerweise nicht riechen. Jetzt hob sie den Blick und schaute Ferdinand an. Ihre Augen waren blau und brannten jedes Wort aus Ferdinands Kopf bis auf drei: »Wer bist du?«
Die Ratte zog das Tuch von Mund und Schnauze. Nun, da der Kampf vorüber war, hatte sie etwas Vornehmes an sich. »Du kannst mich Shadow nennen. Und wer bist du? Ein Junges ohne Namen?«
Ferdinand richtete sich ein wenig auf. »Ich bin Ferdinand.«
Shadow maß ihn mit einem abschätzigen Blick. »Sagte ich doch: ein Junges ohne Namen. Nun gut … Ferdinand. Was hast du hier draußen zu suchen?«
Ferdinand schluckte. Er konnte sich nicht erinnern, dass sein Name jemals mit solchem Spott ausgesprochen worden war. »Ich bin aus einer Zoohandlung abgehauen«, erklärte er. »Da gehörte ich nicht hin.«
Shadow hob den linken Mundwinkel. Ansonsten stand er auf zwei Beinen da wie aus Stein gemeißelt. »Und wohin gehörst du?«
Ferdinand zögerte. »Ich weiß es nicht. Noch nicht.« Shadow schwieg, und Ferdinand konnte nicht länger an sich halten. »Wie hast du das eben gemacht? Sind das wirklich Schwerter? Wieso kannst du damit kämpfen? Bist du …«
Shadow hob nur die linke Pfote, aber die Geste genügte, um Ferdinand verstummen zu lassen. Irgendetwas hatte dieser Kerl an sich, das keinen Ungehorsam duldete. »Viele Fragen«, sagte Shadow. »Zu viele für ein Kind wie dich. Aber eines kann ich dir sagen: Nicht alle Ratten sind Haustiere, Parasiten oder Versuchsobjekte, wie die Zweibeiner glauben. Einige von uns haben besondere Kräfte und leben unabhängig von der menschlichen Gesellschaft. Doch diese Freiheit hat ihren Preis. Nicht jeder hält ihr stand. Geh zurück, woher du gekommen bist, kleiner Junge.« Damit wandte er sich ab.
Ferdinand spürte sein Herz im ganzen Körper. Er hatte geglaubt, dass der Kater ihn an den Rand seiner Kräfte gebracht hatte. Aber offenbar war er noch stark genug für die Wut, die nun in ihm aufstieg. »Ich gehe nirgendwohin«, sagte er mit fester Stimme. »Und ich lasse mir nichts befehlen!«
Langsam drehte Shadow sich um. Seine Schwerter funkelten angriffslustig. Täuschte Ferdinand sich, oder war er auf einmal zurück – der drohende Geruch von Blut auf Metall? Sie maßen einander mit ihren Blicken. Ferdinand kostete es enorme Anstrengung, nicht wegzusehen. Aber er hielt dem Schatten stand.
»Nun«, sagte Shadow schließlich. »Wie lautet deine Entscheidung?«
Ferdinand sah ihn verwirrt an. »Entscheidung?«
»Willst du leben oder sterben?«
»Was …«, begann Ferdinand. »Leben natürlich!«
»Dann hast du also einen Plan?«
»Plan? Ich …«, stammelte Ferdinand. Die Gedanken in seinem Kopf lösten sich unter Shadows eisigem Blick zu grauen Fusseln auf. Er verstummte.
»Du bist eine Farbratte«, fuhr Shadow fort. »Du bist verweichlicht und unerfahren, und du hast keine Ahnung, an welchen Ort du hier tatsächlich geraten bist. Schon sehr bald wirst du Hunger haben, wo willst du schlafen? Und was soll mit deiner Wunde passieren?«
Ferdinand berührte instinktiv den Kratzer und zuckte zusammen. »Ich habe keinen Plan«, sagte er. Dann legte er den Kopf schief. »Aber du bestimmt.«
Shadow antwortete nicht sofort. »Wie kommst du darauf?«, fragte er dann.
»Warum hast du mich sonst gerettet?«
Wieder maßen sie einander mit ihren Blicken. Dann breitete sich eine kluge Tücke auf Shadows Gesicht aus, die jede Vornehmheit wegwischte. Jetzt wusste Ferdinand, wen er vor sich hatte: einen Dieb, einen Betrüger – und einen Krieger, der keinen anderen seines Schlages allein in der Dunkelheit lassen würde.
»Ferdinand«, sagte Shadow wieder mit dieser spöttischen Betonung. »Du bist ein Grünschnabel, aber du gefällst mir. Also komm mit mir.« Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte er sich um und lief den Weg hinab. Nach einigen Schritten wandte er sich halb zurück. »Ich habe meinen Namen nicht grundlos. Ich verschwinde schnell wie ein Schatten. Und ich bitte dich kein zweites Mal, mir zu folgen.«
Da zögerte Ferdinand nicht länger. So schnell er konnte, lief er Shadow nach.
Im Untergrund
»Nun komm schon!«
Shadows Stimme war nicht mehr als ein Raunen in der Tiefe des Abwasserschachts. Ferdinand beugte sich hinunter. Angesichts der stinkenden Finsternis wurde ihm schwindlig. Über ihm sausten die Höllenmaschinen dahin. Es war das pure Glück, dass ihn noch keine davon erwischt hatte. Er musste die rostige Leiter hinabklettern, das wusste er. Aber sobald er es versuchte, überfielen ihn die Bilder des New Yorker Untergrunds, die Kornelius mit seinen Horrorgeschichten in Ferdinands Hirn gepflanzt hatte. Riesige Alligatoren. Giftige Gewässer. Und Schlangen. Jede. Menge. Schlangen.
»Grünschnabel!«
Der Name traf Ferdinand wie ein Hieb. Er taumelte nach vorn. Ehe er es sich versah, hing er kopfüber an der Leiter. »Schon gut«, brachte er hervor. »Ich komme ja!«
»Immerhin kannst du klettern«, murmelte Shadow neben ihm, während sie sich abwärts bewegten. »Jedenfalls einigermaßen. Pass auf, da vorn fehlt eine Sprosse.«
Das hätte er Ferdinand nicht sagen müssen, denn dieser verlor just in diesem Moment den Halt an dem glitschigen Metall. Mit heiserem Keuchen stürzte er ab, schlug seitlich gegen eine Sprosse und landete in der Kloake. »Widerlich!« Hustend und strampelnd kämpfte er gegen die stinkende Brühe, bis er neben Shadow auf einem Betonsockel stand. Ferdinand schüttelte sich, dass die Schlammspritzer nur so flogen, und fuhr sich mit der Pfote über die schmerzende Seite.
Shadows Augen funkelten im Dunkeln. »Es gibt immer noch viele von uns, die auf diese … Hinterlassenschaften und diesen Geruch total abfahren. Nicht dort allerdings, wo wir jetzt hingehen.«
Ferdinand vergaß augenblicklich den Dreck in seinem Fell. Sein ganzes Leben hatte er sich gefragt, was mit ihm nicht stimmte. Jede gewöhnliche Ratte fraß, was ihr unter die Nase kam, machte weder vor Aas noch vor den Exkrementen der Zweibeiner halt und fühlte sich auch im größten Schmutz pudelwohl. Ferdinand nicht. Er war immer schon anders gewesen. Gab es tatsächlich noch mehr, die so waren wie er?
Shadow jedenfalls fand zielsicher Wege, die abseits der übel riechenden Tümpel lagen. Auch er schien heilfroh zu sein, als sie die Kanalisation hinter sich ließen und durch eine Nische in einen trockenen Gang gelangten. Kurz spendete die Beleuchtung der Tunnel ihnen noch etwas Licht. Dann bogen sie um eine Ecke und es wurde dunkel. Aber das kümmerte Ferdinand kaum. Er verließ sich sowieso am liebsten auf sein Gehör und seinen Geruchssinn, wenn es darum ging, neue Umgebungen zu erkunden.
Die Untergrundbahnen dröhnten in der Ferne. Es roch kühl und frisch nach Felsgestein, und wenn Ferdinand mit seinen Krallen gegen einen Erdklumpen stieß, zog der Duft von vergangenen Zeiten in seine Nase: schwer und geheimnisvoll. Dieser Gang war alt. Älter als alles, was Ferdinand bisher gerochen hatte.
Shadow neben ihm bewegte sich vollkommen lautlos. Und noch immer roch er nach gar nichts. Nur an der Wärme, die sein Körper aussandte, konnte Ferdinand erkennen, dass er noch da war. Wortlos führte er Ferdinand durch Maueröffnungen in andere Gänge. Es wurde kühler. Tief, immer tiefer ging es hinab. Und auf einmal wurde es wieder hell.
Ferdinand staunte nicht schlecht, als er glimmende Steine an der Decke bemerkte. Offenbar leuchteten sie aus sich selbst heraus. Sie erhellten einen Gang, dessen Wände von Kratzern übersät waren. Es sah aus, als wären sie von Waffen und Krallen malträtiert worden. Ferdinand nahm den schwachen Geruch von altem Blut wahr. Vor langer Zeit hatte hier eine Schlacht stattgefunden. Aber warum? Und wer hatte in diesem Gang gekämpft?
»Was …«, begann Ferdinand.
»Nicht hier«, raunte Shadow. »Diese Gänge haben Augen und Ohren.«
Prompt hatte Ferdinand das Gefühl, aus all den Schnitten im Stein beobachtet zu werden. Er lief hinter Shadow her, bis dieser endlich stehen blieb. Der Schatten suchte eine Wand ab, richtete sich auf und berührte mit der Kralle eine Kerbe, die aussah wie ein zu einem Kreis geformter Rattenschwanz. Ein Schimmer ging durch die Linie, dicht gefolgt von einem Dröhnen in der Wand. Und dann, mit leisem Knirschen, öffnete sich ein Spalt direkt vor ihnen.
Ferdinand sog überrascht die Luft ein. Doch ein warnender Blick von Shadow verschloss jeden Laut hinter seinen Zähnen. Ohne ein Wort schlüpfte Shadow durch den Spalt. Ferdinand blieb nichts anderes übrig, als ihm mit klopfendem Herzen zu folgen. Der Spalt schloss sich, und vor ihnen lag ein Gang, der noch tiefer ins Erdinnere führte.
Auch hier zogen sich Schrammen über den Fels. Es fiel Ferdinand schwer, Shadow nicht mit Fragen zu bombardieren. Er betrachtete die dunklen Nischen in den Wänden, aus denen er nichts witterte als kalten Stein. Wer sollte sie an diesem verlassenen Ort auch belauschen? Er warf Shadow einen Blick zu – und erschrak.
Shadow war verschwunden.
Verwirrt blieb Ferdinand stehen. Er drehte sich um, aber Shadow war nirgends zu hören oder zu sehen. Ferdinand wollte ihn rufen, besann sich dann aber auf Shadows Warnung. Wieso nur hatte er ihn allein gelassen? Unsicher lief Ferdinand den Gang hinab. Er würde einfach weitergehen. Bestimmt würde Shadow früher oder später wieder zu ihm stoßen und …
Er sah die Pfote nicht kommen. Erst, als sie ihn an der Kehle packte und gegen die Wand presste, so fest, dass er keine Luft mehr bekam, erkannte Ferdinand die männliche Ratte, die ihm mit grimmiger Miene gegenüberstand.
Der Kerl war mindestens drei Köpfe größer als er, hatte braunes Fell und war wie Shadow in einen dunklen Kampfanzug gekleidet. Darüber jedoch trug der Fremde schützende Platten aus Leder, die ebenso mit Schrammen bedeckt waren wie die Wände des Gangs und nun in bedrohlichem Flammenschein aufloderten. Die Kapuze warf Schatten in sein Gesicht, das Tuch vor seiner Schnauze bewegte sich unter seinem Atem. Ansonsten stand er da wie ein Riese aus Stein.
Ferdinands Hinterbeine baumelten in der Luft und er fühlte eine beginnende Ohnmacht in sich aufsteigen. Wieso, verflucht noch eins, hatte er diesen riesigen Kerl nicht bemerkt? Erst, als er schluckte, erkannte Ferdinand, dass er eine Messerklinge an der Kehle hatte.
»Du stinkst«, grollte der Fremde mit einer Stimme, die in Ferdinands Knochen widerhallte. »Was hast du hier verloren?«
Ferdinand wollte etwas erwidern. Aber angesichts der wutglühenden Augen direkt vor ihm zerbröselten seine Worte. Jeden Moment würde der Kerl ihm die Kehle durchschneiden.
»Buzz«, raunte da jemand am Ohr des Fremden. »Das ist die Oberwelt. Abgase. Dreck. Zweibeiner. Du weißt schon. Aber ich freue mich, dich wiederzusehen. Hast du mich vermisst?«
Ferdinand durchflutete Erleichterung, als er Shadow sah. Der Schatten stand dicht hinter Buzz und hielt eine Schwertklinge an dessen Kehle.
Buzz’ Miene verfinsterte sich noch mehr. »Shadow«, brummte er, ohne den Blick von Ferdinand abzuwenden. Zwar lockerte er seinen Griff ein wenig, aber Ferdinand spürte seine Krallen noch immer schmerzhaft tief in seinem Fleisch. Von dem Messer an seiner Kehle ganz zu schweigen. »Du weißt, dass du keine Fremden in diese Gänge bringen sollst.«
»Er ist kein Fremder«, entgegnete Shadow mit einer Gelassenheit, die Ferdinand fast noch mehr beunruhigte als die Klinge. »Jedenfalls nicht mehr lange.«
Buzz sah Shadow an, als würde er nach einer Antwort auf eine Frage suchen, die er nicht laut gestellt hatte. »Das kann nicht dein Ernst sein«, murmelte er dann. »Dieser Winzling ist völlig ungeeignet dafür. Sein Angstgestank erfüllt schon den halben Gang.«
Da blitzte Spott durch Shadows Augen. »Ich möchte dich daran erinnern, dass er gerade kurz davor steht, umgebracht zu werden. Da ist es wohl verständlich, ein wenig erschrocken zu sein. Allerdings ist er nicht der Einzige mit einer Klinge an seinem Hals.«
Buzz schaute auf sein Messer, als hätte er es völlig vergessen, und ließ es sinken. Gleichzeitig zog Shadow sein Schwert zurück. »So oder so«, grollte Buzz. »Du kannst ihn nicht einfach hierher bringen. Er ist eine Gefahr.«
»Ernsthaft?« Shadow tippelte mit seinen Krallen auf Buzz’ Schulter herum. »Einerseits ist er ein Angsthase, andererseits ist er eine Gefahr, die man sofort unschädlich machen muss. Deine Logik ist bestechend. Und mal ehrlich: Du fürchtest dich vor einem kleinen Jungen?«
Buzz schnaubte. »Es geht nicht um mich. Ich bin nur ein Wächter dieser Gänge. Aber du kennst die Gesetze des Clans.«
»Und du kennst mich«, gab Shadow zurück. »Wie oft habe ich euch geschadet, wie oft habe ich euch geholfen und beigestanden?« Er wartete, bis der unwillige Schatten aus Buzz’ Augen verschwunden war. »Siehst du«, fuhr er fort. »Ich habe mich noch nie getäuscht. Also vertrau mir. Was hast du zu verlieren? Wenn der Kleine sich als unwürdig erweisen sollte, kannst du ihn ja immer noch in seine Einzelteile zerlegen.«
Buzz musterte Ferdinand, als würde er sich schon überlegen, mit welchem Körperteil er anfangen würde. Und dann, ohne dass Ferdinand es hätte kommen sehen, ließ er ihn fallen. Wie ein lebloser Futtersack landete Ferdinand am Boden. Seine Knochen knackten, als Shadow ihm wortlos aufhalf.
Buzz steckte das Messer zurück an seinen Gürtel. »Ihr könnt von Glück reden, dass ich heute Nacht Dienst habe. Andere an meiner Stelle hätten kurzen Prozess mit euch gemacht.«
Shadow legte leicht den Kopf schief. »Wenn ich ihnen nicht zuvorgekommen wäre.«
Ferdinand hatte sich weit genug beruhigt, um Shadow von der Seite anzusehen. Hatte er etwa die ganze Zeit gewusst, dass Buzz da war? Hatte er ihn absichtlich in diese riesigen Krallen laufen lassen?
»Es gibt Gefährlicheres auf der Welt als gerüstete Ratten oder fette Kater«, fuhr Shadow fort, als hätte er Ferdinands Empörung gerochen. »Das könnt ihr mir beide glauben.«
»Ach ja?«, fragte Ferdinand. »Was denn?«
Aber Shadow schnaubte nur. »Du würdest vor Angst zerbröseln, wenn ich dir auch nur einen Hauch der Schrecklichkeiten erzählen würde, die dir in Freiheit begegnen können. Also spare dir deine Fragen vorerst. Du wirst noch früh genug Antworten bekommen.«
Ferdinand seufzte. Woran lag es nur, dass fast jeder Satz aus Shadows Mund wie eine Warnung klang?
»Das ist wahr«, murmelte Buzz. Er umfasste Ferdinand mit seinem Blick. »Wie ist dein Name, Junge?«
»Ferdinand«, antwortete dieser. Er rechnete mit demselben Spott, den Shadow seinem Namen entgegenbrachte, aber Buzz verzog keine Miene.
»Du befindest dich in den Sehenden Gängen«, sagte der Wächter. »Es ist eine Ehre, sie betreten zu dürfen. Nicht alle vertrauen diesem Schatten hier – ich für meinen Teil schon. Also heiße ich dich willkommen. Rechne nicht damit, dass dir diese Freundlichkeit von jedem entgegengebracht wird.«
Ferdinand bemühte sich, dem Blick des Wächters standzuhalten. »Ein Messer an meiner Kehle genügt mir fürs Erste. Man soll es mit der Freundlichkeit ja auch nicht übertreiben.«
Buzz stieß ein Lachen aus, warm und grollend. »Nicht auf den Mund gefallen«, stellte er fest und knuffte Ferdinand in die Seite, dass dieser gegen die Wand taumelte. »Das ist gut. Du wirst Wehrhaftigkeit gebrauchen können, dort, wo wir jetzt hingehen.«
Shadow sah ihn überrascht an. »Sag bloß, du begleitest uns.«
»Allerdings«, entgegnete Buzz. »Ihr würdet sonst nur in weitere Kontrollen geraten. Und ich kann nicht verantworten, was du mit ihnen anstellen würdest.« Ein amüsiertes Funkeln ging durch seinen Blick, das ihm etwas Freundliches gab.
Ferdinand strich sich über den Hals. Auch wenn ihre erste Begegnung alles andere als angenehm gewesen war, mochte er Buzz. Er hatte etwas an sich, das Ferdinand an einen Felsen im Sturm erinnerte.
»Ihr habt also die Zahl der Wächter erhöht«, sagte Shadow, nachdem sie eine Weile schweigend gelaufen waren. »Wie ich Schwarzblut kenne, hat er diese Entscheidung nicht grundlos getroffen.«
Ferdinand konnte Buzz nicht ins Gesicht schauen, da er hinter ihm lief. Aber er spürte die Schwere, die sich auf den Wächter legte. »Nein«, grollte Buzz. »Schwarzblut ist ein besonnener Anführer und seine Gründe sind ernst: drei tote Wächter, fünf Verwundete in den Außenbezirken und ein gefallener Krieger seit dem letzten Vollmond.«
Shadow pfiff durch die Zähne. »Ich hörte von Kämpfen im Norden, aber ich wusste nicht, dass es euch so hart getroffen hat.«
»Es sind unruhige Zeiten«, erwiderte Buzz finster. »Mancher sagt, die Waffenruhe der Clans wird bald vorbei sein.«
Shadow schaute ihn an und Ferdinand konnte die Sorge auf dessen Zügen sehen. »Und was sagst du?«
»Ich bin kein Gelehrter«, antwortete Buzz. »Ich weiß wenig über die Geschichte und die Hintergründe der Waffenruhe. Aber ich kann das Blut meiner gefallenen Gefährten riechen. Und ich spüre, dass die Luft kälter wird, selbst in meinen Träumen. Nebel zieht auf. Und wir alle wissen, was das bedeutet.«
Damit schwieg er, und auch Shadow sagte nichts mehr. Obwohl Ferdinand nur die Hälfte von dem verstanden hatte, was besprochen worden war, hallten die Worte unablässig in ihm wider. Schließlich zogen sie sich zu einer Frage zusammen: Wenn die Waffenruhe endete – bedeutete das Krieg?
Er fuhr zusammen, als mitten in diesen Gedanken hinein eine Gestalt vor ihnen auf den Gang trat. Doch Buzz blieb gelassen. Er bedeutete ihnen, stehen zu bleiben, und lief auf die Gestalt zu. Da erkannte Ferdinand, dass es ein anderer Wächter war, der nun leise mit Buzz sprach. Auch er trug eine Lederrüstung, auch sein Blick verfinsterte sich, als er Ferdinand ansah. Aber Buzz schien der Ranghöhere zu sein. Es brauchte nicht mehr als ein Schnauben, um den Wächter zurück an seinen Platz in die Finsternis zu schicken.
Sie setzten ihren Weg fort. Immer wieder begegneten ihnen von nun an Wächter. Manche traten ihnen entgegen, andere beobachteten sie aus den Nischen, und Ferdinand sah eine weibliche Wächterin hoch oben an der Decke ausharren, als wartete sie nur darauf, einem Feind ins Genick zu springen. Ihr Fell schimmerte in einem warmen Goldbraun, doch ihr kühler Blick aus dunkelroten Augen fuhr Ferdinand ins Mark. Wie die anderen schien sie eine unsichtbare Mauer aus Vorsicht um sich errichtet zu haben.
Ferdinand hingegen spürte eine wilde Aufregung, jedes Mal, wenn er die Wächter betrachtete. Gleichzeitig musste er sich zwingen, unter ihren harten Blicken nicht den Kopf zu senken. Aber er hielt ihnen stand. Denn auch, wenn er diese fremden Ratten weder wittern noch vollständig verstehen konnte, begriff er eines: In diesen Gängen Schwäche zu zeigen, konnte böse enden.
Schließlich hielt Buzz vor einer tiefschwarzen Steinmauer inne. »Wir sind da.« Er sah Shadow an. »Du weißt, wohin du gehen musst. Ich hoffe für dich, dass du dich nicht geirrt hast.« Dann richtete er seinen Blick auf Ferdinand. »Und du«, grollte er. »Bewahre dir deine Stimme. Neben allem Mut ist sie das Wichtigste, das du hast.«
Kurz ging eine Wärme durch seine Augen, die Ferdinand jedes Messer an seiner Kehle vergessen ließ. Dann drehte Buzz sich um, und ohne eine Antwort abzuwarten, verschwand er in der Dunkelheit.
Ein flackernder Lichtschein lenkte Ferdinands Aufmerksamkeit auf die Wand. Shadow zog die Pfote von einem Zeichen zurück, das hell aufstrahlte. Der Schein wurde zu einem glimmenden Riss in der Wand. Sofort nahm Ferdinand einen herben, würzigen Geruch wahr, und sein Herz setzte für einen Schlag aus. Ratten. Aber sie rochen nicht wie seine Artgenossen im Zooladen. Ihr Duft war wild, geheimnisvoll und gefährlich.
Ferdinand trat neben Shadow durch den Riss. Die Wand schloss sich hinter ihnen, aber er merkte es kaum. Seine ganze Aufmerksamkeit lag auf dem Anblick, der sich ihm nun bot.
»Willkommen«, raunte Shadow neben ihm. »Willkommen beim Clan des Feuers!«
Der Bau des Feuers
Sie befanden sich in einer riesigen Höhle. Die Wände wurden von Stufen gebildet, die trichterförmig nach unten hin zusammenliefen. Auffällige Felsformationen mit glühenden Fenstern wurden von Sträuchern und glimmenden Bäumen umwachsen. Die Gebäude wirkten fast wie die Häuser der Zweibeiner. Besonders beeindruckend war ein schwarzer Turm, auf dessen Dach Ferdinand den Widerschein von goldrotem Feuer ausmachte. Eine Kaskade aus funkensprühender Glut brauste an der Fassade abwärts. Sie mündete in einem Feuerfluss, der sich über etliche Stufen abwärts schlängelte und am Höhlenboden in einer Arena endete. Glänzendes Glas zog sich über den Grund. Und darunter pulsierte das größte Feuer, das Ferdinand je gesehen hatte.
Er starrte in die Flammen wie in einen Abgrund. Trotz des Schutzglases spürte er die Hitze in seinem Fell. Wie ein Herzschlag durchglühte dieses Feuer jeden Stein und jeden Baum mit seiner Wärme. Ferdinand packte eine heftige Sehnsucht danach, ein Teil dieser Flammen zu sein – ein Teil der Stärke, die in ihnen war. Gewaltsam riss er sich von dem Anblick los und richtete seine Aufmerksamkeit auf die Bewohner dieser Höhle.
Es waren Ratten, junge und alte, kleine und große, männliche und weibliche und sogar Kinder, die allein oder in Gruppen auf den Stufen herumwuselten. Die meisten waren in Kampfanzüge oder Rüstungen gekleidet, manche trugen Umhänge. Sie waren in Gespräche vertieft, liefen geschäftig umher oder trainierten in der Arena mit Wurfsternen, Schwertern, Dolchen und jeder Menge Waffen, die Ferdinand noch nie gesehen hatte. Und sie beherrschten atemberaubende Kampftechniken. Ihm fiel eine junge Kriegerin mit rötlichem Fell auf, die wie ein Wirbelwind eine Kette durch die Luft schleuderte, sie ihrem viel größeren Gegner um die Beine wickelte und ihn zu Fall brachte. Ferdinand spürte ein aufregendes Kribbeln im Leib. Er war in einem Bau von Kriegern gelandet.
Ein rätselhafter Wind griff ihm ins Fell. Schnell lief er Shadow nach, der sich mit sicheren Bewegungen seinen Weg durch die Kämpfenden bahnte. »Ich weiß, dass du nur ungern Fragen beantwortest«, sagte Ferdinand. »Aber wo sind wir hier?«
Shadow würdigte ihn keines Blickes. »Zuhören ist eine Kunst, die du offenbar noch nicht beherrschst. Wie ich bereits sagte: Wir befinden uns beim Clan des Feuers.«
»Klingt gut, sagt mir aber überhaupt nichts.« Ferdinand wich einem Pfeil aus, den eine struppige Ratte dicht an seinem Ohr vorbei auf eine Zielscheibe geschossen hatte. »Buzz sagte, dass es noch andere Clans gibt. Welche hat er gemeint? Was hat es mit der Waffenruhe auf sich? Und wie kommt es, dass die Ratten hier Klamotten und Waffen tragen?«
Shadow stieß die Luft aus. »Es hat seine Gründe, warum ich Fragen nicht mag. Warum wohl tragen wir Kleidung? Weil wir zivilisiert sind, deshalb. Es ist nicht nur praktisch, um sich vor Schmutz und Kälte schützen zu können. Es ist auch eine Sache des Stils.«
Ferdinand betrachtete sein bloßes Fell. Zum ersten Mal in seinem Leben kam er sich unangenehm nackt vor.
»Mach dir nichts draus«, meinte Shadow. »Du bist neu. Man wird darüber hinwegsehen, wie du herumläufst. Und um auf deine Fragen zurückzukommen: Ja, es gibt noch weitere Rattenclans. Insgesamt sind es fünf, um genau zu sein. Sie haben den New Yorker Untergrund schon vor langer Zeit unter sich aufgeteilt. Denn sie verfügen nicht nur über ausgeklügelte Kampftechniken, sondern auch über besondere Waffen und Fähigkeiten. Und sie unterliegen den Grundsätzen der Ninjas, deren uraltes Wissen sie seit jeher weitergeben.«
»Ninjas«, wiederholte Ferdinand. »Ich dachte, das wären Krieger der Zweibeiner gewesen, irgendwo … weit weg.«
Shadow warf ihm einen Blick zu, der an Spott kaum zu überbieten war. »Asien meinst du wohl. Genauer Japan, denn dort liegt der Ursprung der Ninjas. Und ja, die Zweibeiner kennen einige ihrer Lehren. Aber was glaubst du, woher?«
»Von uns Ratten?«, rief Ferdinand überrascht. »Du willst also sagen, dass der Untergrund der Stadt von Ninja-Ratten beherrscht wird? Wieso wusste ich nichts davon?«
»Wenn du wüsstest, was du alles nicht weißt, würdest du nächtelang durchweinen«, erwiderte Shadow. »Die Kraft der Clans resultiert aus ihrer Verborgenheit, und die größte Stärke erwächst in der Dunkelheit. Vielleicht wirst du die Chance bekommen, das zu lernen.«
»Welche Clans gibt es denn noch?«, fragte Ferdinand neugierig. »Und wie kann man bei ihnen mitmachen?«
»Normalerweise wird man in einen Clan hineingeboren«, sagte Shadow. »Aber es gibt Ausnahmen, die einen Wechsel zwischen den Clans oder die Aufnahme von fremden Ratten ermöglichen. Normalerweise gehört eine Ratte in den Clan, dessen Element sie als magische Kraft in sich trägt, auch wenn es hier ebenfalls Ausnahmen gibt.«
»Magie«, flüsterte Ferdinand ehrfürchtig.
»Nur nicht nervös werden«, gab Shadow zurück. »Früher war es für Ratten wie uns ganz normal, Magie in sich zu haben. Heutzutage ist das magische Wissen in Vergessenheit geraten. Aber noch immer ist die Magie ein Teil der Welt. Wie man an dir sieht, verfügen auch manche Ratten der Oberwelt darüber, ohne davon zu ahnen. Viele von ihnen fühlen, dass es mehr in der Welt gibt, als ihnen erzählt wurde. Lerne deine Magie kennen, und du findest heraus, wer du bist.«
»Du sagtest, dass mein Element das Feuer wäre«, meinte Ferdinand. »Was bedeutet das?«
»Nichts«, sagte Shadow. »Außer das, was du daraus machst.« Er sah Ferdinand kurz an. »Manche Antworten musst du dir selbst geben.«
»Dann erzähle mir mehr von den Clans«, bat Ferdinand. »Waren sie immer schon da?«
»Nichts ist immer schon da gewesen«, erwiderte Shadow. »Früher gab es den Großen Clan. Er wurde vom Fürsten regiert – dem mächtigsten Krieger, der im besten Fall dafür sorgte, dass Frieden und Eintracht unter den Ratten herrschte. Doch mit der Zeit kam es zum Streit zwischen verschiedenen Gruppen. Es ging um Besitz, um Nahrung, um Macht, um Territorien. Worum es immer geht, wenn die Beteiligten nicht mehr sehen, was sie verbindet, sondern nur noch, was sie trennt. Die Einigkeit zerfiel Stück für Stück. Es folgten blutige Kämpfe und schließlich ein langer Krieg. Der Große Clan wurde zerschlagen und mit ihm die magische Natur, die zuvor die Unterwelt geprägt hat. Heute gibt es nur noch wenige Orte wie diesen, an dem die Kraft von einst so stark ist.«
Ferdinand betrachtete einen Baum, der von schillernden Kristallen übersät war. »Die Pflanzen sind wunderschön«, flüsterte er ehrfürchtig.
»Das sind sie«, meinte Shadow. »Und schau nach unten. Du läufst auf dem Glas des Himmels. Darunter brennt das Feuer der Ersten Zeit: erschaffen von jenen Kriegern, die den Clan an diesem Ort gründeten. Der Sage nach haben sie die Magie dort unten mit ihrem eigenen Blut verstärkt. So ist jeder Krieger des Clans und jede hier geborene Ratte über ihr Blut damit verbunden und zehrt von der Kraft der Alten Magie.«
»Ich fühle auch etwas«, sagte Ferdinand leise. »Wenn ich in dieses Feuer sehe, dann ist es … als wäre das Rauschen der Flammen auch in mir.«
Shadow hielt inne. »Jeder Krieger, dessen Element das Feuer ist, kann diese Stärke von einst wahrnehmen – wenn auch nur schwach, so wie du jetzt. Solltest du aber die Erste Prüfung bestehen und als Krieger in den Clan des Feuers aufgenommen werden, wird dein Blut in diesen Flammen vergossen und dann wirst auch du mit dieser Quelle auf eine Weise verbunden sein, die alles übersteigt, was du dir jetzt vorstellen kannst. Erst dann wirst du wissen, welche Kraft das Feuer wirklich hat.«
Ferdinand lauschte mit einer Mischung aus Angst und Vorfreude auf das sehnsüchtige Flammenrauschen tief in ihm. »Haben die anderen Clans auch so eine Kraftquelle?«
Shadow neigte zustimmend den Kopf. »Nach dem Zerfall des Großen Clans entstanden die Clans der Elemente. Sie teilten New York unter sich auf und seither wechseln sich friedliche Zeiten mit Kriegen ab. Und dabei geht es längst nicht mehr nur um die Erweiterung der Reviere und die Vergrößerung der eigenen Macht. Es gibt keinen Krieger, der während eines Konflikts zwischen den Clans keinen schweren Verlust erlitten hat. Zorn und Hass sitzen tief. Auf allen Seiten.«
»Was passierte mit dem Fürsten?«
»Das weiß niemand genau. Manche behaupten, er wäre nur eine Legende gewesen. Aber ich glaube, dass es ihn wirklich gibt und dass er noch immer herrscht – auch heute noch, wenn natürlich weit weniger sichtbar als damals.«
Ferdinand warf Shadow einen Blick zu. »Wie kommst du darauf?«
»Intuition.« Etwas an der Art, wie Shadow seine Schritte beschleunigte, weckte in Ferdinand den Eindruck, als hätte der Schatten nun tatsächlich genug von seinen Fragen. Aber so schnell durfte er Shadow nicht vom Haken lassen.
»Wie unterscheiden sich die Clans voneinander?«, fragte er das Erste, was ihm in den Sinn kam.
Shadow seufzte tief. »Nach den Liedern der Unterwelt entstammen die stärksten Krieger dem Feuerclan«, erwiderte er dennoch. »Sind sie erfahren genug, ihr Temperament zu zügeln, gehen sie oft als Sieger aus Kämpfen hervor. Das Gebiet des Feuerclans erstreckt sich im Westen New Yorks. Die Mitglieder des Wasserclans sind Meister der Tarnung und ausgezeichnete Schwimmer. Sie beherrschen den Süden der Unterwelt. Ihre besondere Gabe ist ihre große Intuition, und sie sind berühmt für ihre überragenden Magier. In Kämpfen ahnen sie die Handlungen ihrer Gegner oft voraus und verschaffen sich so einen Vorteil.«
»Und der Wasserclan ist der Feind des Feuerclans«, murmelte Ferdinand. »Jedenfalls hat Buzz vorhin was von Nebeln gesagt und seine Stimme klang unheilvoll.«
Shadow hob erstaunt den Kopf. »Du hast eine gute Beobachtungsgabe. In der Tat ist der Clan des Wassers seit Langem der größte Widersacher des Feuerclans. Allerdings gibt es auch mit den anderen Clans keine Freundschaften mehr.«
»Feuer und Wasser«, sagte Ferdinand. »Fehlen noch Erde und Luft.«
»So ist es«, stimmte Shadow ihm zu. »Der Sturmclan hat sich als einziger hauptsächlich oberirdisch angesiedelt und regiert den Norden der Stadt. Diesem Clan entspringen die größten Künstler, Erfinder und Konstrukteure. Denn die besondere Gabe des Sturmclans ist die Vorstellungskraft. Sie verfügen über die besten Waffen aller Clans. Die Ratten des Steinclans wiederum sind besonders klug und durch ihre Taktik den anderen häufig überlegen. Sie herrschen im Osten.« Er hielt inne. »Und dann gibt es noch den gefährlichen Nachtclan, der wie unsichtbar ist und den alle Clans fürchten. Über ihn gibt es kaum verlässliche Informationen, aber umso mehr düstere Lieder, die von seinen grausamen Taten erzählen.«
»Und du gehörst zum Nachtclan?« Ferdinand sah seinen Begleiter von der Seite an.
Shadow schnaubte spöttisch. »Wegen meines Namens? Nein, mein junger Freund. Ich ziehe es vor, meine eigenen Wege zu gehen. Auch wenn das in letzter Zeit immer gefährlicher wird.«
»Wegen der bröckelnden Waffenruhe?«