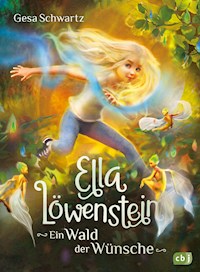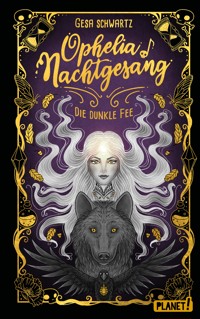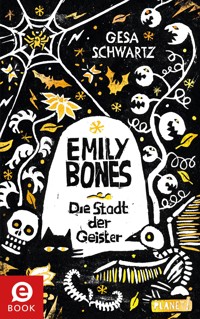10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Seine Augen waren wie eine Frage, deren Antwort sie ersehnte und zugleich fürchtete, und sie spürte instinktiv, dass ein einziger Schritt auf ihn zu sie ins Bodenlose führen würde … ein einziger Schritt, der alles ändern konnte, was sie zu sein glaubte.«
In Venedig gerät die siebzehnjährige Milou in die Welt der Scherben: das Reich der verlorenen Gedanken, der zerschlagenen Träume, der unvollendeten Geschichten und vergessenen Wünsche. Auf der Suche nach spurlos im Nebel verschwundenen Menschen verliebt sie sich in den mysteriösen Rabenwandler Nív, doch sie weiß: Seine Welt ist nicht für sie bestimmt. Und mit jedem Augenblick zieht das Reich der Scherben sein Netz enger …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 832
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Gesa Schwartz
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage 2016
© 2016 cbt Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Carolin Liepins
unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock
(Aleshyn_Andrei, Renata Sedmakova, manfredxy)
mg • Herstellung: wei
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-19270-9V001
www.cbt-buecher.de
Meiner Mutter,
die mich fliegen lehrte
1
Der Nebel zog in geisterhaften Schleiern durch Venedigs Gassen. Tiefschwarz thronte der Nachthimmel über den Dächern, die Kanäle glühten im Schein der Laternen, als bestünden sie aus dunklen Spiegeln, und während Milou durch die verwaisten Straßen lief, konnte sie die Stille atmen hören: wispernd wie ein Geheimnis. Sie liebte es, Venedig in dieser Jahreszeit zu besuchen, wenn der nahende Winter die Schatten schon am Nachmittag in den Hinterhöfen tanzen ließ und nur das leuchtende Rot ihres Koffers die Illusion störte, in eine Schwarz-Weiß-Fotografie aus lang vergangener Zeit geraten zu sein. Die Sommermonate, in denen die schmalen Gassen aus allen Nähten platzten und riesige Kreuzfahrtschiffe im Hafen anlandeten, waren fern, und mit jedem frostigen Pinselstrich verwandelte die Stadt sich stärker zurück in das, was sie eigentlich war: eine Zauberin, gegen deren Magie Milou seit jeher machtlos gewesen war.
Ihr Koffer rumpelte in störrischem Stakkato über das Pflaster, als wollte er seinen Unmut darüber kundtun, dass sie ihn durch die halbe Stadt zerrte, obwohl es doch verflucht noch eins kürzere Wege gab, um an ihr Ziel zu kommen. Fast meinte sie, in dem ärgerlichen Poltern die Stimme ihres Onkels Mathis zu hören, der ihr eindringlich geraten hatte, die Strecke vom Bahnhof mit einem Vaporetto zurückzulegen. Sie sah ihn vor sich, wie sie sich in Paris verabschiedet hatten: das Gesicht so sorgenvoll, als hätte er sie in ein Kriegsgebiet fahren lassen, und die Augen dunkel umwölkt wie immer, wenn der seltene Fall eintrat, dass er in einer Angelegenheit keine Wahl hatte. Er hasste nichts mehr, als keine Wahl zu haben. Aber die Renovierungsarbeiten in seiner Wohnung verzögerten sich, und während er in dieser Zeit auf Geschäftsreise war, hatten Maler und Bodenleger Milou obdachlos gemacht. Sie selbst hätten Farbgeruch und Baulärm nicht gestört, doch Mathis bestand darauf, dass sie sich auch in den Ferien dem Lernen widmete. Denn trotz der teuren Privatschulen, auf die er sie in den vergangenen Jahren geschickt hatte, war es ihr nicht gelungen, ihre Leistungen seinen Ansprüchen anzupassen. In wenigen Wochen würde daher eine Armada von exzellenten Nachhilfelehrern auf sie warten, um sie unter Mathis’ strengem Blick durch das letzte Schuljahr zu begleiten, und so hatte er einen ruhigen Ort für sie finden müssen, an dem sie sich angemessen darauf vorbereiten konnte. Das war alles andere als einfach gewesen. Er selbst konnte auf Reisen keine Ablenkung gebrauchen, ihre beste Freundin Celine war mit ihren Eltern in Mexiko, und Milou musste grinsen, als sie daran dachte, wie sie nach einer angemessenen Pause Venedig vorgeschlagen und Mathis’ Gesicht sich verfinstert hatte. In derselben Sekunde hatten sie beide gewusst, dass die Stadt in der Lagune ihre einzige Möglichkeit war. Und so verbrachte sie die Ferien bei Nonna, ihrer Großmutter – zum Unwillen ihres Onkels und zu ihrer Freude.
Nonna war die warmherzigste, verrückteste Person, die Milou kannte. Sie hatte keine Ahnung von Computern oder Handys, schickte ihr aber regelmäßig Briefe mit gepressten Blumen und Fotos ihrer Katzen (wobei sie stets betonte, dass sie viel mehr den Katzen gehörte als umgekehrt), sie tanzte barfuß im Regen, sie setzte sich lustige Hüte auf und lief damit durch die Straßen, wenn sie Milou zum Lachen bringen wollte, sie düste mit ihrem knallrot gestrichenen Motorboot so rasant durch die Kanäle, dass selbst erfahrene Venezianer auf dem Wasser vor ihr Reißaus nahmen, und sie sang düstere Lieder aus dem Reich der Sagen und Legenden. Bisweilen hatte sie Milou in Paris besucht, dann war sie wie ein farbiger Fleck gewesen in dieser riesigen Stadt und hatte Mathis’ nüchternes Penthouse mit Blumen und bunten Bildern vollgestellt. Immer wieder hatte Milou ihren Onkel in den letzten Jahren gedrängt, ihr einen Gegenbesuch abstatten zu dürfen, doch meist hatte er abgelehnt, kühl und sachlich wie immer, vielleicht aus Furcht vor den Erinnerungen, die auch ihn zwischen diesen Häusern heimsuchen könnten, vielleicht auch aus Sorge vor diesen Gassen, die das Träumen so leicht machten, dass allzu schnell jede Strenge und Rationalität, die er Milou in den vergangenen Jahren mühsam versucht hatte beizubringen, in flüsternden Schatten untergingen. Rationalität. Milou musste lächeln, als sie die Stimme ihrer Großmutter über dieses Wort stolpern hörte, als wäre es nichts als eine Illusion für all jene, die nicht genug Fantasie hatten, die Wahrheit rings um sie herum zu erkennen.
Sie ließ den Blick über die vom Hochwasser gezeichneten Fassaden schweifen und stellte sich vor, wie Mathis diese Gassen betrachten würde: abschätzig und mit kühler Strenge in seinen hellen blauen Augen, als begutachtete er eine der maroden Firmen, die er aufkaufte, um sie gewinnbringend wieder loszuschlagen. Sie seufzte. Mathis hatte es gut gemeint, als er ihr zu dem Wassertaxi geraten hatte. Er selbst legte größten Wert auf komfortables Reisen. Aber er verstand nicht mehr von Venedig als ihr Koffer, und daher wusste er nicht, dass es für sie nur eine Art gab, wirklich in dieser Stadt anzukommen. Schritt für Schritt hatte sie in das Labyrinth der Gassen eintauchen und den Geruch in sich aufnehmen müssen, den sie nirgends so intensiv wahrnehmen konnte wie hier: den Duft ihrer Kindheit nach Meer, Geheimnis und Abenteuer … ein Duft voller Erinnerungen, den Mathis verabscheute, so sehr, dass er es nicht über sich gebracht hatte, sie durch diese Gassen zu begleiten.
Milou nahm es ihm nicht übel. Zu deutlich sah sie ihn vor sich, wie er in jener Nacht vor vielen Jahren auf dem Flur im Krankenhaus von Venedig gestanden hatte, ihr kühler, unnahbarer Onkel, die Hand gegen die Tür gestützt, hinter der ihre Eltern den Kampf um ihr Leben verloren hatten. Nie hatte sie Mathis weinen sehen bis zu diesem Moment. Eine Schwester hatte sie den Gang hinaufgetragen. Er hatte Milou nicht bemerkt, aber sie hatte diesen Augenblick der Schwäche nie vergessen, der so viel mehr Stärke in sich getragen hatte als jeder Moment danach, als Mathis mit der ihm eigenen Eloquenz alle Angelegenheiten geregelt und sie bei sich aufgenommen hatte. Sie kamen aus verschiedenen Welten, er der zielstrebige Karrieremensch, der großen Wert legte auf gesellschaftliches Ansehen und Vorankommen, sie die Träumerin, die viel lieber in den Reichen ihrer Bücher lebte als in dem, was Mathis Realität nannte. Aber sie respektierten einander, und seit jener Nacht im Krankenhaus empfand Milou eine stille Zärtlichkeit, wenn sie in die blauen Augen ihres Onkels schaute, ganz gleich, wie kühl sie blicken mochten – wusste sie doch, dass darin dieselbe Trauer lag, die auch sie tief in sich vergraben hatte.
Musik und leises Stimmengewirr durchdrangen ihre Gedanken, als sie an einem kleinen Restaurant vorbeilief. Es war Jahre her, seit sie ihre Großmutter zum letzten Mal besucht hatte, und doch hatte sich das Viertel Castello kaum verändert. Noch immer war es das Sestiere der einfachen Leute, jenen rebellischen Freigeistern, die trotz offiziellen Verbots im Sommer weiterhin ihre Wäscheleinen zwischen ihren Fenstern spannten. Noch immer schauten die Häuser in den verwinkelten Straßen aus windschiefen Fensteraugen auf Milou herab und lehnten sich aneinander, als müssten sie sich angesichts des drohenden Untergangs am bröckelnden Putz ihres Nachbarn festklammern, und noch immer fiel es ihr nicht schwer, die Fabelwesen zu erkennen, die sie schon früher in den huschenden Schatten der Gassen gesehen zu haben glaubte. Sie zog ihren Koffer die Ponte Marcello hinab und beobachtete, wie ein Schemen, der gerade noch verteufelte Ähnlichkeit mit einem Kobold gehabt hatte, als Katze aus einem Hauseingang hervorsprang. Ein Lächeln glitt über ihr Gesicht. Es war eine verlangsamte, kostbare Welt, in der Nonna lebte, und es erfüllte sie mit einem unruhigen Glücksgefühl, zurück zu sein … zurück in der Kulisse ihrer Kindheit, die noch immer wie ein Märchen war, in dem die Zeit stillstand.
Sie hatte gerade die Calle Borgolocco betreten, als ein Flüstern an ihr Ohr drang, leise nur und doch so eindringlich, dass sie stehen blieb und sich umsah. Sie schien allein zu sein, aber ein Schauer flog über ihren Rücken wie früher, wenn sie mit den anderen Kindern in der Dämmerung herumgelaufen war und sie sich gegenseitig Gruselgeschichten erzählt hatten. Kurz meinte sie, das Gelächter der anderen an den Fassaden der Häuser widerklingen zu hören, und obwohl sie ihren Weg rasch fortsetzte, tauchten die Spukbilder von damals vor ihrem geistigen Auge auf. Sie sah unheimliche Gestalten mit bleichen Gliedern, die lautlos aus den Kanälen krochen und alles Lebendige in ihr eiskaltes Reich zerrten, Geisterfrauen in wehenden Gewändern, deren Hände den Tod brachten, und Clowns in den finsteren Häusernischen, die Zähne rot vom Blut unschuldiger Kinder. Langsam sog sie die Luft ein. Sie wusste, dass diese Bilder nichts als Ausgeburten ihrer wilden Fantasie waren, Gedanken, die nur in ihrem Kopf existierten. Und dennoch schaute sie wie damals als Kind in den gespenstischen Nebel, als bräuchte sie nur die Hand auszustrecken, um den Schleier über ihrer Wirklichkeit fortzuziehen – diese dünne Haut, die sie jedes Mal berührte, wenn sie in ihre Bücher eintauchte, wenn sie mitten in der Nacht erwachte, als hätte eine steinerne Klaue ihre Wange gestreift, oder wenn sich für einen Wimpernschlag das Licht veränderte, das auf den regennassen Asphalt von Paris fiel, schillernd wie in einem Kaleidoskop aus tausend Farben. In solchen Momenten hielt Milou den Atem an, und manchmal konnte sie es noch immer spüren: das Geheimnis, das sie in ihrer Kindheit mit einer Mischung aus Sehnsucht und Furcht hinter jedem flüsternden Blatt und jedem flackernden Schatten erahnt hatte und das ihr seit jeher zuraunte, dass es mehr in der Welt gab, als ihre Augen sehen konnten … so unendlich viel mehr als das. Sie hielt inne, als der Nebel vor ihr aufwallte wie ein lebendiges Wesen, und für einen Moment wollte sie nichts mehr, als auf ihn zuzutreten – ihren Weg zu verlassen und sich in den weißen Schleiern zu verlieren, als wäre sie noch immer das kleine Mädchen von damals, das auf den Schwingen seiner Gedanken fliegen gelernt hatte. Doch gleich darauf riss sie ihren Blick vom Nebel fort und drängte die Bilder zurück, während sie die Ponte dei Preti überquerte. Sie führte sich auf wie ein Kleinkind. Wenn Mathis sie jetzt sehen könnte, würde er …
Das Flüstern strich wie ein Atemzug über ihre Wange. Milou fuhr zurück, so heftig, dass sie sich den Arm am Brückengeländer stieß, aber ehe sie noch etwas hinter sich hätte erkennen können, verlor sie das Gleichgewicht, rutschte über die Stufen abwärts und schlug am Boden auf. Ihr Koffer landete neben ihr. Krachend brach er auseinander, und all die Bücher, die sie mühevoll verschnürt und zusammengepackt hatte, ergossen sich über das feuchte Pflaster. Benommen kam sie auf die Beine. Ihr Schädel puckerte, so heftig war sie auf den Steinen aufgekommen, und kurz drängte der Schmerz jedes andere Gefühl zurück. Dann jedoch nahm sie die Stille wahr, die sie nun wieder umgab. Sie hatte jedes andere Geräusch verschlungen, und zum ersten Mal, seit Milou die Stadt betreten hatte, kam sie ihr unheimlich vor – wie ein Luftholen vor einem entsetzlichen Fluch. Seufzend straffte sie die Schultern. War es nicht schlimm genug, dass sie wegen eines lächerlichen Flüsterns die Stufen hinabfiel? Musste sie nun auch noch anfangen, sich Geschichten auszudenken? Betont gelassen begann sie, ihre Bücher in den lädierten Koffer zurückzustopfen, aber sie brachte es dabei nicht über sich, den Nebel aus den Augen zu lassen, der nun in dicken Schwaden über die Mauern des Kanals trat und auf sie zu kroch, langsam wie ein zum Sprung bereites Tier. Im selben Moment kehrte das Flüstern zurück.
Noch immer fühlte Milou es eiskalt an ihrer Wange und sie zögerte nicht länger. Eilig griff sie nach ihrem Koffer, klemmte sich die übrigen Bücher unter den Arm und setzte sich in Bewegung. Jede Verzauberung, die sie gerade noch empfunden hatte, wurde von dem seltsamen Wispern zerrieben und ließ nichts in ihr zurück als rasende Anspannung. Sie zwang sich, nicht zu laufen, wusste sie doch, dass es mit jagendem Puls schier unmöglich werden würde, die aufkeimende Angst in sich klein zu halten. Stattdessen zerrte sie ihren Koffer über das Pflaster, als wäre er ein bockiger Hund, und versuchte vergeblich, das Flüstern zu ignorieren, das ihr rasch nachglitt. Mit klopfendem Herzen schaute sie über die Schulter zurück, aber ihr Blick perlte an der Wand aus Nebel ab wie Regen von Glas, und sie wich erschrocken zurück, als die Straßenlaternen zu flackern begannen.
Jedes Mal, wenn das Licht der Laternen für die Dauer eines Atemzugs erlosch, schienen sich die Gassen ringsherum zu verändern. Die Fassaden der Häuser wurden brüchig, als bestünden sie aus verbranntem Papier, das Pflaster knackte unter Milous Schritten wie brechendes Eis, und selbst das Licht wandelte sich wie in jenen seltenen Augenblicken vollkommener Stille, die niemand wahrzunehmen schien als sie selbst. Milou schaute zu den Häusern auf, die in der Dunkelheit wirkten wie aus Blei gegossen, und sie lief auf die erleuchteten Fenster zu, die nicht weit entfernt ihr Licht in die Nacht sandten. Eine tiefe Erleichterung brach in ihr auf, als sie die Menschen in ihren Wohnungen sah, wie sie vor dem Fernseher zusammensaßen oder in der Küche miteinander sprachen, gewöhnliche Venezianer, die vermutlich laut lachen würden, sollten sie das Mädchen aus der fernen Stadt mit hochroten Wangen durch albernen Nebel hetzen sehen, als wäre der Teufel hinter ihm her. Aufatmend strich Milou sich das Haar zurück und verlangsamte ihre Schritte. Doch kaum, da das Licht aus den Wohnungen ihre Haut traf, hoben die Menschen die Köpfe, ruckartig wie witternde Tiere, und ihre Züge verzerrten sich zu entstellten Fratzen.
Nur im letzten Augenblick unterdrückte Milou einen Schrei. Sie starrte in die Fenster, die plötzlich vergittert und dunkel wie Totenaugen dalagen, als hätten sie nie etwas anderes gezeigt als reglose Nacht. Dann riss sie ihren Blick fort und begann zu rennen. Ihr Koffer sprang über das Pflaster, als hätte auch ihn der Schreck erfasst, und Milou gelang es nicht, auf die mahnende Stimme in ihrem Inneren zu hören, die ihr zurief, dass sie sich beruhigen und die vernünftige Erklärung für die Ereignisse suchen sollte. Denn die gab es, die musste es einfach geben. Zu eindringlich verfolgte sie das Flüstern im Rhythmus ihrer eigenen Schritte. Immer schneller jagte es ihr mit Schwaden aus klebrigem Nebel hinterher, glitt an ihr vorbei und trieb sie von Brücken und Straßen zurück, bis der Dunst so dicht geworden war, dass sie nicht mehr sagen konnte, wo sie war. Atemlos bog sie um eine Ecke – und fand sich in einer Sackgasse wieder. Sie fuhr herum. Haushoch türmte der Nebel sich vor ihr auf, und gerade, als sie mit dem Rücken gegen die Wand stieß, verstummte das Flüstern.
Milous Herz schlug so heftig, dass sie meinte, es in den Steinen in ihrem Rücken widerklingen zu fühlen. Sie presste die Handflächen gegen die Mauer, bis die scharfen Kanten sich in ihr Fleisch gruben, und starrte in den Nebel, der sich ihr lautlos näherte. Irgendetwas in ihr rief ihr zu, dass sie sich zusammenreißen musste, dass es nichts als Nebel war, dass ihre Fantasie ihr einen Streich spielte wie so oft. Aber ganz gleich, was diese Stimme in ihr sagen mochte – sie fühlte, dass etwas in diesem Nebel sie anstarrte, reglos und lauernd, und sie hörte auf zu atmen, als sich ein schattenhafter Umriss aus dem Dunst hob.
Im ersten Moment meinte Milou, die Gestalt eines Minotaurus mit mächtigem Stierkopf und messerscharfen dunklen Hörnern erkennen zu können. Dann zog der Schemen sich zusammen. Sie glaubte, Luftballons von einem Clown in Pluderhosen aufsteigen zu sehen, und schließlich begann die Gestalt zu flackern wie die Straßenlaternen zuvor, so schnell, dass ihr schwindlig wurde. Schritt für Schritt trat sie auf Milou zu und blieb schließlich stehen, halb noch vom Nebel umschmeichelt. Es war ein Mädchen, etwa siebzehn Jahre alt, ein wenig pummelig mit langen dunklen Locken und beinahe kindlichem Gesicht, die Brauen in leichtem Trotz verzogen. Milou wich das Blut aus dem Kopf. Sie selbst war es, die da vor ihr stand, reglos wie eine Figur aus Eis. Doch anstelle ihrer dunklen Augen prangten Spiegel in dem blassen Gesicht, Spiegel, die das Meer zeigten … das Meer in sturmumtoster Nacht.
Milou stand da wie gelähmt. Die Bücher glitten ihr aus den Händen, aber sie hörte sie kaum am Boden aufschlagen. Alles, was sie deutlich wahrnahm, war das Meer, das sich mit tödlicher Kraft um ihre Kehle schlang und ihr die Luft abpresste, ohne dass sie auch nur das Geringste dagegen tun konnte. Es fühlte sich an, als schlösse sich eine eisige Hand um ihr Herz, gnadenlos und kalt wie … eine Erinnerung … Das Mädchen vor ihr schien zu lächeln, so grausam, dass Milou zu zittern begann. Sie meinte schon, die Gischt des Meeres auf ihrer Haut fühlen zu können, doch gerade als ihr schwarz vor Augen wurde, ging ein Ton durch die Luft – so laut und durchdringend, dass der Nebel vor ihm zurückwich und jede Stille zerbrach. Es war der Schrei eines Raben.
Abrupt riss das Mädchen vor ihr den Kopf herum, und Milou meinte, ein Knurren aus ihrer Kehle dringen zu hören, dunkel wie bei einem Tier. Dann fuhr ihr Spiegelbild herum und ohne sich noch einmal umzudrehen, tauchte es im fliehenden Nebel unter.
Die Lähmung wich so plötzlich aus Milous Gliedern, dass sie sich an der Wand abstützen musste, um nicht zu fallen. Schwer atmend hob sie den Blick, und da sah sie eine hochgewachsene Gestalt am Ende der Gasse stehen, einen Mann, in einen schwarzen Mantel gekleidet, kapuzenbewehrt und umgeben von Schatten. Milou erkannte kein Gesicht in der Dunkelheit und doch erschien ihr irgendetwas an diesem Anblick seltsam vertraut. Langsam richtete sie sich auf, die Finger noch immer in die Mauer gekrallt, aber sie wandte sich nicht für einen Wimpernschlag von dem Fremden ab. War es seine Reglosigkeit, die sie bannte? Das Schweigen, das sich wärmend um ihre Schultern legte und jedes Flüstern aus ihren Gedanken vertrieb, oder das halblange, seidig schimmernde Haar, das in der Düsternis glühte wie eine silberne Flamme? Kurz meinte Milou, ein Lächeln in der Finsternis unter der Kapuze erahnen zu können, stolz und spöttisch und zugleich von einer sanften Vorsicht, die sie auf den Fremden zutreten ließ, instinktiv, als würde in seiner Dunkelheit etwas auf sie warten, das sie lange gesucht hatte, ohne es zu wissen – wie damals als Kind, wenn sie im Haus ihrer Großmutter an ihr Fenster getreten war und hinaus in die Nacht gesehen hatte in der Hoffnung, jemand würde diesen Blick erwidern.
Sie hielt inne. Wie lange hatte sie nicht mehr daran gedacht? Die Finsternis unter der Kapuze schien aufzuglühen wie eine Antwort und im selben Moment überkam Milou heftiger Schwindel. Sie griff erneut nach der Hauswand, als würde ein einziger weiterer Schritt auf diese Dunkelheit zu genügen, um ihr den Boden unter den Füßen zu nehmen. Die Schatten am Ende der Gasse begannen zu tanzen. Sie musste die Augen zusammenkneifen, um den Fremden noch erkennen zu können, und ihr ging der Gedanke durch den Kopf, ob er überhaupt wirklich da war. Seine Umrisse verschwammen bereits, und wie er so dastand, von Finsternis umtost, sah er aus, als wäre er ein Traum … nichts als ein Traum aus Nacht und Schatten. Kurz schien es Milou, als würde er vor ihr den Kopf neigen. Dann loderte die Dunkelheit um ihn herum auf und er war verschwunden.
Milou schwankte angesichts der flackernden Düsternis und schloss die Augen, um den Schwindel zurückzudrängen. Langsam atmete sie ein, und als sie aufschaute, war der Nebel gänzlich verschwunden. Das Licht der Straßenlaternen fiel ihr ins Gesicht, sie hörte Gelächter von einem nahen Balkon, und die Häuser, die gerade noch wie in Blei gebannt dagestanden hatten, zeigten nun ihr vertrautes, von Wellen und Menschen gebeuteltes Gesicht. Milou stieß die Luft aus. Verflucht, was war los mit ihr? Genügte tatsächlich schon ein wenig Nebel, um eine gewöhnliche Taschendiebin für sie in eine Spukgestalt zu verwandeln? Mit aller Kraft drängte sie die Gedanken an ihr Ebenbild mit den Spiegelaugen zurück und griff nach ihren Büchern. Sie war kein Kind mehr, das sich von diesen Gassen verhexen ließ wie früher! Ärgerlich wühlte sie in ihrer Tasche herum und holte ihr Pfefferspray heraus. Sollte noch einmal jemand auf die Idee kommen, sie zu belästigen, würde sie sich zu helfen wissen, so viel war sicher.
Mit entschlossenen Schritten setzte sie sich in Bewegung. Sie sah Mathis vor sich, die Sorge in seinem Blick – und das nur halb unterdrückte spöttische Funkeln angesichts der Hirngespinste, denen sie sich offensichtlich noch immer mit derselben Faszination hingab wie damals als Kind. Dabei gab es etliche naheliegende Erklärungen für das, was geschehen war. Vermutlich war sie einer Diebesbande auf den Leim gegangen, die sie mit gespenstischem Flüstern durch die Gassen gejagt hatte, nur um sie dann mit einer billigen Frauenmaske und dunkler Perücke in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Fratzen hinter den Fenstern waren ihrer eigenen Panik geschuldet gewesen, ebenso wie die Fassaden aus Blei, und flackernde Straßenlaternen waren in dieser Stadt nun wirklich kein Anlass zur Beunruhigung. Die Erleichterung strich kühl durch ihre Glieder, während ihr Verstand die Ereignisse an einen harmlosen Platz rückte, und ihr Herzschlag hatte sich schon fast wieder beruhigt, als sie das Ende der Gasse erreichte.
Kurz nur wandte sie den Blick in die Schatten, und im selben Moment ging ein Ton durch die Luft, gerade dort, wo der rätselhafte Fremde gestanden hatte. Der Laut fuhr Milou ins Mark, so durchdringend, dass sie sich erst nach einigen Augenblicken dazu zwingen konnte, ihren Weg fortzusetzen. Mit festem Griff zog sie ihren Koffer über das Pflaster. Polternd sprang er über die Steine und drängte jede Erinnerung an das merkwürdige Flüstern in ihr zurück. Der Ton vom Ende der Gasse jedoch ging ihr nach, leise und betörend, und so sehr sie es auch versuchte: Es gelang ihr nicht, ihn aus ihren Gedanken zu vertreiben. Ein Lachen war es, so vertraut, als hätte sie es vor langer Zeit schon einmal gehört, und doch fern … so fern wie aus einer anderen Welt.
2
Die Calle de la Madoneta empfing Milou in nächtlichem Schweigen. Die uralten Fensterläden, die für gewöhnlich bei jedem noch so leisen Windhauch klapperten, schwiegen bedächtig, die verwitterten Häuser drängten sich schlafend aneinander, und die Finsternis des Himmels war auch hier in jede Nische eingedrungen und hatte die kleine Gasse schwarz gefärbt. Selbst das Pflaster, auf dem Milou sich früher unzählige Male die Knie aufgeschlagen hatte, gab nur schwach den Schein der Straßenlaternen zurück. Das Haus ihrer Großmutter jedoch glühte in der Dunkelheit wie ein grüner Stern.
Das Licht, das hinaus auf die Gasse fiel, rührte von dem grünen Kristall her, der seit Milou denken konnte an einer Lampe im Küchenfenster ihrer Großmutter hing und ihr umgehend ein Lächeln aufs Gesicht zauberte. Instinktiv beschleunigte sie ihre Schritte und eilte über die Straße ihrer Kindheit auf das Haus zu wie früher, wenn sie nach dem Spielen mit den Nachbarskindern heimgelaufen war. Und wie damals wurde auch nun die Tür aufgerissen, noch ehe sie überhaupt die Schwelle erreicht hatte. In grünen Strömen ergoss sich das Licht auf Milous Wangen und da stand ihre Großmutter, die Haare zu einem lockeren Knäuel ergrauter Locken am Hinterkopf zusammengedreht, die braunen Augen strahlend vor Lachen, und breitete die Arme aus.
»Da bist du endlich!«, rief sie. »Wie habe ich dich vermisst!«
Milou umarmte Nonna herzlich, die diese Worte immer zur Begrüßung zu ihr sagte, ganz gleich, ob sie nur wenige Stunden oder etliche Monate voneinander getrennt gewesen waren. »Es tut mir leid, dass es später geworden ist«, sagte sie und kam sich für einen Augenblick tatsächlich vor wie damals als Kind, als sie die Zeit vergessen und ihre Großmutter mit gespielter Strenge auf sie herabgesehen hatte. »Ich bin vom Bahnhof gelaufen, und der Weg bis hierher hat doch länger gedauert, als ich dachte. Aber ich wollte …«
»… den Duft Venedigs einatmen, bevor du in meine Küche kommst?« Nonna lachte und zog sie ins Haus. »Das war ein weiser Entschluss, denn ich habe Knoblauchbrot gebacken und Federico hat drei meiner Soßen anbrennen lassen, was für ein noch kräftigeres Aroma gesorgt hat.«
»Nicht jeder kann ein Händchen fürs Kochen haben!«
Die warme, dunkle Stimme ließ Milou herumfahren, und mit einem Freudenschrei fiel sie Federico in die Arme, der mit mehlbedeckten Händen und Küchenschürze im Türrahmen stand und sie lachend auffing. Er führte seit einer Ewigkeit den Buchladen in der Nähe, gehörte ebenso lange praktisch zur Familie und war so groß, dass er in den niedrigen Räumen ihrer Großmutter immer ein wenig den Kopf einziehen musste. Auch nun stand er da wie ein Bär, leicht geduckt und mit diesem schelmischen Funkeln in den Augen, das ihm etwas Jungenhaftes verlieh, und hielt Milou ein Stück weit von sich weg, um sie zu mustern. Für gewöhnlich konnte sie es nicht ausstehen, so genau betrachtet zu werden. Sie war sich bewusst, dass ihre Figur nicht ganz den Idealmaßen entsprach, die den meisten Mädchen in der Schule so wichtig waren, und hatte damit eigentlich auch kein Problem. Dafür hatte sie ein gutes Buch einfach schon immer mehr zu schätzen gewusst als ein Workout im Fitnessstudio. Aber die Blicke mancher Leute trafen sie mit einer Verächtlichkeit, als würde jedes Fettpölsterchen mehr darüber aussagen, was für ein Mensch sie war, als ihre Worte es gekonnt hätten, und das ärgerte sie. Federico jedoch sah sie auf eine Weise an, die jedes Unwohlsein sofort im Keim erstickte. Sein Haar stand nach allen Seiten von seinem Kopf ab und gab dem prüfenden Ausdruck, den er auf seine Züge legte, eine komische Note.
»Milou, Milou«, sagte er und seufzte wie jedes Mal, wenn das Lächeln nach diesem Ritual auf sein Gesicht zurückkehrte. »Es ist viel zu lange her, seit du das letzte Mal hier gewesen bist.«
Sie grinste. »Ob du das auch noch sagen wirst, wenn ich erst wieder die Bücher deines Ladens durcheinandergebracht habe? Nicht, dass es irgendwem außer dir selbst in deinem Chaos auffallen würde, aber ich erinnere mich an deine Verzweiflung vom letzten Mal, als du nichts wiedergefunden hast.«
Federico lachte, doch ehe er etwas entgegnen konnte, ging ein Zischen durch die Luft und Nonna schob sich eilig an ihm vorbei in die Küche. »Himmelherrgott, wenn ich nicht aufpasse, verbrennt auch noch der Pudding«, rief sie und wedelte mit einem Geschirrtuch herum. »Los, los! Bringt das Gepäck nach oben. Mein Essen wartet auf niemanden!«
Federico schnappte sich Milous Koffer und wuchtete ihn die schmale Treppe hinauf. »Wie ich sehe, hast du genug Bücher dabei, um meinem Laden fernbleiben zu können«, stieß er aus und stützte sich schnaufend an der Wand zwischen den Familienfotos und hinter Glas gebannten Blütenblättern ab. »Was ist mit deinem Koffer passiert, hat er aufgegeben unter der Last von so viel Wissen?«
Milou schaute prüfend die Treppe hinab, doch ihre Großmutter hantierte lautstark in der Küche herum und schien nichts gehört zu haben. Mit vielsagendem Blick bedeutete sie Federico, den Weg fortzusetzen, und folgte ihm über den verwinkelten Flur bis in ihr altes Kinderzimmer. Die Tür öffnete sich knarrend, als wollte auch sie Milou willkommen heißen, und kaum, dass sie den Raum betrat, umfing sie der vertraute Geruch von Thymian, Lakritz und Wachsmalstiften, der seit sie denken konnte darin herrschte. Noch immer stand ihr weißes Metallbett unter der Schräge neben der Tür, gegenüber dem uralten Holzschrank, vor dem sie sich als Kind gefürchtet hatte, bis Nonna ihr erzählt hatte, dass darin ein Kobold hausen würde, sehr scheu und sehr haarig, aber ausgesprochen erpicht darauf, kleine Mädchen vor Ungeheuern unter ihrem Bett zu beschützen. Seither hatte Milou den Schrank geliebt und bisweilen sogar heimlich Milchreis und andere süße Speisen darin verstaut, um ihrem Mitbewohner etwas Gutes zu tun. Ein Lächeln flog über ihr Gesicht, als sie daran dachte, wie ihr Vater eines Tages dem stechenden Geruch in ihrem Zimmer auf den Grund gegangen und beim Anblick von drei verfaulten Milchreisschälchen ganz grün im Gesicht geworden war.
»Also?«, fragte Federico und riss sie aus ihren Gedanken. »Was ist mit dem Koffer passiert?«
Milou drehte sich seufzend zu ihm um. Er lehnte neben der Tür, und ein Blick in seine Augen genügte, um sie wieder acht Jahre alt sein zu lassen und ebenso gläsern, wie sie seit jeher für ihn gewesen war. Immer schon hatte er ein Talent dafür gehabt, ihre Gedanken zu erraten … und nie, selbst bei dem größten Unfug, den sie angestellt haben mochte, hatte er diese Gabe gegen sie verwendet. Stattdessen war er stets ihr Verbündeter gewesen, und sie erinnerte sich an so manchen Schabernack, den sie zusammen ausgeheckt hatten. Doch dieses Mal war es etwas anderes. Sie hatte auf dem Weg zu ihrer Großmutter so viele rationale Erklärungen für die Ereignisse im Nebel gefunden, dass sie sich vorgekommen war wie Mathis, wenn er sie früher nach einem ihrer Albträume getröstet und ihr erklärt hatte, dass es schlicht keine Monster unter dem Bett gab. Die Anspannung war von ihr abgefallen, doch nun, da sie Federicos Blick erwiderte, hörte sie noch einmal das seltsame Flüstern, das ihr durch den Nebel gefolgt war, und ein Schauer glitt über ihren Rücken, als würde es zurückkehren, laut und übermächtig, wenn sie ihm auch nur mit einem Wort Bedeutung gab. »Ich bin gefallen«, sagte sie deshalb und erinnerte sich so genau an ihren Sturz von der Brücke, dass ihre Hand instinktiv zu ihrer Schläfe fuhr. »Wie sagst du immer: die Nase in den Wolken und einen Fuß über dem Abgrund. Erzähle bitte Nonna nichts davon. Sie würde sich nur Sorgen machen, und es ist ja nichts passiert.«
Noch immer musterte er sie eindringlich, und für einen Moment hatte Milou das Gefühl, als würde er wissen, dass sie ihm nicht die ganze Wahrheit erzählt hatte, ganz genau so, wie er früher stets als Erster herausgefunden hatte, wenn sie heimlich streunende Katzen in ihrem Zimmer versteckt und sie dort durchgefüttert hatte. Dann jedoch nickte er und Sorge trat in seinen Blick. »Ich werde ihr nichts erzählen, wenn du mir versprichst, auf dich achtzugeben. Du weißt doch: Venedigs Gassen sind tückisch, und die Stadt birgt mehr, viel mehr, als unsere sterblichen Augen sehen.«
Milou lächelte über diese Worte, mit denen er früher so oft die Märchen eingeleitet hatte, die er den Kindern in seinem Laden erzählt hatte. »Keine Sorge. Ich kann auf mich aufpassen.«
Er nickte. »Dann gilt unser Versprechen also«, raunte er verschwörerisch. »Jetzt und für immer?«
Milou hatte nicht vergessen, dass sie auf diese Weise stets ihre geheimen Beteuerungen besiegelt hatten, und sie spürte dieselbe Feierlichkeit wie damals, als sie noch ein Kind gewesen war und diese Worte wiederholt hatte. »Jetzt und für immer«, flüsterte sie, und als er ihr Lächeln erwiderte, wich zum ersten Mal, seit sie dem Nebel entkommen war, jede Kälte von ihrem Leib. Gerade öffnete Federico den Mund, um etwas zu sagen, als ein Scheppern aus der Küche drang, dicht gefolgt vom heiseren Fauchen einer Katze. Seufzend schüttelte er den Kopf. »Deine Großmutter wird nie lernen, dass gebratener Fisch und eine Horde Katzen in einer Küche zu allem führen können – aber garantiert nicht zu einem leckeren Essen.«
Milou musste lachen. »Geh du schon vor und fang den ersten Zornesschwall für mich ab. Ich komme gleich nach.«
»Federico, der Wellenbrecher«, murmelte er und grinste. »Jeder braucht einen wahren Namen, ist es nicht so?«
Damit lief er die Treppe hinab und ließ Milou allein. Es war seltsam, wieder zurück in diesem Zimmer zu sein, das sie als Kind verlassen hatte und nun als junge Frau wieder betrat. Fast schien es ihr, als wäre sie in eine Seifenblase geraten, in der die Zeit keine Macht hatte, und sie musste daran denken, was ihre Mutter ihr gerade an diesem Ort einmal über Erinnerungen erzählt hatte. Nimm sie mit dir, hatte sie gesagt. Die Gedanken, Gefühle, Worte, die dir an einem besonderen Platz begegnet sind. Denn Erinnerungen sind wie Herztöne, die durch die Dunkelheit hallen.Und die Schläge eines Herzens sind das Leben. Sie trat ans Fenster und schaute in die Dunkelheit jenseits ihres Zimmers. Früher hatte sie sich vorgestellt, durch ihr eigenes Spiegelbild in andere Welten reisen zu können. Sie hatte Märchenwälder und Fabelwesen in ihren Augen gesehen, und sie hatte sich getröstet gefühlt von der Dunkelheit, die so viel mehr in sich zu bergen schien, als ihre Augen sehen konnten. Noch immer fühlte sie, wie ihr Blick aufgefangen wurde, und sie stellte sich vor, dass er tatsächlich erwidert würde – von den Schatten, von der Dunkelheit, von etwas, das mehr war als alles, was sie kannte.
Sie legte die Hand gegen die Scheibe wie früher, wenn sie heimlich aus dem Fenster geklettert war, um gemeinsam mit ihren Freunden auf der Suche nach den Wundern in den Schatten durch die Nacht zu streifen. Für einen Moment erschien es ihr, als würde ihr Spiegelbild ihr zulächeln, als würde es sagen: Komm heraus… komm heraus in die Dunkelheit, Träumerin, und du wirst alle Zweifel hinter dir zurücklassen in diesem Licht, das ohnehin nie für dich bestimmt war. Doch gleich darauf stieß sie seufzend die Luft aus. Verflucht, sie war kein Kind mehr, Mathis hatte recht. Die Zeiten, da sie daran geglaubt hatte, von einem goldenen Drachen abgeholt und in eine magische Welt gebracht zu werden, waren lange vorbei.
Und doch meinte sie, die Stimmen ihrer Eltern im Nebenraum hören zu können, genau wie früher, wenn sie Nonna über die Ferien und Wochenenden besucht hatten. Nachdenklich ging sie über den Flur und ließ die Hand über die Tür des Zimmers streifen. Inzwischen hatte ihre Großmutter darin ein Nähzimmer eingerichtet, aber Milou hörte noch immer das Lachen ihrer Mutter und die dunkle Stimme ihres Vaters, und wie von selbst folgte sie der Treppe weiter aufwärts, schob die Tür zum Dachgarten auf und trat hinaus.
Sofort umfing sie der Duft der Rosen, die seit jeher an dem alten Mauerwerk aus roten Ziegeln wuchsen. Sie konnte nicht zählen, wie viele fröhliche Stunden sie in den Sommermonaten an diesem Ort verbracht hatte. Der Geruch trug ihr Bilder ihrer Großmutter zu, so intensiv waren beide miteinander verknüpft, und als der Wind ihr das Haar zurückstrich, trat sie an die Brüstung. Sanft und rätselhaft war er, dieser Wind, den ihre Eltern geliebt hatten, so als berge er alle Geheimnisse der Welt, ohne auch nur ein einziges jemals zu verraten. Milou schaute über den nachtbeschienenen Rio di San Severo in Richtung der Lagune, und sie konnte das Meer riechen, dieses Ungetüm, das sie zugleich sehnsüchtig liebte und fürchtete. Für einen Wimpernschlag kehrten die tosenden Wellen zu ihr zurück, die sie in den Spiegelaugen des Mädchens im Nebel gesehen hatte, und sie meinte, ein Grollen hören zu können … so fern wie ein dunkler Traum.
Sie war noch ein Kind gewesen, als sie mit ihren Eltern in den Sturm geraten war, weit draußen auf der Adria, und so sehr sie es in all den Jahren danach auch versucht hatte: Sie erinnerte sich nicht an jene Nacht. Das erste Bild, das dazu tief in ihr vergraben lag, war die Decke des Zimmers im Krankenhaus, in dem sie erwacht war. Mathis hatte an ihrem Bett gesessen und sie mit seltsamem Ausdruck angesehen, und da hatte sie gewusst, dass ihre Eltern tot waren, verschlungen vom Meer, das ihr bis zu diesem Augenblick stets als zärtlicher Freund erschienen war. Die Ärzte hatten geglaubt, dass sie den Tod ihrer Eltern nicht begriffen hätte, weil sie für eine lange Zeit nicht hatte weinen können. Aber sie hatte ihn verstanden, mit jeder Faser ihres Körpers. Noch immer spürte sie die Erschütterung, die sie in diesem Moment durchzogen hatte. Das Gefühl war so leicht abrufbar, dass sie binnen einer Sekunde in das Krankenhaus zurückkehren und wieder sieben Jahre alt sein konnte, und in jenen Augenblicken war sie dankbar, die Nacht nicht noch einmal erleben zu müssen: die Nacht, in der ihre Eltern gestorben waren und die in ihrem Kopf nichts mehr war als ein tödliches, sturmgepeitschtes Meer.
Sacht strich Milou über die Kerben der steinernen Brüstung, wie sie es auch früher so oft getan hatte. Sie erinnerte sich an die Wärme, die Federico ihr in jener Zeit gegeben hatte, an die leisen Tränen ihrer Großmutter, die ein Stück ihrer eigenen Verzweiflung mit sich fortgespült hatten, und an deren Umarmung, als sie mit Mathis fortgegangen war. So fest hatte Nonna sie gedrückt, als wollte sie ein Stück von ihr dabehalten. Und nun, da Milou sich von der Brüstung löste und zurück ins Haus ging, fühlte sie, dass es genau so gekommen war. Ein Teil von ihr hatte diese Stadt nie verlassen. Ein Teil, der es liebte, am Saum des Meeres zu sitzen und den Wellen zuzusehen und der nun, zaghaft und vorsichtig, wieder zu ihr zurückkehrte.
Die Treppe knarzte unter ihren Füßen, als sie Federicos Lachen in die Küche folgte. Wie immer war der Raum rettungslos überfüllt. Unzählige Kräuter standen auf den Regalen, rankten sich von den Hängeschränken und baumelten von der Decke. Teller, Pfannen und Töpfe bevölkerten die Ablagen, und ein riesiger Tisch stand in der Mitte des Raums und war mit Speisen beladen, die einen kompletten Straßenzug für mindestens eine Woche satt gemacht hätten. Und dazwischen, wohlig schnurrend angesichts der Wärme in dem kleinen Raum und der erbeuteten Fischstückchen, lag ein knappes Dutzend Katzen. Mit beeindruckender Gewandtheit stieg Federico kreuz und quer über sie hinweg, während er die Gedecke auflegte, und Milou musste lächeln, als sie Nonna dabei beobachtete, wie sie mit einer mechanischen Greifzange das Basilikum zu sich herab holte, das auf einem Schrank gestanden hatte. Fast hätte man meinen können, dass diese beiden Menschen mitsamt ihren tierischen Gehilfen jeden Abend ein solches Festessen veranstalteten, wenn man sich ihre Routine dabei ansah.
»Setz dich, setz dich«, forderte Nonna sie auf und deutete auf den Tisch, als würde Milou sonst auf die Idee kommen, sich in einer Schublade niederzulassen. »Wenn du wartest, bis eine der Herrschaften für dich Platz macht, wirst du dort in der Tür verhungern.«
Zielstrebig ging Milou zu einem der Stühle hinüber, doch der Kater, der darauf lag, schaute sie nur an, als wäre er der König der Welt und sie ein einfältiger Hofnarr, der es wagte, vor seinen Thron zu stolpern. Erst als sie Anstalten machte, sich auf ihn zu setzen, rutschte er murrend ein Stück beiseite und kletterte, nachdem sein empörter Blick sie nicht vertreiben konnte, auf ihren Schoß, um sich streicheln zu lassen. Sein Fell war seidenweich unter ihren Fingern, und Federico zwinkerte ihr zu, als er die beiden Katzen, die den Stuhl ihr gegenüber blockierten, mit etwas Fisch fortlockte und aufatmend Platz nahm. »Es ist gut, heimzukommen, nicht wahr?« Er lächelte, als würde er den Geruch der Rosen wahrnehmen, und Milou nickte.
»Es ist das beste Gefühl der Welt«, stellte sie fest.
»Aber nur fast so gut wie meine hausgemachten Tortellini«, sagte Nonna und stellte eine Schüssel mit dampfenden Nudeln auf den Tisch. Sie ließ sich so plötzlich auf einen Stuhl fallen, dass die Katze darauf nur im letzten Moment Reißaus nehmen konnte, und damit begann das Festessen. Milou hatte nicht bemerkt, wie hungrig sie eigentlich war. Doch als das Knoblauchbrot auf ihrer Zunge zerging und der Geruch der Tortellini ihr in die Nase stieg, schien es ihr, als hätte sie seit Jahren nichts Anständiges mehr gegessen. Wie früher aß sie sich durch Berge von Nudeln, duftendes Brot und gebratenen Fisch, probierte verschiedene Feigensorten, die Nonna extra auf dem Markt für sie gekauft hatte, und ließ wie Federico immer wieder unauffällig kleine Leckerbissen für die Katzen zu Boden fallen, die sich mit wohligem Schnurren darüber hermachten. Sie aßen und lachten und aßen noch mehr, und nachdem Federico allerhand Anekdoten seiner Kundschaft zum Besten gegeben hatte, erzählte Milou von ihrem Leben in Paris und den Verrücktheiten, die diese große Stadt jeden Tag aufs Neue hervorbrachte.
»Paris hat sich verändert«, sagte Nonna schließlich, als sie pappsatt auf ihren Stühlen hingen. »Ich würde die Stadt wahrscheinlich gar nicht wiedererkennen.«
Federico nickte. »Da lobe ich mir diese alte kleine Bastion auf dem Meer. Ozean und Mensch zehren an ihren Kräften, aber sie wird niemals untergehen. Und wenn doch, wird sie unter den Wellen in silbernem Licht erstrahlen, gerade so, wie es die alten Lieder erzählen.«
»Venedig ist die Königin der Magie«, stimmte Nonna ihm zu. »Sie verwandelt jeden, der durch ihre Gassen geht, und sie birgt Wunder, wohin man auch schaut.«
Milou drehte das Glas mit Traubensaft in ihrer Hand. »Das habt ihr mich früh gelehrt. Vermutlich habe ich meine ganze Versponnenheit, über die Mathis immer die Augen verdreht, nur euch zu verdanken.«
Nonna lächelte. »Deine Mutter hat mindestens ebenso viel Anteil daran. Schon als kleines Kind hat sie mit den Geistern unter ihrem Nachttisch gesprochen, die ich bis heute nicht zu Gesicht bekommen habe. Und dein Vater war der geborene Geschichtenerzähler, ganz genauso wie du. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft du mit den Nachbarskindern hier um diesen Tisch oder in Federicos Laden gesessen hast. Du hast ihnen Geschichten erzählt von tanzenden Feen und wandernden Häusern, von Pfennigen, die um die Welt reisen, und Fischen, die bis hinauf zum Mond fliegen.«
Milou musste lachen. »Ich erinnere mich. Und der Drache aus Feuer und Gold, der sich mit aller Kraft gegen sein eigenes Volk stellte, um die Menschen vor den Mächten des Bösen zu beschützen.«
»Oh ja!«, rief Federico und riss die Augen auf. »An den erinnere ich mich. Ich war so gespannt, wie es weitergehen würde, dass ich mit allen Tricks versucht habe, das Ende der Geschichte aus dir herauszubekommen.«
»Das stimmt«, erwiderte Milou grinsend. »Einmal wolltest du mich mit Schokoladeneis bestechen, aber das ist nach hinten losgegangen. Es ist mir aus der Hand gerutscht und auf einem halben Dutzend alter Bücher gelandet. Ich wusste übrigens selbst nicht, wie die Geschichte ausging. Sie hat einfach ihre Flügel ausgebreitet und mich auf ihnen fliegen lassen.«
»Das sind die besten Geschichten«, warf Nonna ein. »Und du hast alle damit begeistert.«
Milou seufzte leise. »Ja, weil es niedlich ist, wenn ein kleines Mädchen von Drachen und Kobolden erzählt und daran glaubt, fliegen zu können. Heute ist das was ganz anderes. Irgendwann scheint man einfach zu alt dafür zu sein. Mathis sagt mir immer wieder, dass ich eine Träumerin bin, und auch wenn er es auf seine ganz spezielle Art sicher liebevoll meint, weiß ich doch, was dahintersteckt. Er meint damit, dass ich versponnen bin, dass ich ziellos durch die Welt stolpere und mir selbst Geschichten erzähle, die nur dazu führen, dass ich mich fortsehne, weil ich das ja immer tue, fort, nur fort von den Orten, an denen ich gerade bin, ohne zu wissen, wohin ich sonst gehen könnte. Früher hat er sich meine Geschichten angehört, meine Tagträumereien und verrückten Ideen, aber inzwischen findet er sie eher albern, und vielleicht … nun ja, vielleicht hat er damit gar nicht so unrecht.«
Milou drehte ihr Glas zwischen den Händen. Sie sah Mathis vor sich, seinen stillen Blick, mit dem er sie manchmal betrachtete, wenn er glaubte, sie würde es nicht merken, und der ihr jedes Mal einen Stich versetzte. Sorge lag darin … und der klebrige Schatten von Mitleid, als wäre sie ein armseliges Tier mit gebrochenen Beinen, das es nie schaffen würde, sich in der rauen Wirklichkeit zu behaupten. Erst als sich das Schweigen ringsum auf ihre Schultern legte, hob sie den Blick und schaute in die ernsten Gesichter von Nonna und Federico. Schnell räusperte sie sich und wischte durch die Luft, als könnte sie so die Worte zurücknehmen. »Hört nicht auf mich, ich habe nur Unsinn geredet. Das tue ich ständig und treibe Mathis damit in den Wahnsinn.«
Sie lächelte, aber ihre Großmutter sah sie ernst an. »Ein bisschen Wahnsinn hat noch niemandem geschadet. Dasselbe gilt für die Sehnsucht, denn selbst wenn wir manchmal gar nicht wissen, woher sie kommt oder wohin sie uns führt, ist sie doch die einzige Kraft, die uns über uns selbst hinauswachsen lässt, die Veränderung bringt und Mauern einreißt, seien es nun äußere Grenzen oder Barrikaden in unserem Kopf. Und was die Geschichten betrifft, die man sich selbst erzählt … was sollte man anderes tun, wenn niemand sonst zuhört?«
Federico nickte vielsagend. »Genauso ist es. Lass dir das von einem Märchenerzähler sagen, über den all die klugen Leute seit Jahrzehnten den Kopf schütteln und der sich dennoch nie davon abhalten ließ, in voller Lautstärke von Elfen und Feen zu reden und von so vielen anderen Kreaturen, die das schnappatmige Hirn eines wissenschaftlich aufgeklärten Zeitgenossen niemals ganz begreifen wird. Dennoch, sagte ich … nun ja … oder vielleicht gerade deshalb? So ganz bin ich nie dahintergekommen.«
Er zwinkerte und Milou lächelte ein wenig. »Ich habe es geliebt, wenn du mir Geschichten erzählt hast. Und Nonnas alte Lieder von den Feen und den Kobolden und dem grünen Kristall …« Sie schaute zu der Lampe im Fenster hinüber. Der Kristall glühte und warf das Licht zurück, als wäre er in einen Schwarm Glühwürmchen geraten. Als sie ihre Großmutter einmal gefragt hatte, warum diese Lampe in ihrem Fenster stand, hatte Nonna sie beinahe erstaunt angesehen.
Na, für die Wesen in den Schatten, hatte sie geantwortet. Für die Nixen, die Feen, die Trolle und die Bären mit dem fliederfarbenen Fell, damit sie wissen, dass hier ein Mensch wohnt, der ihnen freundlich gesonnen ist.
Dann hatte sie gelacht, und Milou hatte ganze Nächte damit verbracht, heimlich hinter der Gardine zu hocken und auf die Straße zu schauen, wie ihre Großmutter es ihrerseits als junges Mädchen getan hatte. Die Hoffnung, Bären und Trolle mit eigenen Augen sehen zu können, hatte Milou stundenlang ausharren lassen. Und manchmal, so hatte sie damals geglaubt, war es ihr tatsächlich gelungen.
»Dieser Kristall hat mir immer Glück gebracht«, sagte Nonna nun. »Seit ich ein Mädchen war. Und er erinnert mich daran, dass wir die Welt um uns herum mit unseren Gedanken erschaffen. Es liegt an uns, ob wir daraus eine Wüste oder ein Zauberreich machen. Ich für meinen Teil habe mich vor langer Zeit für einen Weg entschieden, und ganz gleich, was irgendwelche klugen Leute dazu sagen, deren Fantasie gerade einmal bis zur nächsten Straßenecke reicht: Ich bin heilfroh, dass ich bis heute die Flüstertrolle unter den Brücken dieser Stadt hören kann, von denen schon mein Vater mir erzählte.«
Federico war ihrem Blick gefolgt, und das Lächeln, das sich beim Anblick des Kristalls auf sein Gesicht gelegt hatte, verwandelte sich in ein Grinsen. »Und manchmal höre ich sogar die Geizkobolde in den Geldbörsen meiner Kundschaft – gruselig, sage ich euch.«
Milou kicherte und Nonna lachte herzlich. »Es gibt mehr als eine Wirklichkeit«, sagte sie dann und sah Milou an. »Du hattest immer schon die Gabe, das zu sehen, und manchmal, in seinen geheimen Momenten, ahnt dein Onkel das auch. Hast du vergessen, wie er hier in meiner Küche saß und sich das Lied der dunklen Königin anhörte, damals vor ein paar Jahren, als du mich das letzte Mal besucht hast?«
Milou nickte. Sie hatte lange nicht mehr daran gedacht, aber nun erinnerte sie sich, wie Mathis in seinem teuren Anzug und den glänzenden Schuhen auf einem wackligen Hocker gesessen und wie schlafwandlerisch die Katze gestreichelt hatte, die ihm auf den Schoß gesprungen war. Erst als Nonnas Lied verklungen war, hatte er sich heiser geräuspert und war mit verklärtem Blick in die Realität zurückgekehrt. Ihre Großmutter nickte, als hätte sie ihn gerade ebenfalls vor sich gesehen.
»Nichts daran ist albern, dem Wissen zu folgen, das tief in dir liegt«, sagte sie leise. »Ganz im Gegenteil. Geschichten, Fantasien, Träume verwandeln uns in Feuer, mit ihnen entzünden wir die Welt. Lass dir von niemandem etwas anderes einreden, auch nicht von ihm.«
Milou senkte den Blick. »Manchmal erscheint es mir leicht, daran zu glauben. In meinen Büchern, in manchen Gesprächen, in Refugien wie hier. Aber dort draußen … dort draußen in der richtigen Welt, wie Mathis sagen würde, ist es unglaublich schwer. Dort sind meine Träume wie Seifenblasen um mich herum, bei denen ein Luftzug genügt, um sie zerplatzen zu lassen.«
Für einen Moment schaute Nonna sie nur an. Dann streckte sie die Hand nach ihr aus und strich ihr über die Wange. Die Berührung war zart, beinahe flüchtig, und doch reichte sie aus, um Milou in die Nächte nach dem schrecklichen Unfall zurückzutragen, als sie schreiend aus tiefstem Schlaf erwacht war und all ihre Träume zum Teufel geschickt hatte.
»Deine Träume sind mächtiger, als du glaubst«, sagte Nonna nun wie damals. »Nur sie können dich gesund machen, dich heilen von dem, was diese Welt dir angetan hat – sie allein. Vergiss das niemals.«
Milou erwiderte ihr Lächeln und sah erst nach einer Weile, dass eine einzelne Träne über Nonnas Wange rann. Rasch wischte ihre Großmutter sie fort und stieß die Luft aus. »Himmelherrgott, dabei hatte ich mir doch fest vorgenommen, bei unserem Wiedersehen nicht zu weinen!« Kopfschüttelnd griff sie nach der Küchenrolle und putzte sich die Nase, während Federico sich zu Milou herüberbeugte.
»Alles, was deine Großmutter gesagt hat, ist wahr«, sagte er leise. »Und wenn es einen Ort gibt, der dich daran erinnern kann, so ist es Venedig. Von tiefem Traum besiegt, vom Tode eingewiegt, schläft hier die Zeit…«
»…und alles Leben scheint so weit, so weit«, setzte Milou das Gedicht fort, das Federico ihr schon früher so oft vorgesagt hatte. »Hier will ich ganz allein durch alte Gassen gehn, bei Fackelschein an Gondeltreppen stehn, in blinde Fenster sehn, bang-glücklich wie ein Kind im Dunkeln sein.«
Die letzten Worte sprachen sie zusammen. Dann berührte er ihre Stirn, gerade so wie die Helden in vielen seiner Geschichten es getan hatten, ehe sie ihre Knappen in die Schlacht entlassen hatten. Milou erwiderte sein Lächeln, bevor sie seinem Blick zu Nonna folgte. In Gedanken versunken schaute diese zum Fenster hinüber. Ihr Gesicht war das einer alten Frau, aber ihre Augen blitzten im Schein des Kristalls. Milou konnte sie vor sich sehen, wie sie am Fenster stand und mit diesem Ausdruck auf die Straße hinausschaute, der dieselbe Feierlichkeit in sich trug wie das Gedicht von Hesse – so, als würde sie auf etwas warten, das sie mehr erahnte als mit Händen greifen konnte und das doch so nah bei ihr war, dass es nichts als Sehnsucht in ihren Augen zurückließ … etwas, das ihr Lächeln mit stillem Glanz erfüllte wie damals, als sie ein junges Mädchen gewesen war.
3
Milou brauchte einen Moment, um zu begreifen, wo sie war. Das Licht der Straßenlaternen drang nur schwach durch die Vorhänge, und fast erwartete sie, in ihrem Schein die Umrisse ihres Zimmers in Paris zu sehen. Doch stattdessen fiel ihr Blick auf den Koboldschrank und die Unmengen von Einkaufstüten, die neben ihm an der Wand lehnten. In den vergangenen zwei Tagen war sie mit Nonna von einem Geschäft ins nächste gewandert, hatte Klamotten und Süßigkeiten gekauft und sich abends in der Küche lachend über ihre wunden Füße beklagt. Selten hatte sie so tief geschlafen wie seit ihrer Ankunft in Venedig und war so ausgeruht am nächsten Morgen erwacht. Aber nun war es mitten in der Nacht und sie spürte noch immer den Schreck in ihren Gliedern. Irgendetwas hatte sie geweckt.
Mit klopfendem Herzen setzte sie sich auf und lauschte. Vereinzelt hörte sie Schritte auf dem Pflaster, die Rufe der Möwen über den Dächern … und einen Ton, leise zuerst, doch rasch so durchdringend, dass sie den Atem anhielt. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals etwas Ähnliches vernommen zu haben. Es war ein Laut wie aus einem Requiem, zart und kraftvoll zugleich, und als sie ans Fenster trat und den Blick über den nächtlichen Kanal schweifen ließ, schwollen die Klänge zu betörenden Gesängen an. Sie musste an den Karneval denken, den sie vor etlichen Jahren einmal in Venedig erlebt hatte und bei dem fantastisch gewandete Sänger in den schwarzen Gondeln der Stadt über die erleuchteten Kanäle gefahren waren und ihre Stimmen wie magische Formeln durch die Gassen geschickt hatten. Es war ein bewegendes Schauspiel gewesen, und als die Gesänge nun anschwollen, zögerte sie nicht länger. Rasch schlüpfte sie in Stiefel und Mantel und schlich sich aus dem Zimmer.
Ein Lächeln flog über ihr Gesicht, als die Treppe leise unter ihren Füßen knarzte. Sie konnte nicht mehr zählen, wie oft sie sich als Kind noch am späten Abend aus dem Haus geschlichen hatte, geduckt und wachsam wie ein Dieb, um sich bei einem der Nachbarskinder auf dem Dachboden zu treffen und in glitzernden Theaterkostümen oder uralten Seemannstruhen herumzustöbern. Es war ein aufregendes Gefühl, das nun mit kindlicher Übermacht in ihren Magen zurückkehrte, und sie spürte die Kälte der Nacht kaum, als sie auf die Straße trat und den Stimmen folgte, die mit den Fingern des Windes nach ihrem Haar griffen und sie vorwärtszogen.
Die Gesänge wirbelten wie unsichtbare Blätter durch die Luft. Sie schoben Milou über den Rio di San Severo, als wäre sie selbst nicht mehr als ein flatterndes Blatt, und sie zwang sich, nicht auf den Nebel zu achten, der aus den Kanälen aufstieg. Zu unbeschwert waren die Stimmen ringsherum, zu heiter, als dass sie sich dieses Erlebnis von düsteren Gedanken zerstören lassen wollte. Beschwingt wich sie den Passanten aus, die ihr vereinzelt entgegenkamen, und als sie die Scuola Grande di San Marco erreichte, deren weiße Fassade im Schein der Nacht leuchtete, schwollen die Gesänge an. Sie brachen über die Gassen herein, als wären sie düstere Wellen, und jeder Ton darin wurde so drängend, als erklänge er nur für Milou allein. Sie begann zu rennen, schnell, immer schneller, als wäre der Schmerz in ihren Füßen nicht mehr gewesen als eine Illusion. Sie glaubte fast, sich auf den Tönen in die Luft erheben zu können, so leicht fühlte sie sich. Erst als die Gischt über ihre Füße schlug, blieb sie stehen und stellte fest, dass sie die Fondamente Nove erreicht hatte. Die geheimnisvollen Stimmen hatten sie an den Rand des Meeres geführt.
Milou schaute über die Wellen hinweg. In einiger Entfernung erhob sich die Friedhofsinsel San Michele wie eine düstere Fata Morgana hinter dem Dunst des aufgepeitschten Wassers. Doch sie konnte weder Gondeln noch Sänger oder andere Quellen des Gesangs sehen, der nun mit erneuter Intensität um sie herum aufbrandete. Sie zog die Schultern an, als ein heftiger Windstoß sie einige Schritte vom Ufer zurücktrieb, aber die Kälte blieb seltsam fern und verschwand vollständig, als sie tief unten in den Wellen einen Schatten entdeckte. Sie hatte schon Aale, Seezungen und kleine Tintenfische in der Lagune Venedigs gesehen, aber die Schemen, die sie nun dort unten im Wasser erkannte, waren etwas anderes. In geschmeidigen Bewegungen glitten sie durch die Wellen, und als Milou neugierig näher heranging, meinte sie, die Umrisse menschlicher Körper in der Dunkelheit zu erkennen, umspielt von tiefblauem Haar – und mächtige Fischschwänze. Sie riss die Augen auf, und kurz schien es ihr, als würden Gesichter aus den Wellen tauchen, Dutzende schmale, betörend schöne Gesichter mit dunklen Rätselaugen, die Münder zu lockendem Gesang geöffnet.
Milou stieß mit dem Fuß gegen einen verrosteten Poller. Im selben Moment brachen die Wellen vor ihrem Blick, und sie schaute noch einmal in die Augen des Spiegelmädchens, die nichts als tiefschwarzes Meer in sich getragen hatten. In plötzlicher Atemnot griff sie sich an die Kehle, doch als die Gesänge erneut mit aller Macht um sie aufwallten, erlosch ihre Panik, als wäre sie nicht mehr gewesen als eine törichte kleine Flamme. Milou meinte, die Stimmen ihrer Eltern in all den Tönen hören zu können, und sie fühlte das Versprechen, das in jedem einzelnen Laut lag. Diese Wellen bargen Nächte aus fließender Seide und Gesänge vollendeter Harmonie, sie kannten die tiefste Finsternis des Ozeans ebenso wie das Leuchten des ersten Sterns am Abend, und sie zogen Milou näher, noch näher zu sich heran. Ihr Blick stürzte in die Tiefe. Sie fühlte, dass sie das Gleichgewicht verlor, aber der Schreck darüber blieb seltsam dumpf. Zu mächtig waren die Stimmen, die sie zu sich riefen und in denen jede Schwere, jede Furcht enden würde.
Der Schrei kam so plötzlich, dass er Milou wie ein Schlag vor die Brust traf und sie von dem Abgrund zurücktrieb. Grell peitschte er über das Wasser, und sie meinte, einen Raben dicht über den Wellen dahinjagen zu sehen, so deutlich hörte sie seinen Ruf. Voller Zorn bäumten sich die Stimmen ringsum auf. Noch einmal schien es, als höben sich dunkle Leiber aus den Fluten, tückisch nun und mit scharfen Klauen. Dann zerbrach der Gesang, und ehe Milou noch wusste, was sie im Tosen der Wellen gesehen hatte, tauchte jeder Schemen in der Tiefe des Meeres unter. Mit rasendem Herzen starrte sie in die Fluten, nicht wissend, ob sie einer optischen Täuschung aufgesessen war oder etwas anderes dort unten gesehen hatte … etwas, das wirklich da gewesen war.
»Deine Wirklichkeit ist eine Illusion«, raunte da eine dunkle Stimme direkt hinter ihr.
Milou erschrak so sehr, dass sie den Halt verlor. Ihr linker Fuß rutschte über den Kairand, doch ehe sie in die Tiefe stürzte, wurde sie gepackt und zurück an Land gezogen. Atemlos schaute sie zu einem jungen Mann auf. Sein halblanges Haar war so hell, dass es fast farblos wirkte. Im Schein des Mondes jedoch, der nun durch die Wolken brach, schimmerte es silbern und umspielte ein erhabenes, von kühlem Stolz gezeichnetes Gesicht. Die Andeutung eines Lächelns lag auf seinen Lippen, und in seinen Augen spiegelte sich das Meer, so schwarz waren sie. Eine rätselhafte Glut stand in ihrer Mitte, und Milou kam es so vor, als würde die Dunkelheit darin als Schwingenschlag über ihre Haut gleiten, zärtlich und seltsam ruhelos zugleich. Noch nie hatte sie solche Augen gesehen.
»Ich kenne dich«, sagte sie und stellte zu ihrem eigenen Erstaunen fest, dass sie ihren Gedanken laut ausgesprochen hatte. »Du warst in der Gasse, als … der Nebel kam.«
Der Fremde zog sie vom Rand des Kais zurück. Sie konnte die Kraft spüren, die in seinem Körper lag, von einem starken Willen beherrscht und doch lohend wie bei einem Raubtier. Aus irgendeinem Grund sah sie sich für einen Wimpernschlag von außen: mit zerzausten Haaren, die Schlafanzughose in die Stiefel gesteckt, als wäre sie geschlafwandelt. Doch der Fremde schien nichts Ungewöhnliches an ihrem Aufzug zu finden. Stattdessen verstärkte er sein Lächeln. »Ich war dort. Mir schien es, als hättest du dich im Nebel verirrt.«
Seine Stimme war eigenartig, rau und sanft zugleich, und auf einmal waren die Bilder aus der Gasse wieder da, das Gesicht des Mädchens mit den Spiegelaugen, die entstellten Fratzen der Menschen in den Wohnungen, die bleigrauen Fassaden der Häuser. Milou schluckte. Irgendetwas in den Augen des Fremden löschte jede rationale Erklärung für diese Ereignisse in ihr aus. Instinktiv schlang sie die Arme um ihren Leib und fürchtete schon, dass die Erinnerung an das unheimliche Flüstern in ihr aufbrechen würde, als der Fremde den Kopf neigte. Das Mondlicht fing sich in seinen Augen. Milou stellte verwundert fest, dass sie hinter einem hauchzarten Schleier lagen, silbrig schimmernd im Schein der Nacht, und im selben Moment sanken die Bilder aus dem Nebel tief in sie zurück.
»Ich war vom Weg abgekommen«, erwiderte sie, als sie merkte, dass der Fremde sie abwartend anschaute. »Ich bin schon seit einer ganzen Weile nicht mehr in der Stadt gewesen, und offenbar habe ich doch mehr vergessen, als ich dachte. All die Schleichwege meiner Kindheit zum Beispiel.«
Er schwieg für einen Moment. Mit jedem Wort, das sie sagte, schienen seine Augen dunkler zu werden. »Mit der Zeit wirst du dich erinnern. Ganz geht man nie mehr fort, wenn man einmal hier gewesen ist, sagt man das nicht?«
»Das ist wahr«, stimmte sie ihm zu. »Und was ist mit dir? Streunst du jede Nacht durch die Gassen und rettest unvorsichtige Mädchen?«
Die Glut in seinem Blick glomm auf, und er lächelte unmerklich. »Es gäbe Schlechteres, das man mit seiner Zeit anfangen könnte, nicht wahr?«