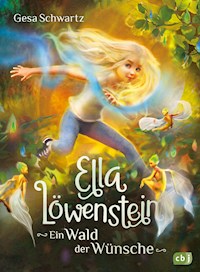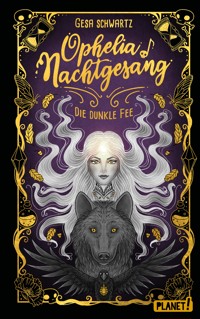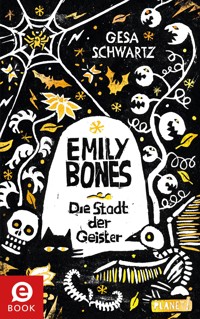12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Romantisch, düster und aufregend fantastisch
Die 16-jährige Naya ist Tochter einer Elfe und eines Menschen. Ein Mischwesen, das keine Magie zu beherrschen scheint und sich weder der geheimnisvollen Elfenwelt New Yorks noch der Welt der Menschen gänzlich zugehörig fühlt. Ihr bester Freund Jaron ist ein Lichtelf, der New York vor den Machenschaften der Dunkelelfen bewahren soll. Doch dann wird Naya mitten hinein gezogen in den jahrhundertealten Krieg zwischen den beiden Völkern. Und als sie den Dunkelelf Vidar kennenlernt, wird all ihr bisheriges Wissen auf den Kopf gestellt. Welche Ziele verfolgt Jaron, welche Geheimnisse verbirgt Vidar? Wem kann sie trauen? Naya muss auf ihr Herz hören, doch das ist leichter gesagt als getan ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 780
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Gesa Schwartz
Nacht ohne Sterne
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House
1. Auflage 2015
© 2015 by Gesa Schwartz © 2015 für die deutschsprachige Ausgabe by cbt Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Carolin Liepins, München MG · Herstellung: kw Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN: 978-3-641-15061-7V002
1
Der Regen hüllte New York in graue Schleier. Naya wich den Menschen aus, die der Wind durch die abendlichen Straßen trieb, während der Karton in ihren Händen zusehends schwerer wurde. Er war so groß, dass sie nur mit Mühe über ihn hinwegsehen konnte, und bei jeder Gelegenheit schlug der Wind ihr den Regen mit einer Leidenschaft ins Gesicht, als hätte er sich den ganzen Tag darauf gefreut. Sie seufzte. So hatte sie sich den Start in die Ferien nicht vorgestellt.
Dabei waren die Vorzeichen wirklich gut gewesen. Ihr Vater war auf Geschäftsreise gefahren, und da es in seinem Antiquariat für gewöhnlich ruhig zuging, hatte sie vorgehabt, in den ersten Tagen nichts anderes zu tun, als im Bett zu bleiben und zu lesen. Aber stattdessen brachte der verfluchte Vollmond sie um den Schlaf, und ihr Vater schickte aus den entlegensten Teilen der Welt mit solchem Feuereifer weitere Bücher, dass ihre Wohnung inzwischen aussah wie ein Warenlager. So war sie an diesem Abend auf die glorreiche Idee gekommen, wenigstens etwas Platz zu schaffen und einen Teil der Bücher ins Geschäft zu bringen. Natürlich war auf halber Strecke der Himmel aufgebrochen, und nun hetzte sie mit mörderisch schwerem Karton durch den Regen und sah zu, wie die Lichter der Schaufenster vor ihrem Blick verschwammen. Ihr Atem ließ ihre Brillengläser beschlagen, aber sie hatte keine Zeit, um stehen zu bleiben und sie zu putzen. Der Karton löste sich in der Nässe auf, und sie konnte sich die Reaktion ihres Vaters vorstellen, wenn den Büchern darin etwas zustieß. Sie musste sie so schnell wie möglich ins Trockene bringen. Im Strom der Passanten kam sie allerdings nur langsam voran. Nicht jeder hatte einen Blick für einen wandelnden Karton auf zwei Beinen.
Unvermittelt streifte ein eisiger Windstoß ihre Wange und ließ sie schaudern. Diese Kälte kam nicht vom Regen. Schon seit zwei Blocks spürte sie die frostigen Luftzüge, die immer wieder durch die Menge glitten, und jetzt hörte sie das Wispern, das wie ein in fremder Sprache gerauntes Geheimnis klang. Ihre Miene verfinsterte sich. Sie hatte sich also nicht geirrt. Nicht nur Menschen waren bei diesem Wetter auf den Straßen Brooklyns unterwegs.
Noch bevor Naya sie sah, fühlte sie ihre Nähe wie einen elektrischen Impuls auf ihrer Haut. Sie schaute über ihren Karton hinweg und da waren sie, kaum wenige Schritte von ihr entfernt. Drei hochgewachsene junge Männer in silbernen Uniformen, die Haut außergewöhnlich hell, die Gesichter makellos. Trotz der Reglosigkeit inmitten der Menge strahlten sie eine intensive Präsenz aus, und während die Passanten an ihnen vorbeieilten, als wären sie leblose Statuen, genügte Naya ein Blick in ihre unnatürlich blauen Augen, um zu wissen, dass der Schein der Menschlichkeit eine Lüge war.
Carmeo Lhunis, so nannten sie sich selbst: das Volk des Lichts. Früher waren sie den Menschen als Elfen bekannt gewesen, doch diese Zeiten waren lange vorbei. Die Menschen hatten sie vergessen, aber das bedeutete nicht, dass sie nicht mehr existierten. Die Askari, wie sie in der Sprache des Lichts hießen, lebten noch immer in der Welt der Menschen, verborgen vor ihren Augen, und nährten sich von ihren Träumen. Doch diese drei waren nicht gekommen, um menschliche Träume zu rauben. Naya hatte ihn schon oft gesehen, diesen Frost in deren Augen. Er war ebenso kalt wie der Wind, der sie begleitete, und sie wusste, was er bedeutete. Die Krieger des Lichts waren auf der Jagd.
Naya beobachtete, wie die Askari sich in Bewegung setzten. Sie waren noch jung, Rekruten vermutlich, und sicher auf der Suche nach unbedarften Elfen, die die Regeln der Königin missachtet hatten. Ihre Gesetze waren streng und unmissverständlich, ebenso wie die Konsequenzen, die bei Nichtbeachtung folgten. Naya hatte immer wieder erlebt, wie ein einfaches Vergehen wie das Hören menschlicher Musik zu schweren Strafen geführt hatte, und sie konnte sich lebhaft vorstellen, wie die Askari dort vor ihr hart mit den Delinquenten ins Gericht gingen. Stolz bewegten sie sich durch die Menge, und sicher konnten sie sich Besseres vorstellen, als bei diesem Wetter nach jugendlichen Übeltätern zu fahnden. Es war, als würden sie jede Nuance ihrer Umgebung mit ihren geschärften Sinnen wahrnehmen und dann tiefer dringen – bis weit hinab in das Labyrinth der Unterwelt, das sich unter den Straßen New Yorks erstreckte und das von den Feinden des Lichts bevölkert wurde.
Naya erinnerte sich daran, wie sie erstmals von diesen Kreaturen gelesen hatte, von ihrer Grausamkeit, ihrer Stärke, ihrem Zorn, und noch immer fröstelte sie beim Klang ihres Namens: Carmeo Dhakar – das Volk der Nacht. Ihre Krieger nannten sich Bharassar, und früher, so hieß es, hatten sie mit den Askari in Frieden gelebt. Doch dann war Krieg über die Völker gekommen, den der mächtige Lichtelf Lyrion mit einer magischen Grenze zwischen Ober- und Unterwelt beendet hatte. Seither bewohnte das Volk des Lichts das magische Refugium Valdurin, das wie ein verborgener Traum in der Welt der Menschen lag, während die Dunkelelfen sich in die Unterwelt Rascadon, die voll düsterer Schönheit sein sollte, zurückgezogen hatten. Nur hin und wieder gelang es Einzelnen, durch die wechselhafte Magie der Grenze in die Oberwelt zu gelangen, doch meist kamen sie nicht weit. Jeder Krieger des Lichts strebte danach, seine Macht an einem Bharassar zu erproben. Gegen eine solche Kreatur zu bestehen, sie niederzustrecken oder in die Schatten zurückzutreiben – das war eine Heldentat, die von den Askari hoch geachtet wurde. Denn die Elfen der Dunkelheit galten als gefährliche Bestien, und es gab nichts, das in der Welt des Lichts stärker gefürchtet wurde als sie.
Die Luft legte sich eiskalt auf Nayas Wangen, so nah war sie den Askari gekommen. Sie hatte gerade beschlossen, unbemerkt an ihnen vorbeizuhuschen, als die Elfen abrupt stehen blieben. Sie fixierten das Zwielicht eines Hinterhofs und Naya bemerkte die plötzliche Anspannung in ihren Gliedern. Wie Raubtiere kurz vor dem Sprung, schoss es ihr durch den Kopf, und noch ehe das kalte Lächeln auf die Gesichter der Elfen trat, wusste sie, dass sie fündig geworden waren.
Gefährlich langsam setzten die Askari sich in Bewegung. Naya kniff die Augen zusammen. Im ersten Moment erkannte sie nichts als den spärlich beleuchteten Hintereingang zu einem Wohnblock, doch plötzlich glomm ein Augenpaar hoch oben in einer Häuserecke auf und erhellte den Umriss eines mit schwarzem Fell bedeckten, etwa katzengroßen Körpers. Scharfe Krallen hatten sich in die Fassade gegraben, während die großen Augen zu den Elfen hinabschauten. Auf den ersten Blick musste Naya an einen Affen denken. Doch das, was da oben hockte, war kein Tier. Es war überhaupt kein Geschöpf der Oberwelt. Dieses Wesen stammte aus den Schatten.
Naya hielt den Karton so fest, dass ihre Knöchel schmerzten. Seit sehr langer Zeit hatte sie keine Kreatur der Unterwelt mehr zu Gesicht bekommen. Doch ihr letztes Erlebnis dieser Art hatte ihr eine lange Narbe im Nacken und jede Menge Albträume beschert, und sie erkannte das Wesen sofort. Es war ein Schattenkobold. Ein Bote, der die Träume der Menschen in die Unterwelt brachte. Ein Dieb, tückisch, verschlagen und gefährlich. Ein Diener der Bharassar.
Einer der Askari rief etwas, seine Worte trafen den Kobold wie Geschosse. Er zuckte zusammen, aber seine Stimme war rau und furchtlos, als er eine wüste Beschimpfung in der Sprache seines Volkes zu den Elfen hinabschleuderte. Fast musste Naya über deren Empörung lachen, doch sie gab keinen Laut von sich. Eine Auseinandersetzung mit den Askari konnte schmerzhaft enden und das hatte ihr an diesem Abend gerade noch gefehlt. Sie sollte einfach verschwinden, es ging sie nichts an, wenn die Elfen einem bösartigen Kobold zu Leibe rückten. Kaum hatte sie das gedacht, bemerkte sie das Blut, das aus seiner Brust rann. Offenbar waren die Askari nicht die ersten Kreaturen der Oberwelt, die ihre Kräfte an ihm erprobten. Jetzt lachten sie leise, ihre Stimmen trieben den Kobold noch enger an die Hauswand. Er zitterte bereits. Bald würden ihn die Kräfte verlassen und dann … Naya sah noch, wie einer der Askari nach dem Dolch an seinem Gürtel griff. Im nächsten Moment setzte sie sich in Bewegung, hielt den Karton wie einen Schild vor sich – und lief mitten in die Elfen hinein.
Der Zusammenprall war so schmerzhaft, als wäre sie gegen eine Wand gelaufen. Die Askari wichen ärgerlich zurück, doch sie selbst stolperte auf dem nassen Boden und landete mitsamt ihrem Karton vor den Füßen des Dolchträgers. Ihre Bücher verteilten sich auf dem nassen Asphalt und die Kapuze rutschte ihr vom Kopf. Kühl rann der Regen ihren Nacken hinab. Sie konnte den Blick des Elfs spüren, der über ihr Haar glitt. Weiß, beinahe silbern war es, wie sein eigenes.
»Kind des Lichts«, sagte er fast lautlos, und doch verstummte auf der Stelle jedes andere Geräusch. Naya schien es, als würde seine Stimme direkt in ihren Kopf fliegen und jeden Gedanken darin auslöschen. »Du kennst die Gesetze unseres Volkes. Es ist gefährlich, bei Anbruch der Dämmerung allein auf den Straßen unterwegs zu sein, wenn Lyrions Wall sich so stark wandelt wie in den vergangenen Wochen. Zu viel Bosheit dringt aus der Unterwelt zu uns. Mit welchem Recht missachtest du das Gebot unserer Königin?«
Naya grub ihre Finger in den Karton. Sie fühlte ihren Herzschlag in der Kehle, als sie sich zu dem Elf umdrehte, aber sie zwang sich, ihn direkt anzuschauen. Seine Gefährten standen hinter ihm, der eine so schmächtig, dass seine Uniform sich locker um seine Hüfte legte, der andere mit raspelkurzem Haar, und auch sie hoben erstaunt die Brauen, als sie ihre Brille bemerkten und die Augen, die dahinterlagen. Sie waren nicht hell wie die Augen der Askari, sondern von einem dunklen, unruhigen Braun – Menschenaugen.
»Eure Gesetze gelten nicht für mich«, gab sie zurück. »Ich bin keine von euch.«
Die Miene des Elfs veränderte sich binnen eines Wimpernschlags. War sie eben noch herablassend gewesen, verwandelte sie sich nun in reglose Gleichgültigkeit. »Halbblut«, raunte er. »Pass auf, vor wessen Füße du taumelst, oder ich werde dich unsere Gesetze lehren!«
Naya lag eine passende Entgegnung auf der Zunge, aber die Askari sprachen keine leeren Drohungen aus. Jede Grausamkeit, die sie ankündigten, war ein Versprechen. »Ich habe euch in diesem düsteren Hof nicht erwartet«, sagte sie daher achselzuckend und begann, die Bücher zurück in den Karton zu legen. »Was tut ihr hier überhaupt? Katzen jagen?«
Sie musste den Kobold nicht ansehen, um zu wissen, dass er noch immer hoch oben in der Häuserecke klebte. Fast meinte sie, seine Erschöpfung spüren zu können.
»Nicht jeder ist so blind wie du«, erwiderte der schmächtige Elf herablassend. »Ein Schattenkobold wie der dort kann dir leicht den Arm abreißen und dann trinkt er dein Blut zu seinem Vergnügen.«
Naya zwang sich, möglichst unbeeindruckt zu erscheinen. »Und was habt ihr mit ihm vor? Soll er für euch die Träume der Menschen stehlen, weil eure eigenen Kobolde euch zu langsam sind?«
»Vielleicht fangen wir ihn, um einem Halbblut das Fleisch von den Knochen nagen zu lassen«, gab der Elf zurück. Etwas wie Belustigung flammte über sein Gesicht, als er auf ihren Karton sah, dicht gefolgt von beißendem Spott. »Leroys Antiquariat«, las er. »Sie ist die Tochter des verrückten Händlers. Nun, was will man bei diesem Vater anderes erwarten? Sammelt Dinge, die er nicht versteht, und verkauft Bücher, die er nicht lesen kann. Ein Narr von einem Menschen!«
Naya hörte die Askari lachen, jeder Ton war wie ein Hieb. »Mein Vater ist kein Narr«, sagte sie so ruhig, dass sie selbst überrascht war. »Vielleicht sammelt er Dinge einer Welt, die er nur aus Erzählungen kennt – aber ihm käme es nicht in den Sinn, Legenden der Unterwelt hinterherzulaufen wie ihr!«
Sie empfand glühenden Triumph, als Zorn in den Augen der Elfen aufblitzte. Doch der Moment währte nur kurz. Gleich darauf kehrte die Gleichgültigkeit auf ihre Züge zurück und der Askari mit dem kurzen Haar hob langsam die Hand. Naya stockte der Atem. Sie spürte den Zauber, der sich zwischen seinen Fingern formte und ihr in kürzester Zeit die Luft aus der Lunge pressen konnte. Aber sie wich nicht vor ihm zurück. Ja, sie war ein Halbblut, ein Kind ohne Welt – aber sie würde nicht auf die Knie fallen vor einem Traumfresser des Lichts!
»Nicht doch«, sagte der Dolchträger und lächelte unmerklich, während sein Gefährte unter seinem stummen Befehl die Hand sinken ließ. »Sie hat doch recht, was ihren Vater betrifft. Vermutlich würde jeder Mensch den Verstand verlieren, der einmal einen Blick in die Welt des Lichts geworfen hat.« Beinahe mitfühlend schaute er Naya an. »Dein Vater hatte gar keine Wahl. Jeder andere an seiner Stelle wäre deiner Mutter ebenso verfallen, einer Askari Valdurins, schön wie das Licht der Sonne und des Mondes. Dann war wohl sie die Närrin in diesem Spiel. Warum sonst nahm sie die Verbannung für einen Menschen in Kauf, das Los, ihr Leben abseits ihres Volkes zu fristen, heimatlos in der Kälte seiner Welt? Nun, wir können sie nicht mehr fragen. So ist das mit den Toten der Menschenwelt. Sie sind nichts als Asche im Wind.«
Naya fühlte die kalte Glut seiner Augen auf sich, und sie überkam das Bedürfnis, ihm den Karton mit den nassen Büchern über den Schädel zu ziehen. Mit aller Kraft drängte sie den Schmerz zurück, den der Gedanke an ihre Mutter in ihr aufriss, und hob stolz den Kopf. »Doch sie haben gelernt zu träumen«, erwiderte sie leise, aber mit fester Stimme. Eine seltsame Stille legte sich bei diesen Worten über die Elfen, als hätte sie einen Fluch ausgesprochen. Schnell bückte sie sich nach ihrem Karton. »Ihr solltet euch mit dem Kobold da oben lieber beeilen«, sagte sie betont gleichgültig. »Sicher habt ihr bald alle Hände voll zu tun.«
Der Elf, der ihr am nächsten stand, musterte sie prüfend. »Wovon sprichst du?«
Scheinbar verwirrt schaute sie ihn an. »Sagt bloß, ihr habt nichts davon gehört! Eigentlich informieren euch eure Sirenen doch sofort. Ich spreche von dem neuen Riss in Lyrions Wall, ganz in der Nähe des Washington Square Parks. Er ist gerade aufgebrochen, als ich vorbeikam. Da wird sicher einiges aus der Unterwelt kriechen und vielleicht ist ja auch die eine oder andere Legende dabei. Seltsam, dass eure Offiziere euch lieber in Hinterhöfen herumstehen lassen, statt euch dort dabeizuhaben. Aber nun ja. Nicht jeder wurde als tapferer Krieger geboren, nicht wahr?«
Eine atemlose Anspannung hatte sich der Askari bei ihren Worten bemächtigt. Wie ein Strick schien sie sich enger um ihre Kehlen zu ziehen, bis der schmächtige Elf die Faust hob. »Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst!«, stieß er überraschend unbeherrscht hervor. »Wenn die Grenze fällt, wird dein loses Mundwerk dich nicht retten können!«
Der Dolchträger warf ihm einen Blick zu, schlangenschnell und so scharf, dass Naya sich nicht gewundert hätte, wenn der andere zurückgetaumelt wäre. Sofort presste dieser die Zähne aufeinander, als wäre ihm plötzlich bewusst geworden, was er gesagt hatte – als hätte er ein Geheimnis ausgeplaudert, das nicht für sie bestimmt war. Naya zog die Brauen zusammen, doch da trat der Dolchträger auf sie zu. Die Kälte seines Körpers ließ sie frösteln.
»Lächerliches Menschenkind«, sagte er kaum hörbar. »Du weißt nichts über die Welt des Lichts, für die deine Augen blind sind, und weniger noch über die Welt der Schatten. Bete, dass du sie niemals kennenlernst. Sie würden dich um den Verstand bringen.«
Dann fuhr er herum, und ehe Naya ihnen mit dem Blick folgen konnte, waren die Elfen verschwunden. Kurz blieb sie stehen, wo sie war, den Karton in den Händen, das nasse Haar eiskalt an ihren Schläfen. Ein bitterer Geschmack hatte sich auf ihre Zunge geschlichen, den sie von zahlreichen Begegnungen mit den Askari kannte und immer schon gehasst hatte. Zurückweisung. Hohn. Und Einsamkeit. Doch stärker noch empfand sie die Unruhe, die gerade über die Elfen gekommen war, als sie vom Einsturz der Grenze gesprochen hatten. Etwas war bei diesen Worten in ihnen aufgebrochen, das auf ihren Gesichtern so fremd aussah, dass Naya einen Moment brauchte, um das passende Wort dafür zu finden. Furcht. Nachdenklich starrte sie dorthin, wo die Elfen verschwunden waren. War es möglich, dass die uralte Sorge der Askari sich nun erfüllte? War Lyrions Zauber dabei zu verglühen?
Ein Scharren hinter ihr ließ sie zusammenfahren. Sie wandte sich um und erwiderte den Blick des Kobolds, der wachsam zu ihr heruntersah. Er rührte sich nicht, aber in der zunehmenden Dunkelheit des Hinterhofs glommen seine Augen in schwarzem Licht und ließen seine Krallen glänzen. Instinktiv strich Naya über die Narbe in ihrem Nacken. Sie erinnerte sich gut daran, was diese Klauen anrichten konnten, und kurz peitschten die Worte des Elfs von abgerissenen Armen durch ihre Gedanken. Langsam atmete sie ein und straffte die Schultern. Verdammt, sie war kein kleines Kind mehr! Ohne den Blick abzuwenden, ging sie auf den Kobold zu. Er war etwas größer als die Kobolde der Askari und im Gegensatz zu deren hellem, seidigem Fell stand seines in alle Himmelsrichtungen von seinem Körper ab. Er beobachtete sie unverwandt, und sie fragte sich, ob er tatsächlich wegen der Träume der Menschen in die Oberwelt gekommen war oder aus einem anderen Grund. Vielleicht, so dachte sie plötzlich, hatte er einfach nur wissen wollen, wie sie war – die geheimnisvolle Welt jenseits all dessen, was er kannte.
So vorsichtig wie möglich kniete sie sich hin und schob den schon halb geöffneten Gullydeckel des Hofs beiseite. Ein eigentümliches Ziehen ging durch ihre Brust, als sie in die reglose Finsternis schaute, die sie nur aus Geschichten kannte und die das Geheimnisvolle ebenso erahnen ließ wie die Gefahr, die ihr innewohnte. Der bittere Geschmack kehrte auf ihre Zunge zurück. Mochte dort sein, was wollte – sie würde es nie erfahren. Die Askari hatten recht gehabt. Die Welt der Magie war ihr verschlossen und mit ihr alles, was sie verbarg.
Sie zog sich von der Öffnung zurück und mit jedem Schritt, den sie tat, näherte sich der Kobold dem Boden. Seine Bewegungen waren schattenhaft wie sein ganzer Leib, doch als er absprang und auf dem Asphalt landete, kratzten seine Krallen über den Stein wie trockene Blätter über Gräber. Er schaute Naya an, als würde er sich fragen, was für ein seltsames Wesen das sein mochte, das da mit nassen Haaren im Regen hockte und ihm zur Flucht verhalf.
»Nun geh«, sagte Naya ermutigend. »Dort unten bist du in Sicherheit.«
Doch der Kobold würdigte das Loch im Boden keines Blickes. Stattdessen kam er direkt auf sie zu. Er humpelte leicht und mit jedem Schritt spürte Naya ihr Herz stärker gegen ihre Rippen schlagen.
Steh auf, sagte sie sich selbst. Verflucht, steh auf und lauf weg, bevor der Kerl dir die Beine ausreißt!
Aber sie rührte sich nicht, auch dann nicht, als der Kobold dicht vor ihr stehen blieb. Er war größer, als sie angenommen hatte. Sie bemerkte den Geruch von verbranntem Fell und etwas, das sie an Thymian erinnerte, sie nahm auch das Blut wahr, das wie Anis roch – da schnellte seine Klaue vor und packte sie im Nacken.
Naya keuchte, so kalt waren seine Finger. Kurz hörte sie sich wieder schreien wie in jener Nacht als Kind, als sie von einem Schattenkobold angegriffen worden war, und wie damals konnte sie sich auch jetzt nicht rühren. Die pechschwarzen Augen des Kobolds weiteten sich, und sie sah, wie sich seine Gestalt veränderte. Das Fell zog sich zurück und offenbarte blaue, von Adern durchzogene Haut, sein Gesicht bedeckte sich mit glänzenden Schuppen, seine Nase wuchs in die Breite, und dann begann sein Bild zu flackern, als durchliefe er in rasender Geschwindigkeit tausend Erscheinungsformen. Naya schwindelte. Sie sah, wie hinter all diesen Gestalten messerscharfe Zähne aus seinem Mund wuchsen, sie konnte das Blut schmecken, das an seinen Lippen klebte, rotes, warmes Menschenblut, und da legte sich die Furcht eiskalt um ihre Kehle. Doch gerade in dem Moment, da sie ihr die Luft nahm, hörte sie eine Stimme, tief und dunkel wie der Klang einer sehr großen Glocke.
Deine Augen können mich nicht sehen.
Naya wusste nicht, ob es die Stimme des Kobolds war oder vielleicht ihr eigener Gedanke, das Bruchstück eines Traums möglicherweise oder die Erinnerung an etwas, das sie gehört oder gelesen hatte. Aber sie fühlte, wie sich der Griff um ihre Kehle lockerte, und schaute atemlos in die schwarzen Koboldaugen, die auf einmal wie zwei Spiegel waren, während seine Gestalt sich in die eines jungen Mädchens mit silberblondem Haar und braunen Augen verwandelte, die sich hinter einer Brille verbargen. Staunend sah Naya sich selbst ins Gesicht und sie fühlte die Worte auf ihrer Zunge wie eine Antwort: Sie sehen, was sie sehen wollen.
Ihr Lächeln zog auch über das Gesicht ihres Spiegelbilds, als es in die ursprüngliche Gestalt des Kobolds zurückkehrte. Seine Augen jedoch waren nicht länger schwarz wie zuvor. Mit einem Wimpernschlag hob sich die Dunkelheit vor ihnen, und da erinnerten sie an geborstene Edelsteine und brachen das Licht all jener Erscheinungen in sich, in die der Kobold sich verwandelt hatte. Nie zuvor, das wusste Naya, hatte sie solche Augen gesehen. Sie hatten nie die Sonne wahrgenommen oder die Ozeane der Menschen, aber sie bargen die Glut der Purpurwüste, die tief in den Eingeweiden der Erde lag, und das klirrende Schattenspiel im Wald des Frosts. Sie wussten nichts vom Mond oder den Sternen, doch sie fächerten die Farben der Brennenden Städte auf, die in den mächtigen Höhlen der Unterwelt thronten, und bannten die blutigen Flüche der Knochenmoore in filigrane Verästelungen. Sie mochten erblinden in der Welt des Lichts, aber sie glühten im Schein der Dunkelheit und erzählten von einer Schönheit, die nur in den Schatten erblühen konnte. Diese Augen trugen jedes Rätsel und jede Grausamkeit der Finsternis in sich, denn sie kannten eine Welt, die für Naya mehr Legende war als Wirklichkeit, eine Welt, die tödliche Gefahr bedeutete und haltlose Sehnsucht, untrennbar ineinander verschlungen, und die Kreaturen in sich barg, die keine Finsternis fürchteten, weil sie die schwärzeste Dunkelheit in sich selbst trugen – einen Splitter der Welt, die sie umgab. Hingegeben erwiderte Naya den Blick des Kobolds und lächelte. Die Augen dieses Wesens hatten Rascadon gesehen – das Reich der Elfen der Nacht.
Naya wusste nicht, wie lange sie die Farben des Kobolds auf ihrer Haut gespürt hatte, ehe er seine Hand zurückzog. Langsam tat er das, und im selben Moment, da sich der Schleier wieder über seine Augen legte und sie schwarz färbte, fühlte Naya etwas Kühles in ihrer Hand. Erstaunt öffnete sie die Faust und fand einen Kristall darin, glühend wie die Augen des Kobolds, von unzähligen Farben durchsetzt.
»Ein Geschenk?«, flüsterte sie, als der Kobold leicht den Kopf neigte. »Aber das ist zu kostbar!«
Doch er lächelte nur. Nemeria, flüsterte er in ihren Gedanken mit einer Stimme, die vielleicht wie eine Glocke klang oder wie der Regen auf den Straßen der Menschen. Danke.
Noch einmal glomm etwas in seinen Augen auf wie die Erinnerung an unzählige Farben. Dann drang ein Geräusch in den Hof, das Schreien eines Kindes auf der Straße, das Naya erschrocken den Blick wenden ließ. Der Laut erschien ihr wie der Klang einer fremden und feindlichen Welt.
Als sie sich wieder umdrehte, war der Kobold verschwunden.
2
Naya erreichte das Antiquariat im letzten Augenblick. Mit gequältem Seufzen gab der Boden des Kartons nach. Hektisch riss sie die Tür auf, stolperte ins Innere und landete mitsamt Karton der Länge nach vor dem Tresen.
»Sollte das ein Kunststück werden?« Eine feine, spöttische Stimme ließ sie aufsehen. Vor ihr in der Luft schwebte eine Fee von der Größe einer Faust. Sie hatte silbrige Flügel und blaue Haare, die sich in zwei kunstvollen Zöpfen auf ihrem Kopf türmten. Ihr ebenfalls blaues Kleid schmiegte sich über ihrer gestreiften Strumpfhose an ihren zarten Körper. Selbst ihre Haut schimmerte bläulich. Ihre Augen jedoch waren golden und zwinkerten vergnügt zu Naya herab. »Vielleicht solltest du mit etwas Leichterem anfangen. Einer Rolle rückwärts zum Beispiel.«
Naya rappelte sich auf. »Was würde ich bloß tun, wenn Scherzkeks Rosa nicht da wäre, um sich über mich lustig zu machen?«
Die Fee zuckte mit den Schultern. »Dann wäre dein Leben furchtbar langweilig und du müsstest dir ein Hobby suchen, wie es gewöhnliche Menschen tun. Schwimmen zum Beispiel. Nass genug bist du ja schon.« Sie seufzte tief, als sie auf den durchnässten Karton schaute. »Meint dein Vater nicht, dass wir inzwischen genug Bücher haben?«
»Man kann nie genug Bücher haben«, stellte Naya fest. »Und du weißt ja: Er ist ein leidenschaftlicher Sammler.«
In der Tat hatte die Sammelwut ihres Vaters inzwischen nicht nur dazu geführt, dass ihre gesamte Wohnung mit seltsamen Gegenständen zugestellt war. Auch das Antiquariat barg allerlei Skurrilitäten. Dennoch oder vielleicht gerade deswegen liebte Naya diesen Ort. Verwinkelte Gänge, die sich labyrinthartig verzweigten, Regale mit uralten Büchern, die bis zur Decke reichten, und überall rätselhafte Dinge, von denen jedes einzelne das Tor in eine andere Welt hätte sein können.
»Gerade ist er in Ägypten«, sagte sie, während sie ihre nasse Jacke auf den Tresen legte und sich die Haare mit einem Handtuch trocknete. »Gestern am Telefon erzählte er mir ganz aufgeregt von den Grimoires, die er da kaufen will.« Sie lachte, als Rosa die Augen verdrehte, und sah ihren Vater vor sich, mit verschwörerischer Miene in irgendeinem Hinterzimmer, das langsam ergrauende Haar nach allen Seiten abstehend und mit einem zwielichtigen Wesen verhandelnd, das nicht unbedingt menschlich sein musste. Er hatte geplant, nicht länger als ein paar Wochen fort zu sein, aber Naya wusste, dass Verhandlungen dieser Art sich hinziehen konnten. Gut möglich, dass er die gesamten Ferien über weg sein würde. Sie hatte sich auf die sturmfreie Bude gefreut, aber nun, da sie hundemüde und durchnässt in seinem Laden stand, fehlte er ihr sehr. Die gemeinsamen Abende auf dem Sofa, seine Geschichten über die mysteriösen Dinge, die er aufgespürt hatte, sein Lachen, wenn sie ihn mit seiner Sammelwut aufzog – selbst die Empörung in seinem Blick, wenn er das schmutzbesudelte Buch gesehen hätte, das Rosa gerade mit spitzen Fingern aus dem Karton holte.
»Was ist denn hier passiert?«, fragte die Fee mit einem Gesicht, als hätte sie ein totes Kaninchen entdeckt. »Hast du damit die Straße gefegt?«
Naya putzte ihre Brille. »So ungefähr. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit drei Askari.«
Rosa riss die Augen auf, als Naya ihr von ihrer Begegnung mit den Elfen und der Fluchthilfe für den Kobold erzählte. »Manchmal hast du mehr Glück als Verstand«, stellte sie fest. »Wärest du eine Elfe, hätte dir der Gang auf die Straße jenseits der erlaubten Uhrzeit mindestens einen Tag Arrest eingebracht. Abgesehen davon sind Kobolde tückische und boshafte Geschöpfe, umso mehr, wenn sie aus der Unterwelt kommen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede – und du auch.«
»Dieser war irgendwie anders«, entgegnete Naya und legte den Stein, den der Kobold ihr gegeben hatte, auf den Tresen. »Das hier hat er mir geschenkt. Er hat mir sein wahres Gesicht gezeigt und es war … faszinierend.«
Rosa warf ihr einen abschätzigen Blick zu, schaute dann aber neugierig auf den Stein. Ihre Augen weiteten sich. »Ein Koboldopal«, flüsterte sie. »Diese Kristalle sind ausgesprochen selten. Sie bergen schwarze Magie und zerschneiden alles, selbst Elfenstahl.« Sie ließ die Farben über ihr Gesicht flackern, ehe sie berechnend den Mund verzog. »Der müsste auf dem Feenmarkt einiges einbringen, so viel ist sicher. Ich könnte ihn gewinnbringend für dich verkaufen.«
Naya lächelte. Rosa konnte so schnell von purer Emotion zu kühlem Verstand wechseln, dass ihr mitunter schwindlig davon wurde. »Er ist ein Geschenk«, erwiderte sie. »Und er erinnert mich daran, dass gerade drei ziemlich aufgebrachte Askari im Washington Square Park stehen, weil sie begriffen haben, dass ein Halbblut sie für dumm verkauft hat.« Sie lachte, ehe sie wieder ernst wurde. »Wobei ein neuer Riss in der Grenze gar nicht so unwahrscheinlich gewesen wäre, wenn man bedenkt, wie stark sie sich in letzter Zeit wandelt. Ob sie wirklich kurz vor dem Einsturz steht?«
Rosa zuckte mit den Schultern. »Es ist ja eine Eigenschaft von so mächtiger Magie, ihren eigenen Kopf zu haben und sich in ständiger Wandlung zu befinden. Aber du hast recht. In letzter Zeit scheint die Kraft der Grenze stärker zu schwanken als je zuvor. Ich habe wegen der Fluktuation jedenfalls seit Tagen Kopfschmerzen und die Askari patrouillieren mit einer Ausdauer wie schon lange nicht mehr. Letzte Nacht habe ich drei Elfen in die Kellergewölbe gelassen, die die Sperrstunde verpasst hatten, und seitdem neues Feensilber geschmolzen. Ich glaube, wir sollten immer genug dahaben in nächster Zeit.«
Sie deutete auf die metallenen Töpfe, die sie an der Decke angebracht hatte, und Naya nickte. Die Gewölbe unter dem Antiquariat waren durch lange Gänge mit der Kanalisation unterhalb Manhattans verbunden und führten damit direkt unter das Herz Valdurins. Über dieses Tunnelsystem hatte schon ihre Mutter verfolgten Elfen zur Flucht verholfen und inzwischen hatten Naya und Rosa diese Aufgabe übernommen. Es gab für sie nicht viele Methoden, um das vor den Askari geheim zu halten, doch das Silber der Feen hatte ihnen schon oft gute Dienste geleistet.
»Ach du meine Güte«, murmelte Rosa und zog ein ledernes Buch aus dem Karton. »Ein Hexenhammer aus der Unterwelt. Dein Vater hat wirklich ein Auge für besondere Bücher.«
Naya betrachtete die verschlungenen Worte auf dem Einband. Unzählige Male hatte sie Zeichen wie diese auf den Büchern ihres Vaters gesehen, fremdartige Gestalten einer anderen Welt. Sie ließ den Blick über all die magischen Manuskripte in den Regalen schweifen. Bücher des Lichts, Bücher der Dunkelheit, Bücher voller Geheimnisse, die man nur lesen konnte, wenn man Magie beherrschte – und die damit für sie selbst unerreichbar waren. »Ich bin umgeben von Dingen, die ich nicht verstehe«, sagte sie leise. »Und von Rätseln, die ich niemals lösen werde.«
»Nimmst du dir etwa das Gequassel dieser Elfen zu Herzen?«, fragte Rosa beinahe streng. »Du weißt doch, dass nur Unsinn aus ihren Mündern kommt, von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen. Das liegt an dem Stock, den sie verschluckt haben, da gehe ich jede Wette ein. Muss doch unbequem sein, ständig so ein Ding mit sich herumzutragen.«
»Aber sie hatten recht«, gab Naya zurück. »Manchmal würde ich gern wie die anderen in der Schule einfach nichts von der Welt ahnen, die sich vor mir verbirgt – oder einen Blick hineinwerfen können, und sei es auch nur für einen Moment. Ich bin ein Mensch, aber nicht nur. Ich bin eine Elfe, aber nicht genug. Irgendwie bin ich gar nichts und dabei fast genauso blind wie die Menschen.«
Rosa verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich kenne keinen Menschen, der schon im Alter von sechs Jahren mit einer Fee befreundet war.«
Naya musste lächeln. Sie erinnerte sich noch genau an den Moment, als sie Rosa zum ersten Mal begegnet war. Kurz nach dem Tod ihrer Mutter war das gewesen, Naya hatte zusammengerollt in einer Ecke hinter zwei Regalen gelegen, ein Geheimplatz von ihrer Mutter und ihr, den nur sie beide kannten, und lautlos geweint. Sie hatte ihre Mutter so sehr vermisst, dass sie geglaubt hatte, im Inneren auseinanderzureißen, und gerade, als sie die Nägel so fest in ihre Handfläche getrieben hatte, dass Blut kam, war Rosa aufgetaucht. Sie hatte sich auf Nayas Hand gesetzt und glitzernden Feenstaub auf ihre Wunde gestreut und Naya hatte vor lauter Staunen aufgehört zu weinen. Zum ersten Mal hatte sie in die Augen des guten Geistes gesehen, der seit ihrer Geburt im Antiquariat ihrer Eltern lebte und dessen Anwesenheit sie immer schon erahnt hatte. Nun hatte er beschlossen, sich ihr zu offenbaren, gerade in dem Moment, da niemand sonst sie hätte trösten können als ein Geschöpf aus der Welt der Magie. In diesem Augenblick hatten sie einander ein wortloses Versprechen gegeben und sie hielten es beide, bis zum heutigen Tag.
»Das ist etwas anderes«, sagte Naya. »Ich habe dich nicht erkannt. Du hast dich mir gezeigt. Und dieser Schritt hat dich deine Welt gekostet.«
Erst viel später hatte Naya erfahren, dass Feen nur unerkannt als eine Art Hausgeist in menschlicher Nähe leben durften, keinesfalls aber als Familienmitglied. In dem Moment, da Rosa sich ihr zeigte, hatte sie Ophemia, das Reich der Kobolde und Feen, das sich zwischen der Elfenwelt und der Welt der Menschen verbarg, für immer verlassen müssen und war damit sichtbar geworden für das Reich jenseits der Magie.
Ein sanfter Schimmer ging durch Rosas Blick, als sie den Kopf neigte. »Ich würde eher sagen: Ich habe eine Welt gewonnen. Sicher, es kann ganz schön nervtötend sein, sich ständig vor den Menschen zu verbergen. Aber seien wir ehrlich: Es ist nicht allzu schwierig, denn sie sind furchtbar langsam im Kapieren. Und hier habe ich alles, was ich will: jede Menge Bücher von einem liebenswerten und verrückten Weltenbummler. Die Freiheit, die Askari mit meinem Silber zu ärgern, wann immer mir der Sinn danach steht. Und dann natürlich das Wichtigste.« Sie wartete, bis Naya sie fragend ansah, und lächelte dann. »Nirgendwo sonst gibt es dich, Naya. Halb Mensch, halb Elfe – und das Beste von beidem.«
Naya konnte das Lachen ihrer Mutter hören, die das immer zu ihr gesagt hatte, und ein warmes, samtenes Gefühl vertrieb die Kälte in ihr. »Wir sind nur so gut wie der Geist, der uns beschützt«, erwiderte sie wie damals, und ein verräterischer Glanz trat in Rosas Augen und ließ sie zwinkern, als wäre ein Staubkorn hineingeraten.
»Kümmern wir uns um die armen Flutopfer«, sagte die Fee schnell und zog ein weiteres Buch aus dem Karton. »Wer weiß, wie die Nässe ihrer Magie zusetzt.«
Sie beförderte eine Wäscheleine unter dem Tresen zutage, und Naya griff nach der Holzleiter, mit der sie die Haken unter der Decke erreichen konnte. »Du hast recht«, stellte sie fest und gähnte. »Wir sollten sie zum Trocknen aufhängen, bevor ich mich auf dem Boden zusammenrolle und einschlafe.«
Rosa beobachtete mit Argusaugen, wie sie auf die Leiter stieg. »Hast du schon wieder schlecht geschlafen? Langsam glaube ich nicht mehr, dass das am Vollmond liegt. Vielleicht macht sich jemand an deinen Träumen zu schaffen.«
Die Sprossen knarzten unter Nayas Füßen. »Die Kobolde der Askari versuchen schon lange nicht mehr, meine Träume zu stehlen«, erwiderte sie. »Du weißt doch, ich fühle ihre Anwesenheit wie ein Kitzeln in der Nase. Ein paarmal habe ich sie so heftig erschreckt, dass sie rücklings vom Balkon gefallen sind.« Sie lachte, aber Rosa blieb ernst.
»Vielleicht hat sich einer der faszinierenden Schattenkobolde an deinen Träumen vergangen. Sie beherrschen andere Bannzauber als die Kobolde der Askari, gut möglich, dass deine natürliche Abwehr bei ihnen nicht greift.«
Naya stöhnte. »Na großartig. Und was soll ich jetzt tun? Einen Askari neben mein Bett setzen, damit mir nichts passiert?«
»Papperlapapp.« Rosa verschwand hinter einer Buchreihe und kam kurz darauf mit einer Phiole wieder zum Vorschein. Rötlicher Nebel drückte sich von innen gegen das Glas. »Wie du weißt, hat mein Volk schon einige Kämpfe gegen die Kobolde ausgefochten, und ich bin wie immer gern bereit, mein Wissen schwesterlich mit dir zu teilen.« Sie schwirrte so schnell vor Nayas Gesicht, dass diese zurückwich. Sie hatte die Haken unter der Decke fast erreicht und die Kombination aus Höhe und Müdigkeit ließ sie schwindeln. »Sei bloß vorsichtig«, sagte Rosa besorgt. »Dein Vater bringt mich um, wenn du dir in meiner Obhut die Beine brichst.« Ehe Naya etwas erwidern konnte, hielt sie ihr die Phiole entgegen. »Feenzauber stehen in dem Ruf, tückisch zu sein. Aber dieser hier ist für dich ungefährlich und sehr nützlich, wenn es um lästige Kobolde geht. Damit kannst du dich zur Wehr setzen und den Traumdieb stellen. Die Formel steht auf dem Korken, sprich sie vor dem Zubettgehen und sieh, was passiert.«
Naya steckte die Phiole in ihre Tasche und knüpfte eine Schlaufe in die Wäscheleine. »Wahrscheinlich verkohle ich dem Kobold die Haare und er versinkt vor Scham im Erdboden, weil er plötzlich nackt vor mir steht. Auch eine Methode, ihn wieder dorthin zu bringen, wohin er gehört.«
Rosa kicherte. »Alternativ könntest du natürlich auch deine Idee mit dem Askari neben deinem Bett umsetzen. Ich wüsste da auch schon einen, der garantiert nichts dagegen hätte.«
Kaum hatte sie mit vielsagendem Blick geendet, öffnete sich die Tür. Ein silberner Schemen tauchte in Nayas Augenwinkel auf. Sie wandte sich halb zurück, doch da schwankte die Leiter zur Seite. Erschrocken griff Naya nach dem Regal, aber nichts als Staub blieb an ihren Fingern haften. Im nächsten Moment verlor sie den Halt und stürzte auf den Boden zu.
3
Schnell wie ein Gedanke stob der silberne Schemen heran und fing sie auf. Sie nahm die Kälte wahr, die sie mit sanftem Griff umfing, die Uniform der Askari an ihrer Wange – und den Duft von Schnee. Erleichtert hob sie den Blick und schaute in das Gesicht eines Elfs. Sein blondes, schulterlanges Haar widersetzte sich störrisch den Versuchen, geglättet zu werden, und umrahmte wie vom Wind zerzaust sein ebenmäßiges Gesicht. Seine Haut war von kühler Blässe wie bei allen Askari, doch seine blauen Augen glühten, als hätte man sie aus einem klaren Winterhimmel herausgeschnitten. Silberne Funken glommen darin wie sonnenbeschienene Schneeflocken und ließen Naya erneut den Duft wahrnehmen, der ihr wie immer ein Lächeln auf die Lippen zauberte.
»Jaron«, sagte sie und kam auf die Beine. »Das nennt man wohl Timing.«
Er lachte. »Das wäre eine schöne erste Begegnung, wenn wir uns nicht schon kennen würden«, sagte er und zwinkerte Rosa zu, die seinen Gruß erwiderte. »Allerdings hättest du eigentlich ein wallendes Kleid tragen müssen, wie es alle holden Damen tun, die sich von einem Ritter das Leben retten lassen.«
Naya hob abschätzig die Brauen. »Hättest du ein Pferd dabeigehabt wie alle echten Ritter, wäre das kein Thema gewesen.«
»Hast du etwa die letzte Begegnung von Sir Jaron Lancelot mit einem Pferd vergessen?«, fragte Rosa spöttisch. »Du weißt es bestimmt noch, und auch ich erinnere mich ziemlich gut daran. Einer von beiden flog in hohem Bogen vom Rücken des anderen und brauchte geschlagene sechs Monate, um sich wieder einem Gaul zu nähern.«
Jaron grinste. »Erstaunlich, dass du dich daran noch erinnerst, so lange, wie das her ist. Ich dachte, Feen sind für ihre Vergesslichkeit bekannt. Das muss an ihren kleinen Schädeln liegen.«
»Es ist nicht höflich, eine Dame an ihr Alter zu erinnern«, stellte Rosa fest. »Ich vergesse nur, was ich vergessen will. Und abgesehen davon: Größe ist nicht alles, mein Lieber. Aber das werden Männer wohl nie begreifen.«
Naya lachte, als Jaron zum Zeichen der Kapitulation die Hände hob. »Ja, die Welt ist voller Rätsel für uns«, gab er zurück. »Zum Beispiel frage ich mich, was ihr mit der Wäscheleine vorhattet. Wolltet ihr eine Falle bauen für aufdringliche Askari?«
»Das wäre auch eine Idee gewesen«, erwiderte Naya. »Vor allem für die, die kein Pferd dabeihaben. Aber ausnahmsweise haben wir einen ganz langweiligen Grund.«
Rosa deutete auf die durchnässten Bücher. »Wir wollen sie zum Trocknen aufhängen. Einmal habe ich ein nasses Buch geföhnt und dabei irgendeinen magischen Mechanismus ausgelöst. Am Ende war das Buch nur noch Asche und mein Gesicht schwarz vom Ruß der Explosion.«
Jaron grinste. »Ich hoffe, es gibt Fotos davon.« Dann verschränkte er die Arme vor der Brust. »Ich weiß ja, dass wir in Zeiten der Emanzipation leben, und das finde ich auch ganz hervorragend. Aber gestattet mir eine Frage: Wieso fragt ihr nicht jemanden, der sich damit auskennt?«
Er bedeutete ihnen, ein Stück zurückzutreten, ballte die linke Hand zur Faust und flüsterte etwas. Dann spreizte er die Finger, und Naya spürte den warmen Luftstrom, der aus seiner Hand in den Raum floss. Flirrend umhüllte er die Bücher, die Seiten flatterten wie in einem lautlosen Sturm, ehe der Zauber sich legte. Neugierig trat Naya an den Tresen und strich über die Bücher. Sie waren trocken. »Beeindruckend«, stellte sie fest und Rosa nickte anerkennend.
»Ist also doch nicht immer ein Pferd nötig«, sagte Jaron und seufzte erleichtert. »Da habe ich ja noch mal Glück gehabt.«
Rosa schwirrte zu dem aufgeweichten Karton und hievte ihn in die Höhe. »Ich werde das hier mal entsorgen. Gibt doch nichts Schlimmeres als nasses Papier in einem Antiquariat.«
Sie grinste Jaron noch einmal an und verschwand dann zwischen den Regalen. Naya deutete auf den Barhocker vor dem Tresen. »Setz dich doch. Was verschafft uns die Ehre deines Besuchs? Ich dachte, du bist derzeit in der Garde eingespannt. Oder hast du etwa geahnt, dass du zwei Damen in Not retten musst, und bist nur deswegen hergekommen?«
Jaron lachte. Er sah eindrucksvoll aus in der Uniform der Garde, wie alle Krieger und Kriegerinnen der Königin, umso mehr, seit er vor einer Weile in den Offiziersrang erhoben worden war und goldene Sterne sein Revers zierten. Und doch erschien er ihr immer ein wenig fremd, bis er wie jetzt den Kragen lockerte und sich durchs Haar fuhr, als würde er so die Kälte ablegen, die den Gardisten anhaftete. »Natürlich wäre ich sofort gekommen, hätte ich von eurer Notlage gewusst. Aber nein – ich wollte dich einfach nur sehen. Heute war ein aufreibender Tag, wieder einmal, und …«
Naya stieß einen Schrei aus, als er sich setzte und dabei den Blick auf seine Hüfte freigab. Ein dunkelroter Fleck lag direkt unter seinem Rippenbogen und schimmerte leicht. »Jaron, du blutest!«, rief sie und lief zu ihm. »Was hast du gemacht?«
»Gar nichts«, gab er zurück, doch Naya ließ sich nicht abwehren. Sie berührte die Uniform und sah den Riss, der das Gewebe durchzog. Darunter klaffte eine tiefe Wunde.
»Das ist ein Hieb wie von einem Messer«, sagte sie erschrocken. »Oder …«
»… von einer Kralle«, beendete Jaron ihren Satz. »Ja, es ist zurzeit viel los. Die Grenze tut, was sie will, und in den letzten Tagen kam einiges aus der Unterwelt nach oben. Meist laufen die Begegnungen glimpflich ab, aber eben nicht immer.«
Naya kramte in einer Kiste hinter dem Tresen herum. »Zieh dein Hemd aus«, sagte sie und verdrehte die Augen, als Jaron mit zweideutigem Lächeln die Brauen hob. »Keine Sorge, ich werde gerade noch an mich halten können, um dir nicht die Klamotten vom Leib zu reißen.«
Jaron grinste, doch er verzog schmerzerfüllt das Gesicht, als er das Hemd auszog. Flüchtig schaute Naya zu ihm hinüber. Sie erinnerte sich daran, wie Jaron ausgesehen hatte, ehe er in die Garde aufgenommen worden war, ein schmaler, fast zarter Junge mit träumerischen blauen Augen und sanftem Lächeln. Inzwischen hatte er gelernt, die eiskalte Maske der Askari über seine Züge zu legen. Er konnte sich schnell und lautlos bewegen, seine Muskeln zeichneten sich unter seiner Haut ab und einzelne Narben zeugten von Konfrontationen mit feindlichen Kreaturen. Noch immer konnte sein Blick sich in Träumen verlieren, und sein Lächeln war zärtlich, wenn er es zuließ, doch sein Körper war der eines Kriegers.
»Ich würde ja langsam auf und ab gehen«, sagte Jaron schelmisch. »Aber du müsstest mich darum bitten.«
Schnell riss Naya ihren Blick fort. »Am besten setzt du dich auf die Kissen«, sagte sie verlegen und deutete auf die bunten Sitzkissen, die auf dem Boden in einer Leseecke lagen. »Wer hat dich verwundet?«
»Ein Vargur«, sagte Jaron beiläufig, während er sich auf den Kissen niederließ.
Erschrocken riss sie die Augen auf. »Ein Wolf der Nacht?«, flüsterte sie. Sie hatte von den Reittieren der Bharassar gelesen, diesen riesenhaften Monstren aus der Unterwelt, schnell wie die Schatten. Nur die Nuro, die katzenhaften Begleiter der Askari, waren ihnen gewachsen.
Jaron zuckte die Schultern. »Er hat mich kaum erwischt, sonst säße ich nicht hier. Er war noch sehr jung, wir konnten ihn ohne weiteres Blutvergießen in die Unterwelt zurücktreiben. Und du weißt doch, dass eine Wunde wie diese einen Elf nicht umbringt. Unsere Selbstheilungskräfte sind enorm, ganz abgesehen von unseren Heilmitteln. Keine Sorge.«
Naya stieß die Luft aus und fand endlich die Salbe, die noch von ihrer Mutter stammte und schon oft bei Verletzungen dieser Art zum Einsatz gekommen war. »Keine Sorge! Du begibst dich in Lebensgefahr und ich soll mir keine Sorgen machen?« Kopfschüttelnd kniete sie sich neben ihn.
»Es gibt Dinge, die man tun muss«, sagte Jaron und zwinkerte wie immer, wenn er das zu ihr sagte. »Wann war denn deine Begegnung mit dem Schattenkobold?«
Die Frage kam so plötzlich, dass Naya zusammenfuhr. Sie schaute zum Tresen, aber Rosa hatte den Opal mitgenommen. »Woher …«, begann sie, doch Jaron lächelte.
Vorsichtig strich er ihr das Haar zurück. Sie hörte, wie er sich an dem Koboldblut verbrannte, das in ihrem Nacken klebte, aber er zeigte keinen Schmerz. Wie Asche fiel es von Naya ab, während seine Finger über ihre Haut strichen. Ein leichtes Kribbeln zog über ihren Rücken. Er war der einzige Askari, mit dem sie gern zusammen war, und ihr bester Freund seit Kindertagen. Aber manchmal, wenn er sie in letzter Zeit auf diese Weise ansah, fing sich das Licht in den Sprenkeln seiner Augen und ließ sie lächeln, ohne dass sie es beabsichtigte. Es war, als würde sich etwas zwischen ihnen verändern … als würde sich der Schleier heben, der sich bisher Freundschaft genannt hatte. Sie hatte kein Wort für das, was da vor sich ging. Aber es verwirrte sie.
»Ich habe ihm zur Flucht verholfen.« Sie begann, die Salbe auf seine Wunde aufzutragen, zum einen, um ihre Unsicherheit zu verbergen, zum anderen, weil sie genau wusste, wie er sie jetzt ansah. In knappen Worten erzählte sie ihm von ihrem Zusammentreffen mit den Askari und dem Kobold.
»Ich erinnere mich an Zeiten, da du dich vor diesen Kreaturen zu Tode gefürchtet hast«, sagte er und zog seine Hand zurück. Seine Stimme war ganz ruhig, aber sie spürte den sorgenvollen Blick auf sich.
»Ich konnte nicht zulassen, dass diese dämlichen Rekruten ihre Kräfte an ihm probieren«, erwiderte sie. »Das sind echte Arschlöcher.«
Jaron schwieg für einen Moment. »Viele von ihnen, ja«, sagte er dann. »Aber sie beschützen unsere Welt – auch dich. Und was den Kobold angeht … sei froh, dass er seine Kräfte nicht an dir probiert hat. Es steckt mehr in ihnen, als man denkt.«
Naya erinnerte sich gut an die tausend unheimlichen Gesichter des Kobolds, und sie sah auch die Klauen und Zähne vor sich, so deutlich, dass die Narbe in ihrem Nacken zu brennen begann. Aber gleichzeitig fühlte sie die Lichter aus seinen Augen auf ihrer Haut, und für einen Moment war sie versucht, Jaron von dem Opal zu erzählen und von den Farben, die sie im Blick des Kobolds gesehen hatte. Doch sie wusste, dass er ihre Faszination niemals nachempfinden würde, ganz gleich, wie eindringlich sie sie beschreiben würde. Manche Dinge, das hatte sie selbst erfahren, musste man erleben, um sie zu begreifen.
»Du solltest dich von den Kreaturen der Schatten fernhalten«, fuhr Jaron fort. »Es gibt Gefährlicheres da unten als Kobolde und die Vargur sind nur ein Teil davon.«
»Du meinst die gefährlichen Elfen der Dunkelheit?«, fragte sie und lächelte ein wenig. »Die Monster, die jedes Kind der Askari erzittern lassen?«
»Ja«, sagte er leise. »Die Bharassar sind in der Tat Bestien, Geister der Schatten, die im Blut ihrer Feinde baden und ihre Klingen in verfluchtem Feuer schärfen. Sie wissen nicht, was Ehre ist oder Gnade. Sie kennen nur den Zorn und das Ziel, das sie vereint: den Tod der Askari und die Vernichtung der Welt. Ihr Blut ist schwarz wie eine Nacht ohne Sterne und ebenso finster ist ihr Herz. Es gibt kein größeres Übel als sie. Nicht grundlos sind unzählige Krieger des Lichts im Kampf gegen sie gefallen.«
Seine Augen waren schmal geworden und Naya erkannte den Schmerz darin. Sie wusste, dass er an seinen Vater Caratorn dachte, den stolzen Heerführer der Askari, der vor einigen Jahren von den Bharassar erschlagen worden war. Er hatte sein Leben der Wahrung des Friedens gewidmet, und Naya zweifelte nicht daran, dass Jaron vor allem aus diesem Grund den Weg des Offiziers gewählt hatte: um in seine Fußstapfen zu treten und sein Erbe zu bewahren. Jaron sprach selten über seinen Verlust, aber Naya kannte die Erschütterung, die der Tod seines Vaters in ihm ausgelöst hatte, und nickte entschuldigend. »Ich weiß«, sagte sie sanft. »Ich denke nur manchmal, dass genug Blut geflossen ist in diesem Krieg. Du magst dich nicht um dich selbst sorgen … aber ich schon.«
Sein Lächeln vertrieb die Traurigkeit von seinen Zügen. »Eines Tages wird der Krieg vorbei sein, daran zweifle ich nicht.«
Naya betrachtete ihn prüfend. »Aber nicht so bald, habe ich recht? Die Askari sprachen vorhin von Lyrions Wall, als würden die Schwankungen der Grenze mehr sein als die üblichen Fluktuationen. Es klang, als stünde der Einsturz der Grenze bevor. Ist das wahr?«
Jaron zögerte, dann nickte er. »Nur die Krieger der Garde wissen bisher Bescheid, um Panik zu vermeiden. Doch es stimmt: Lyrions Macht erlischt und nur sein verschollener Erbe kann die Grenze erneuern und den Frieden bewahren. Seit Monaten sucht die Garde mit aller Kraft nach ihm, bislang ohne Erfolg. Und langsam wird die Zeit knapp.«
Naya kannte die Geschichte um den Erben Lyrions, diesen sagenhaften Helden, der als Einziger das Feuer der Grenze ertragen konnte, während alle anderen darin verbrannten. In unzähligen Liedern wurde besungen, wie Lyrion kurz vor seinem Tod seine Macht an seinen engsten Vertrauten weitergab, der sie seinerseits vererbte. Lange wurden die Träger dieser Macht von den besten Kriegern der Askari im Geheimen beschützt, doch eines Tages gelang es den Bharassar durch Folter, ihnen auf die Spur zu kommen, und sie töteten die Erben beinahe. Daraufhin beschlossen die Askari, deren Spur nicht länger zu verfolgen und sich stattdessen auf das Wort ihres Ahnen zu verlassen: Sollte der Wall brechen, würde er kommen – der Träger der Macht, die den Frieden erneuern konnte.
»Sicher werdet ihr ihn bald finden«, sagte Naya ermutigend. »Vielleicht bist du es und weißt es nur noch nicht.«
»Hoffentlich bekomme ich ein Pferd, wenn ich es herausfinde«, erwiderte Jaron und grinste.
Naya legte die Salbe beiseite. »Eine weitere Tapferkeitsnarbe in deiner Sammlung hast du jedenfalls. Lass es kurz einziehen, dann wird es schnell heilen.«
Jaron lehnte sich zurück und schloss die Augen. Naya wusste, dass die Salbe ihrer Mutter müde machte, sie hatte es selbst erlebt, als sie sich einmal an einem schwarzmagischen Buch geschnitten und sie verwendet hatte. Seufzend legte sie sich neben ihn und betrachtete sein Gesicht von der Seite. Sie erinnerte sich noch genau daran, wie sie früher, als sie noch klein gewesen waren, gemeinsam auf diesen Kissen gesessen und in uralten Folianten geblättert hatten. Damals war ihre Leidenschaft für Bücher entfacht worden, die bis heute anhielt. Sie würde nie vergessen, wie sie zum ersten Mal den Zauber gespürt hatte, der sie ohne jede Gewalt in fremde Welten entführt hatte. Welten voller Magie und Abenteuer waren das gewesen, die ihr noch heute eine Zuflucht boten, und sie vernahm wieder die fremdländische Musik, die durch die Luft geklungen war, fühlte die Wärme der Kerzen und hörte Jaron in der Sprache seines Volkes aus den Büchern des Lichts vorlesen. Lange war das her, und nun lag er neben ihr, so erhaben und makellos, dass er ihr fast unwirklich erschien. Er sah aus wie eine Statue mit seiner bleichen Haut, und plötzlich musste sie an den Barberinischen Faun denken, der sich vollkommen nackt auf einem steinernen Sockel räkelte. Sie lachte, als sie sich vorstellte, was die Mädchen aus der Schule zu diesem Anblick sagen würden, wenn sie gerade in diesem Moment zur Tür hereinkämen. Erstaunt öffnete Jaron die Augen und seufzte, als Naya ihm von diesem Gedanken erzählte.
»Es würde mich umbringen, wenn ich auf eine menschliche Schule gehen müsste«, stellte er fest.
Naya grinste. »Warum? Wegen der Mädchen, die sich um dich reißen würden?«
Jaron schaute an die Decke, als würde er dort etwas erkennen, das Naya verborgen blieb. »Nein«, erwiderte er ernst. »Sie würden mich nicht sehen. Nicht wirklich.«
»Ich sehe dich auch nicht«, sagte Naya leise. Sie spürte Jarons Blick auf sich, aber sie schaute ihn nicht an. Allzu oft vergaß sie, dass sie durch die Macht der Elfenwelt voneinander getrennt waren, die die Magie vor ihrem Blick verbarg, und wieder musste sie an die Worte der Askari denken, die sie voller Verächtlichkeit betrachtet hatten.
»Doch«, sagte Jaron da und zwang sie durch die Sanftheit in seiner Stimme, ihn anzusehen. »Manchmal scheint es mir, als wärest du die Einzige, die wirklich hinsieht.«
Der Ernst in seinen Augen war ungewohnt, und doch fühlte Naya auf einmal wieder die Nähe, die sie in letzter Zeit so häufig empfand. Fast meinte sie, die Schneeflocken aus seinen Augen auf ihrer Haut spüren zu können, und sein Lächeln war so zärtlich wie ein Windhauch in ihrem Haar.
»Kein Wunder«, sagte sie und brachte ein Lächeln zustande. »Bei den Lupengläsern!«
Jaron lachte, als er ihr behutsam die Brille abnahm und über sich in die Luft hielt. Naya rutschte näher an ihn heran, sie konnte sein Haar an ihrer Wange fühlen, und da fing er die Lichtreflexe der Straßenlaternen auf, die durch das Fenster fielen, und warf sie gegen die Buchrücken und die Kristalle, die seit Ewigkeiten vor der Scheibe hingen. Mit leisem Flüstern ließ er sie zerspringen, sodass sie wie winzige Elmsfeuer durch den Raum schwirrten, und sein Atem streifte Nayas Lippen, als er flüsterte: »Zaubergläser.«
Das hatte er ihr damals gesagt, als sie im Kindergarten wegen ihrer Brille geärgert worden war, und sie damit zum Lächeln gebracht, genau wie jetzt. Das Antiquariat war ihr gemeinsamer Spielplatz gewesen, immer schon, eingerichtet von ihren Eltern, die ihren Platz zwischen den Welten gesucht hatten. Sie folgte den Lichtpunkten mit den Augen. Wie oft hatte ihre Mutter mit demselben sehnsüchtigen Blick hinauf zu den Gebäuden Valdurins geschaut, mit dem Naya jetzt diese Farben betrachtete, wie hart musste sie die Verbannung getroffen haben, die die Königin der Askari auf sie gelegt hatte, weil sie einen Menschen geliebt hatte. Naya spürte kaum, wie sie die Augen schloss, doch sie fühlte den Wind, der ihr ins Gesicht fuhr, und sah sich selbst inmitten des Waldes, der einst hell und strahlend gewesen war und nun, an diesem trüben Novembertag vor so vielen Jahren, alle Farbe verloren hatte. Sie sah ihren Vater vor sich, die Urne mit der Asche ihrer Mutter in den Händen, wusste, dass Jarons Mutter hinter ihr stand, die einzige Freundin, die ihrer Mutter unter den Askari geblieben war. Der Wind war Naya einst vertraut gewesen, doch nun klang er so fern, als würde sie nur wissen, dass er sie berührte, und es nicht fühlen. Ihre Mutter hatte diesen Wald geliebt. Sie hatte ihn Thar’ Othan genannt, den Wald der Sonne. Aber das war ein anderer Wald gewesen, der niemals wiederkehren würde. Sie sah zu, wie ihr Vater die Asche zwischen den Bäumen verteilte, haltlos war die Verzweiflung in ihr und unabänderlich, und als der Wind in den Kronen heulte, glaubte Naya, dass er sie mit sich fortreißen würde wie ein hilfloses Blatt im Sturm. Doch da schloss sich eine Hand um die ihre und hielt sie fest, und als sie den Blick wandte, sah Jaron sie an und legte sein Lächeln wie einen schützenden Mantel um ihre Schultern. Sie hatte ihn nicht kommen hören, und doch war er da, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt, als ihre Hand zu halten und an ihrer Seite zu sein in einem fremden, eiskalten Wind.
Naya öffnete die Augen und war nicht überrascht, dass Jaron sie ansah. Er war mit ihr in dem Wald gewesen, gerade eben, als hätte sie ihn geträumt. Immer schon war das seine Gabe gewesen. Lautlos sanken die Lichter um sie nieder, und sie wünschte sich, diesen Augenblick einfrieren zu können, sie beide in ihrem Refugium zwischen den Welten, unantastbar von Licht und Dunkelheit. Doch kaum hatte sie das gefühlt, erklang ein Wehklagen, so durchdringend und sehnsuchtsvoll, dass sie schauderte. Und der Moment zerbrach.
Die Sirenen der Askari ließen die Luft flirren, obwohl sie kaum lauter waren als ein tiefes Seufzen. Jaron sagte kein Wort, während er sich anzog. Er half ihr auf die Beine und strich ihr durchs Haar, noch einmal lächelte er, als er sich an der Tür zu ihr umwandte. Dann verließ er sie. Schon auf der Straße kehrte die Maske der Askari auf seine Züge zurück, und Naya wurde mit seltsamer Klarheit bewusst, dass sie erwachsen wurden. Jaron verließ den Raum ihrer Kindheit, denn er gehörte in die Welt des Lichts. Und sie – sie blieb allein zurück.
4
Das Licht der Kerzen flackerte hinter Nayas Lidern. Sie wusste, dass es Schattenspiele über die Wände ihres Zimmers huschen ließ, doch sie sah sie nicht. Mit geschlossenen Augen lag sie im Bett, lauschte auf den Wind in den Zweigen der uralten Eiche vor ihrem Fenster und konzentrierte sich auf ihren Atem. Gelassen war er, als würde sie schlafen, und beinahe glaubte sie der Illusion der Ruhe selbst, die sie geschaffen hatte. Im Inneren jedoch war sie hellwach. Seit Tagen hatte sie sich an diesen Zustand kaum noch erinnern können, so müde war sie gewesen, begleitet von ständigen Kopfschmerzen, nur weil irgendjemand ihre Träume stahl. In dieser Nacht würde das enden.
Noch immer spürte sie die Worte des Feenzaubers auf ihren Lippen, die sie vor dem Zubettgehen gesprochen hatte. Wie kleine Hagelkörner waren sie über ihre Zunge getanzt und hatten den rötlichen Nebel aus der Phiole gerufen. Als leichte Wärme hatte er sich über ihren Körper gezogen und nun lag sie da und wartete auf ihren ungebetenen Besucher. Sollte es tatsächlich ein Kobold der Askari sein, würde Jaron ihn vierteilen, so viel war sicher. Und wenn es ein Schattenkobold war, würde sie das selbst erledigen. Immerhin hatte sie einen von ihnen vor dem Tod bewahrt. Da konnte sie doch wohl ein wenig mehr Respekt erwarten.
Der Lufthauch streifte sie so plötzlich, dass sie beinahe zusammengefahren wäre. Bei stürmischem Wetter kam es oft vor, dass der Wind durch die Balkontür kroch, und auch jetzt konnte Naya ihn flüsternd über die Dielen streichen hören. Aber der Hauch, der gerade ihre Stirn berührt hatte, war sacht gewesen, beinahe zärtlich. Wie ein Atemzug.
Unwillkürlich spannte sie die Muskeln an und musste sich zwingen, weiter ruhig zu atmen. Die Tür zum Balkon klemmte ein wenig und war nicht lautlos zu öffnen, selbst von einem Kobold nicht, aber sie spürte, dass jemand dort draußen war – instinktiv, so wie sie oft durch ein Kribbeln im Nacken merkte, wenn sie jemand heimlich beobachtete. Für gewöhnlich versetzten die Diebe den Träumenden mit einem Bann in Bewusstlosigkeit, sodass sie ungestört ans Werk gehen konnten. Bei den Kobolden des Lichts war Naya selbst aus tiefstem Schlaf aufgeschreckt, so intensiv spürte sie deren Zauber, doch dieses Mal war er kaum mehr als eine Ahnung, die sich wie eine schwarze Feder auf ihre Haut legte und in ihr das Verlangen weckte, sie festzuhalten, ehe ein Windstoß sie fortwehen konnte. Rosas Zauber löste den Bann, doch er nahm die seltsame Nähe nicht mit sich fort. Noch immer strich sie über Nayas Haut, sanft, als würde sie selbst von dunklen Träumen getragen.
Ja, es war Dunkelheit, die in diesem Lufthauch steckte, das stand außer Zweifel. Kein Kobold des Lichts also stahl ihre Träume, sondern tatsächlich ein Dieb der Unterwelt. Etwas wie Enttäuschung flog Naya an, gepaart mit einer nervösen Unruhe, die es ihr schwer machte, sich auf ihren Atem zu konzentrieren. Einem Dieb der Askari hätte sie gern eine Lektion erteilt. Doch die Schattenkobolde hätte sie seit ihren Erlebnissen in dem Hinterhof lieber als Geschöpfe aus tausend Farben in Erinnerung behalten denn als gefährliche Diebe. Kurz sah sie wieder die messerscharfen Krallen vor sich und die Zähne, die bereits Menschenfleisch zerrissen hatten, aber als ihr Herzschlag sich beschleunigte, drängte sie den Gedanken beiseite. Sie war durch Rosas Zauber vor der Macht des Kobolds geschützt, es gab keinen Anlass, sich zu fürchten. Dennoch hätte sie am liebsten die Augen geöffnet und sich umgesehen. Es hatte etwas erschreckend Hilfloses, blind im Dämmerlicht zu liegen und sich nicht rühren zu dürfen.