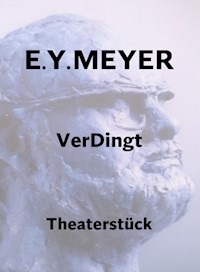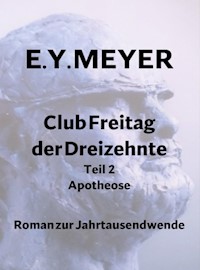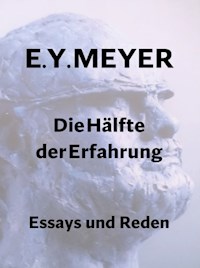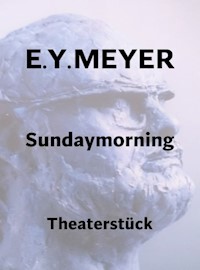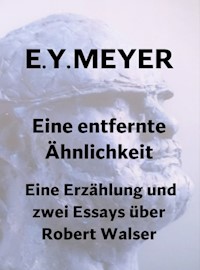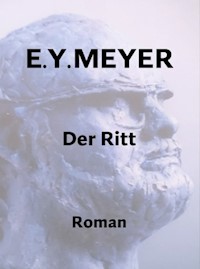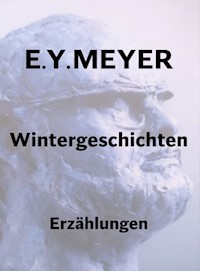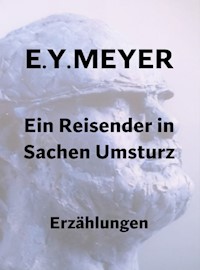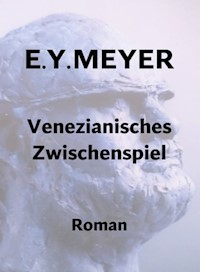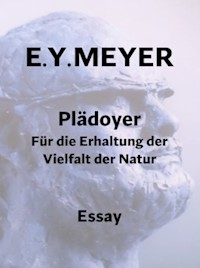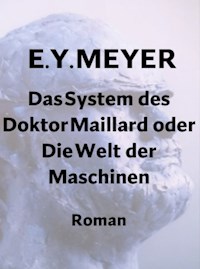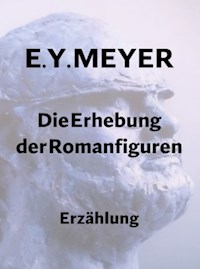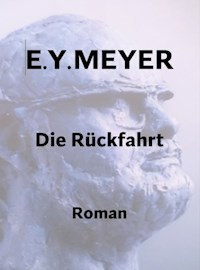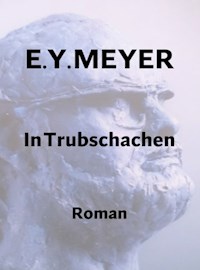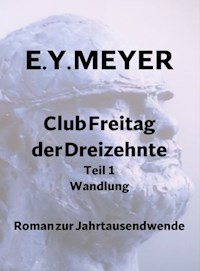
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
E.Y. Meyer, mehrfach preisgekrönter Deutschschweizer Schriftsteller und 2011 Nobelpreiskandidat, erzählt die Geschichte einer stetigen »Wandlung« von der Epoche der europäischen Aufklärung bis in die Gegenwart. Erfahrungen, Nachforschungen und philosophische Reflexionen aus vielen Jahren verarbeitet Meyer in der ihm eigenen und prägnanten Sprache zu einem breit angelegten Fresko. Immer geht es ihm dabei auch um die Schweiz: Ein Club von dreizehn Männern trifft sich an Orten, die mit Wandlungen und mit wichtigen Persönlichkeiten in den letzten paar Jahrhunderten zusammenhängen, zum Beispiel auf der St. Petersinsel im Bielersee, wo Jean-Jacques Rousseau als verfolgter Emigrant lebte, oder auf der Ufenau im Zürichsee, die man mit der Gestalt des Humanisten Ulrich von Hutten verbindet. So entfaltet sich ein mehrstimmiger Reisebericht – ein Bericht von einer Reise durch Raum und Zeit; ein sozial- und geistesgeschichtliches Panorama, verknüpft mit Leben und Denken der dreizehn Clubmitglieder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
E.Y.MEYER
Club Freitagder DreizehnteTeil 1Wandlung
Roman zur Jahrtausendwende
Erstmals erschienen 2012
© 2021 E.Y.MEYER
eymeyer.ch
Cover:
Bronzekopf des Autors
Geschaffen 1997 von PAN YI QUINAcademy of Arts & Design
Tsing Hua UniversityBei Jing, China
El arte es una mentira que nos acerca a la verdad
Pablo Picasso
Obwohl dieser Roman auf realen Ereignissen basiert, sind einige der darin geschilderten Charaktere vom Autor geschaffene Kompositionen oder Erfindungen, und eine Anzahl von Episoden sind fiktiv.
Mit Ausnahme gewisser Figuren und historischer Ereignisse sind die Charaktere, Erlebnisse und Namen der porträtierten Personen fiktiv, und jede Ähnlichkeit mit Namen oder biographischen Daten irgendwelcher Personen ist vollkommen zufällig und unbeabsichtigt.
Das Theater-Hotel Chasa de Capol und dessen Besitzer, E.T.A. und Ramun Schweizer, sind ein realer Ort und zwei real existierende Menschen, die der Autor so wahrhaftig, wie es ihm möglich ist, dargestellt hat.
Ein Treffen des CLUBS FREITAG DES DREIZEHNTEN hat in der Chasa de Capol nie stattgefunden.
Kapitel
PROLOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
EPILOG
DANK
PROLOG
Es war das erste Mal, dass wir noch nur sieben waren. Als Einziger war ich schon am Donnerstag angereist.
Zürich, Walensee, Sarganserland. Tanken und Kaffee auf der Raststätte Heidiland. Landquart, Prättigau, Davos, Flüelapass. Zernez, Nationalpark, Ofenpass.
Der Willkommensdrink im leicht erhöht neben der Dorfstrasse gelegenen kleinen Garten der Villetta Capolina, wo E.T.A. auf mich wartete, war einmal mehr, wie erhofft, ein Veneziano.
Im reich mit Sgraffito-Motiven verzierten mächtigen weissen Haus auf der anderen Strassenseite, dem mehr als fünfhundert Jahre alten einstigen Grafensitz, wartete unter dem Dach, nach dem Aufstieg über die ausgetretenen steilen Holztreppen, die sich durch drei Stockwerke hindurchzogen, wie üblich das Zimmer auf mich, an dessen Tür die wappenförmige schwarze Tafel mit den weissen Frakturbuchstaben hing, die seinen Namen formten:
WALTHER VON DER VOGELWEIDE
Danach befreite ich mich von der Hitze des Unterlandes im fünfzehn Meter langen, seit seinem Bau rund dreissig Jahre vor der Jahrtausendwende wohltuend alt gewordenen, da und dort renovierungsbedürftigen, aber seinen Zweck immer noch zur Genüge erfüllenden Swimmingpool.
Im Wassergeviert am Rand des baumreichen Parks auf der Rückseite des mächtigen Hauses. Auf der Talseite. Mit dem Blick über die grünen Wiesen und Wälder hinweg, hinter denen ringsum die hellgrauen Felswände aufragten. Mit den hoch oben vereinzelt noch auf ihnen liegenden, weiss leuchtenden kleineren oder grösseren Schneefeldern.
Die wilden, unregelmässig emporragenden Zacken, die den Horizont in die Weite des strahlenden Himmelsblau schnitten, das sich über ihnen ins Unendliche wölbte.
Das Abendessen danach im vergehenden Licht der sich auf den Ofenpass hinuntersenkenden Sonne. Am Fuss der hoch aufragenden vierstämmigen Erlengruppe oberhalb des Swimmingpools. Mit dem Rücken zu der dem mächtigen Haus angebauten Kapelle und dem sich über ihr erhebenden ehemaligen Hospizteil. Am Erlkönig-Tisch.
Rhätische Urküche. Die von Ramun, der das Haus inzwischen führte, ohne Elektrizität, nur auf Holz- und Gasfeuer zubereitete, aus vier Gängen bestehende Proposta dad hoz.
Die Empfehlung des Gastgebers.
Die Pièce de résistance: ein Lammkarree mit Thymiankruste, Safranrisotto und Gemüse aus dem eigenen Garten.
AD RECEPTIONEM PAUPERUM SEU AD CONSOLATIONEM OMNIUM ALPES TRANSEUNTIUM.
Zur Aufnahme der Armen oder zum Trost aller die Alpen Überschreitenden.
Die Devise, unter der einst der Fürstbischof von Chur den Hospizbetrieb veranlasst hatte.
Nach dem Eindunkeln des Himmels, dem Verdrängen des hinter den Bergen hervordringenden letzten Scheins der untergegangenen Weltlichtquelle und dem Sichtbarwerden der ersten Sterne wieder ins Haus zurückgekehrt, in den schwarzen Ledersesseln vor dem Kaminfeuer im weiten Aufenthaltsraum, der das Eckgebiet der Marco-Polo-Bar miteinschloss, dann die Gespräche mit E.T.A. und seinem Sohn sowie vier weiteren Hausgästen.
Zwei Rentnerpaare, die gemeinsam in einem Kleinbus reisten. Der eine Mann ein weltweit tätig gewesener Ingenieur. Der zweite ein ehemaliger Besitzer einer Bodenbelagsfirma. Bei Wein, Bier und einigen Gläschen Arvengeist.
Die andern trafen am Freitag ein. Am späten Vormittag oder frühen Nachmittag. Fuchs und Gilomen mit dem Postauto. Frank, Gerd, Vinzenz und Quirin mit ihren Privatautos.
Freitag, der Dreizehnte. Es war unser fünfundzwanzigstes Treffen.
1
Das erste Treffen hatte fünfzehn Jahre zuvor stattgefunden. Zwei Monate später im Jahr. Am Freitag, dem 13. August 1993.
Nicht zufällig in einer anderen Landesgegend. Nicht in den Bergen. Nicht in den Alpen. Sondern in flacheren Gefilden.
An einem Ort, der mir seit meiner Jugend vertraut war. Den ich damals oft und auch später immer wieder aufgesucht hatte.
Es war eine Insel auf einer Insel sozusagen.
Die St. Petersinsel im Bielersee. Im Schweizer Seeland. Dem Land der drei Seen am Südfuss des Schweizer Juras. Auch bekannt als Rousseau-Insel.
Ein Ort, der gleichzeitig seine natürliche Schönheit bewahrt und eine weiterführende geistesgeschichtliche Bedeutung hatte. Ein geographisch und historisch mit einer besonderen Bedeutung besetzter und im Bewusstsein der Menschheit verankerter Raum somit, der für das Wesentliche unserer Treffen stand. Für alle weiteren Treffen wegweisend sein sollte.
Eine Insel der Erinnerung.
In einem Land, das eine Insel war.
Eine Insel in Europa.
Eine Insel in der Welt.
Eine Insel im Universum.
Die Idee zu den Treffen, den Zusammenkünften einer besonderen Art, hatte ich ein Jahr zuvor gehabt.
Im dritten Jahr nach der sogenannten Wende, mit der die Spaltung der Welt einmal mehr vermeintlich aufgehoben worden war. Neunzehnhundertzweiundneunzig.
In Zahlen: 1992.
Herausgefordert durch die Absurdität der Behauptung des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte, das mit dem Zusammenbruch der UdSSR und der von ihr abhängigen sozialistischen Staaten erreicht worden sei.
Eingeleitet durch den Fall der Berliner Mauer 1989.
Im zweihundertsten Jahr nach dem Beginn der Französischen Revolution.
Das behauptete Ende hatte mich gereizt, etwas dagegenzusetzen. Und was hätte das anderes sein können als sein Gegenteil.
Und was konnte das Gegenteil eines Endes anderes sein als ein Anfang.
Ein Anfang also.
Aber ein Anfang von was?
Der Anfang einer Geschichte.
Aber was für einer Geschichte?
Mister Fukuyama hatte sich vorgestellt, dass sich, im Sinne von Hegels Geschichtsphilosophie, nach der es tatsächlich zu einem Ende im Sinne einer letzten Synthese kommen soll, in der es keine weltpolitischen Widersprüche mehr gibt, die Prinzipien des Liberalismus in Form von Demokratie und Marktwirtschaft nun bald endgültig und überall auf der Welt durchsetzen würden.
Sein Buch war 1992 erschienen.
Ich hatte an den Schwarzen Freitag an der Wallstreet von 1929 gedacht. Ein Freitag, der dort wegen der Weltzeitverschiebung, anders als in Europa, eigentlich ein Donnerstag gewesen war.
Und ich hatte an das gedacht, was nicht erst jetzt, nach der sogenannten Wende, sondern bereits zuvor schon seit Jahren, seit Jahrzehnten wieder an der Börse geschah.
An all die Skandale, die, in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Börse, immer mehr westliche Demokratien in immer kürzeren Intervallen erschüttert hatten.
An all die Geschehnisse in der Wirtschaft und in der Politik, die das Vertrauen in deren Glaubwürdigkeit, in die Glaubwürdigkeit der besten aller schlechten Staatsformen, von denen die schlechtesten natürlich die kommunistischen waren, immer stärker ins Wanken gebracht hatten.
Und mir war die Steinfrau eingefallen.
Die Frau, bei der ich das Meeresauge gekauft hatte.
Das Naxos-Auge. Das Occhio di Santa Lucia.
Das kreisrunde, aus Kalziumkarbonat bestehende Aragonit-Stück, das den in den Weltmeeren lebenden Kreiselschnecken als Operculum dient. Als Schutztür.
Das Shiva-Auge.
Ihr Mann war, wie ich aus Gesprächen mit ihr erfahren hatte, Mitglied eines Clubs, der zu den merkwürdigsten gehörte, von denen ich Kenntnis hatte. Des vielleicht seltsamsten Vereins, von dem ich je gehört hatte.
Sein Name:
CLUB FREITAG DER DREIZEHNTE
Gegründet im Hollywood. Nicht in Hollywood. Im Hollywood.
In einem Restaurant an einem Fluss in der Nähe von Bern, das sich diesen Namen im Verlauf der Amerikanisierung der Welt, also auch der Schweiz, zugelegt hatte.
Eine Gruppe von dreizehn Männern, die sich an einem Freitag, der ein Dreizehnter war, zufällig getroffen und ad hoc beschlossen hatten, sich ab sofort an jedem Dreizehnten, der auf einen Freitag fällt, wieder zu versammeln und den Tag im Kreis von Gleichgesinnten zu verbringen.
Die Regeln, die die dreizehn Männer aufstellten, waren einfach und klar.
Die Gruppe durfte nur aus dreizehn Männern bestehen, und die Zusammenkünfte begannen immer um Punkt dreizehn Uhr dreizehn.
Mitglieder, die dem Anlass ohne Entschuldigung fernblieben, wurden ausgeschlossen.
Eisernes Gesetz war, dass alle Mitglieder an einem Freitag, dem Dreizehnten, nicht arbeiten gingen, um, wie es in der Club-Ordnung hiess, den Arbeitgeber vor Schaden und Unglück zu bewahren, welche durch unsere Arbeit an diesem Tag entstehen könnten.
Jeweils ein Mitglied musste die Gestaltung des Tages übernehmen und die anderen, die nicht wussten, was sie erwartete, damit überraschen.
Man machte Besichtigungen, Wanderungen, Fahrten mit Restaurant-Trams, Kutschen, Kleinbussen. In Bern und in der Umgebung von Bern. In anderen Schweizer Städten. Irgendwo auf dem Land.
Ab und zu begab man sich auch über die Landesgrenze hinaus, ins Elsass, in den Schwarzwald, in den französischen Jura, ins italienische Aosta-Tal.
Eine andere Regel, die ernst genommen wurde, obwohl sie nicht in der Ordnung stand, war, dass man, wenn die Ausflüge in ein Ess- und Trinkgelage ausarteten, um kein Risiko einzugehen, erst am Vierzehnten, also am Samstag, wieder nach Hause zurückkehrte.
Wobei es, wie mir die Steinfrau verriet, auch vorkam, dass es der Fünfzehnte, also der Sonntag, wurde.
Ansonsten waren ein Hufeisen und ein vierblättriges Kleeblatt, die auf dem leuchtenden Goldgrund des kreisrunden Clubsignets zu sehen waren, das Einzige, was den von den Clubmitgliedern allerdings nie so genannten Schwarzen Freitagen entgegengehalten wurde.
Angst, dass ihnen ein Unglück zustossen könnte, hatten die Männer nicht. Weshalb sie, wie die Ordnung festhielt, an diesen Tagen eben auch weniger sich selbst, sondern ihre Arbeitgeber beschützen wollten.
Eine Mitgliedschaft in diesem Club, der, jedenfalls in Europa, offenbar einzigartig war, hätte den Anfang einer Geschichte bedeuten können.
Allerdings hätte ich damit, da ich mein eigener Arbeitgeber war, gleichzeitig auch mich selbst beschützt.
Aber dies taten andere Clubmitglieder auch. Wie beispielsweise der Mann der Steinfrau, der in Geschäftsräumen, die an ihren Astro- und Edelsteinladen grenzten, als unabhängiger Versicherungsbroker tätig war.
Problematischer wäre gewesen, dass ich auf die Warteliste hätte gesetzt werden müssen, die es, wegen grosser Nachfrage, inzwischen gab.
Dass ich also auf Ausschlüsse hätte hoffen müssen, zu denen es selten kam. Oder, makabrer, auf Todesfälle.
Und zudem hätte ein solcher Beitritt auch nur für mich persönlich der Anfang einer Geschichte sein können. Denn die Geschichte des Clubs selber hatte schon fünfzehn Jahre zuvor begonnen. 1977 also.
Was tun?
Ich beschloss, selber einen Club zu gründen.
Einen eigenen Club.
Einen eigenen Club, der jedoch den gleichen Namen tragen sollte:
CLUB FREITAG DER DREIZEHNTE
Mit den gleichen Grundregeln.
Wenigstens im Prinzip.
Aber mit einer erweiterten Sinngebung.
Einer erweiterten Zielsetzung.
Ich hatte mich deshalb zunächst noch etwas genauer mit dem Stellenwert beschäftigt, den der vermeintliche Unglückstag im weltweiten Aberglauben einnimmt.
Und ich war, wie hätte es anders sein können, schon bald dort gelandet, wo man oft landet, wenn man sich auf solche Fragen einlässt.
Dort, wo man, wenn es um Ursprünge dieser Art geht, jedenfalls wenn es die westliche, die jüdisch-christlich geprägte Kultur betrifft, immer landet.
Bei der Bibel.
Dies galt für den Wochentag sowohl wie für die Zahl. Für den Freitag sowohl wie für die Dreizehn, die beide für sich, wie es schien, als Tag und als Zahl schon lange als ein Unglückssymbol angesehen wurden.
Denn nach christlicher Überlieferung wurde Jesus an einem Freitag gekreuzigt. Und an einem Freitag sollen auch Adam und Eva von den verbotenen Früchten des Baums der Erkenntnis gegessen haben.
Beim Abendmahl wiederum, das dem Kreuzigungsfreitag voranging, waren dreizehn Personen anwesend. Wobei der Verräter Judas der Dreizehnte gewesen sei.
So wie in der Wissenschaftswelt das Universum als Nachwirkung des Urknalls ein kosmisches Hintergrundrauschen zu haben scheint, scheint in der Menschenwelt alles einen religiösen Hintergrund zu haben.
In der jüdischen Tradition soll die Dreizehn, die das geschlossene Zwölfersystem und dessen harmonisierende Wirkung in der Bibel überschreitet, allerdings eine Glückszahl sein. Und weil sie über der Zwölf steht, sogar ein Symbol Gottes.
Umso besser für die Dreizehn.
Das erste, von der Bibel unabhängige geschichtlich bezeugte Ereignis, bei dem sich die beiden einzelnen Unglückssymbole, der Freitag und die Dreizehn, dann, wie es schien, plötzlich vereint und zu einem neuen, noch mächtigeren Bedrohungszeichen zusammenfügt hätten, sei dann die vom französischen König Philipp dem Vierten, genannt der Schöne, befohlene Verhaftung aller Tempelritter gewesen.
Am Freitag, dem 13. Oktober 1307.
Die, soweit bekannt, erste landesweit am gleichen Tag ausgeführte polizeiliche Kommandoaktion. Ein brutaler Überraschungscoup, der letztlich zur fast völligen Auslöschung des ebenso mysteriösen wie reichen Templerordens geführt habe.
Wirklich als Mythos installiert worden sei der Freitag, der Dreizehnte, als Schreckenstermin aber erst sechshundert Jahre später.
Durch ein belletristisches Werk.
Einen Börsenroman.
1907 geschrieben von einem amerikanischen Multimillionär, der sich seinen Reichtum durch Spekulationen erworben hatte, mit dem schlichten und einfachen Titel:
FRYDAY THE THIRTEENTH.
In Deutschland noch im gleichen Jahr erschienen als:
Freitag, der Dreizehnte.
Eine heute simpel und banal anmutende Geschichte.
Ein Wallstreet-Makler, den eine Frau vom rechten Weg abgebracht hat, löst, um eine Firma in den Ruin zu treiben, an besagtem Freitag durch Aktientricks einen Kursrutsch aus. Er erreicht zwar sein Ziel, doch der Sieg stürzt ihn zugleich ins Verderben.
Die neue Kombiphobie, die teuflische Paarung von Wochentag und Datum, führte im Zeitalter der Massenmedien dann zu einer Flut weiterer Bücher, zu Filmen und Liedern, die der von ihr erzeugten Angst huldigten.
Das hatte 1916 mit einem deutschen Kriminalfilm begonnen, in dem die Angehörigen einer Familie von Eulenstein plötzlich starben, wenn Freitag, der Dreizehnte war, und hatte weitergeführt bis zur heutigen Flut der sich an Brutalität stets von neuem zu übertreffen versuchenden Horrorfilme aus Hollywood, die zu beweisen scheinen, dass wir Menschen den Schrecken wollen, ihn brauchen, ihn haben müssen.
So dass das Ausmass der Freitag-der-Dreizehnte-Furcht inzwischen sogar für die Medizin relevant geworden zu sein scheint, die dafür auch einen wissenschaftlichen Namen bereitgestellt hat.
Paraskavedekatriaphobie.
Interessanter als der Roman, der den Mythos begründet haben soll, war im Übrigen, wie nicht selten der Fall, die Lebensgeschichte des Autors selber. Die wirkliche Geschichte, die ihn das Buch hatte schreiben lassen.
Thomas William Lawson, so der Name des Mannes, hatte, aus einfachen Verhältnissen stammend, als Teenager ohne abgeschlossene Schulbildung das Börsenhandwerk erlernt, mit dreissig seine erste Million gemacht und mit dreiundvierzig bereits fünfzig Millionen besessen.
Dann hatte er sich, wie man heute sagen würde, als bestens informierter Insider zu einem frühen Warner und Kritiker der Machenschaften in der Finanz- und Wirtschaftswelt entwickelt.
Da er mit seinen Vorschlägen für Verbesserungen und Abhilfe bei den Missständen aber kein Gehör fand, hatte er sich enttäuscht wieder dem Börsenmarkt zugewandt, dort an die alten Erfolge allerdings nie mehr anknüpfen können.
So dass er, fünfundzwanzig Jahre später, achtundsechzigjährig, als ein für seine Verhältnisse armer Mann gestorben war.
Zuvor, auf dem Höhepunkt seines Reichtums und seiner Macht, hatte er sich – William Randolph Hearst, Elvis Presley und Michael Jackson lassen grüssen – für sechs Millionen ein Heim bauen lassen, das er DREAMWORLD nannte.
Mit einer eigens dafür gebauten Yacht, die er INDEPENDENCE nannte – auch hier gibt es heute wieder bekannte Nachfolger –, hatte er im America’s Cup gegen den schottischen Teemagnaten Sir Thomas Lipton anzutreten versucht, worauf der New Yorker Yachtclub sein Boot allerdings hatte sperren lassen.
Die jahrelangen Spannungen zwischen ihm und den reichen Mitgliedern des Clubs hatten möglicherweise auch dazu beigetragen, dass er kurz darauf den grössten Schoner der Welt bauen liess.
Das grösste Segelschiff seiner Zeit.
Den einzigen Siebenmastschoner der Seefahrtsgeschichte, den er nach sich selbst nannte.
Die THOMAS W. LAWSON, die, fünf Jahre nachdem sie vom Stapel gelaufen war, von einem Orkan vor den südenglischen Scilly-Inseln gegen eine Felseninsel geworfen wurde, wo sie heute noch siebzehn Meter unter dem Meeresspiegel als Wrack liegt.
Die Katastrophe, bei der von den neunzehn Menschen an Bord nur der Kapitän und der Maschinist überlebten, geschah in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 1907.
Dem Jahr, in dem sein Börsenroman erschienen war.
Und der Wochentag, auf den damals der 13. Dezember fiel, war ein Freitag gewesen.
Von Lawsons DREAMWORLD soll heute noch ein grandioser Wasserturm zeugen, den er im Stil einer deutschen Ritterburg hatte ausstaffieren lassen.
Realität und Fiktion.
Dichtung und Wahrheit.
Wenn es denn dem Menschen möglich sein sollte, aus der Geschichte zu lernen. Erfahrungen weiterzugeben.
Und wenn dies auch nur indirekt würde geschehen können.
Mit Büchern. Mit Romanen Mit Geschriebenem. Mit mündlich Weitergegebenem. Mit Erzählungen. Mit Spracharbeit, Bildarbeit, Lautarbeit, Klangarbeit, Kulturarbeit.
Mit geistiger Arbeit, die würde helfen können, sich unnötige, weil selbst verschuldete Katastrophen als notwendige brutale Lehrmeister zu ersparen.
Prinzipiell voraussehbares Unglück zu vermeiden.
Zu verhindern.
Überflüssig zu machen.
Klarer als der ungesicherte Hintergrund des Tages, der zum Tag des neu zu gründenden Clubs werden sollte, war das Kalendarische.
Da jedes Jahr mindestens einen und höchstens drei Freitage hat, die auf einen Dreizehnten fallen.
So dass sich die dreizehn Mitglieder also mindestens einmal und höchstens dreimal im Jahr treffen würden.
Nicht zu viel. Nicht zu wenig.
Blieb die Frage, wer als Mitglied in Frage kam.
Des Weiteren, wie der Sinn und Zweck umschrieben werden sollte, der dreizehn Männer würde überzeugen können, in einem solchen Club Mitglied zu werden.
Männer selbstverständlich, von denen jeder, so wie Groucho Marx von den Marx Brothers, von sich behaupten würde, dass er keinem Club angehören möchte, der ihn als Mitglied aufnimmt.
Was sollten das also für Männer sein?
Wohl in Anlehnung an den Verräter Judas, der sich als Erster vom Abendmahlstisch erhoben und später Selbstmord verübt haben soll, sei im neunzehnten Jahrhundert in den USA die Angst mancher Menschen, sich an Freitagen mit zwölf anderen an einen Tisch zu setzen, zu einem Thema geworden.
Wenn dreizehn Personen bei Tisch sitzen würden, müssten noch im selben Jahr die erste und die letzte Person sterben, habe es geheissen.
Als Reaktion darauf hätten mutige Männer den Thirteen Club gegründet, dessen Mitglieder mehrmals jährlich, stets freitags, in feinen Restaurants in Dreizehnerrunden diniert hätten.
Man habe sich einen netten Abend gemacht und so dem Schicksal die Stirn geboten.
Eine Art Vorstufe für einen CLUB FREITAG DEN DREIZEHNTEN also, bei der sich die Dreizehn aber noch ausschliesslich auf die Teilnehmerzahl beschränkt hatte und die Freitage noch nicht zusätzlich diejenigen Freitage gewesen waren, die auf einen Dreizehnten fielen.
Gut.
Also sollten die Männer, die es jetzt zu suchen galt, vermutlich noch mutigere sein. Noch waghalsigere, noch verrücktere, noch weisere oder noch klarer sehende.
Wo finden?
Wo in den inzwischen, am Ende des zweiten Jahrtausends der christlichen Zeitrechnung, dichtest bevölkerten Gegenden Europas, wie nun auch die Schweiz eine geworden war?
Wo in jenen Weltteilen, in denen man im Alltag eine immer dichtere Menge von Menschen um sich hat, zu deren Aussen- und Innenleben man im Grunde kaum noch einen Bezug, eine Beziehung hat.
Kaum noch eine echte, eine wirkliche Beziehung.
Wo, wenn die Dichte im gleichen Ausmass wächst wie die Entfernungen, wie der Abstand, den man zu den wenigen Menschen hat, die man noch als echte Freunde bezeichnen kann.
Wo, wenn man in einem Teil der Welt lebt, in dem einen täglich eine Informationsflut überschwemmt, die kaum noch etwas mit dem wirklichen Leben, mit dem Leben derer zu tun hat, die gleichzeitig im gleichen Zeitraum mit einem leben.
Wenn man nichts mehr vom Leben, vom Leben der Anderen, weiss.
Dem Leben derer, die den gleichen Raum und die gleiche Zeit auf einem beschränkten, einem kleinen Teil dieses Planeten gleichzeitig mit einem erleben und durchleben.
Wenn alles bloss noch abstraktes, virtuelles Wissen ist. Kein wirkliches Verstehen mehr.
Wenn echte Freunde oft nicht mehr in der unmittelbaren Nähe des eigenen Lebensortes leben.
Falls dieser Ort überhaupt noch mehr als ein Wohn- und Arbeitsort ist.
Gab es in der Schweiz noch zwölf solche Menschen?
Männer, die interessiert und in der Lage sein würden, die überzeugt werden konnten, Mitglieder in einem Club zu werden mit einem Namen wie:
CLUB FREITAG DER DREIZEHNTE
Sinn und Zweck des Clubs sollte, stellte ich mir vor, der Gedankenaustausch zwischen Menschen sein, die erkannt hatten, die wussten oder ahnten, dass der Mensch ein Wesen ist, das naturgemäss in zwei Welten lebt.
Menschen, die verstanden, eingesehen und sich damit abgefunden hatten, dass die Welt, die wir für die unsere halten, obwohl sie in einer bestimmten Weise auch die unsere ist, nur ein kleiner Ausschnitt, und zwar ein sehr viel kleinerer Ausschnitt, als wir meinen oder bisher gemeint haben, aus einer unendlich viel grösseren Welt ist, die sich, wie unsere Welt, wiederum aus vielen weiteren Welten zusammensetzt, die in einer für den Menschen unvorstellbar grossen Zahl oder auch in einer zahllosen Weise vorhanden sind.
Menschen, die wissen oder ahnen, dass wir in diesen zwei Welten immer und jederzeit gleichzeitig leben.
Menschen, die wissen oder ahnen, dass die grössere Welt nicht das alte Jenseits ist, nicht jene aus Himmel und Hölle bestehende jenseitige Welt, in die wir erst nach unserem Tod gelangen, wie man früher glaubte und teilweise immer noch glaubt, sondern eine Welt, in der wir in und mit unserer eigenen kleinen Welt bereits hier und jetzt leben.
Menschen, die wissen oder ahnen, dass die grössere Welt bereits die Ewigkeit ist, in die wir nicht erst gelangen, wenn wir tot sind, sondern in der wir, wie alle Lebewesen, bereits sind, wenn wir leben.
Menschen, die um diese neu in unserem Bewusstsein erscheinende Komplexität wissen, von der einige Wissenschaftler meinen, durch die Beschäftigung mit ihr würde die Menschheit nun überhaupt erst anfangen, die Welt zu verstehen.
Wirklich zu verstehen.
Menschen, die gleichzeitig aber auch um das Ungeheure dieser für unseren Geist neuen Komplexität wissen und überzeugt sind, dass wir uns nur mit äusserster Vorsicht und Zurückhaltung mit ihr beschäftigen dürfen.
Dass wir sie zwar zu verstehen versuchen können, dass wir mit Eingriffen in sie jedoch so behutsam wie möglich sein sollten.
Menschen, die überzeugt sind, dass vor der Uneinschätzbarkeit der Gefahren, die das Ungeheure dieser Komplexität birgt, auf den Land-, Meer- und Luftkarten der Ewigkeit in der gleichen Art gewarnt werden sollte, wie dies einst auf den alten Weltkarten geschah, an deren Rändern geschrieben stand:
BEYOND THIS POINT ARE MONSTERS
Denn wer von uns könnte schon behaupten, dass er im Geist wirklich gerüstet sei, um in die Abgründe zu blicken, von denen unser Bewusstsein durch die Natur bisher, zu unserem Vorteil, ferngehalten wurde und zum grössten Teil immer noch wird?
Könnte es nicht, im Gegenteil, so sein, dass wir von manchen Aspekten des Wissens um das immense Verborgene in uns bereits ebenso bedroht sind, wie wir es durch die gewaltigen Entdeckungen der Physiker in der Welt ausser uns sind?
Wie heisst es in den Untergrundstationen der englischsprachigen Metropolen:
MIND THE GAP
Einige Männer, von denen ich glaubte, dass sie ein solches Bewusstsein entwickelt hatten, gab es in meiner näheren Umgebung. Einige in anderen Gegenden des Landes.
Männer, die ihr Leben in verschiedenster Weise verbracht hatten und in unterschiedlicher Weise zu einem solchen Bewusstsein gekommen waren.
Nähe und Distanz.
2
Dreizehn waren bereit gewesen mitzumachen. Auch wenn sie nicht garantieren konnten, bei jedem Treffen dabei zu sein.
Einige hatten zu meiner Überraschung erstaunlich schnell zugesagt. Langjährige Freunde, bei denen es zwischendurch allerdings auch immer wieder Perioden gegeben hatte, in denen wir ohne Kontakt waren.
Aber auch Freunde, die ich noch nicht lange kannte, zu denen aber bereits eine mehr oder weniger starke geistige Verbindung entstanden war.
Fuchs und Gilomen kannte ich schon vom Gymnasium her. Von dort auch die Gewohnheit, Dritten gegenüber von uns nur mit dem Familiennamen zu sprechen.
Beide hatten anschliessend Soziologie und Betriebswirtschaft studiert. Fuchs hatte sein Leben der internationalen Zusammenarbeit gewidmet. Gilomen war Wirtschaftsjournalist geworden.
Volpi, wie wir Fuchs in der Schule auch genannt hatten, von Volpone, alter Fuchs, hatte in zwanzig Ländern Afrikas und ausser in Guyana auch in jedem Land Südamerikas gearbeitet. Ebenso in fast allen osteuropäischen Ländern, in der Sowjetunion, in Vietnam, in Australien.
Auch Gilomen war in der Welt herumgekommen. Allein oder mit seiner Frau, die lange als Stewardess für die damals noch existierende nationale Fluggesellschaft gearbeitet hatte. Die Swissair.
Fuchs hatte eine Bolivianerin geheiratet, eine ausgebildete Buchprüferin, mit der er aus Südamerika in die Schweiz zurückgekehrt war. Jetzt war er geschieden.
Beide, Fuchs und Gilomen, hatten je zwei Kinder.
Einen Sohn.
Eine Tochter.
Alle drei hatten wir damals vier Jahre vor unserem fünfzigsten Geburtstag gestanden.
Gezeugt nach dem Ende des zweiten Weltkriegs, hatten wir die ganze zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts durchlebt. Fast jedenfalls, wenn man von den acht Jahren absah, die uns noch bevorstanden.
Männer, je nachdem wie man es sieht, im besten Alter oder in der Midlife Crisis. Sogenannte bestandene Männer, die ihren Lebensweg gemacht hatten. Die den grösseren Teil davon nun aber bereits hinter sich sahen.
Die andern waren älter. Zwei jünger.
Der Älteste war dreiundfünfzig. Der Jüngste dreiunddreissig.
Bis auf drei waren alle in der Schweiz geboren.
Die ältesten Freunde, nach Fuchs und Gilomen, waren Quirin und Arnulf.
Dann folgten Dieter, Paul und Vinzenz.
Dann Simon.
Dann Frank und Gerd.
Dann Robert und Arnold.
Quirin hatte ich kennengelernt, als er mich nach dem Erscheinen meines zweiten Buchs zu einer Lesung eingeladen hatte.
Er war unser Spezialist für Religion und Mystik.
Kenner magischer Orte, Veranstalter von Reisen zu solchen Orten, Verfasser von Büchern über magisches Reisen und Standardwerken über Paracelsus und Niklaus von Flüe.
Gymnasiallehrer. Historiker. Philosoph. Schriftsteller.
Als Metzgerssohn aus einem Dorf auf dem Hochplateau, das in der Schweiz Mittelland genannt wird, hatte er in einer alpinen Klosterschule eine katholische Internatserziehung erhalten.
Die weit von der Metzgerei seiner Eltern entfernt liegende Klosterschule hatte er unbedingt besuchen wollen, weil sein elf Jahre älterer Bruder sie schon besucht hatte und er befürchtete, dass dieser ihm davoneilen könnte.
Aber schliesslich war der Bruder, der neun Monate und zehn Tage vor Quirins Geburt einen schweren Unfall gehabt hatte, an dessen Folgen er sein Leben lang litt, ein Jahr vor dem ersten Treffen unseres Clubs, erst sechsundfünfzig Jahre alt, gestorben.
Körperlich zwar nicht ganz so hochgewachsen wie unsere drei Riesen, konnte dieser Mann, was sein Gedächtnis betraf, es mit jenen jedoch spielend aufnehmen.
Es war riesig.
Weshalb ich ihm für mich auch den Namen Zyklop gegeben hatte. Abgeleitet von Enzyklopädist.
Quirin war ein wandelndes Lexikon.
Mit einem phänomenalen Gedächtnis nicht nur für exakte Daten, für Tageszahlen oder Jahreszahlen, sondern auch für Zusammenhänge. Für Geschichten der Geschichte. Noch und noch.
Für Lebensgeschichten von Individuen. Für deren Verflechtungen in historische Prozesse. Für die bis in die letzten Einzelheiten gehenden dramatischen Verästelungen sowohl der individuellen Lebensgeschichten wie der übergreifenden geschichtlichen Tragödien und Komödien.
Von den Anfängen der Geschichtsschreibung bis heute.
Er war, wenn er einmal zu sprechen begonnen hatte, kaum noch zu bremsen. Daher vielleicht auch sein Vulgo. Sein Studentenname:
SCHOCK.
Ausserdem war er ein leidenschaftlicher Ornithologe.
Wo immer unsere Treffen stattfanden, wies er auf Vögel hin. Auf solche, die dort üblicherweise vorkamen. Auf solche, die dort selten waren. Auf solche, die es nur an diesen Orten zu entdecken gab.
Seine Lieblinge waren der Kirschkernbeisser, der Kleiber und der Raubwürger.
Zwei Töchter.
Maria-Theresia und Katherina.
Eine Polizistin. Eine Bankfrau.
Arnulf, der Hofmeister, war einer unserer drei Riesen. Ein Zweimetermann. Und er war auch einer der drei von uns, die nicht in der Schweiz geboren waren.
Ihn hatte ich kennengelernt, weil er für die Vernissage meines vierten Buchs ein Ex Libris gestaltet hatte. Ein mit dem Datum versehener Einklebezettel, der vom Verlag nur an diesem Abend als exklusive Zugabe an die Käufer des Buches abgegeben wurde.
Er hatte am längsten gezögert, bis er zum Mitmachen bereit gewesen war.
Noch während des Zweiten Weltkriegs in Wien, im damals von den Nazis besetzten Österreich geboren, war er mit seinen Eltern, als er sechs Jahre alt war, in die Schweiz gekommen.
Und er war nicht nur körperlich, sondern auch was seine Arbeit betraf, ein Riese geworden.
Ein Gigant.
Nach einer Typographenlehre hatte er ein paar Jahre als Bühnenmaler gearbeitet. Dann war er als freischaffender Künstler schnell in die Liga der hochdotierten, international bekannten Zeichner und Maler aufgestiegen. Mit Arbeiten, die immer riesigere Formate angenommen hatten.
Sein Talent: das meisterhafte hyperrealistische Zeichnen in Trompe-l’oeil-Manier.
Der bisherige Höhepunkt seines Riesenwerks war eine Eins-zu-Eins-Wiedergabe seines ersten Atelierraums. Der Arbeitsstätte, die er sich in einem in einer Mulde hinter dem ersten Höhenzug am rechten Ufer des Neuenburgersees gelegenen neogotischen, an einen Sektenbau erinnernden Haus eingerichtet hatte.
Geschaffen für die 6. Documenta in Kassel.
Mit tausenden, hunderttausenden oder Millionen von Bleistift- und Farbstiftstrichen auf Holzplatten. In der realen Grösse der Wände, der Decke und des Bodens. Aufs peinlichste genau. Bis hin zu den toten Fliegen in den Ecken.
Wie jeder Künstler kein einfacher Mensch.
Er trank ungeheure Mengen Weisswein, den er als Antriebsmittel für seine tagtägliche Fleissarbeit brauchte.
So dass ich ihm eines Tages, als wir zusammen am Trinken waren, scherzeshalber gesagt hatte, ob er seine Striche nicht lieber in Form von einmal quer durchgestrichenen Vierergruppen anordnen wolle.
Damit er jedes Mal sagen könne:
Schon wieder fünf Franken!
Daneben war er ein ausgezeichneter Koch und grosszügiger Gastgeber. Phantasievoll. Sprachmächtig. Wenn auch nicht selten in bissiger, ironischer Weise.
Selbstverständlich ehrgeizig.
Eine Rabelais-Figur.
Ein Gargantua.
Ein Pantagruel.
Bitte Klopfen und nicht Eintreten!
So hatte er eine seiner Ausstellungen genannt.
Zum zweiten Mal verheiratet.
Ein Sohn und eine Tochter aus erster Ehe.
Ein Sohn in zweiter Ehe.
Dieter, unser zweiter Riese, war, obwohl das für Schweizer wie ein Witz klingen mag, Appenzeller.
Geboren und aufgewachsen in dem Schweizer Kanton, dessen Bewohnern man nachsagt, sie seien so klein, dass Witze über sie gemacht würden.
Unser ältestes Mitglied. Diplomat im Dienst des Eidgenössichen Departements für auswärtige Angelegenheiten.
Ein entschiedener Vertreter der Ansicht, dass dieser Planet, den wir Erde nennen, schon seit dem Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts völlig übervölkert sei. Daher auch die beiden Weltkriege, die vorübergehend etwas Raum geschaffen hätten.
Er hatte nach einer Handelsmatur ein kurzes Intermezzo beim damals noch existierenden Schweizerischen Bankverein gegeben, einer der damals noch vier grössten Banken der Schweiz, und dann in Nepal als Entwicklungshelfer gearbeitet.
Danach Wirtschaftsstudium und Diplomatenausbildung.
Dann auf Posten in Mexiko, Neu-Delhi, Dhaka und Ottawa. Später Caracas und Bonn.
Ihn hatte ich kennengelernt, als er Leiter der Sektion für kulturelle und Unesco-Angelegenheiten in der Zentrale des EDA in Bern gewesen war.
Er hatte mich empfangen, weil ich bei dieser Dienststelle angefragt hatte, ob man mir behilflich sein könne, in Ottawa den historisch kuriosen Prachtbau der dortigen französischen Botschaft zu besichtigen.
Den Abstecher nach Kanada plante ich, weil mir damals ein mehrmonatiger New-York-Aufenthalt bevorstand und ich für den Roman, an dem ich arbeitete, das Botschaftsgebäude als Schauplatz verwenden wollte.
Dass der Mann, Dieter, zuvor schon einmal in Ottawa auf Posten gewesen war, war ein Zufall.
Ebenso, dass ich das Haus kannte, das er später in einem Dorf nahe von Bern kaufte. Es hatte einem renommierten Psychiater gehört, der sich für Literatur interessierte und von dem ich deshalb Jahre zuvor schon einige Male zum Essen eingeladen worden war.
Zum Zeitpunkt, als ich meine Anfrage an ihn richtete, war Didi, wie wir ihn meist nannten, einmal mehr in die Zentrale des EDA nach Bern zurückbeordert worden. Dort nun tätig als Koordinator für internationale Flüchtlingspolitik.
Bei einem Bauern am Rand des Dorfes, in dem das Haus stand, das der inzwischen verstorbene Psychiater sich einst hatte bauen lassen, hatte er ein eigenes Pferd im Stall.
Neider nannten ihn deshalb einen Herrenreiter.
Daneben war er ein grosser Verehrer nicht nur der offensichtlichen, sondern auch der verborgenen Schönheiten der Frauen.
Und manchmal auch etwas mehr.
Zunächst über lange Jahre verheiratet mit einer Jugendliebe aus dem Appenzeller Dorf, in dem sie beide ihre Kindheit und Jugend verbracht hatten, war er inzwischen von dieser Frau geschieden.
Kinderlos.
Paul, dessen Bekanntschaft ich durch Dieter gemacht hatte, war als ein weiterer Schweizer Spitzenbeamter in einer Sphäre tätig, die man nicht sofort mit diesem kleinen Land in Verbindung gebracht hätte.
Er arbeitet zwar wie Dieter für das EDA, aber nicht als Diplomat, sondern als Chef des Büros für Weltraumangelegenheiten.
Zum Ausgleich, oder wohl zutreffender zur spiegelbildlichen Ergänzung seiner Beschäftigung mit dem Universum, kreuzte dieser Mann mit dem von ihm selbst konstruierten kleinsten Dampfschiff der Schweiz, dem er den Namen Fünkli, kleiner Funke, gegeben hatte, wann immer er sich dafür Zeit nehmen konnte, über den Thuner- und den Brienzersee.
Dabei war er, im Gegensatz zu dem, was man hätte erwarten können, von seiner Ausbildung her nicht etwa Naturwissenschaftler, sondern Jurist.
Aber mit einer Doktorarbeit über Raumfahrt und Völkerrecht.
Auch er sah, wie Dieter, in der Übervölkerung des Planeten die grösste Gefahr, die es für die Menschheit heute gibt.
Er hatte die Rechte mit der ganzen Vielfalt ihrer Deutungsmöglichkeiten studiert und betrachtete sich als der Wissenschaft verpflichteter Aufklärer und Feind des Aberglaubens. Er hatte deshalb der Idee des Clubs zunächst zwar skeptisch gegenübergestanden, sie schliesslich aber trotzdem amüsant gefunden.
So wie er, eine andere Eigenheit von ihm, sowohl weder Ufos noch weitere Universen als jenes, das uns bis heute bekannt ist, ausschliessen wollte.
Ich frage mich, warum es heute einfacher ist, finanzielle Mittel für die wissenschaftliche Erforschung des Paarungsverhaltens von Glühwürmchen zu beschaffen als für die seriöse Untersuchung des Ufo-Problems.
So eines seiner Argumente.
Weit über neunzig Prozent der weltweiten Ufo-Sichtungen könnten zwar als Verwechslung mit konventionellen Himmelserscheinungen, so seine weitere Argumentation, getrost auf den Müll befördert werden.
Ihn interessiere der harte Kern der ungeklärten Sichtungen, der übrig bleibe.
Auch in diesem Fall vermag ich die Ignoranz der offiziellen Wissenschaft nicht zu begreifen.
Deshalb seine Frage:
Warum gibt es nicht mehr anerkannte Forscher, die erkennen, dass da etwas Merkwürdiges im Gang sein könnte?
Dass die NASA, die überhaupt nicht eine so ganz zivile Raumfahrtbehörde, sondern ein Regierungsarm sei, der Regierungspolitik durchführe, stets die Wahrheit sage, bezweifle er.