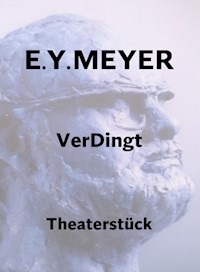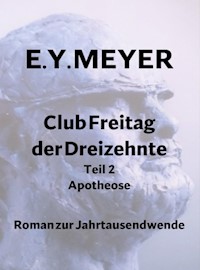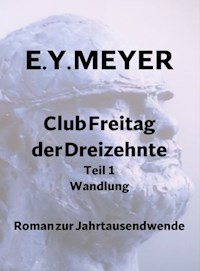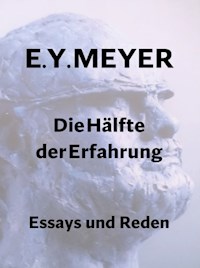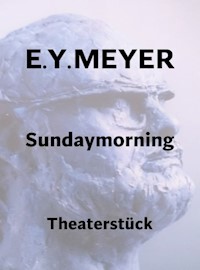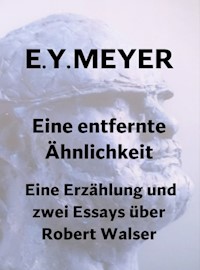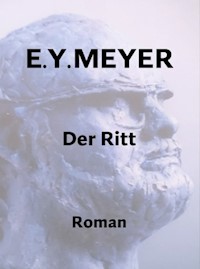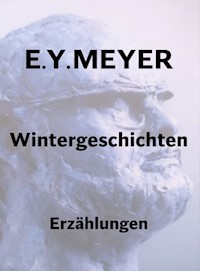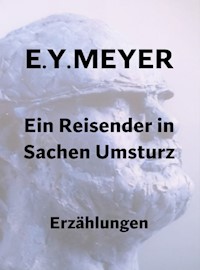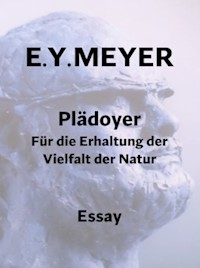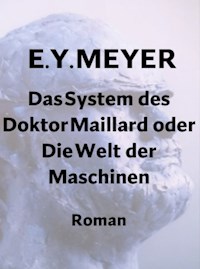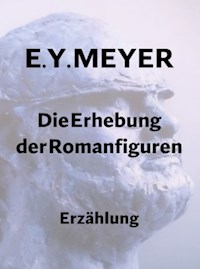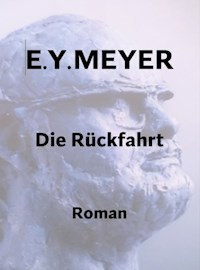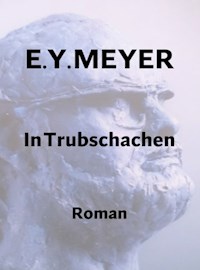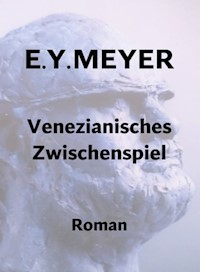
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist eine Neuauflage der Novelle aus Anlass des 75. Geburtstages des Autors E. Y. Meyer am 11. Oktober 2021 mit einem neu geschaffenen superben Nachwort von Samuel Moser, das dem Leser eine grossartige und ausserordentlich geglückte Einordnung dieser Novelle ins gesamte Werk von E. Y. Meyer anbietet. Vier Theaterleute und ein Schriftsteller reisen von Paris nach Venedig, um zu feiern. Die Vergnügungsreise entwickelt sich völlig überraschend zu einem Alptraum. Als sie in der Serenissima eintreffen, ist die legendäre Harry's Bar schon geschlossen, die Vorfreude darauf dahin. Riccardo Malino, ein venezianischer Dramatiker, wird zu ihrem Cicerone. Er führt die Venedig-Besucher durch das Labyrinth der Stadt, lädt sie in kleine versteckte Kneipen ein, lässt sie hinter feudalen Fassaden des Canal Grande blicken. Grosszügig stellt er ihnen für einige Tage sein in der Nähe des »Teatro La Fenice« gelegene Haus zur Verfügung. Eine alte venezianische Falle droht auf erschreckende Weise neue Wirklichkeit zu werden. In einer gespenstischen, unheimlichen Nacht kommt es zu der unerhörten Begebenheit, die das Herz dieser Novelle ausmacht. Die italienische Reise wird zu einer Reise in die Abgründe der menschlichen Seele. Ein geradezu Faustisches Erlebnis…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
E.Y.MEYER
VenezianischesZwischenspiel
Novelle
Mit einem Nachwort vonSamuel Moser
Erstmals erschienen 1997
© 2021 E.Y.MEYER
eymeyer.ch
Cover:
Bronzekopf des Autors
Geschaffen 1997 von PAN YI QUINAcademy of Arts & Design
Tsing Hua UniversityBei Jing, China
FÜRFLORICA
Was ist eine Novelle anders alseine sich ereignete unerhörte Begebenheit.
Johann Wolfgang Goethe
Kapitel
I
II
III
IV
V
VI
NACHWORT
I
Die Unterbrechung der Romanarbeit sollte nur eine kurze sein, einige Tage bis höchstens eine Woche, und hätte doch beinahe ihr Ende bedeutet.
Ob man das Ereignis, um das es hier geht, wirklich als so gravierend einstufen oder ob man es anders sehen will, hängt von den Moralvorstellungen des Einzelnen ab. In einem Jahrhundert, in dem millionenfacher technokratisch geplanter Mord stattgefunden hat, die Atombombe erfunden, gebaut und eingesetzt wurde, ist auch die Beurteilung von Mord relativ geworden.
Alles scheint möglich und als Wertvorstellung akzeptierbar. Und vielleicht wird der Mord, wenn man später auf unser Jahrhundert zurücksieht, möglicherweise sogar als die Kunst angesehen, die es kennzeichnet, wie andere Jahrhunderte durch das Gebet oder das Betteln gekennzeichnet waren.
Das Böse, das es in der Welt gibt, beginnt oft erstaunlich banal und entfaltet plötzlich eine grosse Wirkung.
Damals, als die Begebenheit stattfand, an die ich seither regelmässig zurückdenken muss, schuf meine Frau die Kostüme für eine Aufführung von Niccolò Machiavellis Mandragola im Théâtre de l'Est Parisien (heute heisst es Théâtre National de la Colline), und der aus Italien stammende Regisseur hatte die Idee, am Tag nach der Premiere mit einigen Freunden nach Venedig zu fahren, um dort den Abschluss seiner Arbeit noch ein zweites Mal in der berühmten Harry's Bar zu feiern.
Ein Einfall, der, wie ich zugeben muss, etwas eigenwillig, wenn nicht verrückt oder jedenfalls zumindest exzentrisch erscheinen mag. Kennt man Giorgio Marelli und seine Arbeit näher, verwandeln sich solche Eingebungen, wie ich versichern kann, aber schon bald einmal in Vorschläge, die für die Verhältnisse dieses Mannes durchaus normal, ja beinahe gewöhnlich sind.
Warum meine Frau und ich ausgerechnet auf diese Laune Giorgios eingingen, hatte recht unterschiedliche Gründe. Da wäre zunächst sicher einmal anzuführen, dass auch wir, meine Frau und ich, gewissen Extravaganzen oder sogenannten Verrücktheiten gegenüber nicht unempfänglich sind.
Und dann war da natürlich vor allem Giorgios grosszügiges Angebot, nicht nur den Abend in Harry's Bar zu übernehmen, sondern meiner Frau und mir, wenn wir unseren Wagen für die Reise zur Verfügung stellten, auch noch das Benzin zu bezahlen.
Meine Arbeit hatte durch den Premierenbesuch in Paris ohnehin eine Unterbrechung erfahren, und mir würde sich wahrscheinlich nicht so bald wieder die Gelegenheit bieten, meine Venedig-Erfahrung mit einem so exzellenten Kenner zu erweitern, wie dieser italienische Regisseur einer zu sein schien. Darüber hinaus liess sich der Abstecher, wie es der Zufall oft auf merkwürdige Weise will, zudem noch mit einer sowieso fälligen Recherchereise für den Roman verbinden, an dem ich gerade arbeitete – wobei Zufälle, wie ich in zwischen weiss, eigentlich keine Zufälle sind, sondern bloss Zusammenhänge, die wir nicht genügend überblicken.
Und schliesslich, zu guter Letzt oder last, but not least, bot Giorgios Vorschlag meiner Frau und mir eine schöne Gelegenheit, uns gegenseitig ein Geburtstagsgeschenk zu machen – hatten wir doch beide eben unsere Wiegenfeste im Zeichen der Waage getrennt voneinander gefeiert. Meine Frau das ihre zwei Wochen zuvor zusammen mit den Freunden in Paris und ich das meine neun Tage später siebenhundert Kilometer entfernt an unserem Wohnort.
Meine Frau kannte Giorgio damals schon seit etwa zehn Jahren. Mit ihrer Emigration hatte sie ihn aber über einen längeren Zeitraum hinweg aus den Augen verloren und bis zu dieser erneuten Zusammenarbeit in Paris nur noch sporadisch durch Freunde etwas von ihm gehört. Ich selber begegnete dem Mann, der ein Jahr jünger ist, anlässlich der Mandragola-Premiere zum ersten Mal – zuvor kannte ich ihn nur aus den Erzählungen meiner Frau von früheren Zeiten, von Zeiten, als sie noch nicht meine Frau war.
Ende der sechziger Jahre, so meine Frau, hatte Giorgio am Festival RASSEGNA DEI TEATRI in seiner Heimatstadt Florenz den Direktor des rumänischen Nationaltheaters von Cluj kennengelernt, und dieser hatte den jungen Italiener eingeladen, im Jahr darauf an seinem Haus eine Inszenierung zu übernehmen. Nicht bloss, weil er vom Talent des jungen Mannes überzeugt war, sondern vor allem, weil seine Frau und der Italiener sich ineinander verliebt hatten und er befürchtete, die Frau könnte in Florenz bleiben wollen.
Giorgios Regiearbeit in Cluj, Pirandellos Riesen vom Berge, folgte eine Inszenierung in der rumänischen Stadt Craiova, und auf Grund der beiden Erfolge erhielt der ausländische Jungstar sofort ein weiteres Engagement am Stadttheater von Ploeşti, wo meine Frau zu dieser Zeit als Bühnen- und Kostümbildnerin engagiert war.
Den Namen dieser Stadt kennt man im Westen vielleicht wegen des zwischen ihr und dem Aussenrand der Karpaten gelegenen, im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen fast leergepumpten Erdölgebiets Rumäniens. Vor dem Erdölreichtum, so meine Frau, sei Ploeşti nichts als zwei Strassen mit einer durch den Dichter Caragiale berühmt gemachten Banlieue-Sprache gewesen, eine Wegkreuzung, die nach dem Erdölboom eine eigene Republik habe gründen wollen und zum Gespött des ganzen Landes geworden sei.
Vom Direktor per Telegramm von einer Gastarbeit am Nationaltheater Belgrad zurückgerufen, stand die junge Frau, von der ich damals noch nichts wusste, einer Zusammenarbeit mit einem Ausländer, wie sie mir später erzählte, zunächst skeptisch gegenüber, da Kontakte mit Ausländern im damaligen Rumänien meist Schwierigkeiten hervorriefen. Und bei der ersten Begegnung habe der Italiener ihr auch einen sehr impertinenten und unsympathischen Eindruck gemacht. Aber nachdem sie das Stück, das sie mit ihm machen sollte, La bottega del caffè von Carlo Goldoni, gelesen habe, hätten sie sich bei der ersten Arbeitsbesprechung sofort verstanden. Sie habe dem Italiener gesagt, sie sehe in dieser Komödie, deren eigentlicher Protagonist ein Kaffeehaus an einer belebten Kreuzung Venedigs ist in der Dogenstadt sei 1645 das erste Kaffeehaus Europas eröffnet worden), bühnenbildmässig nur ein Loch, »un trou plein de merde«, Loch im philosophischen Sinn natürlich, und zwei Minuten später seien sie sich über die Konzeption der Inszenierung einig gewesen.
Von da an habe Giorgio beim verrückten Leben, das am Ploeşti-Theater geherrscht habe, mitgemacht und sei vollends vom Balkanvirus befallen worden, von dem er sich seither nie mehr habe befreien können. Man habe, so meine Frau, praktisch Tag und Nacht im Theater gelebt, sich selbst und dabei manchmal auch fast das Theater verbrannt, oder sei ins sechzig Kilometer südlich gelegene Bukarest gefahren, von wo die meisten künstlerischen Mitarbeiter, wie auch meine Frau, stammten und wohnhaft geblieben waren.
Die grossen Feste, die regelmässig gefeiert worden seien, hätten alle im Bukarester Haus einer Grafikerin und eines Malers stattgefunden. Wohnungen, die für Feste dieser Art geräumig genug gewesen wären, habe niemand gehabt, solche zu kriegen sei unmöglich gewesen. Und an einem dieser Feste hätten Giorgio und meine Frau dann auch den aus Turin stammenden italienischen Industriellen Gian-Luca kennengelernt, dem der Vater der Grafikerin im Zweiten Weltkrieg das Leben gerettet hatte.
Der Vater der Grafikerin sei Arzt in Calafat gewesen, einer Stadt an der Donau, der Grenze zu Bulgarien, unweit Jugoslawiens. Und neunzehnhundertvierundvierzig habe er im dortigen Spital den von den Russen gefangengenommenen Italiener wegen einer Nierenkrise behandelt. Eine Pflege, die nur möglich gewesen sei, weil einige der Mitgefangenen die russischen Bewacher mit gestohlenen Zuckersäcken bestochen hätten. Aber als die Russen den Mann dann wieder hätten holen wollen, um ihn zur Zwangsarbeit in ihre Heimat zu verschleppen, habe der Arzt aus Mitleid mit seinem Patienten an dessen Zimmertür kurzerhand ein Schild angebracht, auf dem vor einer ansteckenden Krankheit gewarnt worden sei. Daraufhin hätten die Russen, die sich vor Ansteckungen mehr als vor dem Teufel fürchteten, Gian-Luca zurückgelassen, worauf er, als er wieder einigermassen gesund gewesen sei, über Bulgarien nach Italien habe fliehen können.
Dass Gian-Luca meiner Frau und Giorgio schon bald wieder begegnen sollte, wussten die beiden damals noch nicht.
Die Premiere der Bottega del caffè habe im Sommer stattgefunden und sei ein Riesenerfolg gewesen. Das Publikum habe zwanzig Minuten lang applaudiert, und kurz darauf sei die Produktion zu einem Gastspiel nach Bukarest eingeladen worden, wo es zum Eklat gekommen sei. Das Ausländerproblem habe seinen Tribut verlangt. Wegen zu vieler politischer Anspielungen sei die Aufführung zwar nicht offiziell verboten worden – so etwas sei selten offen geschehen, es hätten meist und so auch diesmal einfach keine Vorstellungen mehr stattgefunden –, aber Giorgio habe das Land, in dem er schon ein Jahr lang gelebt habe, innert vierundzwanzig Stunden verlassen müssen.
Meine Frau ging im Herbst wieder nach Belgrad, wo sie den Winter hindurch an einer Dramatisierung der Philosophie dans le boudoir des Marquis de Sade mitarbeitete – ohne zu ahnen, dass dieser Autor in ihrem Leben noch einmal eine Rolle spielen sollte –, und im folgenden Frühling konnte sie eine von ihr mitgestaltete King Lear-Aufführung des Nationaltheaters Bukarest ans RASSEGNA DEI TEATRI begleiten.
In der toskanischen Hauptstadt traf sie natürlich Giorgio wieder sowie Gian-Luca und dessen Frau Gigina, eine Journalistin, Buch- und Theaterautorin, die aus Turin angereist waren und sich, so meine Frau, liebevoll um sie kümmerten. Sie hätten herrliche Tage verlebt, es sei die Hippie-Zeit gewesen, überall habe man Musik gehört, Giorgio, Gian-Luca und Gigina hätten sie zum Kleiderkaufen und in Restaurants eingeladen, eine Party sei der andern gefolgt.
Nach zwei weiteren Gastspielstationen in Rom und Mailand reiste meine Frau erneut nach Belgrad und überzeugte die dortigen Theaterleute, Giorgio auf der Studiobühne des Nationaltheaters ein neues Stück von Gigina inszenieren zu lassen. Den Sommer verbrachte meine Frau in Bukarest, und im September begleitete sie die Lear-Aufführung ans BITEF-Festival in Belgrad, wo sie den Dramaturgen Zoran kennenlernte, den sie bat, sich des demnächst eintreffenden italienischen Regisseurs anzunehmen.
Im November neunzehnhundertzweiundsiebzig, so meine Frau, sei Giorgio dann zum ersten Mal in seinem Leben nach Jugoslawien gekommen, habe dort, in Belgrad, den Balkan und das balkanische Lebensgefühl wiedergefunden und das Land seither nie mehr verlassen. Er habe eine Schauspielerin, die Tochter eines Ministers, geheiratet und bald überall gearbeitet. Zwischendurch sei er nach Italien zurückgekehrt oder habe in anderen Ländern inszeniert, und auf diese Weise habe er die im Grunde damals relativ grosse Freiheit dieses Landes und gleichzeitig die Vorteile des Sozialismus, insbesondere im Fürsorge- und Kunstbereich, genossen. Alles, was man in Jugoslawien damals nicht habe tun dürfen – man denke heute (sie sagte das 1996) wohl mit Wehmut daran –, sei eigentlich gewesen, etwas gegen Tito zu sagen. Sonst habe man praktisch jede Freiheit gehabt.
Weil die junge Frau, von der ich damals noch nichts wissen konnte, sich kurz zuvor in einen in Bukarest lebenden Mann verliebt hatte, verzichtete sie auf eine Mitarbeit bei der Uraufführung von Giginas Stück und sah Giorgio in der Folge nicht mehr. Vier Jahre später blieb sie auf einer Gastspielreise mit Elisabeth Eins, dem Stück eines jungen Amerikaners namens Paul Foster (ich lernte Paul zusammen mit seinem Freund Richard 1983 in New York kennen), für immer im Westen.
Giorgio hatte sich inzwischen, wie meine Frau von Freunden hörte, von der Ministertochter scheiden lassen müssen, weil eine andere Schauspielerin Zwillinge von ihm erwartete, und als der Dramaturg Zoran, der mit einer Französin verheiratet war und halb in Paris, halb in Belgrad lebte, in Belgrad eines Tages selber ein Stück inszenierte, lud er, in der Hoffnung, dadurch auch einen Regieauftrag in Paris zu erhalten, den Verwaltungsdirektor des TEP, des Théâtre de l'Est Parisien, ein, sich seine Vorstellung anzusehen.
Dieser Mann, ein Bretone namens Eric de Villiers, sah sich bei der Gelegenheit aber auch eine Inszenierung von Giorgio an und lud dann nicht Zoran, sondern den in Jugoslawien lebenden Italiener für eine Arbeit nach Paris ein. Giorgio telefonierte daraufhin mit meiner Frau, die nach ihrer Emigration einige Jahre in Paris gelebt hatte, und bot ihr an, zusammen mit ihm und einem jugoslawischen Bühnenbildner Mandragola zu machen.
Der sonnige Oktobertag, an dem ich nach Paris fahren sollte, war ein Donnerstag, aber ich kam natürlich wieder nicht rechtzeitig von zu Hause los, so dass es bereits Nacht war, als ich endlich ins Auto stieg. Dafür hatte ich eine angenehme Reise mit wenig Nebel und wenig Verkehr und erreichte das Miethaus in Vincennes, wo meine Frau wohnte, schon nach sechseinhalb Stunden um halb drei Uhr morgens.
Sowohl meine Frau wie unsere Freunde, ein arbeitsloser Theateradministrator und eine etwa zehn Jahre jüngere, sich mal als Schauspielerin, mal als Autorin, mal als Malerin durchschlagende kleingewachsene Pariserin mit einem kaum zur Ruhe kommenden Mundwerk, waren noch wach und erwarteten mich in der zigarettenrauchgeschwängerten engen Küche mit einem nächtlichen Festessen aus Foie gras, Austern, Krabben und Bigorneaus. Das Geburtstagsgeschenk, das ich, ohne ihr meinerseits ebenfalls eins überreichen zu können, von meiner Frau erhielt und sofort anprobieren musste, war ein langer dunkelgelber Bademantel aus einem gerippten, kordartigen Baumwollstoff.
Nach einem gegen ein Uhr eingenommenen Frühstück fuhr ich am Freitagnachmittag mit meiner Frau zum Theatergebäude an der Rue Malte-Brun zwischen der Place Gambetta und Paris grösstem Begräbnisplatz, dem Prominentenfriedhof Père-Lachaise, und lernte dort die beiden Leute kennen, die zusammen mit Giorgio und uns nach Venedig reisen sollten. Den Verwaltungsdirektor Eric de Villiers und seine Lebensgefährtin, eine Tschechin namens Milena, die bei der Machiavelli-Produktion als Giorgios Assistentin fungierte. Beide waren etwa gleich alt wie Giorgio und ich, die Frau vielleicht etwas jünger, und sie gefielen mir in ihrer unkomplizierten Art sofort.
Eric stammte, wie ich später erfuhr, aus einer begüterten adeligen Familie, ein athletischer Typ, magerer als ich – magerer, als ich damals noch war –, aber ebenfalls mit einer Tendenz zum Rundlichen. Ein lichtes schwarzes Haargekräusel, das in der Mitte einer fortgeschrittenen Glatze auf der Stirn übriggeblieben war und in scharfem Kontrast zum Vollbart stand, der den Hals bedeckte, verlieh seinem Gesicht eine besondere Note.
Die Tschechin, deren feingeschnittene, hellhäutige Gesichtszüge von einem dunkelbraunen Lockenhaarschopf umrahmt wurden, war schlank und hatte neben ihrer Feminität auch etwas Burschikoses, das durch die Kleidung, die sie trug, eine braune Lederjacke, weisse Jeans, kurzschaftige, über die Hosenbeine ragende dunkelgraue Cowboystiefel, noch verstärkt wurde.
Einst Schauspielerin, hatte die Pragerin, die zu den Unterzeichnern der Bürgerrechtsbewegung Charta 77 gehörte, sich jetzt, nachdem sie der scharfen Repressalien und drohenden Strafprozesse wegen die Tschechoslowakei verlassen hatte, auf Regieassistenz verlegt, da ihr beim Sprechen des Französischen der Akzent zu schaffen machte. Ihr Sprachfluss war schnell, ein hartes Stakkato, und das auffallendste Merkmal war die Aussprache des französischen »u« als »i«, so dass sie zum Beispiel nie »tu sais« oder »tu vois« sagte, sondern meist »ti sais« oder »ti vois«.
Meine Frau und ich begaben uns mit den beiden zu einem Casse-croûte in ein kleines Bistrot, das die Theaterleute »Chez Gégène« oder »L'annexe« nannten (sein richtiger Name war »Café des deux Banques«, da es sich zwischen einer Filiale der CREDIT LYONNAIS und einer der BNP, der BANQUE NATIONALE DE PARIS, befand).
Im prätentiösen Pub an der Place Gambetta, so Milena, esse man nur »des steaks-frites dégueulasses« und »les frites-saucisses, croque-monsieur et cetera« im Café, das den Namen des Platzes trage, seien auch nicht appetitlicher – und erst dort erinnerte ich mich, dass ich als Student im Sommer neunzehnhundertachtundsechzig, in dem Jahr, das in Europa und in der Welt eine hoffnungsweckende Aufbruchsstimmung hervorgebracht hatte, mit einem Freund und einer Freundin für eine Woche nach Prag gefahren war und die Stadt genau zwei Tage vor dem völlig unerwarteten Einmarsch der sowjetischen Truppen und der Niederschlagung des sogenannten Prager Frühlings wieder verlassen hatte.
Gegen Abend besuchten wir zu viert noch zwei der rund vierzigtausend in Paris lebenden Rumänen, einen Theater- und Opernregisseur, der damals, nach der Scheidung von einer französischen Filmemacherin, mit einer Chemikerin und einem Papagei, den ihm der Schauspieler Jean Rochefort geschenkt hatte, in einem in den sechziger oder siebziger Jahren gebauten, von aussen hässlich anzusehenden Haus aus grauem Beton an der Grenze zwischen dem 18. und dem 19. Arrondissement wohnte und an diesem Abend als weiterer Waagemensch seinen Geburtstag feierte.
Giorgio lernte ich erst am folgenden Abend, dafür gleich doppelt, als Person und als in seiner Inszenierung materialisierten Geist kennen. Und beides, sowohl der Anblick seiner Erscheinung wie der des Geschehens auf der Bühne, versetzte mir einen Schock.
Etwa einen halben Kopf grösser als Eric und ich, wies Giorgios Figur zwar keine besonderen Merkmale auf, dafür erschreckte einen sein längliches Gesicht. Zwischen kurzgeschnittenem schwarzem Kopfhaar und einem kurz gestutzten schwarzen Vollbart sassen über einer Knollennase stechend bis durchdringend schauende schwarze Augen, von denen das linke extrem schielte.
Wegen der groben Formen hatte man das Gefühl, einen brutalen Menschen vor sich zu haben, wobei das Furchterregendste aber das extrem schielende linke Auge war. Sobald das Gesicht zusammen mit dem Körper in Bewegung geriet, änderte sich der Gesamteindruck jedoch, brachte das Zusammenspiel den Charme und das Temperament des Mannes zum Ausdruck. Wenn der von schwarzem Haar umgebene Mund zu sprechen begann und die schwarzen Augen neben einem bösen, zornigen und wütenden auch einen lachenden, sanften, listigen und humorvollen Ausdruck annahmen und unzählige weitere Gemütszustände spiegeln konnten, war das Furchterregende verschwunden.
Voll zur Entfaltung kam das impulsive, aufbrausende, laute und herzliche Wesen des Italieners dann natürlich beim grossen Fest, das nach der Vorstellung in den Kellerräumen des Theaters stattfand und bis in die frühen Morgenstunden dauerte, einem Premierenfest übrigens im französischen Sinn. Denn in Frankreich findet das, was man im deutschen Sprachraum eine Theaterpremiere nennt, raffinierterweise gleich zweimal statt. Einmal als erste Vorstellung, die zwar la première genannt wird, dann aber auch noch als zweite Vorstellung, die, weil die Kritik sich erst diese ansieht, la presse genannt wird. Deshalb ist die zweite Vorstellung auch wichtiger und wird so gefeiert wie im deutschsprachigen Raum die Premiere.
Der Witz dabei ist, dass die französischen Kritiker auf diese Weise diejenige Vorstellung sehen, die auch im deutschen Theater meist die bessere ist.