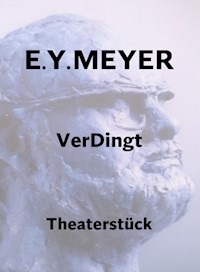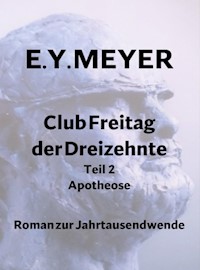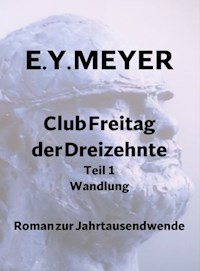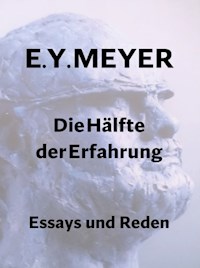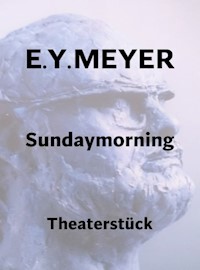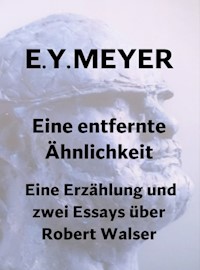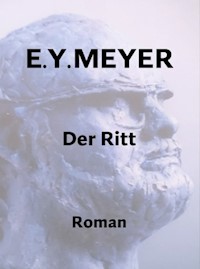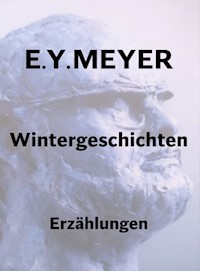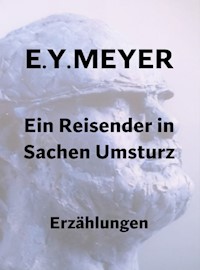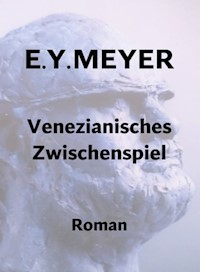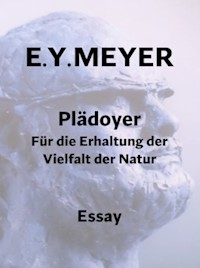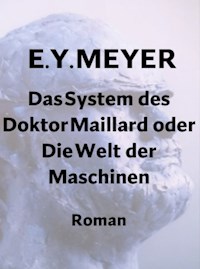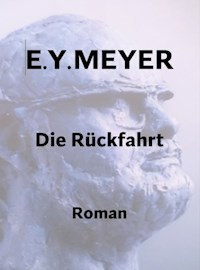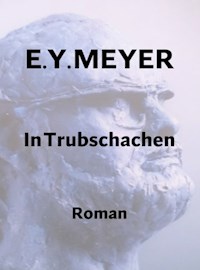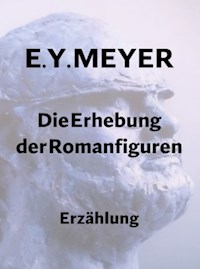
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unglaublich, aber wahr: Romanfiguren verwandeln sich in Wesen aus Fleisch und Blut und revoltieren gegen den Autor, der sie geschaffen hat. In dieser Erzählung lässt E. Y. Meyer, der Autor des Sensationsromans »In Trubschachen«, einen emeritierten Philosophie-Professor einen Bericht über das Schicksal eines jungen Schriftstellers schreiben, der einst sein Schüler gewesen war, der dann, nachdem er einen Roman über ein Dorf in der Schweiz geschrieben hatte, aber unter merkwürdigen Umständen plötzlich verschwand und wie vom Erdboden verschluckt blieb. Der Grund dafür, dass er den Bericht schreibt, obwohl er seinem jungen Freund einst das Versprechen gegeben hatte, über die möglichen Hintergründe, die zu seinem Verschwinden geführt haben, zu schweigen, ist eine Postkarte, die bei ihm eingetroffen ist. Eine Postkarte, die in einem westafrikanischen Land aufgegeben worden war und auf der Vorderseite eine bunte Marktszene zeigte. Auf deren Rückseite aber nur der Name des Professors und seine Adresse standen und das englische Wort „Well“ zusammen mit dem Buchstaben „M“. Wenn man den Roman »In Trubschachen« gelesen hat, verspricht das Lesen dieser Erzählung wunderbaren zusätzlichen Genuss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
E.Y.Meyer
Die Erhebungder Romanfiguren
Erzählung
Mit einem Nachwort vonHeinz Schafroth
Erstmals erschienen 1975
Als eine von den drei Erzählungen
in dem Suhrkamp-Taschenbuch
«Eine entfernte Ähnlichkeit»
Neufassung
© 2021 E.Y.MEYER
eymeyer.ch
Cover:
Bronzekopf des Autors
Geschaffen 1997 von PAN YI QUINAcademy of Arts & Design
Tsing Hua UniversityBei Jing, China
Inhalt
I Die Erhebung der Romanfiguren
II Von allen verstanden: Die Fremdsprache Poesie
Nennen Sie mich András. Felsöloci. Auch wenn dies möglicherweise nicht mein richtiger Name ist oder ein Name, unter dem mich niemand mehr kennt.
Aber der Name tut nichts zur Sache. Und wenn Sie die nachfolgenden Zeilen gelesen haben, werden Sie vielleicht verstehen, warum.
Es geht dabei um ein Versprechen, das ich einem Freund gegeben habe, von dem ich nicht weiss, ob er noch lebt. Oder ob er inzwischen vielleicht tot ist.
Nach langem Zögern habe ich mich, trotz gewisser immer noch ungeklärter Reste darin, jedoch entschlossen, die Geschichte – so wie ich sie erfahren habe und so wahrhaftig, wie mir das möglich ist – in ihrem ganzen mir bekannten Umfang zu erzählen.
Denn auch ich bin nur ein Mensch mit seinen Fehlern und Schwächen.
Und so, wie mein Freund sich mir anvertraut hat, halte auch ich es jetzt nicht mehr aus, ohne mich ebenfalls jemandem anzuvertrauen.
Zudem glaube ich, dass ich, nach allem, was bisher geschehen ist, gar nicht mehr schweigen darf, sondern dass es – ich zögere nicht, es zu sagen – meine menschliche Pflicht ist zu sprechen.
Eine unangenehme und vermutlich nicht ungefährliche Pflicht zwar, aber eben doch eine jener Pflichten, von denen ich glaube, dass man als Mensch nicht um sie herumkommt.
Durch den Lauf, den die Ereignisse genommen haben, fühle ich mich auch nicht mehr an das meinem Freund gegebene Versprechen gebunden, bis er es mir sage, niemandem, auch mir seit langem bekannten Menschen gegenüber, etwas von seinen Vermutungen und Befürchtungen verlauten zu lassen oder auch nur anzudeuten.
Ich solle, wenn die Sprache auf dieses Thema komme, am besten gar nicht darauf eingehen und auf das Risiko einer Brüskierung meiner Gesprächspartner hin kurzerhand ein anderes anschneiden.
Vorsichtsmassnahmen, die mir zuerst als masslos übertrieben und lächerlich vorgekommen sind, von deren damaliger Berechtigung ich nun aber je länger, je mehr überzeugt, ja sogar mehr als überzeugt bin.
Trotzdem kann ich mir keiner Schuld bewusst sein, da ich – auch das muss ich sagen – einmal gegebene Versprechen, und wenn sie mir noch so lächerlich vorgekommen sind, bis jetzt immer gehalten habe, und es mir auch jetzt nicht leichtgefallen ist und der ausserordentlichen und ungewöhnlichen Begebenheiten, die stattgefunden haben, bedurft hat, mich ein Versprechen, das ich einem Freund – wie ich jetzt sogar zu glauben meine, meinem besten Freund – gegeben habe, brechen zu lassen.
Das einzige, was mich in der letzten Zeit, in der ich mich fast ausschliesslich mit dieser Geschichte beschäftigt habe, immer wieder an meiner Schuldlosigkeit zweifeln liess und letztlich vielleicht auch den Anstoss zu dem Versuch gegeben hat, mir dadurch, dass ich die Geschichte jemandem erzähle, endgültige Klarheit darüber zu verschaffen, ist die Frage, ob ich meinen Freund von seinem letzten, entscheidenden Entschluss, von dem er sich durch nichts hatte abbringen lassen, vielleicht nicht doch noch – wenn es nicht anders gegangen wäre, in Gottes Namen halt mit Hilfe der Polizei oder eines Arztes und von Krankenwärtern – hätte abhalten und seine Ausführung hätte verhindern können.
Etwas, das ich damals auch erwogen, schliesslich aber, da er zu diesem Zeitpunkt vielleicht übernervös und überreizt, keinesfalls jedoch krank oder gar gemeingefährlich gewesen war, als vollkommen unverhältnismässig verworfen hatte.
Möglicherweise wäre es für meinen Freund besser gewesen, für einige Zeit unter irgendeinem Vorwand festgehalten zu werden, aber wer – ausser ihm selbst – hätte das schon entscheiden und verantworten können.
Obwohl ich meine ganzen Kräfte dafür eingesetzt hätte, dass ihm der Aufenthalt, in einem Gefängnis, einer Nervenheilanstalt oder wo immer, so angenehm wie möglich gestaltet, und er nach einer angemessenen Zeit wieder, ohne Nachteile davonzutragen, entlassen worden wäre.
Dass ich, als mich mein Freund das erste Mal besuchte, um mir von den Ereignissen zu erzählen, die den Anfang der hier noch einmal zur Sprache kommenden Geschichte bildeten, gerade in Lange-Eichbaums 1948 erschienenem Nietzsche-Buch – »Nietzsche, Krankheit und Wirkung« – las, muss als reiner Zufall angesehen werden und kann nichts mit der Verhaltensweise meines Freundes im weiteren Verlauf der Geschehnisse zu tun haben.
Und wenn ich mir – wahrscheinlich noch zu stark unter dem Eindruck der Lektüre stehend – zunächst trotzdem einbildete, irgendeinen vagen Zusammenhang zwischen der Situation meines Freundes und dem Inhalt des Buches zu spüren, so hat sich das spätestens geändert, als sich das, was mein Freund befürchtet und bereits damals mit einer erstaunlichen Klarheit vorausgesehen hat, zu verwirklichen begann...
»... ich kann mir nicht helfen», hatte mein Freund gesagt, «aber ich werde das Gefühl nicht los, dass sich hinter dieser Angelegenheit mehr verbirgt, als es den Anschein macht. Und ich versichere Dir, dass ich nicht eher Ruhe geben werde, als bis ich herausgefunden habe, ob mich dieses Gefühl getäuscht hat oder nicht. Jemand anderes als Du würde vielleicht versuchen, meine Vermutungen der überbeanspruchten und überforderten Fantasie eines schreibenden und Geschichten erfindenden Aussenseiters und Schöngeistes zuzuschreiben und als eine der üblichen Unwahrscheinlichkeiten aus dem Bereich der literarischen Konstruktionen abzutun, und ich würde nicht einmal viel dagegen einwenden können. Und doch habe ich meine Gründe und auch einige handfeste Hinweise für die Annahme, dass die jetzt in Erscheinung tretenden Personen und Instanzen nicht die eigentlichen Urheber dessen, was sich da anzubahnen beginnt, sind, sondern dass da ganz andere Leute dahinterstecken, denen das niemand auch nur im Geringsten zutrauen würde. Leute, wie sie sonst nur in Romanen vorzukommen scheinen...«
Als auslösendes Moment für meinen Entschluss, die Geschichte nicht länger für mich allein zu behalten, ist aber schlussendlich die in mir zur Gewissheit gewordene Ahnung zu betrachten, dass es meinem Freund nie mehrmöglich sein wird, mich, wie er es als denkbar offengelassen hatte, von meinem Versprechen zu entbinden, zu niemandem davon zu sprechen.
Eine Gewissheit, die ich mir auch durch bestimmte Vorkommnisse in der allerletzten Zeit nicht nehmen und erschüttern lasse, die nun ihrerseits ohne Zweifel meinen eigenen überreizten Sinnen und Nerven zugeschrieben werden müssen – obwohl sich zu den auf Einbildung zurückzuführenden Eindrücken, meinen Freund für kurze Augenblicke an den verschiedensten Orten plötzlich wiedergesehen zu haben, auch eine so konkrete und nachprüfbare Tatsache wie das Eintreffen einer Postkarte aus einem westafrikanischen Land gesellte, die neben meiner Anschrift nur das englische Wort «Well»und den Buchstaben «M» aufwies.
Wer immer diese Geschichte hören wird, soll selbst entscheiden, ob er auch meinen diesbezüglichen Feststellungen Glauben schenken oder ob er mich als Mitbeteiligtenin der Geschichte sehen will, der letztlich auch schon ihr Opfer geworden ist – ganz zu schweigen von dem, was er von der Sache mit der Postkarte halten will.
Dafür, dass ich schon ganz von Anfang an in entscheidender Weise an der Geschichte beteiligt bin, gibt es zwar keine nachweisbaren Gründe, sondern einzig und allein meineAussagen, aber eine solche Beteiligung zu bestreiten wäre ebenso lächerlich wie sinnlos, da ihre Tatbestände von einer Gewöhnlichkeit und Harmlosigkeit sind, die ein Voraussehen auch nur der geringsten schwerwiegenden Folgen, die sich aus ihnen ergeben könnten, für einen nicht übermässig ängstlichen und misstrauischen Menschen schlicht und einfach unmöglich machen.
Oder was hätte ich mir denn dabei denken sollen, als ich meinem Freund für einen Aufenthalt über Weihnachten und Neujahr ein Dorf und einen Gasthof empfahl, in dem ich mich selbst schon zu meiner völligen Zufriedenheit aufgehalten hatte.
Oder als ich es ihm ermöglichte, in einer – wie man, glaube ich, ruhig sagen kann – zurzeit immer noch führenden deutschsprachigen Literaturzeitschrift, deren Herausgeber zu meinen Freunden gehört, eine seiner Geschichten zu veröffentlichen, die ich immer noch gut finde und deren Veröffentlichung mir als durchaus gerechtfertigt erschienen war?
»... ich glaube», hatte ich gesagt, «es wäre wichtig, dass wir meinen Freund dazu bringen könnten, diese Geschichte von dir in seiner Zeitschrift zu veröffentlichen. Aber ich will dir diesbezüglich keine falschen Hoffnungen machen, da mein Freund ein recht launischer und nicht gerade freudiger Briefeschreiber ist und du dich deshalb unter Umständen auf eine lange Wartezeit gefasst machen musst. Ich weiss auch nicht, wie ihm die Geschichte gefallen wird, oder ob wir ihm nach einiger Zeit noch eine neue Fassung, vielleicht mit einem anderen Schluss, schicken sollten, damit er die dann einmal bringt. Das hängt oft ganz von Zufällen ab. Nach einem halben oder ganzen Jahr erinnert er sich plötzlich wieder an die Geschichte, und dann kann sie schon in der nächsten Nummer abgedruckt sein...«
Wie meinen bisherigen Bemerkungen zu entnehmen ist und obwohl es zunächst vielleicht befremdend sein mag, habe ich mich im Weiteren – aus Gründen, die im Verlaufe der Geschichte unschwer auszumachen sein werden – auch dazu entschlossen, auf die Nennung von Namenin Bezug auf Orte und Personenzu verzichten, was jedoch nicht heisst, dass ich mich, bei gewissen immer noch möglichen Wendungen, zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt nicht doch dazu durchringen könnte, diese im Interesse eines höheren Anspruches preiszugeben.
Ich gestatte mir aber, meine Erzählung mit einigen anderen Angaben eher allgemeinererNatur zu der Person meines Freundes zu beginnen, die ich für das Verständnis der weiteren Ereignisse um ihn herum für unablässig halte, wobei da ohne Zweifel in erster Linie eine meiner Meinung nach offensichtliche Begabung für das Schreiben und sein mehr oder weniger ernsthaft erklärtes Ziel, den Beruf eines sogenannten freien Schriftstellers auszuüben, zu nennen wäre.