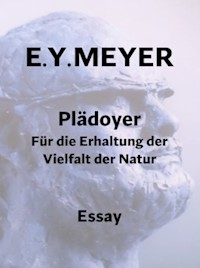3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Wirtshaus »Schützen« eines Schweizer Dorfes wird der Erzähler Zeuge des Selbstgesprächs eines verschrobenen und angeheiterten Alten, der vom Wein, Litern getrunkenen Blutes und von Nierenleiden berichtet. Tage und Wochen danach beschäftigt jener Mann den Erzähler und erinnert ihn an einen anderen, an den 71-jährigen Schriftsteller und Anstaltsinsassen Robert Walser auf einer historischen Fotografie. Er sucht den alten Mann und findet ihn im nahegelegenen ehemaligen Kloster, das jetzt Alters- und Pflegeheim ist. Loser, so sein Name, wird dem Erzähler zur Projektionsfläche für die Erinnerung an die Spaziergänge und Gespräche Carl Seligs mit Walser – und doch auch wieder nicht, denn Loser behauptet sich selbst mit seinen Geschichten von Hilfs- und Gelegenheitsarbeiten. E. Y. Meyer erweist sich als Meister der feinen Beobachtung und der präzisen Beschreibung. Zwei Essays über Robert Walser begleiten die Erzählung. Stimmen zu E. Y. Meyer »Eine ungemein suggestive und kraftvolle Prosa, zu der man jeden Leser nur beglückwünschen kann.« Adolf Muschg »Wie E. Y. Meyer Erinnerung und Erwartung entstehen lässt, das ist einfach wunderbar.« Siegfried Lenz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
E.Y.MEYER
Eine entfernte Ähnlichkeit
Eine Erzählung undzwei Essays über den Schweizer Schriftsteller Robert Walser
Erstmals erschienen 1975
© 2022 E.Y.MEYER
eymeyer.ch
Cover:
Bronzekopf des Autors
Geschaffen 1997 von PAN YI QUINAcademy of Arts & Design
Tsing Hua UniversityBei Jing, China
Die Anstalt war ein ehemaliges Kloster, das für die Besitzlosen eingerichtet worden war. Dünne Eisdecken bedeckten die Pfützen der
Strassen, welche zum Armenhaus führten.
Friedrich Glauser
Inhalt
Eine entfernte Ähnlichkeit
Zwei Robert Walser Essays
1 Sympathie für einen Versager
2 Ein grosser Spaziergänger
Zeittafel zu Robert Walser
Eine entfernte Ähnlichkeit
VON ALLEN IHM bekannten Wesen sei er selber das am wenigsten spezialisierte und deshalb am meisten anpassungsfähige. So wie immer das Unspezialisierte wandelbarer und damit zukunftsvoller bleibe, sei er deshalb auch katastrophenhärter als alle höheren Tiere.
In jeder neuen Umgebung könne es ihm gelingen, ein für die Gegebenheiten geeignetes und sich in ihnen bewährendes Verhalten herauszuarbeiten. Er nähre sich bald von der Jagd, bald vom Fischfang, baue seine Hütte bald aus Holz, bald aus Stein, bald aus Schnee. Deshalb habe er sich auch als einziges Wesen über die ganze Erde auszubreiten vermocht, denn wohin er auch gekommen sei, habe er sich auf die bestehenden Verhältnisse eingerichtet.
Man finde ihn in den kältesten und in den heissesten Gegenden, an den Polen und am Äquator, auf dem Wasser und zu Lande, im Wald und in der Steppe, im Sumpf und im Gebirge.
Während die Inuits bis zu zwei Dutzend oder noch mehr Wörter für fallenden und ebenso viele für liegenden Schnee hätten, ohne dabei einen Oberbegriff für Schnee zu kennen, würden den Gauchos bis zu zweihundert für das Pferd, aber nur vier für Pflanzen zur Verfügung stehen. Und das gleiche würde man bei den Arabern für die Worte Kamel, Sand und die Farbe Braun finden.
Man kennt die Thesen und die Beispiele.
Und so sei er also, wie er es später immer wieder genannt habe, hingegangen und habe sich die Erde und alles, was sich auf ihr befinde, untertan gemacht.
Man hatte die in dem ehemaligen Kloster und um dieses herum entstandene Anstalt schon früher besucht.
Obwohl durch hügeligeres Gebiet führend und deshalb kurvenreicher, war man die an der Anstalt vorbeiführende, landschaftlich abwechslungsreichere Nebenstrasse stets lieber gefahren als die in ihrem letzten Teil zur Autostrasse ausgebauten Kantonsstrasse, die der eingleisigen Bahnlinie folgte und mit dieser zusammen die Hauptverkehrsachse der Gegend bildete.
Und eines Tages, es musste an einem Sonntag im November oder anfangs Dezember gewesen sein, zur Zeit also, in der man in der Schule die Klöster und das Klosterleben durchnahm, hatte man auf der Anhöhe oberhalb der Anstalt Halt gemacht und die in einer leichten Mulde liegende, weilerähnliche Siedlung fotografiert.
Wieder hatte einen das plötzlich vor einem liegende Nebelmeer überrascht, das bis an den Jura hinüberreichte und bis vor kurzem auch die Anstaltsgebäude bedeckt haben musste, sich im Moment aber zwischen den Dächern und Mauern lichtete und aufzulösen begann.
Nur noch hier und da hatten dichtere Schwaden die sonnenbeschienene Landschaft oberhalb der Anstalt bedeckt oder unscharf erscheinen lassen, die Sicht aber schon auf eine von einem roten Kran überragte Baustelle auf der nähergelegenen Seite der Anstalt, auf den der Anstalt angeschlossenen landwirtschaftlichen Betrieb auf der anderen Seite sowie auf die obersten Teile der einzeln oder nebeneinanderstehenden ästereichen Bäume der Mulde freigegeben.
Hell und deutlich war auf der gegenüberliegenden Seite des Nebels in der ersten Jurakette die schneebedeckte Höhe des Chasserals zu erkennen gewesen.
Als man das Auto kurz darauf an der Strasse oberhalb des ehemaligen Klostergartens abgestellt hatte, waren auch die letzten Nebelschwaden verschwunden gewesen, und die auf dem höchsten Punkt ihrer Bahn stehende Wintersonne hatte die angenehm frische Luft erwärmt.
Die in der Sonne glänzenden, messingenen Zeiger der Turmuhr hatten, durch einen minimen Winkel getrennt, beinahe senkrecht nach oben gezeigt.
Eine fast vollständige Stille hatte die Siedlung umgeben. Nur ab und zu war sie von einem vorbeifahrenden Auto unterbrochen worden.
Die moosbewachsenen braunroten Ziegel der ineinandergeschachtelten Giebel- und Krüppelwalmdächer waren trocken und nur gelegentlich noch von kleineren Schneeflächen bedeckt gewesen.
Neben auffallend kleinen Mansardendächern mit kleinen Mansardenfenstern hatten sich auffallend dünne und hohe graue Kamine erhoben.
Die dünnsten Zweige der Bäume im ehemaligen Klostergarten, der immer noch als Garten genutzt wurde, waren mit Raureif überzogen, und über die Mauer um den Garten herum war zum Teil mit Schnee bedeckter Efeu gewachsen.
Obwohl sich sonst immer einige oder mehrere Anstaltsinsassen um die Gebäude herum oder der Strasse entlang aufgehalten hatten, war man niemandem begegnet, als man der Frontseite des ehemaligen Klosters entlanggegangen war.
Auch der Hof, der durch die halbkreisförmig an das ehemalige Kloster angebauten neueren Anstaltsgebäude gebildet wurde, war leer gewesen, so dass man ihn ungehindert hatte betreten können.
Neben einem kleinen Garten, der von einer dünnen Schneeschicht bedeckt und von einem reifüberzogenen Drahtgehege umgeben war, hatten zwei von Dreck durchzogene, zusammengeschmolzene und verharschte Schneehaufen gelegen.
Vom untersten Teil des von dieser Seite aus zur Gänze sichtbaren Turms, auf dessen Uhr die messingenen Zeiger bereits wieder einen grösseren Winkel bildeten, hatte eine überdachte Steintreppe schräg nach oben zu einem nach aussen vorstehenden, ebenfalls überdachten Gang geführt, unter dem sich eine halbgeöffnete Tür befunden hatte, die in das ehemalige Klostergebäude hineinführte.
Im Gegensatz zu den grossen, fensterartigen Öffnungen in der Seitenmauer der Steintreppe waren die Öffnungen des Ganges mit einem Rahmen und festen Fensterflügeln verschlossen, die durch weisse Holzleisten in viele kleine, hochstehende Rechtecke unterteilt waren.
Auf den sich in ihrem obersten Teil kelchartig verbreiternden Pfeilern zwischen den Fenstern befanden sich die Wappen zweier emmentalischer und diejenigen zweier weiterer bernischer Ämter, und das Mauerband unter ihnen wies drei in verschnörkelter Schrift gemalte Jahreszahlen aus dem Anfang des Jahrtausends auf.
Wegen der Spiegelung der Umwelt in den Glasflächen waren die beiden männlichen Insassen der Anstalt, die sich unmittelbar hinter den Scheiben aufgehalten hatten, der eine sitzend, der andere stehend, nicht gleich zu erkennen gewesen, so dass man zusammengefahren war, als man ihre wahrscheinlich durch die Verzerrung des Glases, aber man war da nicht ganz sicher gewesen, abnorm erscheinenden Gesichter wahrgenommen hatte, die schon die ganze Zeit über unverwandt zu einem herunter geschaut haben mussten.
EINE BEGEBENHEIT, DIE SICH im Frühling des darauffolgenden Jahres abspielte, war der Grund dafür gewesen, dass man das ehemalige Kloster oder, wie man nun wohl sagen musste, Alters- und Pflegeheim noch ein zweites Mal aufgesucht hatte.
An einem schulfreien Nachmittag im März oder April, jedenfalls vor Ostern, also auch vor den Frühlingsferien und somit wohl eher im März, hatte man seine Schwester an ihrem Arbeitsplatz, dem Medizinisch-Chemischen Institut der Universität, abgeholt, um mit ihr die im Bezirksspital des Wohnorts der Eltern liegende Mutter zu besuchen.
Es war ein schon recht warmer Tag gewesen, und man war übereingekommen, die Nebenstrassenstrecke zu nehmen und erst unterwegs, in einem der an der Strasse liegenden Gasthäuser, einem Landgasthof, etwas zu essen, um danach, gegen drei Uhr, wenn die Mutter nach dem Essen eine Zeit lang geschlafen hätte, direkt ins Spital zu fahren und nicht noch zuerst das leere Elternhaus aufzusuchen und dort eine Mahlzeit zuzubereiten.
Der dem Alters- und Pflegeheim auf der anderen Strassenseite gegenüberliegende »Hirschen«, den man hatte aufsuchen wollen, was für beide, die Schwester und einen selbst, das erste Mal gewesen wäre, hatte geschlossen gehabt, so dass man erst kurz nach den Zweien im übernächsten Dorf im »Schützen« eingekehrt war und, da die Küche schon zu und der Koch schon weg gewesen war, nur noch etwas Kaltes, einen gemischten Salat, Bauernwurst, Milch, ein Restaurationsbrot und ein Bier, hatte bekommen können.
Und während des Wartens auf das Essen hatte einer der sonst noch anwesenden Gäste, ein kleiner alter Mann in bäuerlicher Kleidung mit kurzgeschnittenen weissen Haaren, der allein an einem runden Tisch in der Mitte der Gaststube vor einem Dreier Roten sass, nachdem er einen Schluck Wein genommen hatte, zuerst zu sich und zu der Serviertochter und dann nur noch zu sich, aber so laut, dass es in der ganzen Gaststube hatte gehört werden können, also auch an dem Tisch, an dem die Serviertochter und eine weitere Frau, wahrscheinlich die Wirtin und Schwester der Serviertochter sassen, zu sprechen begonnen.
Das gebe Kraft! Sie solle ihm gerade noch einen bringen. Ja, vom gleichen. Algerier!
Was? Kein Algerier? Was denn das für einer gewesen sei?
So. Magdalener. Also gut. Dann solle sie ihm halt wieder von dem bringen.
Aber warum sie denn hier keinen Algerier hätten? Der koste wahrscheinlich einen Batzen oder zwei weniger. Deswegen würden sie keinen haben.
Das seien doch immer die gleichen Herrgottsdonner. Diese Wirtsleute. Und alles nur wegen einem Batzen oder zwei. Herrje!
Aber eine Kraft gebe einem dieser Wein. Das würden sie nicht glauben.
Er würde heute noch ein halbes Kalb oder eine halbe Sau herumtragen können. Wenn die Sache mit dem Rücken nicht wäre. Das würde ihm nichts zu tun geben.
Nur eben. Das sei nicht mehr wie früher.
Früher, da habe er eine Zeitlang jeden Tag einen halben Liter Blut getrunken. Kälberblut. Das habe eine Kraft gegeben. Potz!
Da habe er eine Kraft gehabt. Er hätte ein Eisen krümmen können. So eine Kraft habe er gehabt.
Aber alles nur wegen dem Kälberblut. Kälberblut!
Am Morgen, wenn sie dagehangen seien, schnell mit dem Messer hineingestochen. Und wenn es herausgespritzt sei, den Mund hingehalten, solange es noch warm gewesen sei. Das habe eine Kraft gegeben.
Die Störenmetzger, die hätten es manchmal noch von der Sau gesoffen. Zack. Mit dem Hammer eins ins Genick. Dann aufgehängt, hineingestochen und gesoffen.
Einmal hätten sie einen Eber gebracht. In Langnau. Ins Schlachthaus. Fünf Zentner schwer. Sie hätten gemeint, es sei eine Kuh.
Ist das eine Kuh? Ist das ein Rind? hätten sie gefragt. Zwei fünfunddreissig mit dem Schwanz.
Beim Lehmann hätten sie eine Sau gemetzget. Da habe der Störenmetzger auch gefragt: Ist das eine Kuh?
Aber beim Eber in Langnau sei die Kugel nicht durch den Schädel. Und der sei losgerast, mit der Kugel im Kopf. Habe das Seil durchgerissen.
Pferdebeine abhacken und so, das habe Kraft gebraucht. Därme wegräumen und dieses Zeugs habe nicht viel zu tun gegeben.
Aber dann sei wieder andere Ware gekommen. Da habe es geheissen: So, los. Zeig, was du kannst. Zeig, was du für eine Kraft hast!
Damals habe er eine Kraft gehabt. Ja heute noch. Heute habe er noch eine Kraft. Er würde es noch mit manchem Vierzigjährigen aufnehmen.
Und das Essen sei auch gut gewesen. Das sei etwas anderes gewesen als da oben. Im Heim.
Dreimal in der Woche Kuttelsuppe! Ob sie das hier auch machen würden? Kuttelsuppe.
Wahrscheinlich nicht. So richtig dick. Mit Tomatensosse. Das sei dann etwas Gutes!
Da habe er jeweils mehr als nur einen Teller voll genommen. So mit Kartoffeln und einem Sösselchen daran. Im Wirtshaus würde man dafür acht, neun Franken bezahlen. Ohne weiteres.
Und einen guten Lohn habe er auch gehabt. Hundertfünfzig Franken im Monat. Und wenn er durchhalte, nach zwei Jahren zweihundert, hätten sie gesagt.
Heute sei das ja nichts mehr. Heute würden sie ja soviel als Sitzungsgeld erhalten. In Bern. Im Grossen Rat. Nur dafür, dass sie dasitzen und grosse Reden halten und schwatzen.
Der Verwalter sei ja auch so einer.
Und dann noch einen dreizehnten Monatslohn dazu. Gestern hätten sie es gesagt. Im Fernsehen. In der Tagesschau. Dass sie es beschlossen hätten. Für die Bundesbeamten.
Dabei. Was das denn sei? Ein dreizehnter Monatslohn? Das gebe es ja gar nicht. Einen dreizehnten Monat. Und dann solle es einen dreizehnten Monatslohn geben?