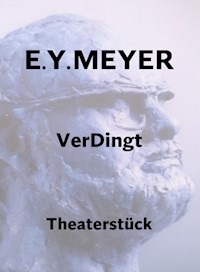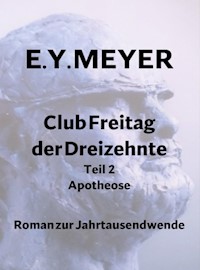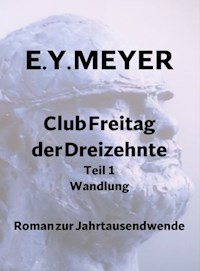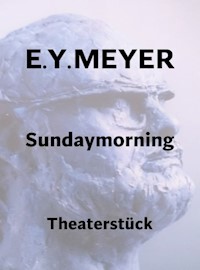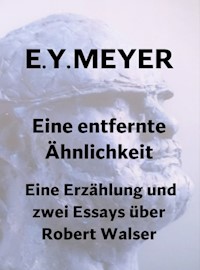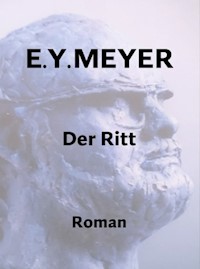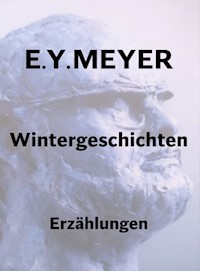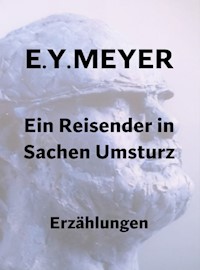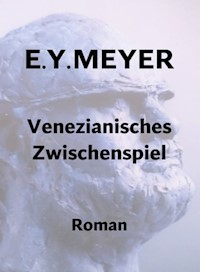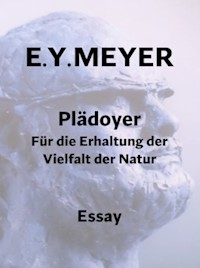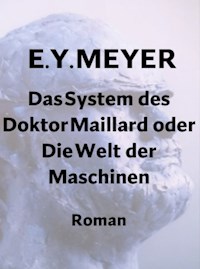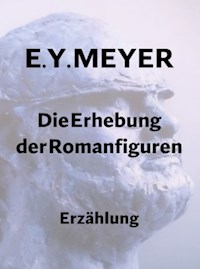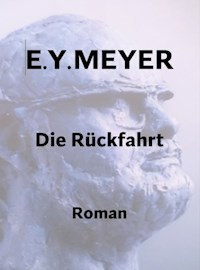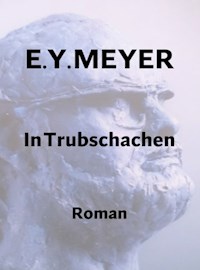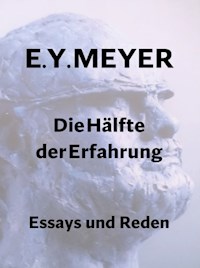
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Hälfte der Erfahrung versammelt Essays und Reden, die zwischen 1972 (dem Jahr von E. Y. Meyers erster Buchveröffentlichung) bis 1980 entstanden sind. Es sind Reflexionen über Lebens-, Schreib- und Leseerfahrungen und über deren Wechselwirkung untereinander. Die Texte zeigen, wie jemand, vom Leben bestimmt, zum Schreiben kommt, und wie nun seinerseits das Abenteuer des Schreibens und der zum Beruf gewordenen Schriftstellerei das Leben zu bestimmen beginnt: den Weg einer beginnenden Identitätsfindung und deren Behauptung in einer Welt, in welcher der Druck der Anonymität, der die Identität des Einzelnen zu zerstören droht, immer stärker wird. Die Essays »Ach Egon, Egon, Egon« und vor allem »Das Zerbrechen der Welt« – letzteres befasst sich mit der am Anfang von Meyers Schreiben stehenden »Kantkrise« – sind von der Kritik und in wissenschaftlichen Arbeiten zu Meyers Werk immer wieder als »Schlüsseltexte« bezeichnet worden. Die Auseinandersetzung mit dem Leben und Werk anderer Schriftsteller – in welcher in einem Prozess von Wiedererkennen und Befremdungsspüren, in einem Entdecken von Ähnlichkeiten und in einer Vornahme von Abgrenzungen die eigene Identität Konturen anzunehmen beginnt – umfasst ein Spektrum, das von Kant und Voltaire bis zum modernen Kriminalroman (oder im Musikbereich bis zum King of Rock’n’Roll Elvis Presley) hin reicht. Weitere Schwerpunkte sind Robert Walser, Hermann Hesse, Robert Louis Stevenson. Neben Texten, die sich mit der Schweiz und Schweizer Verhältnissen befassen, stehen Texte, die sich zur Welt hin öffnen – ja sich ausdrücklich um eine bessere Kenntnis und ein besseres Verständnis unserer selbst und der Welt, in der wir leben, bemühen. Um eine unromantische, unsentimentale, nüchtern realistische Sicht der Welt, deren unsere – ob wir das wollen oder nicht – von den Naturwissenschaften geprägte Zeit so dringend zu bedürfen scheint. Im Eingespanntsein zwischen Zufall und Notwendigkeit, zwischen Freiheit und naturgegebener und deshalb wohl unüberwindbarer Begrenztheit sieht Meyer ein Grundparadoxon der menschlichen Situation. Im Sinne von Goethes Wort, »dass die Erfahrung nur die Hälfte der Erfahrung ist« endet das Buch mit einer Kritik der Auswüchse des gegenwärtigen Kulturbetriebs und mit der Forderung nach einer neuen Aufklärung über die Natur des Menschen und der Welt – der Aufforderung, die falschen Paradiese, die wir uns aufgebaut haben, zu verlassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
E.Y.MEYER
Die Hälfteder Erfahrung
Essays und Reden
Erstmals erschienen 1980
© 2022 E.Y.MEYER
eymeyer.ch
Cover:
Bronzekopf des Autors
Geschaffen 1997 von PAN YI QUINAcademy of Arts & Design
Tsing Hua UniversityBei Jing, China
Inhalt
Ach Egon, Egon, Egon
Das Zerbrechen der Welt
Die Hälfte der Erfahrung
An den Main
Sympathie für einen Versager
Ein grosser Spaziergänger
Die grossen und die kleinen Wörter
Der grosse Durst
Freddy, Elvis & Co und die Folgen
Das Holz, aus dem die Träume sind
Spotten Sie nicht über Kriminalromane
Ein Buch für Winterabende
Echo der Zeit
Von den Schwierigkeiten »kluger Kritik«
1. August
Frei, freier, am freisten
Schweizerschriftsteller
Grazer »Heimat-Rede«
Wissenswertes
Vita
Ach Egon, Egon, Egon
Ein Briefwechsel mit Monsieur de Voltaire anlässlich seines »Candide«
Candide war ein Jüngling, der einen sehr sanftmütigen Charakter, ein argloses Gemüt und einen gesunden Menschenverstand hatte und deshalb auch seinen französischen Namen trug, der auf Deutsch so viel wie rein, lauter, unschuldig und treuherzig bedeutet. Trotz seines Namens lebte dieser Jüngling jedoch nicht etwa in Frankreich, sondern auf dem Schloss des Freiherrn von Thunder ten Tronck in Westfalen und war der uneheliche Sohn einer Schwester des »Barons«, wie ein Freiherr in Deutschland angeredet wird.
Der Candide unterrichtende Hauslehrer mit dem griechischen Namen Pangloss, der auf Deutsch so viel wie Allesredner bedeutet, lehrte die Metaphysico-theologico-cosmologie und vertrat die Lehre des Philosophen Leibniz, der meinte, dass Gott die Welt nicht geschaffen hätte, wenn sie nicht unter allen möglichen die beste gewesen wäre und immer noch sei. Eine Lehre, die der englische Dichter Alexander Pope in seinem Lehrgedicht »Essay on man« dann noch auf den Satz: »Alles, was ist, ist gut« vereinfachte.
Für alles, was es auf der Welt gab und was auf ihr geschah, und für alles, was der Mensch geschaffen hatte und tat, versuchte Pangloss deshalb mit seiner Vernunft auch immer einen guten Grund zu finden. Denn wenn alles auf dieser Welt auf das beste eingerichtet war, musste es auch für alles einen guten Grund geben.
Daran, dass es aber sowohl im Bereich der Natur wie im Bereich des menschlichen Zusammenlebens auch viele Dinge gab, die die Menschen mit ihrer Vernunft besser hätten einrichten können, so dass sie ihnen nicht mehr schaden, sondern vielmehr ihrem Wohlbefinden dienen würden, schien Pangloss ob seiner eifrigen Suche nach guten Gründen gar nicht zu denken. Und dass das Finden von guten Gründen als einziger guter Grund für die menschliche Vernunft etwas wenig war, schien ihn dabei nicht zu stören.
Unerfahren und unschuldig wie er war, dachte auch Candide nicht an diese Dinge, sondern hörte Meister Pangloss, den er für den grössten Philosophen der Welt hielt, aufmerksam zu und glaubte ihm alles.
Neben dem Glück, Meister Pangloss zu lauschen, gab es aber auch für Candide noch ein grösseres Glück, und das bestand darin, Fräulein Kunigunde, die Tochter des Barons und der Baronin, jeden Tag zu sehen.
Als die beiden sich eines Tages zufällig hinter einem Wandschirm trafen, überraschte sie der Baron jedoch und jagte Candide mit einem wuchtigen Tritt in den Hintern aus dem Schloss, was für Candide der Vertreibung aus einem irdischen Paradies gleichkam.
Dabei sollte dies ja nur seine erste Erfahrung einer Wirklichkeit sein, wie sie der Philosoph Pangloss nicht sah oder nicht sehen wollte.
Den Anfang einer langen Reihe von Wirrnissen und Abenteuern voll Missgeschicken, Unglücken, Schrecken und Grausamkeiten, die Candide nun zu bestehen hatte, bildete die wider seinen Willen erfolgte Anwerbung als Soldat des Königs der Bulgaren.
Als Überlebender einer Schlacht, in der etwa 30 000 Menschen ihr Leben verloren hatten, flüchtete er aus der kriegsverseuchten Gegend nach Holland, da er gehört hatte, dass dort alle Leute reich und christlich gesinnt seien. Aber erst ein Ungetaufter, ein braver Wiedertäufer namens Jacques, erbarmte sich seiner.
Ein kranker und gespensterhaft aussehender Bettler, dem Candide begegnete und der trotz seiner schrecklichen Erscheinung mehr Mitleid als Abscheu in ihm erweckte, entpuppte sich als sein teurer Lehrer Pangloss, der ihm nun erzählte, dass bulgarische Soldaten die ganze Familie des Barons von Thunder ten Tronck getötet und das Schloss dem Erdboden gleichgemacht hatten.
Der brave Wiedertäufer Jacques nahm auch Pangloss bei sich auf, und als ihn nach einiger Zeit Handelsgeschäfte nach Lissabon führten, nahm er Candide und Pangloss auf seinem Schiff mit. Vor dem Hafen von Lissabon gerieten sie jedoch in ein fürchterliches Unwetter, in dem das Schiff unterging und der Wiedertäufer Jacques ertrank.
Pangloss und Candide erreichten das Ufer und machten sich zu Fuss auf den Weg nach Lissabon, aber als sie die Stadt erreicht hatten, ereignete sich ein Erdbeben, das diese zu drei Vierteln zerstörte.
Um die befürchtete vollständige Vernichtung der Stadt zu verhindern, wurde nun ein sogenanntes »Glaubensgericht« veranstaltet, das heisst einige willkürlich ausgelesene Menschen wurden getötet, weil man glaubte, dadurch Erdbeben verhindern zu können. Pangloss und Candide befanden sich natürlich – wie man nach dem bisherigen Verlauf der Geschichte zu sagen versucht ist – zufällig auch bei diesen Auserlesenen, und während Candide ausgepeitscht wurde, wurde Pangloss gehängt.
Eine alte Frau, die Candide wieder gesund pflegte, führte ihn daraufhin in ein Landhaus, wo er zu seinem Erstaunen seine totgeglaubte, geliebte Kunigunde wiederfand, die dort von einem jüdischen Kaufmann und dem Grossinquisitor gefangen gehalten wurde.
Der Grossinquisitor, der als oberster Richter der katholischen Kirche dafür zu sorgen hatte, dass sich niemand getraute, den Glauben an die Kirche zu untergraben, war es, wie sich nun herausstellte, auch gewesen, der nach dem Erdbeben auf die merkwürdige Idee mit dem Glaubensgericht gekommen war. Er hatte Kunigunde zu diesem »Schauspiel« eingeladen, und diese hatte dort Pangloss und Candide erkannt und ihrer alten Dienerin den Auftrag gegeben, sich um Candide zu kümmern und ihn zu ihr zu führen.
Während Candide und Kunigunde nun so beisammensassen, betrat plötzlich der jüdische Kaufmann, der sich Kunigunde mit dem Grossinquisitor teilen musste, das Zimmer, zog einen langen Dolch und stürzte sich auf Candide, so dass diesem nichts anderes übrig blieb, als seinen Degen zu ziehen und den jüdischen Kaufmann zu töten. Und das gleiche tat er dann auch mit dem kurz darauf ebenfalls ins Zimmer tretenden Grossinquisitor.
Dann blieb unserem geplagten Jüngling nichts mehr anderes übrig, als drei Pferde zu satteln und mit Kunigunde und der Alten nach Cádiz, einer spanischen Hafenstadt, zu fliehen.
Da sie unterwegs ihres Geldes beraubt wurden, liess sich Candide in Cádiz dann bei einer Truppe, die aufgestellt wurde, um Jesuitenpatres in Paraguay zurVernunft zu bringen, als Hauptmann anwerben und schiffte sich mit Kunigunde, der Alten und zwei Dienern nach Südamerika ein. Die Jesuitenpatres in Paraguay wurden beschuldigt, einen Eingeborenen-Stamm gegen die Könige von Spanien und Portugal aufgewiegelt zu haben.
Als das Schiff in Buenos Aires gelandet war, begaben sich Kunigunde und der Hauptmann Candide zum Gouverneur, um sich von ihm trauen zu lassen, was jedoch mit einigen Schwierigkeiten verbunden war, da der Gouverneur sofort selber ein Auge auf die schöne Kunigunde warf und die Eheschliessung hinauszögerte.
Inzwischen traf aber ein Schiff mit spanischen Gerichts- und Polizeidienern ein, die auf der Suche nach dem Mörder des Grossinquisitors waren, so dass sich Candide gezwungen sah, Kunigunde zu verlassen und mit einem seiner Diener, der Cacambo hiess, erneut die Flucht zu ergreifen.
Dank der Welt- und Menschenkenntnis des Dieners Cacambo fanden die beiden nun bei den Jesuitenpatres, die Candide hätte bekämpfen sollen, Aufnahme, und im Kommandanten der Patres erkannte Candide den ebenfalls tot geglaubten Bruder von Kunigunde, den jungen Baron von Thunder ten Tronck.
Als Candide dem jungen Baron jedoch verkündete, dass er dessen Schwester Kunigunde heiraten wolle, kam es zu einem Hiebwechsel mit den Degen, da der Baron sich gegen die Heirat seiner Schwester mit einem Nichtadeligen zur Wehr setzte. Dabei bohrte Candide dem Baron seinen Degen bis ans Heft in den Leib.
Wieder mussten Candide und sein Diener Cacambo die Flucht ergreifen, wobei sie in die Gefangenschaft von Eingeborenen gerieten, die »Ohrlappen« genannt wurden und die nur der Umstand, dass Cacambo sie davon überzeugen konnte, dass Candide und er keine Jesuiten waren, davon abhielt, die beiden zu braten und aufzuessen.
Wieder in Freiheit, gerieten die beiden bei ihrem Versuch, in die Hafenstadt Cayenne zu gelangen, dann mit einem Boot, das sie mit Kokosnüssen gefüllt hatten, auf einen Fluss, der immer breiter wurde und sich schliesslich in einem Felsgewölbe verlor, wobei das Wasser immer schneller dahinschoss.
Als sie nach vierundzwanzig Stunden endlich das Tageslicht wieder erblickten, zerschellte das Boot, und sie befanden sich im sagenhaften, von der Umwelt durch unüberwindbare Gebirgszüge abgeschlossenen Goldland Eldorado, wo Candide zum ersten Mal glückliche und vernünftig lebende Menschen von eigenartiger Schönheit traf, welche die beiden mit einer bisher nirgends angetroffenen Gastfreundschaft aufnahmen.
In Eldorado lagen Goldkugeln, Smaragde und Rubine von den Menschen unbeachtet als Kiesel auf der Strasse herum, und alle Wirtshäuser wurden auf Staatskosten unterhalten. Alles war vortrefflich eingerichtet, und die Menschen lebten friedlich und glücklich miteinander.
Nach einem Monat wollte Candide das schöne Land dann aber doch wieder verlassen, da er Sehnsucht nach Fräulein Kunigunde hatte und hoffte, dass es ihm nun, mit dem Reichtum, den er aus Eldorado mitnehmen wollte, besser als bisher ergehen würde.
Obwohl ihn der König davor warnte, diese Dummheit zu begehen, und ihm zu bedenken gab, dass man, wenn man irgendwo leidlich aufgehoben sei, dortbleiben solle, liess er Candide seinen Willen und beauftragte seine Maschinenbaumeister, eine Maschine zu konstruieren, welche die beiden merkwürdigen Männer bequem aus dem Land hinaus befördern sollte.
Zusammen mit zwei grossen roten Hammeln, die ihnen jenseits der Berge als Reittiere dienen sollten, zwanzig Lasthammeln, die mit Lebensmitteln, dreissig anderen, die mit kostbaren Geschenken, und fünfzig, die mit Eldorado Kieseln bepackt waren, wurden die beiden dann mit der riesigen Maschine auf die Höhe des Gebirges gewunden, und als sie sicher gelandet waren, verabschiedeten sich die Techniker von ihnen, da sämtliche Bewohner des Landes gelobt hatten, dieses niemals zu verlassen, und alle auch viel zu verständig waren, um ihren Eid zu brechen.
Als Candide und Cacambo nach einer Reise von hundert Tagen durch Sumpf, Wüste und Gebirge jedoch endlich die Stadt Surinam erreichten, die den Holländern gehörte, besassen sie nur noch zwei von den Hammeln, die mit Schätzen beladen waren, und Candide beauftragte Cacambo mit Diamanten für etwa 6 Millionen in der Tasche nach Buenos Aires zu fahren, Kunigunde dort, wenn nötig, vom Gouverneur loszukaufen und nach Venedig zu bringen, wo er, Candide, die beiden erwarten würde. Er selbst machte einen holländischen Schiffsherrn ausfindig, der ihn nach Europa zurückbringen sollte, aber als dieser in See stach, befanden sich wohl die beiden Hammel Candides mit ihrem kostbaren Gepäck, nicht aber er selbst an Bord des Schiffes.
Da Candide nun nur noch ein Beutel mit Gold und Diamanten geblieben war, nahm er eine billige Kajüte auf einem französischen Schiff und suchte einen ehrlichen Menschen als Reisebegleiter, der jedoch die Voraussetzung erfüllen sollte, seines Lebens ganz und gar überdrüssig und der unglücklichste Mensch des Landes zu sein. Aus den unzähligen Bewerbern wählte Candide schliesslich einen betagten Gelehrten namens Martin aus, da er hoffte, dass dieser ihm unterwegs die Langeweile vertreiben würde.
Auf dem Meer gelangte Candide dann unverhofft wieder in den Besitz eines seiner roten Hammel, als ein spanisches Schiff dasjenige eines holländischen Seeräubers versenkte und neben dem französischen Schiff, auf dem Candide sich befand, plötzlich etwas leuchtend Rotes im Wasser schwamm.
Von der französischen Hafenstadt Bordeaux fuhren Candide und Martin nach der Hauptstadt Paris, wo Candide sich von verschiedenen Gaunern grosse Geldsummen abknöpfen liess. Zuerst geriet der arme Candide nach einem leichten Unwohlsein in die Hände von geldgierigen Ärzten, Betschwestern und Pfaffen, dann durch die Vermittlung eines spitzbübischen Abbés – eines Priesters, der keiner Klostergemeinschaft angehörte – in einen Kreis von Spielern und in die Fänge einer betrügerischen Lebedame, und schliesslich wurde er das Opfer von korrupten Polizeibeamten, die ihn jedoch gegen die Bezahlung einer entsprechend hohen Summe wieder frei liessen.
Auf einem kleinen holländischen Schiff, das nach dem englischen Seehafen Portsmouth auslief, gelangten Candide und Martin dann vor die englische Küste, wo sie Zeugen der Hinrichtung eines englischen Admirals wurden, den vier Soldaten auf dem Verdeck eines Schiffes der englischen Flotte erschossen, weil er in einem Seegefecht mit einem französischen Admiral nicht genug Leute hatten niedermetzeln lassen. Candide setzte daraufhin keinen Fuss auf das englische Festland und vereinbarte mit dem holländischen Schiffspatron, ihn auf dem kürzesten Weg nach Venedig zu bringen, wo er Cacambo und seine geliebte Kunigunde wiederzusehen hoffte.
Da Cacambo und Kunigunde dort aber noch nicht eingetroffen waren, verfiel Candide in düstere Schwermut, und als er eines Tages auf dem Marktplatz einem glücklich aussehenden jungen Paar begegnete, Schloss er mit Martin eine Wette, in der er behauptete, die beiden seien auch glücklich. Martin vertrat dagegen die Meinung, die beiden seien nicht glücklich.
Bei einem gemeinsamen Essen stellte sich nun heraus, dass es sich bei dem jungen Mädchen um eine ehemalige Kammerzofe der Baronin von Thunder ten Tronck handelte, welche die Geliebte des Hauslehrers Pangloss gewesen war und jetzt den Beruf eines Freudenmädchens ausüben musste, und dass der junge Mann ein Mönch war, der das Klosterleben zutiefst verwünschte, so dass Candide seine Wette also verloren hatte. Als Candide den beiden daraufhin Geld gab, damit sie glücklich würden, meinte Martin, dass er sie damit vielleicht nur noch unglücklicher mache.
Candide und Martin besuchten dann noch den Senator Pococurante, einen venezianischen Edelmann, von dem man behauptete, er kenne keine Sorgen, und bewunderten dessen Palast, seine Gemäldesammlung und die Schönheit und Anmut seiner Dienerinnen. Sie waren entzückt von einem Konzert, das er geben liess, nahmen ein ausgezeichnetes Mahl zu sich und bestaunten seine Bibliothek und die kunstvoll angelegten Gärten. Am Schluss ihres Besuches mussten sie jedoch feststellen, dass der Senator nur ein Vergnügen zu haben schien, und das war das seltsame Vergnügen, kein Vergnügen zu haben.
Bei einem Abendessen, das Candide und Martin zusammen mit sechs Ausländern einnahmen, gaben sich diese alle als entthronte Könige zu erkennen, die nun ein eher armseliges und trauriges Dasein führten, und Candide fand ganz unverhofft seinen Diener Cacambo als Sklaven eines dieser Herren wieder. Cacambo erreichte nun bei seinem neuen Herrn, dem ehemaligen Grosssultan Achmed III., dass Candide und Martin auf dem türkischen Schiff, das diesen nach Konstantinopel zurückbrachte, mitfahren durften, und er zählte Candide, wie es ihm ergangen war.
Der Gouverneur von Buenos Aires hatte Kunigunde für zwei Millionen freigegeben, aber dann waren Kunigunde, die Alte und Cacambo in die Hände eines Piraten gefallen, der sie in der Türkei als Sklaven verkauft hatte. Kunigunde und die Alte waren Dienstmägde bei einem alten Fürsten geworden, und Kunigunde hatte ihre ganze Schönheit verloren und war nun entsetzlich hässlich.
Trotz dieser Nachricht hielt es Candide für seine Pflicht als Ehrenmann, Kunigunde in alle Ewigkeit zu lieben, und kaufte Cacambo aus seiner Sklaverei los.
Auf einer Galeere, die Martin, Candide und Cacambo zu dem alten Fürsten bringen sollte, bei dem sich Kunigunde befand, kaufte Candide noch zwei Sträflinge unter den Galeerensklaven frei, da einer von ihnen – wer hätte das erwartet – der totgeglaubte Pangloss und der andere der ebenfalls totgeglaubte Jesuitenbaron und Bruder von Kunigunde war.
Pangloss war damals in Lissabon am Leben geblieben, weil sich der Strick, mit dem er gehängt wurde, verknotet hatte, und dem jungen Baron hatte ein Apotheker in Paraguay die Wunden, die Candides Degen hinterlassen hatte, geheilt. Eine Folge von unglücklichen Ereignissen hatte dann dazu geführt, dass die beiden in Konstantinopel zum Galeerendienst verurteilt und an dieselbe Ruderbank gekettet worden waren.
Zusammen begaben sich nun alle – Martin, Cacambo, Pangloss, der Baron und Candide –- zu dem alten Fürsten, wo Candide, trotz seines Erschreckens über das Aussehen Kunigundes, diese und die Alte loskaufte.
Die Alte machte Candide daraufhin den Vorschlag, einen kleinen Bauernhof in der Nachbarschaft zu pachten, bis sich ihre Lage wieder günstiger gestalten würde, und als Kunigunde Candide in sehr bestimmtem Ton an sein Heiratsversprechen erinnerte, wagte dieser nicht zu widersprechen. Dass der Baron wieder darauf beharrte, dass nur ein deutscher Reichsbaron seine Schwester heiraten werde, bewirkte diesmal nur, dass Candide, der im Grunde seines Herzens nicht die geringste Lust verspürte, Kunigunde zu heiraten, auf seinem Entschluss bestand und den widerspenstigen Baron, auf den Rat Cacambos hin, wieder dem Galeerenführer übergab.
Obwohl er nun sein Ziel erreicht hatte und endlich mit seiner Geliebten vereint war, konnte Candide aber immer noch kein angenehmes Leben führen, da ihm nur der kleine Bauernhof geblieben war, auf dem zu leben es weder Kunigunde, noch der Alten, noch Cacambo und Pangloss gefiel. Einzig Martin war überzeugt davon, dass es ihm überall gleich schlecht ginge, und liess alles geduldig über sich ergehen.
Eines Tages erschienen zudem noch die ehemalige Kammerzofe der Baronin von Thunder ten Tronck und der Mönch, denen Candide in Venedig Geld gegeben hatte, auf dem Hof, die jetzt, wie Martin vorausgesagt hatte, noch unglücklicher als zuvor waren.
Auch ein berühmter Derwisch, der in der Nähe wohnte und der beste Philosoph der Türkei hätte sein sollen, konnte Candide und seinen Freunden keinen Rat geben, was sie tun sollten, damit es ihnen besser ginge.
Erst die Begegnung mit einem alten Bauern, der sie auf dem Rückweg von ihrem Besuch beim Derwisch in sein Haus einlud, bewirkte, dass sie sich auf eine Absicht einigen konnten. Der Bauer, der zusammen mit seinen Kindern auch nur einen kleinen Hof und kein grosses und herrliches Gut bebaute, dem es aber trotzdem gut zu gehen schien, gab ihnen nämlich zu verstehen, dass es die Arbeit sei, die drei grosse Übel von ihnen fernhalten werde: die Langeweile, das Laster und die Not.
Und so beschlossen denn auch Candide und seine Freunde nun, zu arbeiten, ohne viel zu grübeln – da dies, wie Martin sagte, das einzige Mittel sei, um das Leben erträglicher zu machen. Nur dem unverbesserlichen Pangloss lag trotz des recht angenehmen Lebens, das sie jetzt führten, und trotz allem, was jeder von ihnen durchgemacht hatte, immer noch daran, darzulegen, wie in dieser besten aller Welten alles miteinander verknüpft sei und wie sie jetzt nicht dieses Leben führen würden, wenn sie nicht all das durchgemacht hätten, was sie durchgemacht hatten.
Aber jedes Mal, wenn Pangloss davon anfing, sagte Candide zu ihm: »Sehr richtig, aber wir müssen unseren Garten bestellen.«
Als ich die Geschichte von Candide gelesen hatte, verspürte ich eine grosse Lust, ihrem Verfasser einen Brief zu schreiben, und da ich der Ansicht bin, dass man das, wozu man Lust hat, wenn möglich auch tun soll, habe ich mich hingesetzt und folgenden Brief geschrieben:
AMonsieur de VoltaireChâteau FerneyA Ferney-VoltaireFrance
Hochverehrter Monsieur de Voltaire, mit grossem Vergnügen habe ich Ihren Roman »Candide« gelesen und erlaube mir, Ihnen hiermit meinen Dank dafür auszusprechen – sind doch, wie mir scheint, gerade die Dinge, die einem ein wirkliches Vergnügen bereiten können, in Gefahr, als unwesentlich angesehen zu werden und immer mehr in eine scheinbar ohne weiteres als zu vernachlässigende Minderheit gedrängt zu werden.
Ich gebe zu, dass dies etwas pessimistisch klingt und den Menschen im Gebrauch ihrer Vernunft immer noch kein besonders gutes Zeugnis ausstellt – aber ich glaube mich da in einer ähnlichen Lage wie Ihr Candide zu befinden, der trotz der gegenteiligen Beteuerungen seines ihn anfänglich stark beeindruckenden Lehrers Pangloss immer wieder am eigenen Leib har erfahren müssen, dass es bei den Menschen mit dem Gebrauch ihrer Vernunft nicht auf das beste bestellt ist und dass auch die Welt für das Leben der Menschen auf ihr nicht auf das beste eingerichtet ist.
Und wenn ich es richtig sehe, ist ja auch die Einstellung des Verfassers des »Candide« – trotz des zweiten Teils des Titels, welcher »oder der Optimismus« lautet – nicht eine durchwegs optimistische, sondern wohl höchstens eine in ihrem Optimismus immer wieder von den wenig erfreulichen Erfahrungen mit der Wirklichkeit betroffene – wenn es ihm nicht sogar darum gegangen sein könnte, sich über die im zweiten Teil des Titels genannte und in der Geschichte selber von Pangloss verkörperte Einstellung auf eine mehr oder weniger versteckte Art zu mokieren und sie so in ein angemessenes Verhältnis zur Wirklichkeit zu bringen.
Ich weiss, verehrter Monsieur de Voltaire, dass es auch in Ihrem Leben Dinge und Ereignisse gegeben hat, die nicht Ihren Vorstellungen von dem, was hätte sein oder werden sollen, entsprochen haben, und ich vermute, dass einige von diesen Sie doch auch zu einer eher pessimistischen Haltung gezwungen haben.
Bitte korrigieren Sie mich, wenn dies zum Beispiel für das Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755 nicht der Fall war, das mich in diesem Zusammenhang besonders interessiert und das ja auch in Candides Geschichte eine wichtige Rolle spielt.
Es scheint mir, dass gerade dieses Ereignis die Gemüter der Menschen in der damaligen Zeit über die Massen erregt hat, da sich in ihm mit einem Mal etwas angemeldet hat, das bisher in der Diskussion nicht oder nur ungenügend, mit der linken Hand sozusagen, behandelt worden ist.
Wenn ich mir erlauben darf, die meiner Ansicht nach damals vertretenen Anschauungen als zwei Grundtendenzen zu charakterisieren, so fällt eine von ihnen, wenn Sie nichts dagegen haben, mit Ihrer Position, und die andere, wenn Sie es mir verzeihen wollen, mit derjenigen, die der von Ihnen wenig geschätzte Jean-Jacques Rousseau eingenommen hat, zusammen.
Ihre Position, verehrter Monsieur de Voltaire, würde ich dabei – kurz gesagt – dadurch kennzeichnen, dass Sie sich für eine vermehrte Wirkung der menschlichen Vernunft eingesetzt haben, in der Hoffnung, dass sich durch die Veredlung und Verfeinerung der Formen des menschlichen Zusammenlebens auf der Welt, auf der wir nun einmal zu leben haben, ein Reich der Vernunft und der Gerechtigkeit verwirklichen lassen würde – während ich die Ansicht des »armen Jean-Jacques« in der Formel zusammenzufassenversuchen würde, dass er als Verfechter der ursprünglichen Güte des Menschen die Ansicht vertrat, dass der Mensch erst durch die Bildung und Veredlung und Verfeinerung der Lebensformen verdorben worden sei.
Sie, verehrter Monsieur de Voltaire, haben also im grossen Ganzen gesehen eine eher optimistische Haltung und der »arme Jean-Jacques« hat eine eher pessimistische Haltung eingenommen.
Aber wenn ich es richtig sehe, so haben Sie, der sogenannte Atheist, anlässlich des Erdbebens von Lissabon plötzlich die Ansicht vertreten, dass für die entsetzliche Katastrophe, die eine für die damaligen Verhältnisse furchtbar grosse Zahl von 30 000 Todesopfern forderte, der Gott verantwortlich zu machen sei. Nicht, dass er das Erdbeben willentlich herbeigeführt, aber dass er es nicht verhindert habe.
Sie, der Sie bis anhin und auch später immer wieder eine auf die menschliche Vernunft bauende optimistische Ansicht vertreten und sich in Ihrer Vorstellung von Gott immer etwas zurückgehalten haben, nehmen angesichts der Naturkatastrophe von Lissabon und in Bezug auf die Beschaffenheit des Gottes plötzlich eine pessimistische Haltung ein.
Der »arme Jean-Jacques Rousseau«, der sogenannte Deist, dessen Werke Sie ziemlich ungnädig aufgenommen haben, und der darunter gelitten hat, nicht ebenso erfolgreich zu sein wie Sie, hat sich hingegen merkwürdigerweise bemüht, der Unvernunft der Menschen die Schuld für die grosse Zahl der Opfer in die Schuhe zu schieben – weil sie, die Menschen, ja auf die Idee gekommen seien, ausgerechnet an dieser Stelle 20 000 sechs bis sieben Stock hohe Häuser aufzustellen –, und er hat den Gott – der es schon gut gemeint habe – verteidigt. So, dass der »arme Jean-Jacques« in dieser Sache also plötzlich eine optimistische Haltung eingenommen hat – obwohl er natürlich nie in dem Sinn, wie Sie es zunächst waren, ein auf die menschliche Vernunft bauen der Rationalist geworden ist.
Sie haben damals das »Poem über die Zerstörung Lissabons« geschrieben und dieses zusammen mit einem anderen Gedicht auch Rousseau zukommen lassen, den diese Ehrung jedoch mehr erbost, als dass sie ihm geschmeichelt hat, und er hat Ihnen daraufhin jenen berühmten Brief geschrieben, in dem er – auf eine recht ungeschickte Weise, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf – eben den Gott reingewaschen und den Menschen und den zweifelhaften Errungenschaften des zivilisatorischen Fortschritts die Verantwortung und die Schuld für den Tod so vieler Menschen gegeben hat.
Dass Rousseau dadurch zum Optimisten geworden ist, kann man natürlich nicht sagen, aber die optimistische Seite in ihm, die sicher da war, wenn er annahm, dass der Mensch von Natur aus gut sei, hat sich durch die Auseinandersetzung mit Ihnen, wie mir scheint, doch noch verstärkt.
Dass es bei dieser Auseinandersetzung andererseits aber auch um Persönliches gegangen ist, kann nicht bezweifelt werden – schrieb Rousseau Ihnen in seinem Brief doch auch: »Gesättigt mit Ruhm leben Sie frei im Schosse des Überflusses; Ihrer Unsterblichkeit ganz gewiss, philosophieren Sie ruhig über die Natur der Seele; wenn der Körper oder das Herz leidet, haben Sie Tronchin zum Arzt und Freund – und trotzdem finden Sie alles schlecht auf der Erde. Und ich, der unbekannte, arme und von einem unheilbaren Übel geplagte Mensch denke in meiner Einsamkeit mit Vergnügen nach und finde, dass alles gut ist. Woher kommen diese scheinbaren Widersprüche? Sie haben das selbst erklärt: Sie geniessen, aber ich hoffe, und die Hoffnung verschönert alles.«
Nachdem Ihnen Rousseau dann, als Sie auf Ihrem Landgut Ferney ein Privattheater für sich hatten errichten lassen, in einem weiteren Brief noch schrieb, Sie hätten Genf ins Verderben gestürzt und er hasse Sie, haben Sie in einem Brief an d’Alembert erklärt, Rousseau sei völlig wahnsinnig geworden, und sind nicht mehr von der Überzeugung abzubringen gewesen, dass Rousseau ein bemitleidenswerter und zudem gefährlicher Narr sei.
Bitte verzeihen Sie mir, verehrter Monsieur de Voltaire, wenn ich Ihnen vom heutigen Standpunkt, vom Standpunkt der heutigen naturwissenschaftlichen Forschung und der heutigen, immer mehr ins allgemeine Bewusstsein dringenden Kenntnis der Naturgesetze aus – obwohl ich volles Verständnis für Ihre Sicht der Dinge habe und auch je länger je mehr Verständnis für ihre Haltung dem armen Jean-Jacques gegenüber aufbringen kann –, was Ihre Beurteilung des Erdbebens von Lissabon betrifft, nicht mehr zustimmen kann, und zwar so wenig wie ich es Rousseaus Beurteilung gegenüber tun kann – was aber alles andere als ein Vorwurf sein soll.
Ich glaube, dass Sie und Ihre Zeitgenossen damals einfach nicht das Vermögen besessen haben, die Natur und ihre Rolle im Leben der Menschen zu sehen, da man, was das betraf, zu Ihrer Zeit entweder gesagt hat, »es« ist mit der menschlichen Vernunft nicht fassbar, oder »es« ist Gottes Gnade, oder »es« ist des Teufels – Sie wissen sicher besser als ich, was da noch alles gesagt worden ist.
Ich hoffe, dass Sie mir wegen dieser meiner Meinung aus einer späteren Zeit nicht böse sind – was ich angesichts Ihres lebenslangen Kampfes für Duldsamkeit, Nachsicht und Versöhnlichkeit eigentlich als eine unbegründete und gegenstandslose Befürchtung ansehe – und dass Sie auch nichts dagegen haben, wenn ich meine, dass einem von heute aus gesehen nichts anderes übrigbleibt als zu sagen, dass die Natur eine nach eigenen Gesetzen funktionierende Lebensgrundlage für uns Menschen ist, und dass ein Ereignis wie das Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755 halt in Gottes Namen – wenn es ihn gibt, und auch wenn es ihn nicht gibt – nichts anderes als ein Zufall, wenn vielleicht auch ein naturnotwendiger, sein kann, den man – ob man will oder nicht und im vollen Bewusstsein der vorläufig immer noch bestehenden menschlichen Ohnmacht solchen Naturkatastrophen gegenüber – auch als solchen, der menschlichen Einwirkung höchstwahrscheinlich noch für längere Zeit entzogenen Zufall eben, hinzunehmen hat.
Obwohl der Mensch die Eigengesetzlichkeit der Natur er forschen und zu beherrschen versuchen kann und dabei, wie ich schon angetönt habe, innerhalb kürzester Zeit auch bereits enorme Fortschritte gemacht hat, so dass ihm einige von ihnen schon selber unheimlich sind, glaube ich nicht, dass er dabei einmal über gewisse Grenzen hinauskommen wird, da er ja selber ein Bestandteil dieser Natur ist, der nur durch seinen Geist die übrige Natur und auch sich selber erforschen und beeinflussen kann, dem es aber trotz aller Beeinflussung der Natur und ihrer Gesetze nicht gelingt, sich von ihr loszulösen und sie vollständig zu beherrschen – es sei denn, es würde ihm gelingen, auch sich selber vollständig zu beherrschen und das Band des Todes, das ihn mit der Natur verbindet und immer wieder in ihre Eigengesetzlichkeit zurückholt, zu zerschneiden.
Das heisst jedoch nicht, dass ich nicht auch Ihrer Ansicht bin und nicht auch finde, dass die Formen des menschlichen Zusammenlebens und die dazu notwendigen Einrichtungen der menschlichen Vernunft unterworfen sein sollten, die, wie mir scheint, doch dazu da ist, uns zu ermöglichen, dass wir uns in dieser Welt, so wie sie ist – und sie ist ja schon an sich nicht besonders lebensfreundlich eingestellt –, einigermassen zurechtfinden und eine einigermassen anständige Lebenszeit auf ihr verbringen können.
Wenn es denn also heute zum Beispiel in China zu einer Hungerkatastrophe käme, so würde ich da natürlich nicht sagen, dass das auch ein Zufall sei.
Was bei Ihnen, verehrter Monsieur de Voltaire, noch ein Erdbeben von Lissabon bewirken musste – dass sich Ihre optimistische Grundhaltung nämlich in eine pessimistische verwandelte –, das kann heute schon das Lesen von Zeitungen und das Hören und Sehen von Nachrichten bewirken.
Wenn Sie – vor dem Erdbeben von Lissabon – noch ein volles Vertrauen in die menschliche Vernunft haben konnten, so ist das nach dem, was seither auf der Welt geschehen ist, und nach den Erfahrungen, wie der Name »menschliche Vernunft« als Deckmantel für jedwelche Untaten benutzt werden kann, heute kaum mehr möglich, obwohl in ihr, der wirklich menschlichen Vernunft, auch heute noch unsere einzige Chance liegen mag.