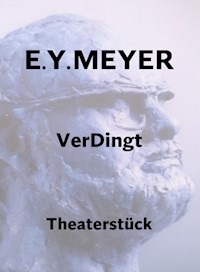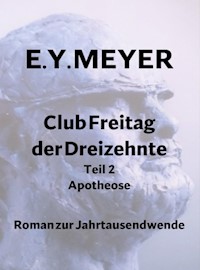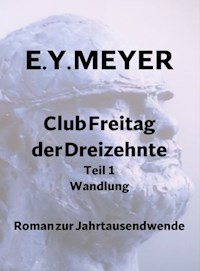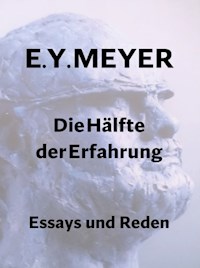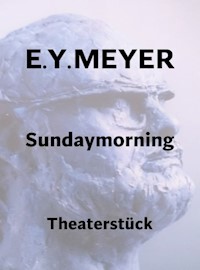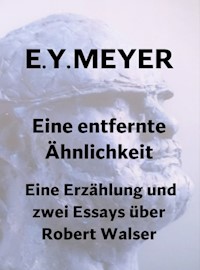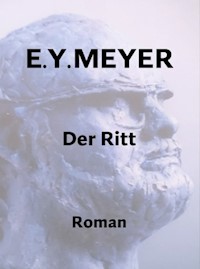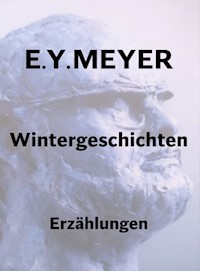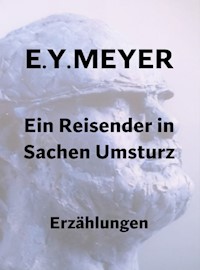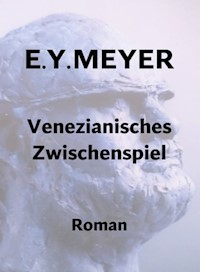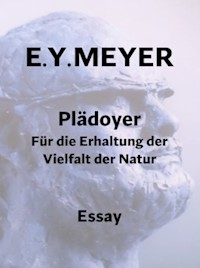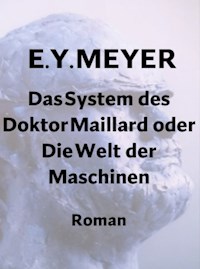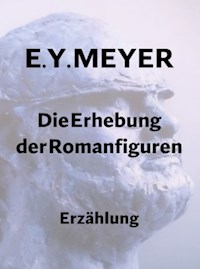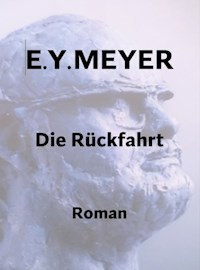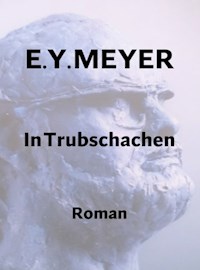
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sensation im Bücherherbst 1973: Kein Geringerer als Suhrkamp-Chef Siegfried Unseld verkündete euphorisch: «Das Emmental kann und wird niemals mehr eine so detaillierte Darstellung erhalten.» Mit seinem Roman «In Trubschachen» katapultierte E. Y. Meyer (geb. 1946) die unscheinbare Emmentaler Gemeinde auf die weltliterarische Karte, sehr zum Missfallen der Einwohnerinnen und Einwohner… Meyer beschreibt Dorfgeschehen und Dorfatmosphäre in den Tagen um den Jahreswechsel, mitten drin, aber eben doch nur als Gast, als Fremder. Das liebliche Emmental verwandelt sich unter seiner Feder in ein fremdes Territorium, in ein «Tal des Todes», und auf seinen Spaziergängen durch die winterliche Landschaft (wie «unter einem Leichentuch») erkennt der Erzähler Anzeichen von Verwesung. Mit dem Trubschachen-Roman ist E. Y. Meyer vor über vierzig Jahren berühmt geworden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
E.Y.MEYER
InTrubschachen
Roman
Erstmals erschienen 1973
© 2021 E.Y.MEYER
eymeyer.ch
Cover:
Bronzekopf des Autors
Geschaffen 1997 von PAN YI QUINAcademy of Arts & Design
Tsing Hua UniversityBei Jing, China
Kapitel
Freitag, 26. Dezember
Samstag, 27. Dezember
Sonntag, 28. Dezember
Montag, 29. Dezember
Dienstag, 30. Dezember
Mittwoch, 31. Dezember
Donnerstag, 1. Januar
Freitag, 2. Januar
Samstag, 3. Januar
Freitag, 26. Dezember
Nach dem Winterfahrplan – gültig vom 26. September bis zum 27. Mai – erreicht man Trubschachen von Biel aus mit der SBB (Schweizerische Bundesbahnen) über Lyss (fünfzehn Uhr achtunddreissig) und BERN (fünfzehn Uhr siebenundfünfzig) wo man vom Schnellzug mit Speisewagen in einen Bummler (Bummelzug) der Linie Bern-Luzern umsteigen muss –, über OSTERMUNDIGEN (sechzehn Uhr sechzehn), GÜMLIGEN (sechzehn Uhr neunzehn), WORB - SBB, im Gegensatz zu Worb VBW, der Endstation der Vereinigten Bern-Worb-Bahnen (sechzehn Uhr vierundzwanzig), TAEGERTSCHI (sechzehn Uhr dreissig), KONOLFINGEN (sechzehn Uhr vierunddreissig), ZÄZIWIL (sechzehn Uhr einundvierzig), BOWIL (sechzehn Uhr fünfundvierzig), SIGNAU (sechzehn Uhr neunundvierzig), EMMENMATT (sechzehn Uhr dreiundfünfzig) und LANGNAU (sechzehn Uhr siebenundfünfzig) um siebzehn Uhr null sieben –
Der genau dreizehn Minuten dauernde Aufenthalt in Bern (von fünfzehn Uhr siebenundfünfzig bis sechzehn Uhr zehn) würde nach dem Umladen des Gepäcks höchstens noch einen kürzeren Rundgang durch den seit Jahren im Umbau befindlichen und jetzt kurz vor der Beendigung stehenden neuen Berner Bahnhof, auf keinen Fall aber ein Verlassen der weitläufig und mehrgeschossig angelegten Überbauung erlauben. Mehrere Kioske mit vielreihigen Zeitschriften- und Zeitungsauslagen würden aber Gelegenheit bieten, sich für die einstündige, von drei bis vier Minuten langen Aufenthalten an zehn Stationen unterbrochene Reise im Bumm1er mit Lesestoff einzudecken würde der nun aus irgendwelchen Heftli (vorwiegend deutschen Illustrierten), Tages- oder Wochenzeitungen (der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG, der WELTWOCHE, dem BLICK, dem BUND, dem EMMENTHALER-BLATT) bestehen. Das Einnehmen eines Getränkes oder eines kleinen Imbisses im Selbstbedienungsrestaurant oder im Express-Buffet würde die Zeit hingegen wieder nicht zulassen, aber nach einem normalen, ordentlichen Mittagessen in Biel würde sich auch weder das eine noch das andere aufdrängen. Trotz der Festtagszeit würde es nicht schwer sein, die bereits hier in Bern in den Zug gestiegenen, aus dem Gebiet des Emmentales stammenden Landbewohner von den übrigen Zuginsassen zu unterscheiden. Wahrscheinlich würden viele von ihnen den zweiten Weihnachtstag, den STEPHANSTAG, dazu benutzen, um wieder einmal ihre Verwandten oder Bekannten in der Stadt zu besuchen, so wie ihn umgekehrt sicher auch viele Städter dazu benutzen würden, um ihren Verwandten oder Bekannten auf dem Lande einen weihnachtlichen Besuch abzustatten. Die meisten würden den Zug rechtzeitig genug bestiegen haben, geduldig auf dessen Abfahrt warten und an ihrer althergebrachten bäuerlichen Sonntagsbekleidung zu erkennen sein: Männer in Anzügen aus festem, braunem Wollstoff mit dazu passenden flachen, schmalrandigen schwarzen oder braunen Hüten auf dem Kopf, mit bis zuoberst zugeknöpften, nur noch selten kragen- und krawattenlosen Hemden und schwarzen oder braunen Gilets, einige von ihnen gekrümmte Pfeifen rauchend und grosse, halbleere Rucksäcke tragend, Frauen in langen, faltigen Röcken und dicken, dunkelfarbigen Strickjacken, Kopftücher um die aufgesteckten Haare geschlungen und Henkelkörbe, deren Inhalt mit grossen Tüchern bedeckt ist, auf dem Schoss haltend, Kinder in – vor allem bei den halbwüchsigen Knaben an Kittelärmeln und Hosenbeinen – zu stark verkleinert erscheinenden Erwachsenenkleidern, ihrerseits Plastiktragtaschen aus den Warenhäusern der Stadt tragend die meisten mit wind- und wettergebräunten Gesichtern und schweren, zerarbeiteten Händen ...
Während der Fahrt würden sich von Station zu Station immer mehr solche Leute im Zug befinden – zu denen, die den Zug bereits in der Stadt bestiegen haben, würden sich nun noch diejenigen gesellen, die die Bahn nur innerhalb eines kleineren, nicht bis zur Stadt reichenden Gebietes benutzen und in den Bummelzügen meist in der Mehrzahl sind – seien das nun selber die Meistersleute die Bauern (obwohl einige Grossbauern ihre Fahrten sicher nur noch im eigenen Auto, vorzugsweise einem MERCEDES, zurücklegen würden) oder seien das – unter sich, nur von ihren Kleidern her, nicht mehr so leicht voneinander zu unterscheiden – Pächter, Küher, Käser, Bedienstete auf den Höfen wie die Melker, Karrer, Traktorführer, Knechte, Mägde, Lehrbuben und Lehrtöchter oder Leute, die zu den Bauern und Pächtern auf die Stör gehen wie der Störenmetzger, die Näherin, die Wäscherin, der Schnapsbrenner und der Klauenschneider, obwohl auf alle Fälle der Brenner und wahrscheinlich auch der Metzger und der Klauenschneider für die Fahrt zu ihren Arbeitsplätzen ebenfalls ihre eigenen Fahrzeuge benutzen würden ... Möglicherweise würde sich auch ein invalider, blinder, tauber, stummer oder taubstummer Hausierer mit einem zerbeulten Kartonkoffer und – ist es ein blinder Hausierer – einem Blindenhund oder einem menschlichen Begleiter, vielleicht auch mit einem Blindenhund und einem menschlichen Begleiter im Zug befinden, mit Sicherheit jedoch kein Handelsreisender oder, wie man in der Schweiz sagt oder sagte, Commis Voyageur mit seinen Musterkoffern, da die Handelsreisenden schon lange – wie die meisten Grossbauern – nur noch im Auto unterwegs sind. Auch Jodler, Jodlerinnen, Alphornbläser und Fahnenschwinger in Sennen- und Bernertrachten, die auf den Bahnhöfen vor der Abfahrt noch einen zum Besten geben, würde man – obwohl man da Überraschungen erleben kann – zu dieser Zeit, in der keine Kantonalen, Regionalen oder Eidgenössischen Schwing-, Jodler- oder Älplerfeste mehr stattfinden, kaum noch zu sehen bekommen ... Die Gewöhnung an die sich langsam, aber stetig ändernde Zusammensetzung der Zuginsassen, aber auch die Gewöhnung an den bald nach Bern, in der Gegend von Konolfingen – dem Geburtsort Friedrich Dürrenmatts, wie man sich erinnert – eintretenden Landschaftswechsel, der Übergang vom flacheren Mittellandteil zum hügeligen, fast bergigen Emmental, würde nur langsam erfolgen und einen das Blättern und gelegentliche Lesen eines Abschnittes oder einer Bildlegende in Zeitung oder Heftli immer wieder vergessen lassen, bis man in der aus einer Sportzeitung entstandenen Illustrierten PARIS MATCH zufällig auf einen längeren, reichbebilderten Artikel über den Herzog von Windsor – NIEMAND WUSSTE, DASS DAS SCHICKSAL DIESEN KÖNIG UND DIESE SCHÄFERIN VERHEIRATEN WÜRDE – stossen könnte, der plötzlich die Aufmerksamkeit wenigstens soweit für sich in Anspruch nehmen würde, dass man der Reihe nach sämtliche Legenden unter den mehr oder weniger grossen, zum Teil auch ganzseitigen Photographien lesen würde … 1921. Eduard, damals Herzog von Cornwall, ist noch ein schüchterner, streng erzogener junger Mann. »Die Marine wird ihn alles lehren, was er wissen muss«, sagt sein Vater, König George V. ... Im gleichen Zeitraum in den USA, die kleine Wallis Warfield ... Mit seiner Grossmutter Viktoria. »Sie hat mir immer Angst eingeflösst«, wird er später sagen ... Besuch der Vettern aus Russland: von links nach rechts, der zukünftige Eduard VIII., damals Prinz von Wales, Königin Mary, Königin Alexandra, Prinzessin Mary, Zar Nikolaus II., Prinzessin Viktoria, der Zarewitsch Alexis (sitzend), König Eduard VII., Zarin Alexandra und König George V. umgeben von den Grossherzoginnen ... Mit 15 Jahren auf der »Hindustan« vor seinem Eintritt in die Marineschule … Im Jahre 1917, Oberst der Grenadiers Guards an der italienischen Front ... 1921. Er tritt den Anstoss beim Fussballspiel Tottenham-Fulham ... 1924. Sturz mit »Petite Favorite« in einer Military-Prüfung. Die Liederdichter sticheln: »Der Prinz ist ein glänzender Reiter, der oft Wagnisse eingeht« ... Er macht sich bereit, der Gott von 500 Millionen Hindus zu sein. Besuch bei der Begum von Bhophal. Die Begum bleibt verschleiert unter dem Sonnenschirm. Der Prinz, in grosser Uniform, auf dem Kopf einen Kolonialhelm mit Spitze, schreitet zwischen den Trägern der Fliegenwedel voran … 1922. Der Prinz von Wales besucht Indien. Oben: Eduard als Oberst der 35th Jacobs Horse. »Ich genoss eine orientalische Gastfreundschaft«, sagt er, »wie ich glaubte, dass sie nur in Büchern existieren würde.« Gemäss einem sehr genauen, von seinem Vater aufgestellten Programm legt er in vier Monaten 17 000 km zurück. Er bedauert, dass die Polizei ihn von den Massen trennt. Antwort des Königs: »Ihr Besuch verschafft der Bevölkerung ein wirkliches Vergnügen, auch wenn man ihr nicht erlaubt, es zu bezeugen.« Unter den Attraktionen der Reise nach Nepal, die traditionelle Tigerjagd, von zehntausend Eingeborenen vorbereitet. Aber Eduard hat den Tiger nicht selbst getötet ... Im Juni 1936: König seit sechs Monaten und noch für weitere sechs Monate. Eduard V III. besichtigt in der Gala uniform eines Obersten der Walisischen Garde die Yeomen« der Königlichen Garde, deren rot-goldene Uniform, von Halskrause und Hut abgesehen, immer noch die gleiche ist wie zur Zeit ihrer Erschaffung anlässlich der Thronbesteigung der Tudor im Jahre 1485 ...1935: die Herzogin war eine der regelmässigen Gäste im königlichen Besitz von Fort Belvédère geworden ... Diese Photos, in ganz England verbreitet, bildeten den Anfang des Skandals. Im August 1936 verbringt der König seine Ferien an der jugoslawischen Küste. Jeden Tag unter nahm er eine Ruderfahrt mit Wallis ... Seite an Seite an einem Strand Dalmatiens in der Nähe von Cettinje ... 1935: er ist immer noch erst Prinz von Wales. Im August hatte er in der Nähe von Biarritz eine Villa gemietet. Wallis begleitete ihn mit einigen Freunden. Es ist die letzte Frist vor dem Jahr des Dramas ... »Ich lege meine Last nieder. Am 21. Dezember 1936 übermittelt dieser Marconi Bleiglanz Detektorempfänger der Londoner Bevölkerung die Stimme des abdankenden Königs: die einen freuen sich, die andern sind tief bewegt ... am 21. Dezember – ... Einige Stunden nach seiner Abdankung schifft sich der Exkönig in der Nacht auf einem Torpedobootzerstörer der Navy ein und trifft sich mit seiner zukünftigen Frau in Frankreich wieder. Sie unternehmen gemeinsam eine lange Reise durch Europa auf der Suche nach einem Zufluchtsort, wo sie ihr Exil würden verbringen können. Zwei Monate später, am 8. März 1937, verleiht ihm sein Bruder George VI., der am 18. Mai gekrönt werden soll, mittels eines amtlichen Briefes seinen letzten Titel, indem er ihn für immer zum Herzog von Windsor er nennt ... 3. Juni 1937: ein dissidenter anglikanischer Priester vermählt sie im Schloss von Candé in der Touraine ... Obwohl der Umstand, dass die schöne, geistreiche und gebildete Wallis Warfield, geschiedene Simpson, zudem noch Millionärin war, in den Legenden nicht berücksichtigt ist, würde die Illustrierte – nicht nur, weil man sie noch nicht ganz gelesen hat – bei der Ankunft in Trubschachen kurz nach fünf Uhr abends nicht bei den ausgelesenen Zeitungen und Heftli im nach Wiggen, Escholzmatt und schliesslich nach Luzern weiterfahrenden Zug liegen bleiben, sondern zusammen mit dem übrigen Gepäck, möglicherweise mit einem schweren, mit Büchern und warmen Wintersachen vollgepackten Koffer und einer ebenso schweren Reisetasche, den Zug verlassen –
In den Tagen nach Weihnachten ist es in Trubschachen um diese Zeit schon dunkel. Den »Hirschen« finde man, wenn man vom Bahnhofplatz aus alles der Hauptstrasse entlang in Richtung Bärau Langnau gehe, ausgangs des Dorfes auf der rechten Seite der Hauptstrasse, erfährt man von den Trubschachern, die sich um diese Zeit noch auf der Strasse befinden – etwa von einem Bauern, der noch mit einem Pferdefuhrwerk oder -schlitten unterwegs ist, oder von einem Bauernbuben, der mit einem Hundewägeli Milch in die Käserei fährt – wenn man sie danach fragt. Das Trottoir ist mit einer dicken Schicht vereisten Schnees bedeckt, und man muss auch dann vorsichtig gehen, wenn man keinen schweren, mit Büchern und warmen Wintersachen vollgepackten Koffer und keine ebenso schwere Reisetasche zu tragen hat, wenn man nicht hinfallen will. Die Hauptstrasse dagegen ist fast vollständig schneefrei. Der »Hirschen«-Wirt, Herr Rudolf Soltermann-Hirschi, kommt, wenn man der Serviertochter sagt, dass man gern ein Zimmer hätte, zur Begrüssung extra aus der Küche und fragt einen dann – während er einen, den oder die schweren oder auch weniger schweren Koffer und Reisetaschen für einen tragend, über eine steile und schmale Treppe ins obere Stockwerk und durch einen engen, niedrigen und schmalen, nur schwach beleuchteten, braungestrichenen Gang in ein Zimmer, ein Eckzimmer, das er noch frei hat, führt – höflich, wie lange man denn ungefähr bei ihnen zu bleiben gedenke. Selbstverständlich könne man noch zu Abend essen, und ob man während seines Aufenthaltes Voll- oder nur Halbpension wünsche, könne man dann vor oder nach dem Abendessen noch seiner Frau sagen. Nachdem er sich erkundigt hat, ob einem das Zimmer gefalle, zeigt er einem dann auch noch die Toilette (das WC, den Abort) und das Bad, die sich dem Eckzimmer schräg gegenüber in dem sich hier erweiternden Gang befinden, wobei man, wenn man das Bad benutzen wolle, den Schlüssel dazu allerdings zuerst bei ihm oder seiner Frau holen und dann, nach der Benutzung des Bades, wie der ihm oder seiner Frau zurückbringen müsse, damit sie eine Kontrolle darüber hätten, wer das Bad benutze ...
Wenn man sich vor dem Hinuntergehen zum Abendessen noch waschen will, muss man die Seife und den Waschlappen dafür aus dem Koffer oder der Reisetasche nehmen, da wie in fast allen Gasthöfen und Hotels auch hier beim Lavabo (Waschbecken) an der Wand, die das Zimmer von dem seitlich angrenzenden Zimmer, das ganz auf die Strassenseite hinaus liegt, trennt, nur Handtücher bereitgelegt sind. Um den Koffer – wenn sich Seife und Waschlappen in ihm befinden – zu öffnen, legt man ihn am besten auf das Bett, das mit dem Kopf ende an der Zimmerwand steht, die die Zimmertür enthält, wo man ihn dann auch liegen lassen kann, bis man vom Abendessen wieder hinaufkommen würde. Mantel, Halstuch und Pelzmütze hängt man an den Kleiderhaken an der Innenseite der Zimmertür, die sich gegen die Wand mit dem Lavabo zu öffnet und dabei, nach einer Drehung von etwas mehr als neunzig Grad, gegen einen an dieser Wand angebrachten roten Hartgummiring stösst. Die Handschuhe hat man in die Manteltasche gesteckt oder auf das Nachttischchen gelegt, das zwischen der Zimmertür und dem Bett steht. Über dem Bett hängt an der Wand, die die Zimmertür enthält und das Zimmer von dem seitlich angrenzenden Zimmer, das ganz auf das Nachbargrundstück hinaus liegt, trennt, eine aus einem Familienblatt – dem GELBEN HEFTLI, dem SCHWEIZER HEIM oder der SCHWEIZER FAMILIE – ausgeschnittene, gerahmte, aber nicht hinter Glas gesetzte, farbige Photographie eines aus einer Höhle hinausschauenden Fuchses. Die Seifenverpackung wirft man, ohne die Silva Cheques, die AVANTI-Punkte oder anderen Bons aus ihr herauszulösen, in den Papierkorb, der auf dem rechteckigen Linoleumstück steht, das unter dem Lavabo in den Holzboden eingelassen ist ... Dann, nachdem man sich gewaschen hat, erinnert man sich – wie fast jedes Mal, wenn man sich anschickt, in einem neubezogenen Hotelzimmer zu übernachten – wie der an einen seiner Lehrer und daran, wie er einmal, in einem Wintersemester, in einer Vorlesung über Tod und Leben – »Der Tod als philosophisches Problem« – erzählt hat, dass er jedes Mal, wenn er in einem Hotelzimmer übernachtete, daran denken müsse, dass er in dieser ihm völlig fremden, nichtssagenden – nichts über ihn aussagenden –, für einen nichtexistierenden Durchschnittsgeschmack eingerichteten, von soundso vielen Menschen – ohne dass sie auch nur eine einzige Spur ihrer persönlichen Anwesenheit hinterlassen hätten – vor ihm und von soundso vielen Menschen – ohne dass sie auch nur eine einzige Spur ihrer persönlichen Anwesenheit hinterlassen würden – nach ihm benutzten (nicht bewohnten) Umgebung, zu der er keinerlei, aber auch überhaupt keine Beziehung habe – und das sei ein ihm unerträglicher Gedanke – sterben könnte ...
Zum Abendessen wird man von der Wirtin, Frau Anna Soltermann-Hirschi, die einen am Fusse der Treppe aus dem Obergeschoss angesprochen hat, nicht in die Gaststube an der Frontseite des Gasthofes gegen Bärau Langnau zu, sondern an einen Tisch im vorderen Teil des an der Strassenseite gelegenen Sälis geführt, dessen hinterer Teil von einer hölzernen Harmonikaschiebewand vom vorderen abgetrennt ist und unter dem Eckzimmer, das man gerade erst belegt hat, enden muss. Nachdem man sich gesetzt hat, fragt einen die Wirtin – wie man es nach der Ankündigung ihres Mannes erwartet hat –, ob man sich schon für Voll- oder Halbpension entschieden habe, und gibt einem dann die Essenszeiten für Morgen-, Mittag- und Abendessen bekannt. Anschliessend bittet sie einen noch, den Anmeldezettel auszufüllen, und erkundigt sich, was man zum Essen zu trinken wünsche, es gebe STEINPILZSUPPE, HACKBEEF STEAK MIT SPIEGELEI, NÜDELI, ENDIVIENSALAT UND FRUCHTSALAT. Bis sie einem – wieder persönlich – die bestellte Flasche Beaujolais und das Mineralwasser bringt, füllt man die Anmeldekarte mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Beruf, Wohnadresse, Nationalität, Herreiseort und Reiseziel aus; danach vertreibt man sich die Zeit, indem man ein oder zwei Glas Wein trinkt und den – bis auf einen selbst – leeren Speisesaal und die übrigen gedeckten, in Reihen stehenden Tische betrachtet. Vor der Fensterreihe gegen die Strasse zu sind schwere, bis zum Boden hinunterreichende Vorhänge gezogen, die keinen Lichtschimmer mehr von draussen hereinfallen lassen und auch die Geräusche der hin und wieder am Gasthof vorbeifahrenden Motorfahrzeuge dämpfen. Durch die geschlossenen Türen von Säli, Gaststube und Küche werden auch die Geräusche aus der Gaststube, aus dem Radioapparat in der Gaststube und aus der Küche gedämpft, die nur etwas lauter zu hören sind, wenn ein Gast die Gaststube verlässt, um durch den Gang zwischen Säli und Küche die Toilette aufzusuchen oder um durch die Eingangstür den Gasthof zu verlassen, oder wenn ein neuer Gast die Gaststube betritt, wenn die Serviertochter, der Wirt oder die Wirtin die Gaststube oder die Küche betreten oder verlassen. Man hört auch, wenn jemand über die Treppe am Ende des Ganges, der bei der Eingangstür beginnend zwischen Küche und Gaststube hindurch zur Hintertür führt, ins obere Stockwerk hinauf oder aus dem oberen Stockwerk hinuntersteigt, wenn jemand die Hintertür öffnet oder wenn jemand in den Zimmern, die sich über dem vorderen Teil des Sälis befinden, herumgeht. Das von der Wirtin aufgetragene Essen würde einem nach der etwas langwierigen Reise ausgezeichnet schmecken, und man würde sich über die Grösse der Portionen und die Beschaffenheit des Essens – im Hinblick auf den Umstand, dass man sich für Vollpension zu zwanzig Franken am Tag entschieden hat – noch keine Gedanken machen ...
Bevor man sich schlafen legt, räumt man die Kleider aus dem Koffer in den Schrank, der, dem Fussende des Bettes gegenüber, an der Wand gegen die Strassenseite zu steht, und stapelt die Bücher – unter ihnen eine alte Reclamausgabe von Kants »Kritik der praktischen Vernunft«, der vierte und der achte Band der bei WALTER DE GRUYTER & Co. erschienenen Akademie-Textausgabe von Kants Werken und zwei Kant-Biographien –, das Schreibzeug und den PARIS MATCH auf den Tisch, der neben dem Schrank in der Ecke steht. Aus dem Fenster in der Wand, die zur Frontseite des Gasthofes gegen das Dorf zu gehört, kann man über einen grossen, jetzt tief verschneit daliegenden Gemüsegarten des Nachbargrundstückes hinweg einen Teil des sich links und rechts der Hauptstrasse entlangziehenden, jetzt ebenfalls tief verschneit daliegenden, vom Schnee und von den Strassenlampen schwach erhellten Dorfes erkennen. Dann hebt man den leeren Koffer vom Bett auf den ziemlich hohen, fast bis zur Zimmerdecke hinaufreichenden Schrank, wo man ihn nun – bis zu dem Tag, an dem man wieder abreisen würde – endgültig liegen lassen kann. Die zum Abhalten der Kälte vor den beiden Fenstern des Zimmers eingehängten Vorfenster verunmöglichen ein Schliessen der sich kalt und staubig anfühlenden, dunkelgrün gestrichenen Fensterläden, die an der Aussenseite des Gasthofes neben sämtlichen Fenstern eingehängt sind, so dass man sich zur Verdunkelung des Zimmers mit dem Zuziehen der bis zum Boden reichenden, dünnen Stoffvorhänge begnügen muss. Da man Hände und Gesicht schon vor dem Essen gewaschen hat, kann man sich nun – angesichts der Kälte, die trotz des wahrscheinlich schon während des ganzen Tages warmen Zentralheizungsradiators immer noch in dem Zimmer herrscht – damit begnügen, noch die Zähne zu putzen, wobei man im Spiegel über dem Lavabo bemerkt, dass die Luft in dem Zimmer sogar so kalt ist, dass sich der Atem – wie in der kalten Luft draussen vor dem Gasthof – weiss in ihr abzeichnet. Zwischen zwei barchenen Leintüchern und unter einer dicken Wolldecke und einem schweren Deckbett kann man sich aber nach einiger Zeit, dank der mit dem Essen und dem Wein eingenommenen Kalorienmenge, eine angenehme Wärme verschaffen und – die kalte, angenehm frisch und unverbraucht erscheinende Luft einatmend – ruhig schlafen ...
Samstag, 27. Dezember
Wegen der Kälte, die im Winter, auch während klaren, sonnigen Tagen mit einem wolkenlosen, tiefblauen Himmel wie sonst selten irgendwo, oft in Trubschachen herrscht, ist es wichtig, genügend warme Wintersachen bei sich zu haben (die man zur Not allerdings auch in der Gemischtwarenhandlung ergänzen kann, wenn das Material dort auch, qualitativ und vor allem bezüglich des Schnittes, nicht dem entspricht, was man in der Stadt, möglicherweise auch bereits in Langnau erhält), damit man je nach Aussentemperatur und Witterung (schönes, sonniges, trockenes – oder schlechtes, nebliges, feuchtes Wetter), noch zwei, drei oder mehr Kleiderschichten zu der ersten, gewöhnlich getragenen Schicht hinzu anziehen kann. Da jedoch schon vier oder fünf Kleiderschichten zu einer fast vollständigen Unbeweglichkeit führen und ein Sich-nach-draussen-Begeben somit verunmöglichen würden, nehmen die Trubschacher die zur zusätzlichen und überhaupt zur Wärmeerzeugung notwendigen Kalorien, die durch die Kleiderschichten ohne hin nur vorübergehend vor einer allzu schnellen Umwandlung in die benötigte Wärme geschützt werden können, in Form von reichlichem, Stadtmenschen vielleicht fett erscheinendem, aber gutem Essen zu sich, das in der Wirtschaft zum Hirschen am Morgen zum Beispiel immer aus BROT, WEGGLI – am Sonntag BERNER ZÜPFE (Zweistrang-Zopf) –, BUTTER, Zweierlei KONFITURE und KÄSE, am Mittag des ersten Aufenthaltstages, am SAMSTAG, DEN 27. DEZEMBER etwa aus einer SPARGELCREMESUPPE, einem grossen ENTRECOTE (je nach Wunsch à point, saignant, mit oder ohne Kräuterbutter), FENCHEL MIT GERIEBENEM Käse, in Öl gebackenen KARTOFFELWÜRFELI, RANDENSALAT und einer COUPE MELBA und am Abend dieses Tages aus einer ERBSENSUPPE, SAUERKRAUT MIT GNAGI (Eisbein) UND BAUERNWÜRSTEN (vom Bauern hergestellte Würste), SALZWASSERKARTOFFELN und einem MOKKAWÜRFEL besteht und das bei manchem Feriengast oder Reisenden, der in Trubschachen absteigt und ein solches Essen und einen guten Tropfen oder auch mehrere dazu schätzt, es aber nicht gewohnt ist, trotz der Kälte und trotz langer, anstrengender Spaziergänge dem Tal entlang oder über die umliegenden Talhänge und Eggen (Hügelrücken), zu einer oder mehreren unwillkommenen zusätzlichen natürlichen Körperschichten führen kann, die er nicht mehr so leicht wie die willkommenen zusätzlichen künstlichen Kleider körperschichten ablegen kann ... Körperschichten, die in einem gewissen, wenn man so will, tieferen Sinn aber auch zur Abwehr einer grösseren, absoluteren Kälte als der, die bereits in Trubschachen herrscht, zugelegt worden sein könnten – und, wenn man es sich richtig überlegt, wie alles, was wir tun, auch zur Abwehr dieser uns allen bestimmten Kälte zugelegt worden sind –, wie das meiste von dem, was wir tun, paradoxerweise jedoch nicht der Abwehr, sondern im Gegenteil nur dem schnelleren Herbeiführen der Kälte dient ...
Schon durch den Umstand, dass man das Zimmer – damit es vom Zimmermädchen gemacht werden kann – jeden Morgen für ungefähr eine Stunde würde verlassen müssen, würde eine gewisse Regelmässigkeit in den Tagesablauf hineinkommen, die später, wenn man – wie man es sich vorgenommen hat – auch arbeiten würde, in einen mehr oder weniger gleichbleibenden Tagesrhythmus würde übergehen können. Der je nachdem längere oder kürzere Spaziergang, den man sich deshalb – um die Zeit nicht sitzend in der Gaststube zu verbringen – jeden Morgen nach dem Frühstück zur Gewohnheit machen würde, würde aber nicht genügen, um sich die Bewegungsmenge zu verschaffen, die bei Vollpension und der Beschaffenheit des Essens im »Hirschen« wünschenswert wäre, so dass man sich schon nach einem oder zwei Tagen auf alle Fälle für jeden späteren Nachmittag oder Abend noch einen längeren oder kürzeren Spaziergang würde vornehmen müssen, den man später – je nachdem, wie man mit der Arbeit vorankommen würde – auch auf die Zeit gleich nach dem Mittagessen oder auf den frühen Nachmittag würde verschieben können.