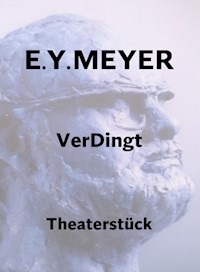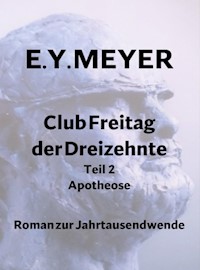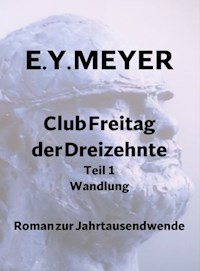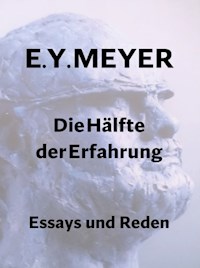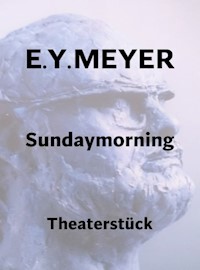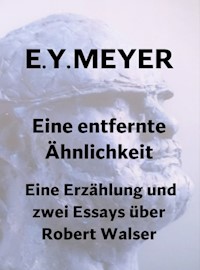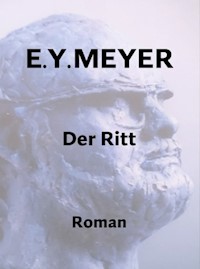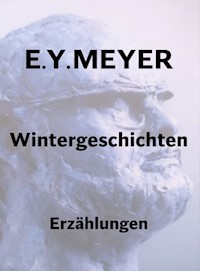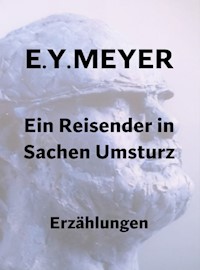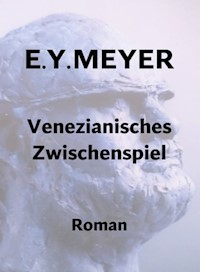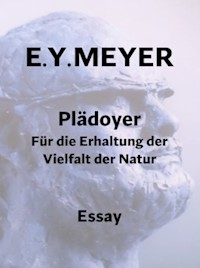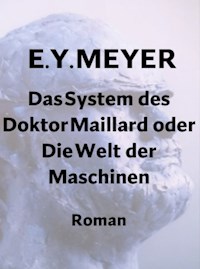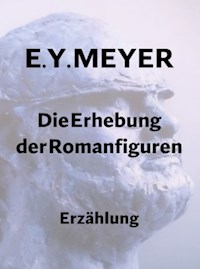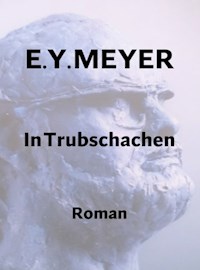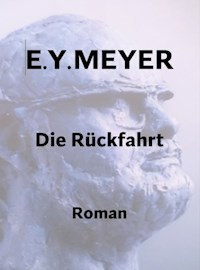
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Die Rückfahrt« erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, von seinen Schwierigkeiten mit dem Leben im reichsten Land der Welt und dem Versuch, sich mit der Hilfe eines Psychiaters auf eine neue Existenz in der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Schweiz vorzubereiten. Sie erzählt von den Gesprächen mit einem Denkmalpfleger und von der Entscheidung des jungen Mannes, den Lehrerberuf aufzugeben. Mit der eigenen Vergangenheit steigt die historische auf. Kunstwerke, Denkmäler, Erziehung und politische Geschichte verbinden sich mit den persönlichen Erfahrungen, lassen sie wachsen und heben sie im Gang der Geschichte auf. »Die Rückfahrt« meint nicht nur die letzte Fahrt mit dem Denkmalpfleger, sie meint ebenso die Umkehr im Sinne einer geschichtlichen Wende, die Abkehr von einem sich über grosse Zeiträume erstreckenden Vernichtungsprozess des Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
E.Y.MEYER
Die Rückfahrt
Roman
Erstmals erschienen 1977
© 2021 E.Y.MEYER
eymeyer.ch
Cover:
Bronzekopf des Autors
Geschaffen 1997 von PAN YI QUINAcademy of Arts & Design
Tsing Hua UniversityBei Jing, China
Für Judith und Georg
Kapitel
Erster Teil Sonnmatt
Zweiter Teil Das Papageienhaus
Dritter Teil Die Rückfahrt
Erster TeilSonnmatt
»Es gibt Erinnerungen, die wie schillernde Blasen sind. Nach vielen Jahren steigen sie plötzlich auf in einer Nachtstunde, wachsen und wachsen, wollen nicht zerplatzen, sondern blenden die Augen unter den geschlossenen Lidern.«
Friedrich Glauser: »Mensch im Zwielicht«
1
Sie standen auf dem Münsterturm und schauten über die Stadt und das Land, über das sich die Dämmerung breitete. Das Amt für Denkmalpflege lag weit unten. Aus der Turmhalle drangen über den Treppenaufgang die Töne der einsetzenden Orgel bis zu ihnen hinauf, und über ihre Köpfe zogen ungezählte Schwärme von Fledermäusen hinweg, die die alte Turmkappe verliessen und über die ganze Stadt hinflatterten. Als die letzten Fledermäuse den Turm verlassen hatten und das Geräusch der Flügelschläge verstummt war, das wie das Knattern von Segeln im Wind getönt hatte, glaubten sie ausser dem entfernten Orgelspiel noch ein immer lauter werdendes Kratzen zu hören, das sich der breiten Balustrade der obersten Münstergalerie näherte, auf der sie sich befanden; und als sie an die Balustrade traten und über sie hinweg der Fassade entlang hinunterblickten, sahen sie, wie dicht zusammengedrängt und von allen Seiten her unzählige kleine affenartige Wesen, die sich in ihrer Farbe nicht im geringsten von der des Sandsteins des Münsters unterschieden, mit einer grossen Geschicklichkeit und Geschwindigkeit von den Fialen der Strebepfeiler her, über die Strebebogen und die Turmfassade auf die Galerie zu kletterten. Alles an ihnen, auch die Kleider, die sie zum Teil trugen, war sandsteinfarben, so dass es aussah, als ob Teile der Münsterfassade in Bewegung geraten seien, und als die ersten von ihnen die Balustrade erreichten, sahen sie, dass es Konsolen-, Türpfosten-, Türsturz-, Konsolenträger-, Bogenfeld- und Archivoltenfiguren sowie zu grotesken, widernatürlichen Gestalten geformte Wasserspeier waren, die ohne aufeinander Rücksicht zu nehmen panikartig den Turm erklommen und in deren Sandsteinaugen Angst stand. Als er zum Denkmalpfleger hinüberblickte, sah er, dass sich dieser schon wieder aufgerichtet hatte und ihn mit hochgezogenen Augenbrauen und weitgeöffneten, wahnsinnsgefüllten Augen ansah – so dass er erschrocken vor ihm zurückwich – und dass sich dessen Gesicht zu einem breiten Grinsen verzog, das unvermittelt in ein unmenschliches, höhnisches Gelächter von einer unvorstellbaren Lautstärke überging. Dann begann die dicke Steinplatte des Galeriebodens und mit ihr schliesslich der ganze Turm langsam zwischen ihnen auseinander zu brechen, so dass sich der Denkmalpfleger, ohne in seinem Gelächter innezuhalten, mit seiner Turmhälfte und den verzweifelt Halt suchenden Sandsteinfiguren, die reihenweise in die Tiefe fielen, langsam von ihm entfernte und ihm, gerade noch bevor die beiden Turmhälften in sich zusammenstürzten, mit einer Donner stimme durch das ohrenbetäubende Krachen und die immer lauter werdende Orgelmusik hindurch die Worte: Machs na! zurief...
Berger lag auf dem Rücken und sah zur Decke hinauf. Er hatte wieder geschlafen, aber er machte sich nichts daraus; das war es ja, was man von ihm verlangte.
Draussen war es immer noch gleich beängstigend dunkel wie schon seit dem späteren Vormittag, als sich nach anfänglichen Aufhellungen der Himmel plötzlich wieder mit grauschwarzen Wolkenfetzen zu überziehen begonnen hatte, die dann schnell zu einem den ganzen Himmel bedeckenden dunklen Gewölbe zusammengeflossen waren, das Berger an die Decke eines unterirdischen Verlieses hatte denken lassen. Durch die geöffnete zweiflügelige Balkondoppeltür und die ebenfalls offenstehenden Fensterteile in ihr drang vereinzeltes Vogelgezwitscher ins Zimmer sowie das Glockengeläut und langgezogenes Blöken der am Talhang weidenden Schafe. Ab und zu waren auch Geräusche, die von einer Baustelle im Tal unten stammten, das Surren eines elektrisch betriebenen Krans oder ein rhythmisch ertönendes Hämmern zu hören.
Berger betrachtete den Wasserfleck an der Stelle, wo sich die Decke in einer Rundung etwas nach unten senkte, und sah darin wieder einen Käfer oder einen Tintenfisch mit Menschenkopf. Über einem runden Kinn mit Bartstoppeln öffnete sich ein kleiner, lippen- und zahnloser runder Mund, über dem eine überdimensioniert grosse Nase nach vorn ragte, auf der an ihrem oberen Ende ein ebenfalls überdimensioniert grosses Glotzauge sass. Über dem Auge streckte sich ein fühlerähnliches Gebilde nach vorn, in dem man auch eine Mütze, ein Geweih oder die Tentakel eines Tintenfisches hätte sehen können, wogegen sich der Kopf hinter dem Auge sofort flach senkte. Wenn man im Vorderteil einen Menschenkopf sah, ähnelte der Leib, der sich direkt an den Kopf anschloss und die Form und Grösse eines Brotlaibes besass, aber doch am meisten einem Käferleib oder Käfer mit einem Menschenkopf, den man Gregor Samsa hätte nennen können...
Als es draussen zu regnen begann, erhob sich Berger und trat zur Balkontür. Durch den Regen hindurch, dessen Rauschen die übrigen Geräusche dämpfte, sah er auf die Gartenanlage hinunter, in der sich zum Grün der beiden kegelförmig geschnittenen Buchsbäume am Anfang der Treppe zur offenen Terrasse hinauf schon wieder das Grün der übrigen Pflanzen hinzuzufügen begann.
Auf der gegenüberliegenden Talseite reichte die Wolkenschicht bis zum Mischwald hinunter, der dort den Hang bewuchs und auch bereits wieder dichter und undurchsichtiger zu werden schien.
Um seine Schlaftrunkenheit loszuwerden, trat Berger auf den gegen den Regen geschützten Balkon hinaus und konnte nun auch auf die Teile des Gartens hinuntersehen, die unmittelbar vor und neben dem Balkon lagen. Nicht wie aus Pflanzen, sondern eher wie aus menschlichen Wesen schien ihm die exakt ausgerichtete Doppelreihe junger Linden oder Ulmen zu bestehen, die ihre unverzweigten, nass-schwarzen Aste wie handlose Arme gegen ihn ausstreckten. Durch einen rücksichtslosen Schnitt waren nur die kräftigsten der Äste übriggeblieben, die von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende, und auch unter sich, alle gleich dick aussahen, so dass sich später über dem Kiesweg, der sich zwischen ihnen durchzog, ein dichtes, flaches Laubdach bilden würde.
»Dem klassischen Stil dieses Patrizierhauses aus dem achtzehnten Jahrhundert entspricht ein Garten nach französischer Art, mit schnurgeraden Alleen, entlang deren sich Buchsbaum und beschnittene Eiben hinziehen – wobei der Reiz des Pflanzendekors hier noch durch zwei Magnolien und eine Doppelreihe von Kastanien vervollständigt wird.« Wo und wann hatte er diesen Satz gehört oder gelesen? Und wenn er ihn gehört hatte, wer hatte ihn gesagt und war er so gesagt worden?
Hatte der Denkmalpfleger ihn gesagt, und hatte es damals auch geregnet? Oder war nur die Strasse nass gewesen und das Laub, das sie hin und wieder bedeckt hatte? Oder hatte es geschneit, und war die Strasse von Schnee und Eis bedeckt gewesen? Oder von Schneematsch? Oder war es schönes sonniges Wetter gewesen und die Strasse völlig trocken, und hatten also ideale Fahrbedingungen und Verhältnisse geherrscht?
Berger verspürte trotz oder gerade wegen der Feuchtigkeit, die ihn umgab und seine Haut berührte, plötzlich wieder einen Drang, etwas zu trinken, und er trat ins Zimmer zurück. Er erinnerte sich, wie er als Kind, in der zweiten oder dritten Klasse, wenn er von der Schule nach Hause gekommen war und es draussen regnete, oft einen grossen Durst verspürt hatte und in die Küche gegangen war, um dort das vom Mittagessen stehengebliebene, nun süsslich schmeckende Zitronenwasser direkt aus dem oft noch halbvollen Milchhafen zu trinken. Seine Mutter hatte ihn deswegen getadelt, wenn sie ihn dabei gesehen hatte.
Später hatte Berger dann das Zitronenwasser mit einem angemessenen Anteil Gin zu schätzen gelernt und es, soviel er sich erinnern konnte, eigentlich nur noch so getrunken.
Trotz der geschlossenen Balkondoppeltür und der nun ebenfalls geschlossenen Fensterchen in ihr, konnte Berger immer noch den Regen und die Vogelstimmen hören, nahm nun aber auch wieder Geräusche aus dem Innern des Hauses wahr, so eine dumpfe, unverständliche Frauenstimme im angrenzenden Zimmer, das durch eine verschlossen gehaltene Doppeltür mit dem seinen verbunden war.
Berger hatte sich wieder auf das Bett gelegt und den Rest einer Flasche Mineralwasser getrunken, ohne dass sein Durst dadurch verschwunden wäre. Irgendwo eine vollständige Stille suchen zu wollen, war ein Vorhaben, das nicht ausführbar schien, denn überall würde es wieder Geräusche geben. Die Frage war nur, was für eine Art von Geräuschen und wie man sie zum Zeitpunkt, in dem sie erzeugt wurden und man sie wahrnahm, ertragen würde. Es gab Zeitpunkte, in denen ihm sogar Vogelgezwitscher unerträglich laut und nerventötend vorkam und er ständig darauf wartete, dass das unablässige Pfeifen, Trillern, Schlagen, Tirilieren, Quirilieren, Quinkelieren und so weiter, endlich abbrechen und der Ruhe anderer, weniger aufdringlicher Geräusche Platz machen würde. Und es gab Zeitpunkte, in denen er erschrocken zusammenfuhr, wenn in eine vermeintlich vollständige Stille hinein in einer unmittelbaren Nähe plötzlich ein von einem Insekt oder einem anderen, nicht sichtbaren Kleintier verursachtes Rascheln, Schwirren oder Summen ertönte.
In der vergangenen Nacht hatte ihn während einer scheinbaren vollständigen Stille mit einem Mal ein hohes Summen und Rauschen wie von einer elektrischen Hochspannungsleitung zu stören begonnen, obwohl er sicher war, dass es schon die ganze Zeit über, in der er wach in der Dunkelheit gelegen hatte, ohne ein bewusstes Hören in ihm auszulösen, dagewesen war. Und obwohl er schliesslich zu merken geglaubt hatte, dass er selber, durch das Fliessen des Blutes in seinem Körper, die Ursache für das Geräusch war, hatte er immer wieder versucht, sich in jenen Zustand zurückzuversetzen, in dem er es nicht bewusst gehört hatte. Aber jedes Mal, wenn er sich hatte vergewissern wollen, ob es nicht mehr zu hören sei, war es wieder oder immer noch da gewesen, was ihn immer unruhiger hatte werden und ihn immer weniger wieder hatte einschlafen lassen, so dass er schliesslich mit dem Kissen andere, lautere Geräusche an seinen Ohren erzeugt und so das Summen und Rauschen zu übertönen und wieder zum Verschwinden zu bringen versucht hatte.
Während es im Zimmer immer dunkler wurde, überlegte Berger, was er für den Rest des Tages tun wollte. Für einen Spaziergang regnete es ihm zu stark, obwohl er hin und wieder, wenn es richtig schüttete, gern im Regen spazieren gegangen war und sich deshalb auch einen englischen Burberry-Regenmantel gekauft hatte, den man bis zum Hals hinauf zuknöpfen konnte und dessen Durchgreiftaschen es zuliessen, dass man zu den Hosen- und Rocktaschen gelangen konnte, ohne dass man den Mantel aufzuknöpfen brauchte. Er hatte sich dann immer an die schwarze Wollstoffpelerine erinnert, die er als Kind besessen und die ihn, wenn er ganze Vormittage oder Nachmittage in ihr auf der Strasse herumgegangen war, schön warm und trocken gehalten hatte. Wobei das, wie er wusste, nicht der einzige Grund für den Kauf des Burberrys gewesen war. Da es nun aber schon die ganze Zeit über regnerisches Wetter gewesen war und er hier auch kein geeignetes Schuhzeug dafür besass, hatte er vorläufig schon vom Überraschtwerden vom Regen beim Spazierengehen genug, vom Spazierengehen im Regen ganz zu schweigen.
Da er kein Licht machen wollte und gleichzeitig befürchtete, dass es zum Lesen nicht mehr hell genug war, mochte er auch nicht lesen, obwohl er bis jetzt den ganzen Tag noch nichts gelesen hatte. Am liebsten wäre er so liegen geblieben und hätte beobachtet, wie die Dunkelheit das Zimmer zu füllen begann, und dann an den obwohl weiss gestrichenen, bereits schwarz erscheinenden Fenstersprossen der Balkontüren vorbei hinausgeschaut, wie sich die Dunkelheit dort ausbreitete, und dabei ab und zu einen Schluck Zitronenwasser mit Gin zu sich genommen.
Eigentlich hätte er versuchen müssen, sich an seinen Traum zu erinnern und sich diesen, so gut das ging, in seinem ganzen Umfang zu vergegenwärtigen, um ihn dann – auch wenn ihm seine Bedeutung und seine Beziehung zu Ereignissen aus seiner Vergangenheit völlig unklar gewesen wäre – in ein dafür vorgesehenes Heft zu schreiben, das er auf Doktor Santschis Rat hin angelegt hatte. Auch wenn man nie alles in seinen Bezügen zu der eigenen Vergangenheit verstehen könne und ein solches Vorgehen auch niemals imstande sei, die Ergebnisse einer psychoanalytischen Arbeitsweise hervorzubringen, so sei es doch möglich, dadurch, dass man während einiger Zeit seine Träume regelmässig aufschreibe, einigermassen ein Bild von sich – seinem Wesen, seiner Art – zu bekommen, hatte Santschi gesagt. Die Menschheit beschäftige sich nicht mehr genug mit ihren Träumen, wodurch der Abstand zwischen diesen und der Wirklichkeit immer grösser werde.
Da Berger, wie für das Lesen, auch für das Schreiben jedoch auf jeden Fall nicht mehr lange ohne Licht ausgekommen wäre, unterliess er auch das, verschob es – in der vielleicht unberechtigten Hoffnung, dass er sich auch dann noch an den Traum würde erinnern können – auf die Zeit nach dem Abendessen, wenn er sich ohnehin mit dem elektrischen Licht würde behelfen müssen.
Nach einer Weile erhob sich Berger wieder und strich sich mit den Fingern die Haare zurecht. Er nahm die leere Mineralwasserflasche, öffnete die Tür an der Wandinnen- und die an der Wandaussenseite und trat in die noch weiter fortgeschrittene Dunkelheit des Ganges hinaus, der sich gegen sein Ende auf der rechten Seite zu, wo sich eine Nebentreppe befand, nur unmerklich, gegen seine Mitte auf der linken Seite zu, wo sich die Haupttreppe befand, hingegen etwas mehr aufhellte. In der anderen Ganghälfte oder im anderen Gang auf der linken Seite brannte bereits Licht.
Als er den mittleren Teil des Ganges erreicht hatte, den Treppenhausteil also, wo sich die Haupttreppe und der Lift befanden, verspürte er einen Drang, Wasser aus seinem Körper zu lösen, und ging deshalb durch die zweite offengehaltene Glaspendeltür, die zur Abtrennung des Treppenhauses von den beiden Gängen diente, zum Toilettenraum weiter, der sich am Anfang des nächsten Ganges befand. Während er die Mineralwasserflasche unter den linken Arm geklemmt hielt und den Urin in die weisse Schüssel hineinlaufen liess, sah er durch das geöffnete Toilettenfenster auf den Vorfahrplatz und die Stallungen des Bauerngutes auf der anderen Wegseite hinunter und die Fortsetzung des Hanges hinauf, über dessen Wiesen nun Nebel hinabzusteigen begann.
Nach allem, was mit den unzureichenden menschlichen Sinnen feststellbar war, schienen die Wissenschaftler, allen voran die amerikanischen, mit ihren Aussagen, dass nach einer Zeit eines weltweiten Temperaturanstieges nun seit zehn oder fünfzehn Jahren eine zunehmende Abkühlung im Gange sei, recht zu behalten. Wobei, wie Berger irgendwo gelesen hatte, beide Phänomene paradoxerweise nahezu die gleichen Ursachen hätten: nämlich die durch Industrie- und Zivilisationsabgase bewirkte Luftverschmutzung, in deren Folge sich in den oberen Luftschichten der Erde zunächst eine Kohlendioxydhülle gebildet habe, die durch das Zurückhalten der irdischen Wärmestrahlung während etwa vierzig Jahren für die Aufrechterhaltung einer treibhausartigen Konstellation verantwortlich gewesen sei. Dann sei dieser Effekt jedoch durch mikroskopisch kleine Schmutzteilchen, die in zunehmendem Masse von Industrie- und Kraftwerkanlagen ausgestossen worden seien, wirkungslos geworden, da diese ihrerseits nun wie ein Vorhang wirken würden, der die Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche abhalte. Wohl brachten heftige Regengüsse reinigende Abhilfe, doch werde die Reinigungskraft des Regens schnell zu Nichte gemacht.
Beim Händewaschen besah sich Berger im Spiegel seine Zunge, die immer noch einen weissen Belag aufwies, der aus abgestossenen Hautzellen, Speiseresten und Bakterien bestehen sollte, was von blossem Auge jedoch nicht wahrzunehmen war. Das Zurückbiegen der Zunge brachte die grausilbern glänzenden Amalgamplomben in den Malzähnen zum Vorschein, die in die durch Zahnfäule und anschliessendes Wegbohren des kranken Gewebes entstandenen Höhlungen gefüllt worden waren. Wie er in dem Lexikon, das er besass, einmal nachgelesen hatte, werde Amalgam durch Verreiben von Quecksilber mit fein verteiltem Metallpulver hergestellt und – wegen seiner Weichheit und Knetbarkeit bei geringer Erwärmung – zu Metallkitten und Zahnfüllungen verwendet.
Wenn es zutraf, dass die Zahnfäule gegenüber früheren Zeiten zunahm, dann würde man sicher mit einem gewissen Recht sagen können, dass die Menschheit einen Weg eingeschlagen hat, für den sie von der Natur, jedenfalls in dieser Hinsicht, nur mangelhaft ausgestattet worden ist. So dass sich der Mensch, so gut es geht, mit allerlei Hilfsmitteln und Hilfstechniken, wie beispielsweise dem monatlichen gemeinsamen Fluor-Zähnebürsten in den Schulen, selber zu helfen versuchen musste. Bis er einmal nur noch mit der Hilfe unzähliger solcher Mittel und Techniken lebensfähig wäre und existieren könnte – oder bis er dadurch, dass er sich seine Lebensbedingungen selbst verändert und die Beherrschung der Natur erreicht hätte, diese zwingen würde, ihn doch noch den veränderten Lebensbedingungen anzupassen und mit den für das Leben unter diesen Bedingungen nötigen Organen auszustatten. Wobei es auf diese Weise, wenn man unter Natur alles verstand, was so war, wie es sich gab, und sich nach eigenen innewohnenden Kräften, Trieben und Gesetzen gestaltete und entwickelte, immer schwieriger zu sagen würde, was noch Natur sei und was schon zur Kultur gehöre – vor allem, wenn man dies auch in Bezug auf den Menschen selber zu bedenken versuchte.
Obwohl ihm der Zahnarzt nicht hatte sagen können, ob die Reihe von ergebnislosen Untersuchungen, die bei ihm, Berger, die Folge gewesen war, auf das regelmässige Einnehmen von Fluortabletten zurückzuführen sei – zwar sei deren grösste Wirkung eindeutig beim Kind und Kleinkind festzustellen, aber man habe auch in amerikanischen Militärcamps, in denen Fluortabletten ausgegeben würden, einen gewissen Rückgang der Karies beobachten können –, schien es Berger, da er die Möglichkeit eines Zusammenhanges nie ganz hatte verdrängen können, dass er nun eigentlich mit dem Einnehmen dieser Tabletten auch wieder hätte anfangen sollen. Wie immer in solchen Fällen würde dabei andererseits aber auch die Gefahr, oder doch wenigstens die Möglichkeit, noch nicht bekannter, sogenannter unerwünschter Nebenwirkungen bestehen, die sich erst viel später bemerkbar machen würden, wenn es schon zu spät wäre nämlich, mit der Einnahme der betreffenden Mittel wieder aufzuhören. Aber das schien man in Kauf nehmen zu müssen – und er, Berger, hatte sich das alles ja schon überlegt gehabt, als er sich entschlossen und damit begonnen hatte, die Fluortabletten ebenfalls einzunehmen.
Wenn eine gewisse Vorsicht auch angebracht sein würde, so konnte man doch nicht auf alles verzichten, was die medizinische Forschung hervorgebracht, in der Praxis aber noch zu wenig erprobt hatte – oder einfach nicht hatte erproben können. Schliesslich hatte er, Berger, ja in der Hoffnung, dass sie ihm helfen würden, auch bedenkenlos die ihm verordneten Valium eingenommen und nahm sie immer noch nach Vorschrift ein, obwohl er, wie von den meisten Produkten der pharmazeutischen Industrie, nichts von ihrer Zusammensetzung, Erprobtheit und von ihren eventuellen Nebenwirkungen wusste. So wenig wie er beispielsweise wusste, ob ein weisser Zungenbelag immer noch – wie es seine Mutter jeweils gesagt hatte – als Zeichen einer Erkrankung galt oder ob ein solcher nicht etwa auch durch das Einnehmen von Valium entstehen konnte. In Situationen, die ausweglos schienen, war einem jedes Mittel recht, das Abhilfe oder auch nur Aufschub versprach.
Berger verliess den WC-Raum, ging zur Treppenhaushalle zurück und stieg über die mit einem roten Läufer bedeckte Treppe hinunter, wobei er aus den Treppenhausfenstern wieder auf die dunkle Landschaft und das nassschwarz glänzende Blechdach der gedeckten Einfahrt hinaussehen konnte.
Auf der Treppe vom ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss blieb er auf den Stufen über dem letzten Treppenabsatz stehen und betrachtete ein grosses, mit E. Hodel signiertes Ölbild, das an der gegenüberliegenden Wand hing und die vom Maler ganz in einem leicht gelblichen Weiss gehaltene, gegen Süden, also gegen den See gerichtete Hauptfassade des Hauses in einer grünen Umgebung zeigte.
Obwohl eher in impressionistischer Manier gemalt, war die Gliederung des Hauses deutlich zu erkennen. Ein hochgiebeliger vierstöckiger Haupttrakt, dessen Giebel in der Blickrichtung des Betrachters verlief. Eine kleinere, dreistöckige Wiederholung desselben am linken, also westlichen Seitenende des Hauses. Ein ebenfalls dreistöckiger Verbindungsbau zwischen den beiden, dessen Giebel für den Betrachter quer zur Blickrichtung verlief, sowie ein zweistöckiger Anbau auf der rechten Seite, also östlich des Haupttraktes, der sich in einer leicht gegen Norden zu gebogenen Linie an diesen anschloss. Und ebenso deutlich trat auch die Gliederung der Fassade durch die vielen Balkone, die offenen und gedeckten Terrassen, die Erker und die runden Vorbauten hervor, obwohl letztere durch die en face-Darstellung auf dem Bild nicht als rund wahrgenommen werden konnten. Sogar die gesprossten Stützen zwischen dem langen Balkon und dem Dachvorsprung im Verbindungsbau und die ebenfalls gesprossten Balkonverkleidungen der beiden darüberliegenden Dachzimmer waren festgehalten und recht gut zu erkennen.
Trotz der auf dem Bild auch wiederum nicht als vorspringend zu erkennenden Hauptterrasse – wenn man vom Anbau absah, zog sie sich in Stockwerkhöhe über dem Boden auf einer Säulenreihe der ganzen Fassade entlang – und trotz der langen, durchgehenden Balkonreihen, die nur durch dünne Holzwände unterteilt waren, wirkte nicht nur die Horizontale des Verbindungsbaus, der in Wirklichkeit zwischen den Vertikalen der beiden Flügel zurücktrat, sondern die ganze breit gelagerte, umfangreiche Baumasse auch auf dem Bild als eine geschlossene Einheit, die den Eindruck des Organischen, Unzerrissenen und Rhythmisch-Ruhigen erweckte.
Als wohltuend empfand Berger bei der grossen Zahl von rechteckigen Fenstern zum Beispiel das Rundbogenmotiv bei den Fenstern unter dem Giebel des linken Flügels, und die anspruchslose Zeichnung der vielen Fenstersprossen nahm sich wie ein Flächenornament aus. Beim Haupttrakt wurde die Wand unter dem Giebel von zwei Erkern flankiert, die in ihrer breiten Gestaltung jedoch wieder wie ein Stück Hausfläche wirkten – was nicht nur an dem Bild liegen konnte, obwohl dieser Umstand darauf besonders augenfällig wurde. Aus den grauen, in vielen Partien geschweiften Schieferdächern, die farblich gut zur dunklen Umgebung des waldreichen Hintergrundes vermittelten, erhoben sich einzelne oder in einer Reihe zusammengefasste kleine Dachfenster sowie einige Kamine von verschiedener Grösse, und unter der grossen Terrasse, die, wie er vom Denkmalpfleger wusste, eigentlich als Altane hätte bezeichnet werden müssen – sie gestattete als Plattform auf einem Unterbau den Austritt ins Freie auch aus dem, wegen der Hanglage, auf dieser Seite in Stockwerkhöhe über dem französischen Garten liegenden Erdgeschoss –, unter der grossen Terrasse oder Altane wuchs über die säulenartig dargestellten Betonstützen das Grün der das Haus umgebenden Natur.
Das Bild musste in der Zeit kurz nach dem Bau des Hauses gemalt worden sein, also wahrscheinlich kurz nach der Jahrhundertwende, denn der zweistöckige Anbau an den Haupttrakt, der wohl irgendeinmal in der Zwischenzeit auch mit Schiefer überdacht worden war, wies auf dem Bild noch ein mit Holzwerk eingerahmtes und unterteiltes Flachdach auf, das vermutlich als Terrasse für Sonnen- und Luftbäder gedient hatte.
Wenig unterhalb des Bildes, das fast die ganze Mauerfläche bedeckte, wurde die Wand dort, wo sie mit der Decke des unter ihr folgenden Raumes zusammentraf, durch gedrechselte, senkrechte Holzsprossen ersetzt, die sich nach dem Treppenabsatz zusammen mit den hinabsteigenden Stufen verlängerten, bis sie am Ende der Treppe in einem breiten, mit dem gleichen Holz verkleideten Pfeiler ihren Abschluss fanden. Durch diese, wie er vermutete, aus gebeiztem Tannenholz bestehende Sprossenwand konnte Berger von dort, wo er stand, bereits ins Erdgeschoss sehen, und durch die Wand rechts von ihm, an die er sich angelehnt hatte, um das Bild zu betrachten, drangen leise, metallisch klingende Geräusche aus dem Liftschacht, um den herum die gerade, dreiläufige Treppe mit gleichsinnigem Richtungswechsel, wie man das nannte – eine Treppe mit zwei Absätzen oder Podesten also – jeweils ins nächsthöhere Stockwerk hinaufführte.
Während Berger die wenigen Stufen vor und nach dem letzten Treppenabsatz hinunterstieg, fragte er sich, ob das Haus wohl noch der Zeit zugerechnet werden konnte, die in der Kunst und in der Architektur als Jugendstil bezeichnet wurde, und ob das Haus wohl unter Denkmalschutz stand, oder ob es dieses Schutzes doch würdig wäre und bedürfte – was Fragen waren, auf die ihm der Denkmalpfleger sicher ohne weiteres befriedigende Antworten hätte geben können.
2
Als Berger die Vorhalle betrat, brannte nur in der Empfangsloge, über einem altmodischen Vermittlungsschrank, an dem sich ein italienischer Hausdiener um eine Verbindung bemühte, und in den dahinterliegenden Büroräumen Licht, das jedoch keine grosse Reichweite hatte und durch die Dämmerung der Halle und des schmalen Ganges, der hinter der Loge zu den Büroräumen führte, gedämpft wurde.
Da er den Hausdiener in seiner Tätigkeit nicht ablenken oder zu einer unangenehmen Eile drängen wollte, trat er zu der Schwingtür, die einen kleinen Eingangsraum von der Vorhalle abtrennte, und sah durch ihre grossen Glasflächen und die Glasflächen der beiden Flügel der Eingangstür auf die gedeckte Einfahrt hinaus, wo vom Rand des auf vier Säulen ruhenden Daches an verschiedenen Stellen das Regenwasser hinuntertropfte oder in dünnen Wasserstrahlen hinunterrann. An der fensterlosen linken Wand des kleinen Raumes waren verschiedene Anschläge angebracht, unter anderem auch eine Liste mit den Fahrten und Preisen des hauseigenen Autodienstes. Auf der rechten Seite befand sich ein hochgelegenes, kleines Fenster in der Wand, durch das Berger, von dort aus, wo er stand, jedoch nichts sehen konnte.
Als der Hausdiener mit dem Herstellen der Verbindung fertig zu sein schien, trat Berger an das Empfangsbüffet und sagte, dass er gern eine neue Flasche Mineralwasser und ein Glas hätte und ein paar Auskünfte wünsche. Der Hausdiener bat ihn um einen Moment Geduld und begab sich für kurze Zeit in einen der Büroräume hinter der Loge.
Kurz darauf erschien im Gang, der zu den Büroräumen führte, die schrift- oder hochdeutsch sprechende Frau, die hier als Sekretärin arbeitete und etwa fünf oder zehn Jahre älter als Berger, also dreissig oder fünfunddreissig Jahre alt war. Berger hatte sie schon öfters mit anderen Hausbewohnern sprechen sehen, und wenn das in seiner Nähe geschehen war, hatte er sie auch sprechen hören und ihre Stimme und Sprache als angenehm empfunden. Als sie das Anmeldebüffet erreicht hatte, erkundigte sie sich nach seinen Fragen und sagte dann, nein, über den Maler des Ölbildes wisse sie nichts. Das Haus müsse um neunzehnhundert herum, etwas nach neunzehnhundert gebaut worden sein, der erste Bau, aber ob es unter Denkmalschutz stehe, könne sie leider auch nicht sagen.
Berger fragte noch, ob sie vielleicht etwas über einen Aufenthalt Hallers in diesem Haus wisse, des Dichters Hermann Haller, aber sie sagte wiederum, nein, auch darüber wisse sie leider nichts. Aber wenn er sich dafür interessiere, könne sie einmal mit dem Herrn Direktor darüber sprechen.
Mit einem »Bitte schön« und einem Lächeln, das Berger nicht zu deuten imstande war, quittierte sie seinen Dank – wobei das Lächeln wahrscheinlich gar kein Lächeln war, das er in irgendeiner Weise hätte deuten müssen. Dann stand der italienische Hausdiener in seiner blauen Berufsschürze mit dem Mineralwasser und dem Glas in den Händen wieder neben ihm, und die Sekretärin ging zu den Büroräumen zurück.
Berger bedankte sich auch beim Hausdiener, durchquerte die Vorhalle und betrat die grosse, langgezogene Aufenthaltshalle, deren Längsseiten in die Fensterfront eines runden Vorbaus mündeten, durch die man über die offene Terrasse hinweg auf die Gartenanlage hinaussehen konnte. Vor den Fenstern hingen dünne, weisse Gardinen, und auf den Scheiben der Vorfenster waren Regentropfen zu sehen.
Berger hatte sich in der Rundung in einen der Fauteuils gesetzt, die um einen kleinen Tisch, ein Rauchertischchen, wie man das wohl nannte, herumstanden, auf dem in einer Vase einige langstenglige, rote und gelbe Gerbera eingestellt waren. Ausser Berger befand sich niemand in der Halle, und während er die leicht staubig wirkenden Blumen betrachtete, erinnerte er sich daran, wie ihm seine Mutter erzählt hatte, dass er bei ihrem ersten Besuch im Spital, als sie ihm Blumen mitgebracht und ihn darauf hingewiesen habe, dass sie aus dem eigenen Garten seien: »Ja, ich werde sie dann gleich essen«, gesagt haben soll. Obwohl er sich alles, was ihm die Mutter davon erzählt hatte, immer wieder in Erinnerung gerufen hatte, konnte er sich auch diesmal nur an ihre Erzählung, nicht aber an den Besuch selber erinnern. Dafür erinnerte er sich jetzt, dass die Gerbera nach einem deutschen Arzt und Naturforscher genannt wurden, der Gerber geheissen hatte, und dass man, wenn man bei dem Namen Gerber die Buchstaben G und B austauschte, den Namen Berger erhielt.
Soweit er sich zurückerinnern und soweit er die Geschichte seiner Familie zurückverfolgen konnte, waren fast alle ihre Mitglieder eher mit einem Hang ins Grüblerische hinein ausgestattet gewesen, den sie jedoch durch eine grosse, ja wahrscheinlich übermässig zu nennende Arbeitsamkeit auszugleichen gesucht hatten und zum Teil immer noch suchten. Wobei er, Berger, natürlich beispielsweise im Vergleich zum Denkmalpfleger nur über wenige Familienmitglieder etwas wusste und nur einen lächerlich kleinen Teil der Familiengeschichte kannte und dazu in seiner Sehensweise vielleicht noch durch den Eigenen, wie es ihm schien, doch vererbten oder sonst halt durch Erziehung weitergegebenen Hang zum Grüblerischen beeinflusst wurde. Ob man das Phänomen nun Vererbung oder Erziehung nannte, oder einfach nur Beeinflussung oder Prägung durch Umwelt und Menschen, die einen von Anfang an umgeben hatten, oder ob man beides als daran beteiligt annahm – das alles konnte einem höchstens eine Erklärung dafür geben, dass man so war, wie man war, an der Tatsache selber und an dem Umstand, dass man sich, wie Doktor Santschi meinte, nicht ändern könne, das sei also unmöglich, änderte das nichts. Über sich selbst, seine Zusammensetzung und Funktion vollständiges Wissen und vollständige Klarheit zu erlangen, würde wahrscheinlich ein noch grösseres Ding der Unmöglichkeit sein als beispielsweise die Quadratur des Kreises, die Verdoppelung des Würfels oder das Perpetuum mobile und andere ebenso berühmte Unmöglichkeiten der Menschengeschichte und der im Sichtbereich des menschlichen Geistes liegenden Wirklichkeit.
Wenn Berger es sich recht überlegte, gehörte er zu jenen Leuten, von denen es im Grünen Heinrich von Gottfried Keller hiess, dass sie alle möglichen Sagen und wunderlichen Geschichten ihrer Gegend mit der grössten Genauigkeit erzählen konnten, ohne zu wissen, wie es zugegangen war, dass der Grossvater die Grossmutter nahm.
Sein Vater hatte ihm immer nur knapp und ungern Auskunft gegeben, wenn er ihn nach seinen Vorfahren gefragt hatte, und wenig Verständnis für sein Interesse aufgebracht. Fast jedes Mal hatte er ihn schon bald zurückgefragt, warum und wozu er denn diese Sachen wissen wolle, die er selber auch nicht wisse – so wie der Vater überhaupt, auch mit der Mutter, wenig sprach und ein eher verschlossenes, auf sich selbst gerichtetes Leben führte, ohne dabei jedoch in den meisten und wichtigsten Fällen das zu erreichen, was er wollte oder hoffte. Die Gespräche innerhalb der Familie waren meistens auf Auseinandersetzungen beschränkt geblieben oder hatten in Auseinandersetzungen gemündet, die fast immer am Küchentisch, beim Mittag- oder Abendessen stattgefunden hatten. Gewiss konnte der Vater auch anders sein, was zu sehen war, wenn er sich, anlässlich einer Beerdigung eines ihrer Toten beispielsweise, im Kreise der noch lebenden Familienangehörigen und alten Bekannten im Heimatort befand, dem Ort, in dem er aufgewachsen war und in dem oder in dessen Nähe fast alle Familienangehörigen, auch die mütterlicherseits, wohnten. Oder wenn sie gemeinsam einen dieser Verwandten oder Bekannten besucht hatten, was allerdings nur selten der Fall gewesen war, so wie sie diese Besuche schon nach dem Tod der Eltern des Vaters, seiner, Bergers, Grosseltern väterlicherseits also, immer mehr eingeschränkt oder einfach gelassen hatten.
Die entscheidende Wendung im Wesen seines Vaters zu seiner jetzigen Art hatte wahrscheinlich, ohne dass dieser sich dessen bewusst gewesen war, zusammen mit seinem Entschluss stattgefunden, den Heimatort und den Kreis der Angehörigen einer scheinbar besseren Stellung im relativ weit entfernt liegenden Landesteil Seeland wegen zu verlassen, und als er sich dessen im Verlauf der Zeit dann irgendeinmal mehr oder weniger bewusst geworden war, hatte er sich schon damit abgefunden gehabt. Und erst bei den Besuchen im Spital hatte sich der Vater zu Bergers Erstaunen nach langer Zeit auch ihm gegenüber wieder einmal so, von jener anderen, offeneren, ja besorgten Seite gezeigt, wie Berger sie in seiner Kindheit im Heimatort oft an ihm erlebt hatte und wie er sie aus dieser Zeit noch in Erinnerung zu haben glaubte, wie sie später jedoch nur noch selten zum Vorschein gekommen war.
Berger schenkte sich ein Glas Mineralwasser ein und lehnte sich, nachdem er einen Schluck getrunken hatte, ohne das Glas abzustellen, wieder im Fauteuil zurück.
Während er dem leiser werdenden Rauschen der aufsteigenden Kohlesäureblasen lauschte, das für kurze Zeit das unvermindert anhaltende Rauschen des Regens zu übertönen vermochte, fragte er sich, warum er sich eigentlich immer mehr für seine Vorfahren väterlicherseits interessiert hatte. Ein Grund dafür mochte sein, dass er seine Grosseltern mütterlicherseits gar nicht gekannt hatte: die Mutter seiner Mutter war schon bald nach deren Geburt, und der Vater im Alter von etwas über fünfzig Jahren noch vor der Verheiratung der Tochter mit seinem, Bergers, Vater an einem Magenkrebs gestorben, und auch die Stiefmutter seiner Mutter, die so seine, Bergers, Grossmutter oder besser Stiefgrossmutter mütterlicherseits geworden war, hatte kein hohes Alter erreicht, sondern war, wenn Berger sich recht erinnerte, kurz nachdem er in die Schule gekommen, ebenfalls früh gestorben. Wahrscheinlich war das der wichtigste Grund- obwohl da natürlich noch die Sache mit der Weitergabe des Familiennamens von der Vaterseite her war, die möglicherweise auch einen Einfluss hatte. Als einziger Sohn und allfälliger zukünftiger Vater würde er, Berger, den Namen wieder weitergeben müssen und so für den Fortbestand der Familie sorgen, was in ihrem Fall, da der Name Berger alles andere als ein seltener Name war, jedoch nicht von grosser und in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr von Bedeutung sein konnte. Möglicherweise war aber auch ganz einfach die dominierende Stellung seines Vaters gegenüber seiner Mutter und so in ihrer Familie überhaupt entscheidend für sein einseitiges Interesse gewesen. Die Mutterseite, die durch den frühen Tod der Muttereltern und der Stiefgrossmutter zufällig ohnehin schon geschwächt gewesen war, hatte dieser nichts entgegenzusetzen gehabt, und hatte es, was seine Mutter betraf, immer noch nicht, und auch er, Berger, musste deshalb vom Vater und der Vaterseite massgebend geformt worden sein.
Da in ihrer Familie das sonst in vielen Familien – so, wie ihm dieser erzählt hatte, auch in der des Denkmalpflegers – übliche Mitglied, das deren Geschichte einmal nachgegangen war und ihre Herkunft erforscht hatte, fehlte oder zusammen mit seinen Ergebnissen und Erkenntnissen, ohne auch nur die geringste Spur hinterlassen zu haben, in der Reihe der Toten, denen er nachgespürt hatte, selber wieder verschwunden war, hätte eigentlich er, Berger, diese Stellung einnehmen oder wiedereinnehmen können, und er hatte sich dies auch schon vorgenommen gehabt, sich jedoch zu den dazu notwendigen Schritten in die Gemeindearchive, zu den Standesregistern und den Kirchenbüchern bis jetzt noch nie entscheiden können. Alles, was er über die Vorfahren, die seinem Urgrossvater vorangegangen waren, wusste, beschränkte sich auf die allgemeine Bedeutung des Namens Berger als Herkunftsname, der besagte, dass der erste Träger des Namens seine Wohnung auf dem Rücken, am Hang oder am Fusse eines Berges gehabt haben musste und also der »vom Berg« gewesen war; eine Eigenschaft, die für viele Menschen in den verschiedensten Gegenden der Welt zutraf, so dass es auch völlig ungewiss war, ob Bergers Heimatort schon immer der Heimatort der Familie gewesen war oder ob einer der Vorfahren das Heimatrecht an diesem Ort erst erworben hatte. Obwohl er sich mit dem Verlassen des Elternhauses und dem vorläufigen Niederlassen im Emmental so noch weiter als seine Eltern von diesem Heimatort entfernt hatte, war Berger dadurch auch wieder in eine Gegend gelangt, wo viele Leute den gleichen Namen wie er trugen, was aber, wenn man die dortige Landschaftsgestalt kannte, wohl weiter nicht verwunderlich war.
Wie man ihm gesagt hatte, sollte es im Oberemmental, in den Ämtern Konolfingen und Thun, in der Gegend von Konolfingen, Oberdiessbach, Linden, Heimberg und Steffisburg allerdings noch mehr Berger haben – allein in Steffisburg gab es, wie Berger einmal im Telefonbuch nachgesehen hatte, gegen fünfzig Abonnenten dieses Namens. Ob sich dabei noch weitaus mit ihm Verwandte hätten befinden können, wusste er aber nicht. Dafür hatte er noch gehört, dass sich in dieser Gegend der Versammlungsort einer religiösen Gemeinschaft oder Sekte befinde, die im ganzen Emmental, das überhaupt ein guter Boden für das Sektenwesen sei, Anhänger habe, die nach dem Gründer und ehemaligen Oberhaupt der Sekte »Bergerianer« genannt würden. Der Sektengründer, der also auch ein Berger gewesen war, habe »ein gutes Wort gehabt«, sei also ein guter Prediger gewesen, der den Bauernhöfen nachgegangen sei, dort, wie man sich sagte, vor allem gern zu den Tageszeiten, in denen sich nur die Frauen auf den Höfen befanden, »missioniert« habe, und sich von den Bäuerinnen, die ihn anscheinend auch ganz gern zu jenen Tageszeiten bei sich gesehen hätten, noch mit Kaffee und Omeletten habe »traktieren« lassen. Die Anhänger der Sekte, die sich nichts daraus machen würden, als »Stündeler« bezeichnet zu werden, seien jedoch, wie sie selbst erklärten, allem Weltlichen abhold und würden ein frommes, streng nach den Grundsätzen der Bibel ausgerichtetes Leben führen – unter ihnen auch viele reiche Bauern, die grosse Teile ihres Reichtums an die Sekte abgetreten hätten, die nicht zuletzt auch deshalb, weil da Geld vorhanden sein müsse, so mächtig geworden sei.
In der zwanzigbändigen Taschenbuchausgabe seines Konversationslexikons hatte Berger aber verständlicherweise über die »Bergerianer« und deren Gründer und Namengeber nichts gefunden, obwohl sich, was natürlich nichts heissen wollte, auch unter den dort aufgeführten Trägern des Namens niemand befunden hatte, von dem er schon gehört hätte: ein österreichischer Theaterdirektor, Schriftsteller und Freiherr von, ein impressionistisch-realistischer schwedischer Erzähler, ein deutscher Literaturhistoriker und Verfasser einer volkstümlichen Schillerbiographie, ein im Stil von Brahms komponierender amerikanischer Musiker und eine Opern- und Konzertsängerin, von der nur das Geburtsdatum angegeben war und von der es hiess, dass sie Koloratursopran war.
Berger nahm sich vor, bei Gelegenheit auch einmal im Telefonbuch nachzuschauen, wie viele Berger in Luzern angegeben waren. In Thun waren es etwas über hundert gewesen und in Bern gegen zweihundertfünfzig, in Biel dagegen nur um die fünfzig herum.
Als er eine der Türen aufgehen hörte, welche die Aufenthaltshalle mit den übrigen Teilen des Hauses verbanden, drehte er den Kopf in die Richtung, aus der die Geräusche ertönten, und sah am Ende der Halle, wo es dunkler war als bei der Fensterfront, die Sekretärin eintreten. Sie hielt ein Heft in der Hand, das wie eine Partitur aussah, obwohl er sie sich nicht als Sängerin vorstellen konnte, und kam damit auf ihn zu, so dass er sich nach vorn beugte, das Glas neben die Flasche auf das Rauchertischchen stellte und sich erhob. Bevor die Sekretärin, die wirklich auf ihn zukam, vor ihm stehen blieb und zu sprechen begann, schien sie ihn wieder freundlich anzulächeln.
»Ich habe mit dem Herrn Direktor gesprochen«, sagte sie, »Haller war wirklich hier. Aber der Direktor ist erst seit neunzehnhundertfünfzig hier, und er weiss auch nicht, ob aus der Zeit von Hallers Aufenthalt noch etwas vorhanden ist. In der Kartei haben wir jedenfalls nichts mehr. Aber in seiner Zeit, wenn Sie das vielleicht interessiert, war der Professor Buber da, der langjähriger Gast bei uns war.«
»Also gleichzeitig mit Haller?«
»Nein, in der Zeit vom jetzigen Direktor. Ich habe Professor Buber übrigens noch selbst gekannt. Ich bin schon vor zehn Jahren einmal hier gewesen, und da war Professor Buber auch da. Und hier, wenn Sie’s interessiert, habe ich noch ein altes Heft einer Zeitschrift gefunden, in dem allerdings nichts über die Geschichte des Hauses steht, aber es handelt von alten, das heisst damals also modernen Bauformen, und da ist unter anderem auch die Sonnmatt aufgeführt.«
Auf dem grauen Umschlag, der mit einer dunkelblauen Farbe in der Art des Jugendstils bedruckt und gestaltet war, las Berger oben rechts das Datum März 1921. Das Heft selbst hiess Moderne Bauformen, und unter einem dunkelblauen Rechteck, das mit einem spitzwinkligen, gleichschenkligen Dreieck und Pflanzenmotiven in der grauen Farbe des Umschlags gefüllt war, stand in einem darunter anschliessenden, weniger hohen rechteckigen Rahmen zur Ergänzung noch der Aufdruck Monatshefte für Architektur und Raumkunst. Während Berger es durchblätterte, schaute auch die Sekretärin hinein und sagte, er könne es behalten, sie habe, glaube sie, noch einen ganzen Stoss davon, aber sie müsse zuerst noch einmal nachsehen.
Berger setzte sich wieder und sah sich in dem Heft den Beitrag über die Architekten Teiler & Helber in Luzern an, in dem neben der Sonnmatt noch das Schulhaus und das Pfarrhaus in Göschenen, das Schulhaus in Attinghausen und das Schulhaus in Bürglen, alle im Kanton Uri, gewürdigt und im Bild vorgeführt waren. Von Sonnmatt hatte es neben der Fotografie der Eintrittshalle noch zwei Gesamtansichten der Südseite, also der Seite gegen den Garten hinaus, die auch auf dem Ölbild im Treppenhaus zu sehen war, und eine von der Nordwestseite. Dann noch: Eine Teilansicht der Nordfassade mit der Anfahrt, eine Aufnahme des Eingangs zum Badehaus, eine des Musikraumes, je ein Ausschnitt aus dem Musikraum und dem kleinen Speisesaal und eine Abbildung der Grundrisse von Erdgeschoss, zweitem Obergeschoss und Obergeschoss des Badehauses im Massstab eins zu fünfhundert. Fertiggestellt worden sein musste das Haus, soviel er dem Text entnehmen konnte, im Sommer neunzehnhundertelf.
Auf der Umschlagrückseite waren in einem Oval, in einer Technik, die an eine Radierung erinnerte, der Kopf und die Vorderbeine eines Elefanten gezeichnet, der seinen Rüssel zwischen den Stosszähnen hinunterhängen liess und das gekrümmte Ende bei einem kleinen Haus, das zwischen zwei ebenso kleinen Bäumen zu seinen Füssen stand, zur Türöffnung hineinhielt. Wie es in einem rechteckigen Rahmen über dem Oval hiess, warb das Bild für Romul-Vacuum-Entstaubungsanlagen System Schauer, die die besten seien. Die Firma Röpner u. Müller in Feuerbach-Stuttgart fand, wie es in einem rechteckigen Rahmen unter dem Oval hiess, die Reinigung mit Saugluft sei die gründlichste, gesundeste, einfachste und billigste, die Entstaubungsanlage sei für das moderne Haus ebenso unentbehrlich wie das Bad und besass, wie es in den rechteckigen Rahmen auf beiden Seiten des Ovals hiess, dafür die D R und die ausländischen Patente.
Von Martin Bubers Aufenthalt in Sonnmatt hatte Berger schon von Doktor Santschi gehört. Und später, in seinem Zimmer, hatte er sich plötzlich an eine schon mehrere Jahre zurückliegende Lektüre von Hugo Balls Hallerbiographie erinnert, die zu Hallers fünfzigstem Geburtstag erschienen war, und daran, dass es darin geheissen hatte, Haller habe sich zur Zeit des Ersten Weltkrieges zu einer Kur in Sonnmatt aufgehalten. Berger hatte Santschi gefragt, ob er etwas davon wisse, aber dieser hatte nur von Bubers Sonnmattbesuchen gehört. Als pikantes Detail, an dessen Wahrheitsgehalt jedoch kaum gezweifelt werden könne, hatte ihm Santschi noch erzählt, dass Buber bei diesen Aufenthalten immer wieder von anderen Freundinnen begleitet worden sei.
Als Berger, nachdem er wieder einen Schluck Mineralwasser getrunken hatte, das erneute Öffnen der Tür hörte und – wie es ihm schien, in einer perfekten Wiederholung – die Sekretärin eintreten sah, die wieder ein Heft, das an eine Partitur erinnerte, in der Hand hielt, erschrak er für einen Moment ob der Vorstellung, das erste Eintreten der Sekretärin könnte gar nicht wirklich stattgefunden haben. Durch den handfesten Beweis des Heftes, das er selber in der Hand hielt, beruhigte er sich dann aber sofort wieder. Um den ersten Eindruck noch weiter zu verwischen, sah Berger der Sekretärin, als sie auf ihn zutrat, nicht ins Gesicht, sondern an ihr vorbei in den goldgerahmten Spiegel, der im Hintergrund des Raumes hing und dort die Dunkelheit durch das Spiegeln der Fensterfront unterbrach. Vorübergehend sah er die silhouettenhafte Rückenansicht der Sekretärin darin auftauchen, dann hatte er gerade noch Zeit, sich zu erheben, bevor sie wieder vor ihm stand.
»Sie können das Heft behalten«, sagte sie. »Aber ich habe hier noch eines, das ein bisschen besser erhalten ist.«
»Und sonst, über die Geschichte des Hauses, gibt es nichts mehr?« fragte Berger.
»Ausser dem, nein. Bis neunzehnhundertfünfundvierzig-fünfzig war es ja als Klinik geführt, nur als Klinik, und dann wurde es als Hotel weitergeführt, mit ärztlicher Betreuung. Es nennt sich zwar auch jetzt noch medizinische Privatklinik, es ist aber doch mehr Hotel als Klinik. Die Klinik war unter ärztlicher Direktion, unter Professor Holz, Herzspezialist in Luzern, und jetzt ist das Haus unter Hoteldirektion. Mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen.«
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür wieder, durch die die Sekretärin eingetreten war, und eine schwarzhaarige Frau in den Vierzigern betrat die Aufenthaltshalle. Die Sekretärin, nun mit dem Heft, das sie Berger zuerst gegeben hatte, in der Hand, begann die Halle zu verlassen, obwohl Berger das Gespräch gern noch etwas verlängert hätte, dafür jedoch nicht gleich eine passende Bemerkung gefunden hatte. Unschlüssig, das besser erhaltene Heft in den Händen haltend, blieb er deshalb an seinem Platz stehen und sah von der einen Frau zur anderen, bis sich die Tür hinter der Sekretärin geschlossen hatte.
Die Frau mit dem schwarzen Haar, das, wenn man es aus der Nähe sah, schon von vielen weissen Haaren durchzogen war, gehörte wie er, Berger, zu den Gästen des Hauses und war ihm schon verschiedentlich aufgefallen, weil er, wenn sie sich hier, in der Aufenthaltshalle, auf Spaziergängen oder in den Gängen des Hauses begegnet waren, das Gefühl gehabt hatte, sie mustere ihn eingehender, als es üblich war. Auch jetzt waren ihre dunklen Augen auf ihn gerichtet, als sie in einem Schriftdeutsch, das weder hochdeutsch noch österreichisch gefärbt und doch nicht akzentfrei zu sein schien, grüsste und fragte, ob er erlaube, und sich dann ihm gegenüber in einen mit Kissen ausgelegten Korbsessel setzte. Berger entschloss sich, ebenfalls noch einmal Platz zu nehmen und wieder in dem Heft zu blättern, und benutzte die Gelegenheit dazu, zwischendurch die Frau auch einmal etwas genauer anzusehen. Wenn sich ihre Blicke trafen, sah er jedoch sofort wieder in das Heft oder drehte seinen Kopf langsam weg und sah zum Fenster in den Regen hinaus. Obwohl er nicht hätte sagen können, woran es lag – es musste etwas mit ihrer Frisur, den aufgesteckten, in einem lockeren Chignon zusammengebundenen schwarzen Haaren, mit den schwarzen Augen und der Physiognomie ihres Gesichtes zu tun haben –, glaubte er plötzlich sicher zu sein, dass die Frau eine Jüdin war, was ihn äusserst überraschte, weil er bisher nicht geglaubt hatte, dass man jemandem ansehen könne, ob er Jude sei oder nicht.
Als er auf die Uhr blickte, sah er, dass es bald Zeit für das Abendessen war, wahrscheinlich war das auch der Grund dafür, dass die Frau in die Aufenthaltshalle gekommen war. Nach und nach kamen nun ständig weitere Gäste des Hauses herein, alles Leute, die zwischen sechzig und siebzig Jahre alt waren, und Berger ergriff die Mineralwasserflasche und das Glas, verabschiedete sich von der Frau, verliess die Halle und ging durch den breiten Gang zu den Speisesälen im Westflügel des Hauses, um zum ersten Mal, seit er hier war, dort zu essen. Als er in dem grossen Raum jedoch die vielen Tische mit den brennenden Lampen und die paar alten Leute sah, die wie in Zugabteilen Rücken gegen Rücken bereits dasassen und warteten, erschrak er und kehrte wieder um. Vor der Aufenthaltshalle traf er auf die schwarzhaarige Frau, die ihn anlächelte und an ihm vorbei zu den Speisesälen ging. Berger trat an den Empfangstisch, wartete, bis jemand erschien, und sagte dann der Frau Direktor, die kam, dass er doch lieber weiterhin in seinem Zimmer essen wolle.
Wieder verzichtete er auf die Benutzung des Liftes, als er nach oben ging, diesmal um dem automatisch einschaltenden Licht der Liftkabine zu entgehen, das er für noch überflüssig hielt und vor dessen übergangsloser Helligkeit er sich mit einem Mal fast wie vor einem körperlichen Schlag zu schützen versuchte. Hatte ihm nicht einmal jemand, den er geliebt hatte, gesagt, er empfinde künstliches Licht, solange noch eine Spur von Tageslicht vorhanden sei, als etwas Tödliches, weil die beiden Lichtarten sich gegenseitig töten würden?
Auch in seinem Zimmer machte er kein Licht und schloss nach einigem Zögern die Zimmertür mit dem im Schloss steckenden Schlüssel ab. Dann setzte er sich auf einen unschön geformten, aber einigermassen bequemen Holzsessel, dessen Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert und mit einem abgenutzten Stoff überzogen war – ein billig gearbeitetes Produkt aus dem geschmacklosen Massenangebot einer marktbeherrschenden Möbelfabrik, das diese wahrscheinlich einst als modern ausgegeben und weit über dem eigentlichen Wert verkauft hatte. Die Rückenlehne dem Bett zugewendet, schaute Berger an den schwarz erscheinenden Fenstersprossen vorbei in das gleichmässige, noch einigermassen helle Nebelgemisch hinaus, das das Haus nun vollständig umgab.
Über das künstlich vom Menschen erzeugte elektrische Licht und die ihn, den Menschen, während des Tages umgebende natürliche Helligkeit des Raumes, welche die eigentliche Ursache seiner Sehwahrnehmung bildeten, hatte Berger mit dem Denkmalpfleger nicht gesprochen, obwohl das ein Thema gewesen wäre, das zu diesem gepasst hätte: zu seiner Art, seinem Beruf und seiner Vorliebe für die Geschehnisse und die Kultur des Mittelalters, mit denen er sich auch seiner Arbeit wegen zu befassen hatte, die ihn jedoch, wie er gesagt hatte, nie die Zusammenhänge mit der übrigen bekannten und erahnten Menschengeschichte, mit den Denkweisen der Gegenwart und den Visionen der Zukunft hätten vergessen lassen, sondern ihm im Gegenteil oft die Sicht darauf geklärt und ihn auch auf eine Art entkrampft hätten. So hatte Berger jedenfalls die Äusserung verstanden, die dieser einmal – war es auf ihrer Simmentaler Reise, in einer der gotischen Kirchen des Tales gewesen? – gemacht hatte. Neben anderen Werken sei ihm, dem Denkmalpfleger, für sich und seine Arbeit gerade auch die Dichtung des Sankt Galler Mönches Notker Balbulus, des Stammlers, wichtig und teuer, hatte er damals noch gesagt, wobei er dessen Sprachfehler ausdrücklich in dieses Urteil hatte miteinbezogen wissen wollen. Media vita in morte sumus – oder wie es in der von ihm ebenso geschätzten Übersetzung von Luther heisse: Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen... Dies scheine ihm ein Lebensverständnis und Todesverständnis zu sein, das zum Beispiel in der Form des Mönchtums, trotz der Fragwürdigkeiten, die diese sicher auch habe, vielen Menschen eine mehr oder weniger anständige Lebensweise ermöglicht habe und heute in anderen Formen immer noch ermöglichen könnte, wenn man anständig etwa im Sinne der heutigen Redensart anständig über die Runden kommen verstehen würde. Für ihn sei diese Redensart eine Art zu sprechen, die ihm mehr als nur eine Redensart bedeute.
Berger erinnerte sich jedoch, dass der Denkmalpfleger auch einmal etwas gesagt hatte, das mit dem Phänomen des Lichtes zu tun hatte. Oft führe ihn seine Arbeit schon während des Tages in die Dämmerungen der Kirchen, ehemaligen Klöster, Schlösser, Burgen, Landsitze, Türme, Pfarrhäuser, Amtshäuser, Spitäler, Altersheime, Gefängnisse, Erziehungsheime, Anstalten, Gasthöfe, Zunfthäuser, Bürgerhäuser, Museen und Schulhäuser, hatte er gesagt, welches Dämmerungen seien, die nicht unabänderlich hinzunehmen gebraucht würden wie das Ineinanderübergleiten von Tag und Nacht infolge des Streulichtes in der Erdatmosphäre. Sich gegen diese aufzulehnen, würde er jedoch als ebenso unsinnig empfinden, wie es gegen jene zu tun. Ein dämmerungsloses Anschliessen völliger Nacht an den Sonnenuntergang würde es nur auf atmosphärelosen Himmelskörpern wie dem Mond geben, der zwar bereits in die Reichweite des Menschen geraten sei, das Angewiesensein desselben auf die Erde aber bisher noch nicht habe aufheben können.
Doktor Santschi hatte Berger vor dunklen Zimmern und vor dem einsamen Sitzen in der Dunkelheit gewarnt, seinen Einwand, dass er in diesem Zustand Einfällen und Eingebungen gegenüber aber möglicherweise offener und aufnahmefähiger sein könnte, jedoch ebenfalls gelten lassen. Trotzdem hatte Santschi ihm geraten, wenn sich die depressive Gefühlslage auszuweiten beginne, ein oder zwei Valium zu nehmen und sich ins Bett zu legen. Wenn es ihm möglich sei, solle er dort dann im Scheine einer Nachttischlampe noch etwas lesen.
Berger hörte, wie zuerst die äussere Zimmertür geöffnet wurde, und erschrak deshalb nicht besonders, als die Falle der inneren Zimmertür zweimal nacheinander hinuntergedrückt wurde und dann, bis er die Tür erreicht und den Schlüssel im Schloss herumgedreht hatte, hinuntergedrückt blieb. Wie er erwartet hatte, stand eines der Mädchen vor der Tür, die das Essen zu bringen pflegten, und schaute ihn etwas erstaunt an, als er ihr erklärte, dass er, wegen der Augen, noch kein Licht zu machen wünsche. Er sagte, er hoffe, es mache ihr nichts aus und sie sehe trotzdem noch genug; wenn er fertig gegessen habe, werde er das Geschirr zusammenstellen und es ihr, wenn sie an die Tür klopfe, an diese heranbringen. Das Mädchen, das ihm, wenn er auf dem Zimmer ass, meistens das Essen brachte und ihm auf seine Frage hin, wie sie heisse, Beetje Liewens gesagt hatte, hatte zwar nichts dagegen, aber während er ass, fragte sich Berger plötzlich, ob sein Verhalten wirklich »in Ordnung« war, wie das Mädchen gesagt hatte, oder ob es ihm diese Antwort nur aus Höflichkeit, Bequemlichkeit oder Mitleid gegeben hatte.
Um beim Essen etwas mehr zu sehen, hatte Berger die inneren und äusseren Flügel der Balkontür geöffnet, so dass kalte, regenfeuchte Luft in das Zimmer strömte und dieses langsam zu füllen begann, was seinen Appetit auf die Gerstensuppe, die Omelette mit Spargeln und die Zitronencrème erhöhte. Als er fertig gegessen hatte, schluckte er mit etwas Mineralwasser zwei Valiumtabletten hinunter.
Bald darauf klopfte das aus Holland stammende, etwa zwanzig Jahre alte Mädchen namens Beetje Liewens an die Tür, er brachte ihr wie versprochen das Tablett mit dem zusammengestellten Geschirr, bedankte sich bei ihr und wünschte ihr eine gute Nacht. Dann zog er seinen Schlafanzug an und legte sich ins Bett.
3
Obwohl er – was allerdings nicht ganz klar war – den Schuldienst aufgegeben hatte oder von diesem dispensiert worden war, musste er immer noch zeitweise Schule halten und litt darunter. Er beschwerte sich deshalb, als dieser in der grossen Pause um zehn Uhr das Lehrerzimmer betrat, beim Oberlehrer, der auf seine Vorwürfe und Klagen aber gar nicht einging, sondern ihn auf eine Kammer ansprach, die er, der Oberlehrer, dazu benütze, um in ihr die Esswaren, die bei den Quartalsschluss-Essen jeweils übrig blieben, aufzubewahren; die Esswaren würden dort für das nächste Essen aufbewahrt, das letzte Mal sei zum Beispiel noch eine Poularde übrig geblieben, sie, die Kollegen des Oberlehrers, würden diese Kammer ja auch kennen. Neben den verschiedenen Braten und Geflügeln, den Spanferkeln, Zicklein, Lämmchen und so weiter bewahre er, der Oberlehrer, in dieser Kammer aber auch noch die Fässer mit dem ausgelassenen Fett all dieser Tiere auf, und nun habe er entdeckt – und das Nachfragen beim Händler, bei dem er sich immer für die Tombolas eindecke, denn als Oberlehrer sei er ja auch für die Tombolapreise verantwortlich, habe es ihm bestätigt –, nun habe er entdeckt, dass Schüler aus seiner Klasse, aus der Klasse, die er, der Oberlehrer, im nächsten Jahr von ihm zu übernehmen gedenke, und zwar, wie er vermute, sämtliche Knaben, immer wieder ein Fass von dem Fett an den Händler verkauft hätten, so wie er, der Oberlehrer, das vor den Quartalsessen auch immer tue, denn er habe gemerkt, dass dies das beste Geschäft sei, das man mit dem Fett machen könne. Mit dem Geld hätten die Schüler sich dann bei dem Händler mit den verschiedensten Lebensmitteln eingedeckt – wenn er, als verantwortlicher Klassenlehrer, mit ihm, dem Oberlehrer, in sein Büro kommen wolle, könne er es gleich selber sehen. Im Büro des Oberlehrers fanden sie sich dann von Knaben umringt, die unaufgefordert Unmengen von Würsten, Süssigkeiten, Backwaren und Getränken aus ihren Taschen zogen und auf den Schreibtisch und die übrigen Tische legten, bis der ganze Raum von Esswaren überstellt war. Als die Pause vorbei war und er das Büro des Oberlehrers wieder verlassen hatte, wusste er nach dieser merkwürdigen und peinlichen Szene nicht mehr, wo er weiterunterrichten musste, und eilte durch die ganze Schulanlage. In der Turnhalle wollte ihn der Turnlehrer – ein bekannter Schweizer Fussballschiedsrichter, dem auch im internationalen Fussballgeschehen schon oft Spielleitungen anvertraut worden waren – an seiner Stelle ein Spiel pfeifen lassen, was er jedoch ablehnte. Unter den Spielern, die ihn lachend ebenfalls zum Pfeifen des Spiels aufforderten, entdeckte er ehemalige Mitschüler von sich, mit denen er ins Gymnasium gegangen war, aber als er sie grüsste, schienen sie ihn nicht zu erkennen. Da die Stunde, die er hätte geben sollen, schliesslich schon bald zu Ende war und er den Unterrichtsort immer noch nicht gefunden hatte und auch wusste, dass er eigentlich gar keine Schule mehr zu geben brauchte, fuhr er zuletzt langsam auf einem Fahrrad nach Hause...
Berger versuchte sich vergeblich nach einem Anhaltspunkt zu erinnern, der es ihm ermöglicht hätte, die Schule, in der sich das abgespielt hatte, und damit auch die Zeit näher zu bestimmen. War es eine Land- oder eine Stadtschule gewesen, eine Schule, an der er selber unterrichtet hatte, oder eine, an der er zum Unterrichten ausgebildet worden war, oder war es sogar eine der Schulen gewesen, an der er als Kind seine eigene obligatorische Schulzeit absolviert hatte?
Auf der Uhr an seinem Handgelenk sah er, dass es schon fast halb acht war und dass er nicht länger im Bett liegen bleiben konnte.
Er schlug das warme Deckbett, die zerknüllte Wolldecke und das verwickelte und verschwitzte Leintuch zurück, zog seinen Morgenmantel an, strich sich durch die Haare und trat zu der Balkondoppeltür, deren innere und äussere Flügel er über die Nacht leicht geöffnet gelassen hatte. Es regnete immer noch oder schon wieder, nicht heftig, aber regelmässig, wie es dies schon seit drei oder vier Tagen fast ununterbrochen tat.
Es fröstelte ihn. Er schloss die Balkontür und begab sich zum Waschbecken, das sich zusammen mit dem Radiator, der das Zimmer erwärmte, in einer Nische auf der anderen Seite befand, wozu er um das Bett und einen Tisch, der ans Fussende des Bettes gestellt war, herumgehen musste.
Als er sich das kalte Wasser, das er mit dem Waschlappen in der hohlen linken Hand auffangen konnte, zum Gesicht führte, überlegte er, wie lange er sich nun schon jeden Morgen und Abend mit kaltem Wasser wusch, aber er hätte nicht sagen können, ob diese Gewohnheit in seine Jugendzeit oder sogar in seine Kindheit zurückging. Es war auch nicht wichtig, aber er fragte sich doch, warum es ihn interessierte.
Er hätte sich doch jetzt für andere Dinge interessieren müssen- oder sollte diese seine Gewohnheit, sich nur mit kaltem Wasser zu waschen, vielleicht etwas mit diesen anderen Dingen zu tun haben?
Als er sich gewaschen und gekämmt hatte, ging er zur Balkontür zurück und schaute wieder in den Regen hinaus, wo sich der Nebel der vergangenen Nacht aufgelöst hatte und den Blick über das Tal hinweg freigab: auf die neueren Wohnhäuser im Tal unten und die wahrscheinlich erst vor kurzem gebauten rechteckigen weissen Wohnblöcke in der Lichtung des Waldes auf der Höhe der gegenüberliegenden Talseite. Wenn sich der Hochnebel darüber nicht auch noch auflösen würde, dann würde es wahrscheinlich auch diesen ganzen Tag hindurch regnen und nur unmerklich heller werden. Wie man ein solches Klima aushalten konnte oder können sollte, ohne ab und zu durchzudrehen, wurde ihm immer rätselhafter.
Das Öffnen der äusseren Zimmertür und ein Klopfen kündigte das Mädchen mit dem Frühstück an, es war wieder Beetje Liewens, das Mädchen, das er für sich Bethli nannte, die schweizerische Diminutivform des Namens Elisabeth. Als es ihm das Frühstück auf dem Tisch am Fussende des Bettes bereitstellte, fragte er es, wie es bloss dieses Klima hier in der Schweiz aushalten könne.
»Das ist bei uns in Holland nicht viel anders. Nur dass die Berge fehlen. Die stören mich hier manchmal schon, vor allem bei Föhn, wenn sie so nahe scheinen, dass man meint, sie könnten einen im nächsten Augenblick erdrücken.«
»Ja«, sagte Berger, »aber Sie haben doch das Meer.«
Das Mädchen hatte wahrscheinlich nicht verstanden, was er mit dem Wort »Meer« hatte sagen wollen: dass er glaubte, das Klima besser aushalten zu können, wenn es in der Schweiz ein Meer geben würde. Ob das dann auch wirklich so wäre, wusste er aber nicht. Vielleicht war das Meer nur ein Bild für etwas, was es in diesem Land nicht gab, für das es in anderen Ländern andere Bilder gab, und das es selbst nirgends gab. Vielleicht war es auch nur die Hoffnung, dass das Meer die Bewohner dieses Landes, also auch ihn, Berger, günstig beeinflussen und ihnen etwas von ihrem Kleinmut nehmen würde.
Auch Berger hatte oft Angstgefühle gehabt, wenn der Föhn, der vor allem in den nördlichen Alpentälern mit grosser Stärke talwärts wehte und den Leuten Beschwerden wie Kopfweh, Mattigkeit, Gereiztheit und seelische Verstimmung brachte und so die Anzahl der Selbstmorde, der Gewaltakte und auch der Verkehrsunfälle stark erhöhte, wenn dieser warme, trockene Fallwind die Berge wie eine Kulisse hinter die nächsten Hügel oder Städte des Mittellandes gerückt hatte, so dass die Aussenwelt plötzlich etwas Unwirkliches, Theaterhaftes bekommen hatte – Züge einer Traumwirklichkeit, die im Wachsein nichts zu suchen hatten oder nichts zu suchen haben durften und einen zutiefst verwirren konnten.
Besonders in seiner Bern-Zeit, und auch danach, wenn er sich wieder in Bern aufgehalten hatte, wenn zu der unwirklichen Nähe und Deutlichkeit der Schneeberge vor einem ebenso unwirklich scheinenden blauen Himmel noch die wirklich aus einer anderen Zeit und Wirklichkeit stammende Silhouette der mittelalterlichen Berner Altstadt, mit dem Münsterturm als ihrem hervorragendsten Kennzeichen, hinzugekommen war, hatte ihn das oft verunsichert. Vielleicht hatte er sich an einem solchen Tag – nach dem Besuch einer Vorlesung, vor der Universität, auf der Terrasse der Grossen Schanze, von der aus man an klaren Tagen über die Dächer der Stadt hinweg bis zu den Alpen sah – zum ersten Mal gefragt, ob die »gewöhnliche« Wirklichkeit, wie man sie an den Tagen erlebte, die keine Föhntage waren, eigentlich die eigentliche Wirklichkeit war, oder ob es hinter der »gewöhnlichen« Wirklichkeit nicht noch eine andere Wirklichkeit gab, so wie es hinter der »Föhnwirklichkeit« die »gewöhnliche« Wirklichkeit gab. Jedenfalls hatte er sich fast immer, wenn ihn an einem Föhntag Angstgefühle befallen hatten, an diese Frage erinnert. Und von dieser Frage aus war er dann schliesslich zu der Einsicht gekommen, dass »unsere« Wirklichkeit, die »gewöhnliche« Wirklichkeit also, von der Beschaffenheit unserer Wahrnehmungs- und Erkenntnisorgane, von der Beschaffenheit unserer Sinne und unseres Verstandes, abhängig war, und hatte beim Philosophen Kant für die ander