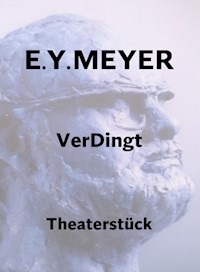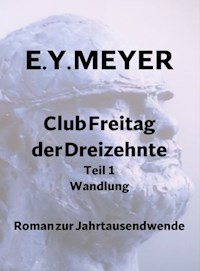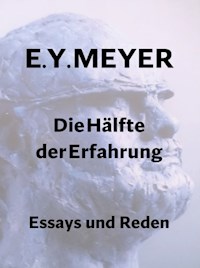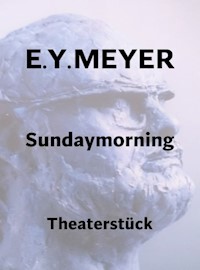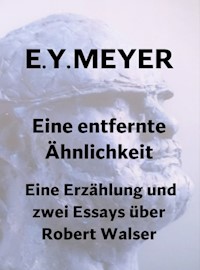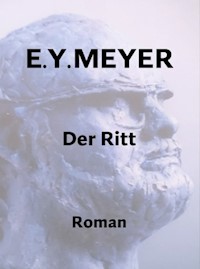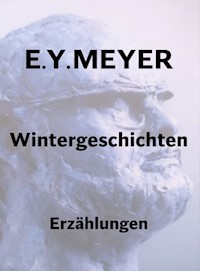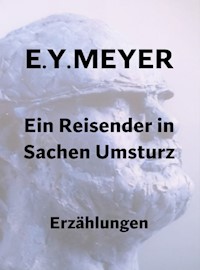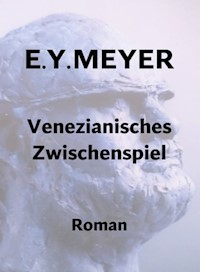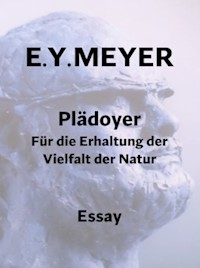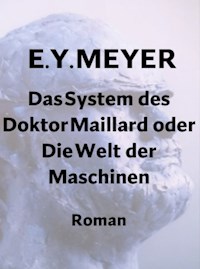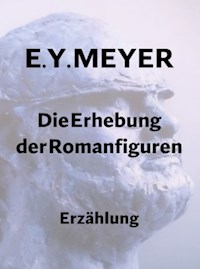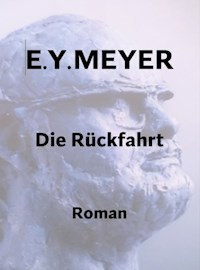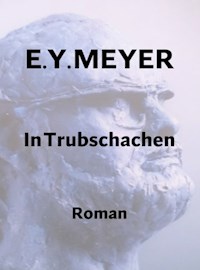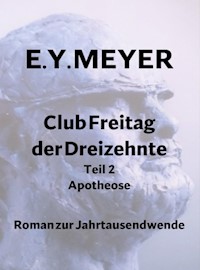
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Schweizer Spiegel der Jahrtausendwende. Die Geschichte eines Clubs mit dem Namen 'Freitag der Dreizehnte'. Vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2008. Das Schweizervolk ist weder im Aufstieg noch im Abstieg. Es befindet sich vielmehr in einer Metamorphose, einem Wandel zu etwas Neuem. E. Y. Meyer sieht dies als Apotheose eines alten europäischen Volkes, das sich zögerlich dem 21. Jahrhundert öffnet. Apotheose bedeutet aber bei ihm nicht einseitige Verherrlichung, Verklärung, sie ist mehrschichtig, mit ironischen Untertönen durchsetzt. Der Autor setzt fort, was er in seinem Buch 'Wandlung' begonnen hat: Die Geschichte einer Männergruppe, die den Wandel der Zeit erlebt und reflektiert. Der grosse Schweizer Schriftsteller, dem schon Marcel Reich-Ranicki huldigte, baut in seinen Roman einen Kranz meisterhaft erzählter Geschichten ein und liefert ein Zeitgemälde, in dem sich jeder Leser erkennen oder spiegeln kann. Ein wahres Lesevergnügen. E. Y. Meyer ist einer der bedeutendsten Schweizer Schriftsteller. Er hat während mehr als vierzig Jahren die Aufmerksamkeit vieler Leser in Deutschland und der Schweiz auf sich gezogen. Aus dem stets revolutionären Kanton Baselland stammend, siedelte er bald in den Kanton Bern über und schrieb dort in der Nachfolge Gotthelfs und Dürrenmatts über die Gegenwart. Als weitgereister Schweizer, der immer gerne in seine Heimat zurückkehrte, hat er die letzten zwanzig Jahre seinem 'Diptychon der Jahrtau-sendwende' gewidmet, worin er die Schweiz im Übergang aus einer alten in eine neue Welt aufleuchten lässt. Seine Charaktere sind ebenso grimmig wie weltgewandt und gebrochen – ein Stück der wahren Schweiz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
E.Y.MEYER
Club Freitagder DreizehnteTeil 2Apotheose
Roman zur Jahrtausendwende
Erstmals erschienen 2015
© 2021 E.Y.MEYER
eymeyer.ch
Cover:
Bronzekopf des Autors
Geschaffen 1997 von PAN YI QUINAcademy of Arts & Design
Tsing Hua UniversityBei Jing, China
El arte es una mentira que nos acerca a la verdad
Pablo Picasso
Obwohl dieser Roman auf realen Ereignissen basiert, sind einige der darin geschilderten Charaktere vom Autor geschaffene Kompositionen oder Erfindungen, und eine Anzahl von Episoden sind fiktiv.
Mit Ausnahme gewisser Figuren und historischer Ereignisse sind die Charaktere, Erlebnisse und Namen der porträtierten Personen fiktiv, und jede Ähnlichkeit mit Namen oder biographischen Daten irgendwelcher Personen ist vollkommen zufällig und unbeabsichtigt.
Das Theater-Hotel Chasa de Capol und dessen Besitzer, E.T.A. und Ramun Schweizer, sind ein realer Ort und zwei real existierende Menschen, die der Autor so wahrhaftig, wie es ihm möglich ist, dargestellt hat.
Ein Treffen des CLUBS FREITAG DES DREIZEHNTEN hat in der Chasa de Capol nie stattgefunden.
Kapitel
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Epilog
Dank
Prolog
»Der Mensch denkt, Gott lenkt.«
Ich erinnerte mich, wie der Abt von Marienberg dies gesagt hatte.
Um gleich darauf hinzuzufügen:
»Der Mensch dachte, Gott lachte.«
Ohne danach aber selber in ein irgendwie schallendes, einem romanhaften Klischee entsprechendes Gelächter auszubrechen. Sondern sich mit einem feinen, aber deutlich erkennbaren Schmunzeln begnügend, das seine Lippen umspielte.
Wir befanden uns im kirchlich stilgerecht, aber nicht überprächtig, nicht allzu prunkvoll, sondern wohltuend dosiert eingerichteten grossen Empfangsraum des Klosters, der weite Leerstellen zuliess und deshalb umso beeindruckender wirkte.
Weisse Wände, die zu einer hohen weissen Decke hinaufführten, wie dies auch in den Räumen des mächtigen alten Hauses von E.T.A. üblich war.
Dunkle Möbel. Grosse Ölbilder. Sparsam, aber wirkungsvoll eingesetzte christliche Insignien katholischer Prägung. Ein Kruzifix. Ein paar Kult- oder Schmuckgegenstände, deren Namen und Bedeutung ich nicht kannte.
Und dazwischen immer viel freier Raum.
Raum zum Atmen. Zum Denken.
In den Händen hielten wir die Gläser mit dem fruchtigen Südtiroler Weisswein, den der stattliche, den weltlichen Freuden anscheinend nicht abgeneigte, wohl um die sechzig Jahre alte, hochgewachsene Mann in seinem gut ausgefüllten schwarzen Rock uns zum Empfang kredenzt hatte.
E.T.A. hatte uns im Range Rover in der Abenddämmerung durch die winterlich verschneite Landschaft über die Landesgrenze zu der am Hang gelegenen, hoch aufragenden, burgähnlichen, festungsartig wirkenden, weissen Gebäudemasse oberhalb der Talstrasse hinaufgefahren, die vom südtirolischen Mals zum Reschenpass und von dort aus weiter nach Landeck führte.
Er hatte dies getan, nachdem er erfahren hatte, dass die sechzehn Jahre jüngere Frau, mit der ich damals hauptsächlich zusammenlebte und mit der ich mich für einige Tage bei ihm aufhielt, sich auf eine Weise mit Engeln beschäftigte, die über ein gewöhnliches, seit einiger Zeit wieder modisch gewordenes Ausmass hinausging.
Krina hatte ihm einen Faltplan der Engel geschenkt, den sie und eine Freundin geschaffen hatten: Ein wie ein Stadtplan oder eine Landkarte gefaltetes grosses Blatt mit berühmten Gedichten über Engel und einem Lageplan, wo in der Berner Altstadt Engeldarstellungen zu finden waren.
Und E.T.A. hatte gemeint, dass wir uns deshalb, zumal wir beide noch nichts von ihnen gehört hätten, unbedingt die als einzigartiges Denkmal romanischer Kunst geltenden Engelfresken im nahegelegenen, sich nur unweit der Landesgrenze auf der italienischen Seite befindenden Kloster Marienberg ansehen müssten.
Zu diesen hatte uns dann ein speziell dafür beauftragter Klosterbruder geführt.
Ein Pater, der eine gleiche schwarze Kutte wie sein Chef trug, ohne das grosse silberne Kreuz natürlich, das an einer langen Kette über dem Bauch des Abtes gehangen hatte, das Brustkreuz oder Pektorale.
Ein kleiner, vielleicht schon siebzig oder noch mehr Jahre alter, asketisch aussehender Mann mit einem dünnen Haarkranz um den kahlen Schädel, aber einem von Runzeln noch bemerkenswert freien Gesicht, der eine ruhige Vitalität ausstrahlte.
Und dann hatten wir in den tiefen Untergründen des Klosters unter dem Kreuzgewölbe der Krypta gestanden, in dem verborgenen Raum, in der ehemaligen Gruft, und waren ringsum, von allen Wänden und auch von der Decke herab, von teils kraftvoll leuchtenden, teils zarten, pastellartigen Farben umgeben gewesen.
Intensives Orange bis Rot und ein tiefes Blau als Umrahmung und Hintergrund.
Darin, kreuz und quer hineingemalt dem Menschen nachempfundene Gestalten.
Engel. Apostelfiguren. Heilige. In der Mittelnische, in einer Mandorla, wie der Pater erklärte, Christus. Eine streng gehaltene Majestas Domini.
Jedes Gewölbefeld war vollständig ausgemalt und in einem unglaublich guten Erhaltungszustand.
»Die Fresken«, so der Pater, »sind im zwölften Jahrhundert entstanden und am Ende des neunzehnten Jahrhunderts wiederentdeckt worden. Und neunzehnhundertachtzig, nachdem man die Grufteinbauten aus der Zeit der Barockisierung der über der Krypta gelegenen Klosterkirche entfernt hatte, sind sie zur Gänze freigelegt worden.«
Die in lange Gewänder gehüllten Engelgestalten, so der Pater weiter, würden auf einen byzantinischen Einfluss hinweisen. Ihre grossen Augen hätten, wie wir sehen könnten, keine oder nur schwach wahrnehmbare Pupillen. Das Nikolausfresko sei in der gotischen Zeit hinzugekommen und wohl zweihundert Jahre jünger.
Auf merkwürdige Weise schienen sich die überwiegend in zartem Pastell gehaltenen Engelbilder in einem Schwebezustand zu befinden, als wollten sie in der Mauer, auf die sie einmal gemalt worden waren, entweder wieder verschwinden oder aus ihr heraustreten, um sich dann in der Luft, welche die Mauern umgab, aufzulösen, unsichtbar zu werden, um in der Welt, die uns umgab, ihr Werk auf eine für uns sinnlich nicht direkt oder überhaupt nicht erkennbare Weise in Angriff zu nehmen und durchzuführen.
Worin dieses Werk auch immer bestehen mochte.
Dass wir Zugang zu den Fresken bekommen hatten, war ein Privileg gewesen.
Denn aus Sorge um die Bewahrung des guten Erhaltungszustandes war die Krypta nur noch zum Gebet zugänglich. Zur Vesper. Dem Abendgebet.
Danksagung nach vollbrachtem Tag,Gebet, bevor die Nacht beginnt,gelobten Dienstes heil’ge Pflichtsei vor dir unser Lobgesang.
In den Wintermonaten blieb der 1160 als erster Teil des Klosters gebaute, der heiligen Dreifaltigkeit, der Gottesmutter Maria und allen Heiligen geweihte, verborgene Raum zum Schutz der Fresken geschlossen.
Das Privileg, ihn trotzdem besichtigen zu können, hatten wir E.T.A. zu verdanken, der mit dem Abt in einer ebenso freundschaftlichen wie respektvollen Beziehung stand, wie er das auch mit weiteren Würdenträgern der katholischen Kirche diesseits wie jenseits der Landesgrenze zu tun pflegte.
Die Bemerkung über Gott und die Menschen – »der Mensch denkt, Gott lenkt, der Mensch dachte, Gott lachte«– hatte der Marienberger Abt gemacht, nachdem E.T.A. mich als Schriftsteller vorgestellt und wir einige Sätze über die Schriftstellerei, über das Schreiben und über die Geheimnisse der schriftlichen Überlieferungen ausgetauscht hatten.
»Der Geist ist der andere Teil der sichtbaren Natur«, hatte der Abt gesagt. »Die unsichtbare Natur.«
Und dann noch hinzugefügt:
»Und über dem allen, mein Sohn, lass dich warnen, denn des vielen Büchermachens ist kein Ende, und viel Studieren macht den Leib müde.«
DOMINUS FORTITUDO VITAE MEAE.
Dies war seine Devise.
Das Lebensmotto des Abts.
Der Herr ist die Kraft, die Stärke meines Lebens.
Auf der Visitenkarte, die er mir überreichte, stand sein
Name mit den nachgestellten Buchstaben O.S.B. – Ordo Sancti Benedicti. Dann: Abt. Dann: Benediktinerabtei Marienberg. Dann die italienische Postleitzahl von Mals und eine italienische Telefonnummer.
OLD EUROPE.
Der Konvent im höchstgelegenen Benediktinerkloster Europas mit einer neunhundertjährigen Geschichte bestand damals aus dreizehn Mitgliedern.
Diese Begegnung, diese Besichtigung, dieser Besuch musste irgendeinmal zwischen 1997 und dem Jahr 2000 stattgefunden haben.
In einem der Winter jedenfalls, die dem Freitag, dem 13. August 1999, vorangegangen waren.
Dem Tag, an dem der Club sich, weil ich damals für ein Jahr dort lebte, in London getroffen hatte.
Und da es nicht der Winter 96/97 gewesen sein konnte, weil ich E.T.A. und sein Haus in diesem Winter erst kennengelernt hatte, und auch nicht der Winter 98/99, weil ich diesen in London verbracht hatte, musste es der Winter 97/98 gewesen sein.
Und vielleicht war dieser Besuch in Marienberg und die Tatsache, dass die Klostergemeinschaft damals aus dreizehn Mitgliedern bestanden hatte, sogar der entscheidende Auslöser dafür gewesen, dass ich mich im Jahr 2000 dazu entschlossen hatte, das Haus von E.T.A. nicht mehr nur für mich allein oder für mich und Krina zu behalten, sondern es auch dem Club, den zwölf anderen Mitgliedern, für ein Treffen zugänglich zu machen.
Das Kloster Marienberg und seine Engel.
Der Mensch soll sich behutsam schnäuzen und nur hinter sich ausspucken, wegen der Engel, die vor ihm stehen.
Alte deutsche Mönchsregel.
Wer weiss schon, was ein Engel in einem Jahrhundert wie diesem zu suchen hat.
Patrick McGrath.
Zwei der Texte, die auf dem Faltplan der Engel abgedruckt waren, den Krina und ihre Freundin zusammengestellt hatten.
Jetzt, am Freitag, dem 13. Juni 2008, einem heissen Sommertag, da diese Erinnerung an Marienberg einmal mehr in mir aufgestiegen war, befand ich mich erneut im Haus von E.T.A.
In diesem mehr als fünfhundert Jahre alten einstigen Grafensitz, den E.T.A. nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor dem Verfall gerettet und renoviert hatte und den er nun sowohl als eigenen Wohnsitz benutzte wie als Hotel führte.
Mit dem Namen, den er von den einstigen Herren des mächtigen Hauses übernommen hatte:
CHASA DE CAPOL
Auf tiefgründenden Fundamenten eines noch früheren Baus war hier ab 1199 ein Gebäudekomplex mit Hauskapelle, Refektorium und einem Hospiz entstanden, in dem mehrere Jahrhunderte lang das aus Venedig stammende Geschlecht Polo residierte.
Entdeckt hatte ich das mächtige Haus auf einer Rückfahrt von Venedig im Februar 1997. Auf der Rückfahrt von einer Reise, die ich unternommen hatte, um ein letztes Mal eine Überprüfung der Ortsbeschreibungen und andere Nachrecherchen für die Novelle zu machen, die im Herbst unter dem Titel Venezianisches Zwischenspiel erscheinen sollte.
Die Erinnerungen vermischten sich.
Die genauen Daten und die chronologische Reihenfolge der Geschehnisse mussten aus einem Gedächtnis heraufgeholt werden, das sich Zahlen nur schwer merken konnte: aus einem Erinnerungskonglomerat, für das die Zeit, dieses im Grunde undefinierbare Phänomen, zu etwas verschmolz, das über die Zahlen hinausging.
Zu einem Phänomen, das mit dem Leben eine identische Einheit zu bilden schien.
Auch wenn das Gedächtnis die Zahlen, die auf eine unserem Verstand zum Teil zugängliche Art darin verwoben sind, nicht ausser Acht lassen kann.
Jetzt, im Jahr 2008, im Sommer, im Juni, an einem Freitag, der ein Dreizehnter und ein heisser Tag war, befand ich mich also ein weiteres Mal bei E.T.A. in der Chasa de Capol.
Zu einem wiederholten Mal aber nicht mehr allein oder nur mit Krina, sondern ohne Krina, dafür mit Mitgliedern des Clubs, den ich 1992 ins Leben gerufen hatte.
Mit Mitgliedern eines Clubs, der sozusagen eine Antwort hätte sein sollen auf die in ebendiesem Jahr kurz zuvor in die Welt gesetzte, wie ich und die anderen Clubmitglieder fanden, absurde Behauptung des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte.
Eine kleine, eine winzige Antwort zwar nur, die ausser von den Mitgliedern des Clubs von niemandem sonst gross zur Kenntnis genommen werden würde, aber doch eine Antwort.
Eine Kleinstantwort auf eine grosse Feststellung.
Auf eine gewaltige Behauptung.
Auf die unerhörte, aber damals viel beachtete Diagnose eben, dass die Geschichte nun zu Ende sei.
Zwar nicht die Geschichte der Menschheit. Und auch nicht die Geschichte der Welt.
Und schon gar nicht die Geschichte des Weltalls natürlich. Aber die Geschichte der politischen Systementwicklung.
Diese habe nun, wenn man die Geschichte der Menschheit, so wie Fukuyama, als eine gesetzmässige und teleologische Verkettung von Ereignissen und nicht als eine zufällige Anhäufung von Umständen verstehen wollte, ihr endgültiges Ziel erreicht.
Einen Idealzustand, von dem aus es keine weitere Entwicklung mehr geben könne.
Herbeigeführt durch einen letzten Dreischritt im Sinne der Hegel’schen Dialektik.
Mit These, Antithese und Synthese.
Zuerst extremer Liberalismus.
Dann Totalitarismus.
Dann liberale Demokratie.
Und dann deren Triumph.
Deren Apotheose.
Deren Verherrlichung.
Deren Verklärung.
Deren Vergöttlichung.
Die liberale Demokratie als Endstadium.
Eingeleitet durch den Zusammenbruch der UdSSR und der von ihr abhängigen sozialistischen Staaten.
Eingeleitet durch den Fall der Berliner Mauer 1989.
Im zweihundertsten Jahr nach dem Beginn der Französischen Revolution.
Vierundvierzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Das 1992 vom Amerikaner mit japanischen Vorfahren behauptete und auf eine einfache Formel gebrachte grosse Ende, sein Ende der Geschichte, hatte mich gereizt, etwas dagegenzusetzen.
Und was hätte das anderes sein können als sein Gegenteil.
Ein Anfang.
Aber ein Anfang wovon?
Der Anfang einer Geschichte.
Aber der Anfang einer Geschichte welcher Art?
Der Anfang einer Geschichte, die, wie ich, einer auf verschlungenen Wegen entstandenen Eingebung folgend, schliesslich befunden hatte, die Geschichte eines Clubs sein sollte.
Keines grossen Clubs. Und schon gar nicht eines grossartigen.
Im Gegenteil. Es sollte ein möglichst kleiner Club werden.
Und ja. Wenn möglich natürlich auch ein feiner.
Es sollte ein Club werden, der die Grösse der nächstkleinsten gesellschaftlichen Formation hatte, die gleich nach der Familie kam. Dem Kern einer Familie. Nicht eines ganzen Familienverbands.
Eine kleine Gruppe.
Wie einst eine steinzeitliche Jagdgruppe.
Oder heute eine Fussballmannschaft.
Und zwischendurch auch einmal eine Apostelgemeinschaft.
Elf Männer.
Dreizehn Männer...
Ein Männerclub also.
Aber was für ein Männerclub?
Nicht einer von denen, die es bereits zur Genüge gab. Kein gewöhnlicher Männerclub.
Sondern einer, der spezieller war.
Ausgefallener.
Kein einzigartiger.
Aber ein seltener.
So dass es schliesslich ein Club geworden war, dessen Name, wie sich herausstellte, gleichzeitig auch sein Programm war.
Ein Club mit dem Namen:
CLUB FREITAG DER DREIZEHNTE
Ein Club, der, wie meine merkwürdige Eingebung es gewollt hatte, nur aus dreizehn Männern bestand, die sich immer an einem Freitag, der ein Dreizehnter war, an einem immer wieder anderen Ort trafen.
An einem Ort, den jeweils ein Mitglied im Sinne eines Überraschungseffekts auszuwählen hatte – ohne, wenn das logistisch möglich war, die anderen lange zuvor davon zu informieren.
Mit Einladungen, die in schriftlicher Form zu erfolgen hatten.
In Form eines realen, papierenen Briefes und nicht bloss als elektronische Nachricht.
Und mit den jedes Mal darunter gesetzten Buchstaben:
S.c.J.
Der Abkürzung für Sub conditione Jacobi.
Oder Jacobea.
Bezogen auf den Jakobusbrief.
Jakobus 4, 13–16:
Und nun ihr, die ihr sagt: Heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen –, und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen: Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse.
Oder einfacher, kürzer, auf die Formel gebracht:
So Gott will und wir leben.
Als ein Hinweis darauf, dass die Ereignisse, die auf die Zukunft geplant sind, nicht in unserer Hand liegen.
Was bedeutete, dass wir uns, so Gott wollteund wir lebten, also mindestens einmal und höchstens dreimal im Jahr treffen würden.
Nicht zu wenig und nicht zu viel.
Wobei man das Wort Gott natürlich auch durch Wörter wie Schicksal, Zufall oder Fügung hätte ersetzen können, was uns jedoch des von uns als nicht unbeträchtlich empfundenen Vergnügens beraubt hätte, welches uns die Verwendung einer alten biblischen Formel bereitete.
Das jetzige Treffen, das Treffen in der Chasa de Capol am Freitag, dem 13. Juni 2008, war unser fünfundzwanzigstes.
Und inzwischen bereits das achte, das im Haus von E.T.A. stattfand.
Ich war als Einziger schon am Tag zuvor, am Donnerstag, dem 12. Juni, angereist.
Mit E.T.A. hatte ich den zwischen uns üblich gewordenen Willkommensdrink, einen Veneziano, getrunken und mich danach im alten Swimmingpool im Garten unterhalb des Hauses erfrischt.
Dann hatte ich an einem der im Freien, zwischen dem Haus und dem Swimmingpool stehenden Tische zu Abend gegessen: an dem von mir bevorzugten Tisch, der bei einer vierstämmigen Erlengruppe platziert war und den Namen Erlkönig trug.
Und zum Schlafen hatte ich mich in das Zimmer im obersten Stock unterhalb des Dachs begeben, das ich stets bezog
In ein Zimmer, das, wie alle Zimmer im Haus, keine Nummer, sondern einen Namen trug, der in weisser Frakturschrift auf ein wappenförmiges, an der Zimmertür hängendes, schwarzes Täfelchen gemalt war.
Ein Name, der bei diesem Zimmer aus vier Wörtern bestand:
WALTHER VON DER VOGELWEIDE
Die anderen waren am Freitag, dem Dreizehnten, eingetroffen.
Am späten Vormittag oder frühen Nachmittag.
Fuchs und Gilomen mit dem Postauto.
Frank, Gerd, Vinzenz und Quirin mit ihren Privatautos.
Es war das erste Mal, dass wir nur noch sieben waren.
1
Die Jahrtausendwende, den Wechsel vom Jahr 1999 zum Jahr 2000, den die Menschheit entgegen den Gesetzen der Mathematik, rechnerisch unrichtig, ein Jahr zu früh feierte, hatte ich in Graubünden verbracht.
Nicht in der Chasa de Capol allerdings.
Nicht bei E.T.A. Nicht in Santa Maria im Münstertal.
Sondern im Engadin. Im Tal des Inns.
In der berühmten Gegend der Oberengadiner Seen.
In Sils Maria.
Im Nietzsche-Haus.
In einem der vier einfach eingerichteten Doppelzimmer, die oberhalb des im Erdgeschoss untergebrachten Museums lagen und für eine begrenzte Zeit an Künstler, Schriftsteller, Gelehrte, Studenten, Journalisten und im weiteren Sinn philosophisch, literarisch und kulturell interessierte Menschen vermietet wurden.
Zusammen mit Krina.
Das kleine Haus, das ein bescheidenes ehemaliges Bauernhaus war, aber wie ein einfaches Wohnhaus aussah, stand am Fuss eines steil aufragenden, von Felsen durchsetzten Hangs, der von dunklen Tannen bewachsen war.
Von der Strasse zurückversetzt. Von den Hotels und Geschäften an ihr ferngehalten. Durch ein vor ihm liegendes, unbebaut gebliebenes Landstück.
Der vom Schnee freigeschaufelte, aber immer noch von einer festen weissen Schicht bedeckte Weg, der von der Strasse zu dem Haus führte, war links und rechts von unberührten, einen guten Meter hohen Schneefeldern gesäumt gewesen.
Hier, in diesem Haus, das nun seinen Namen trug, hatte der klassische Philologe, der postum als Philosoph zu Weltruhm gekommen war, in den Sommermonaten der Jahre 1883 bis 1888 ein Zimmer im ersten Stock bewohnt. Als Untermieter einer Familie Durisch.
Friedrich Nietzsche. Der schnauzbärtige Mann mit dem Silberblick, der erklärt hatte, dass Gott tot sei und dass wir, die Menschen, es seien, die ihn getötet hätten.
Der von gesundheitlichen Problemen geplagte Mensch. Der Pfarrerssohn, der allein durch die Kraft seines Geistes, mit den Büchern, die er schrieb, versucht hatte, die Menschheit weiterzubringen. Sie auf eine höhere Stufe des Bewusstseins, der Evolution, zu heben.
Mit seinen Konzepten des Übermenschen.
Des Willens zur Macht.
Der ewigen Wiederkunft.
Den Tod Gottes am eindrücklichsten verkündet hatte er in seiner Schrift Die fröhliche Wissenschaft. Im Aphorismus mit dem Titel Der tolle Mensch.
»Wohin ist Gott?« rief er, »ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet, – ihr und ich! Wir Alle sind seine Mörder!... Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet! Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?«
Also hatte der Mann geschrieben, der eine radikale Lebensbejahung in den Mittelpunkt seiner Philosophie hatte stellen wollen.
Der scharfe Kritik an Moral, Religion, Philosophie, Wissenschaft und Formen der Kunst in der zeitgenössischen Kultur geübt hatte, die er als lebensschwächer als die des antiken Griechenlands beurteilte.
Der letztlich den Wert der Wahrheit überhaupt in Frage stellte.
Bevor er im Alter von fünfundvierzig Jahren in Turin einen geistigen Zusammenbruch erlitt, der ihn für die restlichen zehn Jahre seines Lebens in eine bleibende geistige Umnachtung verbannte.
Dass sich der fünfundvierzig Jahre alte Gelehrte damals, in Turin, auf offener Strasse, weinend vor Mitleid, an den Hals eines Droschkenpferdes gehängt habe, weil das Tier vom Kutscher misshandelt worden sei, beruhe aber, wie man heute meint, nur auf späterer mündlicher Überlieferung und gelte deshalb als wenig glaubwürdig.
Nach dem Tod seiner Mutter, die ihn zunächst pflegte, hatte der umnachtete Mann ab 1897 bis zu seinem Tod im Jahr 1900, dem Jahr vor der damaligen Jahrhundertwende, dann noch bei seiner Schwester in der Villa Silberblick in Weimar gelebt.
Wo ausgewählten Besuchern, etwa Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, das Privileg gewährt worden war, zu dem dementen Philosophen vorgelassen zu werden.
Ein Mann mit einem Silberblick beendete sein Leben im Jahr 1900.
In einer Villa mit dem Namen Silberblick.
Eine jener merkwürdigen Koinzidenzen, von denen das Universum voll ist und die dem Menschen, wenn er sie erkennt, manchmal bedeutungsvoll und manchmal belanglos erscheinen.
Winter.
Die Zeit, in der die Erde unfruchtbar ist.
Wenn sich das Leben umkehrt.
Wenn das Leben zu Nebel wird.
Wenn Proserpina, die Tochter der Göttin des Korns und der Fruchtbarkeit, beim Blumenpflücken auf einer Wiese vom Gott der Unterwelt geraubt, während eines Drittels des Jahres im Totenreich lebt.
Dann sei die Erde unfruchtbar.
Während zweier Drittel des Jahres soll sie sich danach aber wieder bei ihrer Mutter in der Oberwelt aufhalten.
Dann sei die Erde wieder fruchtbar.
Proserpina. Die Totengöttin der römischen Mythologie. Die zuvor, in der griechischen Mythologie, wo sie Persephone geheissen hatte, zugleich eine Vegetationsgöttin gewesen war.
Eine Erinnerung an die Proserpina-Grotte in der Eremitage von Arlesheim.
Dem grössten englischen Garten der Schweiz.
Dem Ort, der beim sechsten Treffen des Clubs mit dem Namen CLUB FREITAG DER DREIZEHNTE als Zusatzprogramm an die Besichtigung des Goetheanums angehängt worden war – des Sitzes der von Rudolf Steiner ins Leben gerufenen Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft im nebenan gelegenen Dornach.
An einem Freitag, der ein 13. Dezember gewesen war.
Ein Tag, der mit Nebel begonnen hatte, dann aber erstaunlich hell geworden war.
Mit weissgrauen Wolken, die über einen blassblauen Himmel zogen.
Bevor sich am Abend wieder ein zunächst hellgrauer, dann dunkelgrau werdender Dunstschleier über ihn zu ziehen begonnen hatte.
Für die Nacht war ein Sturm angesagt gewesen. Hier, im Oberengadin, in Sils Maria, gab es keinen Nebel.
Die Tage waren vom Morgen bis zum Abend strahlend klar.
Ein strahlend blauer Himmel.
Und darunter eine strahlend weisse Landschaft.
Eine weisse Schneelandschaft, deren Glitzern und Blenden die Intensität und Endlosigkeit des tiefen Blaus über ihr noch zu verstärken schien.
Am späteren Vormittag des 31. Dezember, am Tag des Silvesters, der auch wieder so ein strahlend klarer Tag gewesen war, hatten Krina und ich auf der Strasse, die vor dem Nietzsche-Haus vorbeiführte, überraschend einen Mann in Begleitung einer Frau getroffen, den ich von Bern kannte.
Die beiden waren, wie sich herausstellte, am Vortag in das neben dem freien Landstück vor dem Nietzsche-Haus gelegene Hotel Edelweiss gezogen und wollten nun ins Fextal wandern, was wir auch vorhatten.
So dass wir gemeinsam wanderten.
Hugo war jahrelang einer der zwei oder drei wichtigsten Nachrichtensprecher des Schweizer Radios gewesen. Einer der Hauptsprecher der Mittags- und der Abendnachrichten. Eine Stimme, die man kannte.
Eine angenehm nüchterne, unaufdringliche, neutrale Stimme, die auf übertriebene, aufgesetzte und deshalb oft falsch und unnatürlich wirkende Emotionen verzichtet hatte.
Hugos Stimme hatte einfach Fakten mitteilen wollen.
Und sie hatte sich deshalb, wie das einst noch möglich und üblich gewesen war, der Zuhörerschaft, ohne dass die breite Öffentlichkeit gewusst hätte, wie der Besitzer der Stimme aussah, über lange Jahre hinweg sozusagen als eine allgemein anerkannte und bekannte Stimme der Nation eingeprägt.
Persönlich kennengelernt hatte ich ihn, als mein damaliger Verlag, Suhrkamp, in der Wohnung des Leiters seiner Zürcher Filiale eine szenische Lesung aus meinem eben fertiggestellten ersten Theaterstück Sundaymorning organisiert hatte.
Hugo war für den Vortrag einer der Rollen engagiert worden.
Der Rolle des nebenbei mit Champagner und alten Autos handelnden, zusammen mit einer englischen Freundin in einem Berner Stöckli wohnenden Gymnasiallehrers Bopp.
Dass die wirkliche englische Freundin des wirklichen Bopp, die mir als Anregung für zwei meiner Sundaymorning-Theaterfiguren gedient hatten (wobei der wirkliche Bopp natürlich anders geheissen hatte), zuvor auch einmal Hugos Freundin gewesen war, hatte ich erst später erfahren.
Hugos jetzige Begleiterin war eine um etliche Jahre jüngere, attraktive, dunkelhaarige Psychologin mit warmen braunen Augen.
Dass seine Freundinnen immer wieder wechselten, wusste ich inzwischen.
Das Fextal.
Dieses erreichten wir auf einem Fussweg, der durch eine von Sandsteinwänden gesäumte Schlucht führte. Auf ihm überwanden wir die erste, waldbewachsene Hangstufe und gelangten so zum ersten Weiler des Tals, zu den wenigen Steinhäusern von Fex Platta, wo sich die ganze Pracht dieses vielleicht schönsten Seitentals des Engadins vor uns ausbreitete.
Der weite, sanft geschwungene, weisse Talboden.
Die seitlich allmählich ansteigenden weissen Hänge.
Und die über den Hängen in den tiefblauen Himmel ragenden weissen Berggipfel.
An den Sonnenhängen praktisch baumlos.
Auf der Schattenseite mit ausgedehnten Arven- und Lärchenbeständen.
Das etwa zehn Kilometer lange, oberhalb von Sils Maria direkt nach Süden führende Seitental war eines der wenigen noch ganzjährig bewohnten Hochtäler der Alpen und für seine Unberührtheit berühmt.
Es gab hier keine oberirdische Stromleitungen, keine Skiliftanlagen, keine Kabinen- oder Sessellifte. Und es galt in ihm ein allgemeines Motorfahrverbot.
Ausser natürlich für Zufahrten zu den paar Weilern und zu den wenigen vereinzelt in der Landschaft verteilten übrigen Häusern sowie zu den paar Hotels und Pensionen. Alles zumeist einfache Steinhäuser.
Hier gingen wir auf der schmalen, aber unter der fest gepressten Schneeschicht, wie man erkennen konnte, geteerten Fextalerstrasse weiter.
Da es bereits nach elf Uhr war, waren schon ziemlich viele Menschen unterwegs.
Solche, die, wie wir, ins Tal hinaufstiegen. Andere, die uns, das Tal hinuntergehend, entgegenkamen.
Die Sonne stand hoch, und fast alle Leute, denen wir begegneten, ob sie nun zu Fuss gingen oder sich in den jetzt im Winter hier verkehrenden, sich mit Glockenklingeln bemerkbar machenden Pferdeschlitten ins Tal hinauf- oder nach Sils Maria hinunterfahren liessen, trugen Sonnenbrillen.
Ebenso weiss und strahlend wie der sie umgebende Schnee erschien vor uns dann, nachdem wir etwa eine Stunde gegangen waren, auf einer kleinen Anhöhe von einigen Häusern umgeben eine kleine Kirche, bei der anstelle eines Turms ein kurzes Mauerstück in die Höhe ragte, in dessen Mitte ein längliches Stück frei gelassen war, in dem die Glocke hing.
Eine dicke Mauer umgab den kleinen Friedhof, der vor der Kirche angelegt war.
Das Bergkirchlein des Weilers Crasta Fex. Das Wahrzeichen des Tals.
»Da drin gibt es Fresken, die wir uns ansehen sollten«, meinte Hugos Freundin.
Wandmalereien aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, die den ganzen Chor füllen würden.
Diese zogen den Blick, wenn man eintrat, denn auch sofort auf sich.
Durch das Schiff hindurch, das ein überraschend kleiner Raum mit einer tiefhängenden, dunklen Holzleistendecke war und Seitenwände hatte, die völlig schmucklos und wie die Aussenseite der Kirche weiss getüncht waren.
Zentraler Anziehungspunkt im Halbrund der Apsis, die etwas höher als der niedrige Raum des Kirchenschiffs aufragte, war ein grosses Oval oder vielmehr eine senkrecht stehende Ellipse.
Die Mandorla, in der ein übergrosser Gottvater zu sehen war, der seinen kleinen gekreuzigten Sohn, der ihm bis zum Bauch reichte, an den Händen vor sich hinhielt, während die Vielzahl der übrigen Gestalten, Apostel, Heilige und auch die Mutter Gottes, die Gebärerin des Gottessohnes, in viel kleineren Formen, wie in Filmstreifen nebeneinander oder in Dreiecksfeldern übereinander, um diese Mitte herum angeordnet waren.
Als die Reformation einen neuen Glauben in die Welt gebracht hatte, der schliesslich auch in einen Teil der Alpentäler hatte vordringen können, waren diese Fresken im Zuge dessen, was man Kirchenreinigung genannt hatte, überpinselt worden, bevor man sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter dem weissen Verputz wiederentdeckt hatte.
Erinnern und Vergessen.
Wieder erinnern.
Wieder vergessen.
Wieder erinnern.
Vergessen.
Woher kommen wir?
Wohin gehen wir?
OLD EUROPE.
Nach dem Abstecher in die Vergangenheit hatten wir uns in das am Rand des Weilers gelegene Hotel Sonne begeben, um in dessen Restaurant eine Gerstensuppe, Pizokel, Capuns oder eine andere lokale Spezialität zu essen, wie man das in Graubünden, wenn man heutzutage als Tourist unterwegs ist, ebenso tut.
Die »Sonne« war das jeweils erste Ziel der zahlreichen Wanderer, die im Fextal unterwegs waren, obwohl man noch weiter nach hinten gehen konnte, bis zum zweiten Hotel, dem Hotel Fex, und danach bis zum Fexgletscher, der, wie es hiess, von Jahr zu Jahr weiter zusammenschrumpfe und bald ganz verschwunden sein werde.
Von dort aus würden nur noch Trampelpfade ohne Wegweiser und Zielangabe weiterführen, die einst dem Kleinschmuggel nach und von Italien gedient hätten.
Und in dem bis auf den letzten Platz besetzten Speisesaal, in dem wir einige Zeit auf einen freiwerdenden Tisch hatten warten müssen, hatten Krina und ich meinem Freund Hugo und seiner Freundin, während wir assen, von den Wanderungen erzählt, die wir in den Tagen zuvor unternommen hatten.
Von der obligaten Wanderung zum Zarathustra-Stein, zu jenem am Ufer des Silvaplaner Sees unterhalb von Surlej gelegenen, einer aufgedunsenen Pyramide gleichenden, mächtigen Felsblock, auf dem ein Blatt Papier mit dem Text von Nietzsches Gedicht Sils-Maria aufgeklebt gewesen war.
Obligat war des Weiteren natürlich auch das Gehen auf dem zugefrorenen See von St. Moritz gewesen, das Promenieren auf der schneebedeckten Eisfläche, wo man den dort ebenfalls obligaten, unübertrefflich elegant und stilbewusst gekleideten, die neuste und teuerste Mode vorführenden Männern, Frauen und Kindern begegnete.
Mit Mänteln, Mützen, Hüten und Kappen entweder aus edelsten Stoffen oder erlesensten Pelzen. Zum Teil ohne, meist aber mit Hund oder Hündli, wie man auf Schweizerdeutsch sagt.
Mit kleinen oder kleinsten Tierchen, für deren Winzigkeit manchmal nicht einmal das schweizerische Diminutiv ausreichend genug zu sein schien. Oft ebenfalls, wie ihre Herrin oder ihr Herrchen, in einem neckischen Nerzumhang.
Und wenn das Tierchen Glück hatte, zusätzlich noch mit einem diamantbesetzten Halsband.
Eine weitere obligate Wanderung war die nach Isola gewesen, jenem kaum besiedelten, wie das Fextal autofreien kleinen Weiler in der Mitte des Südufers des Silsersees, vor dem sich ein ausgedehntes, jetzt im Winter verschneites und zugefrorenes Flussdelta ausbreitete, um dort auch wieder obligaterweise im Restaurant des Hotels Lagrev einzukehren, wo sich unter den Fotografien, die an den Wänden hingen, auch eine Porträtaufnahme von Max Frisch befand.
Und schliesslich war da auch noch die obligate Umrundung der Halbinsel Chastè gewesen, die vor Sils Maria in den Silsersee hinausragte und an deren Spitze sich ein Rastplatz befand, bei dem auf eine Felswand der berühmte Rundgesang des Zarathustra eingemeisselt war. Das trunkene Lied.
Mit der Anfangszeile: »O Mensch! Gib acht!«– und den Schlusszeilen: »Weh spricht: Vergeh! Doch alle Lust will Ewigkeit – will tiefe, tiefe Ewigkeit!«
Der Text auf dem Blatt Papier, das auf dem Zarathustra-Stein aufgeklebt gewesen war, hatte gelautet:
Hier sass ich, wartend, wartend, – und doch auf nichts, jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts geniessend, bald des Schattens, ganz nur Spiel, ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel. Da, plötzlich, Freundin! Wurde Eins zu Zwei – Und Zarathustra ging an mir vorbei.
Worte, die das Eintreffen der Inspiration beschrieben, aus der jenes Buch entstanden war, das wohl das berühmteste des Mannes mit dem Silberblick wurde.
Also sprach Zarathustra.
Ein Buch für Alle und Keinen.
Hugo, der seine Karriere mit einer Schauspielerausbildung begonnen hatte und nach verschiedenen Engagements in Ensembles an deutschen Bühnen und seiner Rolle als einer der Hauptnachrichtensprecher der Schweiz jetzt an einer Privatschule in Bern Deutsch unterrichtete, hatte, wie er sagte, seinen Schülern und Schülerinnen den Mann, der habe zeigen wollen, wie man mit dem Hammer philosophiert, ebenfalls näherzubringen versucht.
»Das hat er ja als bewusste Provokation in Form eines Untertitels seiner Götzen-Dämmerung hinzugefügt«, hatte Hugo gesagt. Götzen-Dämmerung – oder Wie man mit dem Hammer philosophiert.
Letztlich schätze er, Hugo, die Gedichte und das Lyrische in Nietzsches Prosa aber mehr als einen grossen Teil der Grundideen, die hinter seiner Philosophie steckten.
Anschauungen, wie er meinte, die wir heute, mit allem, was seither aus den Naturwissenschaften, den Geisteswissenschaften und der Kunst hinzugekommen sei, wieder in einer neuen Weise zu denken, zu verstehen, zu fühlen und zu spüren würden versuchen müssen.
»Nietzsche hat alles gesagt und das Gegenteil von allem, hat einmal jemand gemeint«, sagte Hugo, »Rousseau, dem armen Jean-Jacques, hat Nietzsche, im Gegensatz zu seiner Beurteilung Goethes, zum Beispiel sehr kritisch gegenübergestanden.«
Der Mensch Rousseau habe das grösste Feuer, habe Nietzsche geschrieben, und sei sich der populären Wirkung gewiss, aber er sei auch der gefährlichste.
Rousseau dränge auf Revolution und wolle zur Natur zurück, wodurch die wildesten und vernichtendsten Kräfte entbunden würden, wenn dieses Feuer die Massen erfasse...
Der Mensch Goethes dagegen, habe Nietzsche gemeint, sei keine so bedrohliche Macht. Der goethescheMensch verkörpere den kontemplativen Typus, der zutiefst unrevolutionär, ja sogar antirevolutionär sei.
Ihm, dem goetheschen Menschen, gehe es um ihn selbst. Er trachte danach, alle Reichtümer der Welt in seine Seele aufzunehmen.
Auch dieses Bild vom Menschen werde aber von der Menge missverstanden, die nicht fähig sei, es Goethe gleichzutun.
Ganz abgesehen, so Hugo, von der Rolle, die Nietzsches Schwester, Elisabeth Förster-Nietzsche, als alleinige Nachlassverwalterin ihres Bruders in der ersten Hälfte des Jahrhunderts gespielt habe, um den Nietzsche-Kult in Deutschland zu inszenieren und zu lenken, mit ihren Fälschungen an den Schriften und Briefen, die nach dem Zweiten Weltkrieg zum Glück allgemein bekannt geworden seien.
Nur habe das von dieser Frau verbreitete Bild ihres Bruders offenbar dem damaligen Zeitgeist, insbesondere dem, der von den Nazis verbreitet wurde, halt weitgehend entsprochen und sei von zahlreichen Gelehrten und Literaten vorbehaltlos geteilt worden.
Dann zitierte er drei Strophen eines Wintergedichts von Nietzsche, das den Titel Vereinsamt trug, aber auf eine merkwürdige Weise auch einen Bezug zu unserer jetzigen Situation zu haben schien.
Menschen im Winter.
Wenn Proserpina sich in der Unterwelt befindet...
Hugo, der einst Schauspieler gewesen war, dann einer der Hauptnachrichtensprecher der Schweiz und der jetzt an einer Privatschule in Bern Deutsch unterrichtete und zurzeit mit einer Frau zusammenlebte, deren Vorname Ursula war...
Die Krähen schreinUnd ziehen schwirren Flugs zur Stadt;Bald wird es schnein. –Wohl dem, der jetzt noch – Heimat hat!
Nun stehst du bleich,Zur Winter-Wanderschaft verflucht,Dem Rauche gleich,Der stets nach kältern Himmeln sucht.
Die Krähen schreinUnd ziehen schwirren Flugs zur Stadt;Bald wird es schnein. – Weh dem, der keine Heimat hat!
In der Nachfolge Nietzsches waren dann weitere Schriftsteller, Dichter und Denker, Maler, Musiker und andere Künstler, Theaterleute und Filmmenschen, Schauspieler und Regisseure nach Sils Maria gekommen.
Thomas Mann, Richard Strauss, Hermann Hesse, Albert Einstein, C.G. Jung, Marc Chagall, Theodor W. Adorno, Luchino Visconti...
Und alle waren sie im Hotel Waldhaus abgestiegen.
Dem einzigen Grandhotel in Sils Maria. Dem Hotel, dessen Name einerseits zutreffend, andererseits eine Untertreibung ist.
Denn die bescheidene Bezeichnung als »Haus« ist eine nur unzureichende Beschreibung für das mächtige weisse Gebäude, das auf einem Felsvorsprung am Rand des Dorfs und am Eingang zum Fextal wie eine Burg oder ein Schloss an die zehn Stockwerke hoch aus den Tannen und Lärchen des dichten Hangwalds aufragt.
Mit an der einen Ecke einem schmalen, von einer spitzen Haube bedeckten, runden Turm und mit zwei wuchtigen, mit einem flachen Dach versehenen, rechteckigen weiteren Ecktürmen als markantesten architektonischen Merkmalen.
Ringsum versehen mit unzähligen Fenstern und gekrönt von einer auf einem der rechteckigen Ecktürme an einer langen Stange hängenden Schweizer Fahne.
In seinem Spätwerk, im Band VIII seiner Stoffe, einer unkonventionellen, eigenwillig angelegten Art von Autobiographie anhand der literarischen Komplexbrocken, die ihn durch sein Leben hindurch beschäftigt hatten, hat Friedrich Dürrenmatt mit einigen wenigen Sätzen beschrieben, wie er einmal vom »Waldhaus« in Sils Maria ins Fextal hinaufgestiegen sei und in der Gaststube der »Sonne« eine Erzählung mit dem Titel Vinter zu schreiben begonnen habe, wozu er, wie immer, einen Blindband benutzt habe.
Auf dem Rückweg, beim Eindunkeln, sei er auf der steilen und vereisten Strasse dann ausgerutscht und auf den Rücken gefallen. Worauf es warm und feucht über sein Gesicht geglitten sei, und er einen grossen weissen Abruzzen Schäferhund über sich habe stehen sehen, so als ob dieser ihn habe bewachen wollen. Der Hund eines Bauern, dem er zusammen mit seinem Besitzer zuvor schon in der »Sonne« begegnet war.
Das grosse weisse Tier habe etwas Gespensterhaftes, Unwirkliches gehabt.
Aber er, Dürrenmatt, habe sich trotzdem seltsam geborgen gefühlt.
Dann habe jemand gepfiffen, und der Hund sei lautlos in den Hang von Schnee hinauf verschwunden.
Das, was er, Dürrenmatt, in der »Sonne« geschrieben habe, der Blindband, sei jedoch ebenfalls verschwunden gewesen, so dass er die Arbeit an der Erzählung von neuem habe beginnen müssen.
Se non è vero, è ben trovato.
Wie ich bei literarisch verarbeiteten Rückblicken auf das eigene Leben, nicht nur bei Dürrenmatt, sondern auch bei anderen Schriftstellern, oft denken musste.
Denn galt das nicht für die meisten Schriftsteller?
Oder jedenfalls für viele von ihnen?
Dass die Dinge, die sie beschrieben, gut erfunden waren, aber vielleicht nicht wahr.
Jedenfalls nicht in einem üblichen Sinn von Wahrheit.
Dichtung und Wahrheit.
Wahrheit und Dichtung.
Zur Feier des Tages hatten Hugo, Ursula, Krina und ich uns jedenfalls dazu entschlossen, von der »Sonne« im Fextal nicht wieder zu Fuss nach Sils Maria zurückzugehen, sondern uns in einem der auf der Talstrasse verkehrenden Pferdeschlitten zurückfahren zu lassen.
Aber in der leicht euphorischen Stimmung, in die uns der bisherige Verlauf des Tages und wohl auch der in der »Sonne« getrunkene Wein versetzt hatten, hatten wir dem Kutscher, der, wie wir mit Befriedigung feststellten, zwischendurch freundlich zu seinem Pferd sprach, kurz bevor die Fahrt zu Ende gewesen wäre, dann noch die Anweisung gegeben, von der Fextalerstrasse abzuzweigen und uns auf der grossen Auffahrt vor dem Hotel Waldhaus abzusetzen.
Zu einem, wie wir gefunden hatten, des Tages würdigen Zwischenhalt.
Über die langen Treppenstufen, die zum Haupteingang führten, waren wir in den Empfangsbereich und von dort, über ein paar weitere Treppenstufen, zu einer holzgefassten mehrteiligen Glastür gelangt, hinter der sich das Herzstück des in seinen Grundzügen anscheinend bis heute unverändert gebliebenen Belle-Epoque-Prachtbaus befand.
Ein weiter Saal.
Eine grosse Halle.
Ein hoher Raum, der an seinem hinteren Ende von einer halbrunden Fensterfront abgeschlossen wurde. Mit Scheiben, die von der Decke bis fast zum Boden hinunterreichten. Nur von wenigen schmalen Mauerstreifen zwischen den grossen Glasflächen unterbrochen.
Eine Fensterfront, durch die man auf die Schneelandschaft und die aus ihr aufragenden, mehr oder weniger dicht nebeneinanderstehenden, schneebedeckten, dunklen Tannen und Lärchen sehen konnte.
So dass auch die letzten Zweifler, falls es solche noch gegeben hätte, davon überzeugt werden mussten, dass sie sich hier tatsächlich in einem Waldhaus, in einem mitten in einem Wald stehenden Haus, aufhielten.
Dem Erbauer des 1908 eröffneten Hotelpalastes mit seinen hundertvierzig Zimmern habe, wie Hugo erzählte, die Erschaffung eines vollkommenen Hauses vorgeschwebt, das mit allen technischen Neuerungen seiner Zeit ausgestattet war, zu denen damals auch ein eigenes Elektrizitätswerk gehörte.
Eine Neuheit, die heute mit der Energiewende wieder aktuell geworden sei.
Möbliert war die einst auch als Ballsaal genutzte Halle mit schweren Sofas und Sesseln, die auf orientalischen Teppichen standen. Gruppiert um niedrige Tische.
Und die Menschen, die sich darin aufhielten, die auf den Sofas und in den Sesseln sassen oder sich durch den Raum bewegten, waren, wie es auf den ersten Blick schien und auch nicht anders zu erwarten gewesen war, alle der Umgebung entsprechend elegant gekleidet.