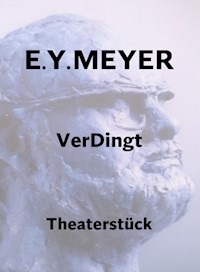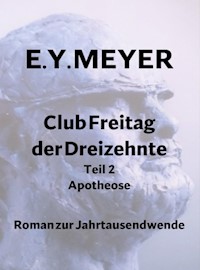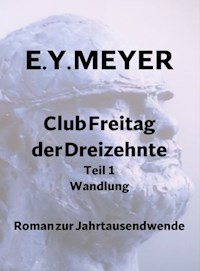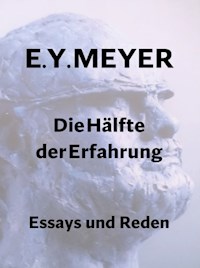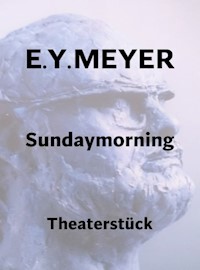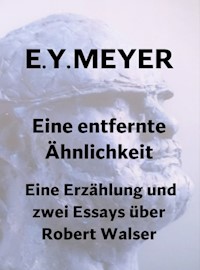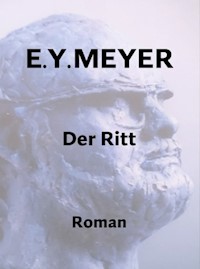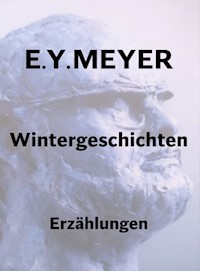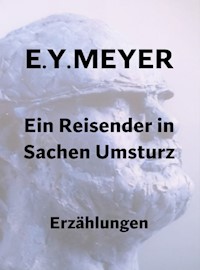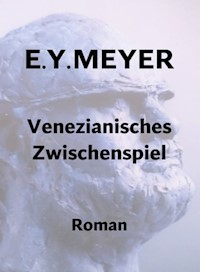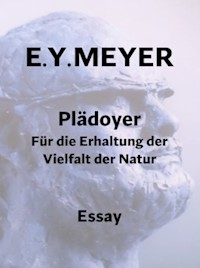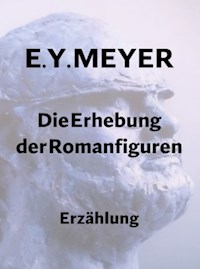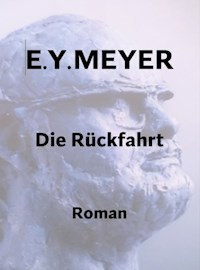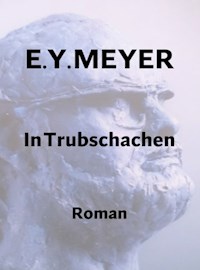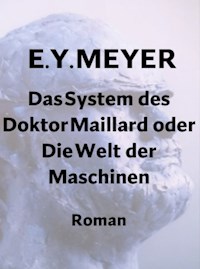
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn in einem Roman ein Autofahrer ein einsames Gebäude betritt, dann erwartet ihn irgendeine Überraschung. Dieser Roman beginnt so, dass ein Doktorand der Psychologie namens Edgar Ribeau am Tor eines Schlosses steht, das jetzt „Clinique Château Europe“ heisst. Er will den berühmten Psychiater Doktor Maillard treffen und sich mit dessen neuer Heilmethode vertraut machen - dem »System der Beschwichtigung«. Nach einigen Drinks eröffnet ihm Maillard jedoch, dass er inzwischen die Methode gewechselt hat und nun einem amerikanischen Forscherpaar namens Tarr und Fether folgt. Wenn Ribeau die Geschichte von Edgar Allan Poe aus dem Jahr 1845 gelesen hätte, dann würde er nun ganz sicher wissen, dass in dieser Klinik die Irren regieren. Er müsste sich schnell aus dem Staube machen. Aber der getarnte Poe-Hinweis war ja wohl eher für den kundigen Leser da, der natürlich schon vorher gemerkt hat, dass Maillard und seine »Gäste« nicht ganz bei Trost sind. Und der Name »Klinik Schloss Europa« zeigte ja von vornherein, dass hier nicht nur private Verrücktheiten zu erwarten sind, sondern solche von kontinentaler Bedeutung. E. Y Meyer hat Philosophie, Geschichte und Literatur studiert. An seinem Wissen lässt er uns intensiv teilhaben. Äussere Spannungsmomente und Gruseleffekte sind nur hinzugegeben, der Roman lebt vom intellektuellen Disput. Den führt Maillard mit dem Doktoranden und dem Doktor Anseaume. Mit der sokratisch angehauchten Logik und dem Fanatismus eines Wahnsinnigen entwickelt Maillard seinen Plan einer neuen Weltordnung. Dafür brauchte der Autor ja nur weiterzudenken, was in der Realität Europas für jeden sichtbar ist. Vieles deutet darauf hin: Wir leben in einem grossen Irrenhaus, die Vernunft ist unter Verschluss gehalten. Das »System« des Doktor Maillard ist ausgeklügelt, und es ist für den Leser eine vergnügliche Herausforderung, die Konstruktion zu durchschauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
E.Y.MEYER
Das System desDoktor Maillard oderDie Welt derMaschinen
Roman
Erstmals erschienen 1994
© 2021 E.Y.MEYER
eymeyer.ch
Cover:
Bronzekopf des Autors
Geschaffen 1997 von PAN YI QUINAcademy of Arts & Design
Tsing Hua UniversityBei Jing, China
Wir wissen, dass das System nicht direkt aus der Natur abgeleitet ist, wie wir sie auf der Erde oder im Himmel vorfinden, sondern Züge aufweist, die an jedem Punkt den Stempel des menschlichen Geistes tragen, teils rational, teils schwachsinnig, teils dämonisch.
Lewis Mumford, Mythos der Maschine
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Viertel Teil
Fünfter Teil
Erster Teil
Der Himmel über der Provence erstrahlte in einem intensiven, tiefen Blau, und sein berühmtes Licht hob die satten Farben der Herbstvegetation so stark hervor, dass es aussah, als ob die vielfältigen, sich einmal mehr in der letzten Phase ihres Wachstums befindenden Pflanzen auch von innen her leuchten würden.
Bei Orange, einer Stadt, die einst eine prunkvolle Römerkolonie gewesen war und heute noch einen gut erhaltenen Triumphbogen aus jener Zeit, aber auch eines der schönsten Theater der antiken Welt besitzt, verliess der Doktorand der Psychologie Edgar Ribeau die Autoroute du Soleil und durchquerte die fruchtbare Ebene rund um Carpentras – die auf Frühgemüse spezialisierten, riesigen Gärten des Comtat Venaissin, auf deren Nordostseite sich die imposante Pyramide des Mont Ventoux erhebt, dessen Gipfel von einer Steinwüste bedeckt wird, die von einem so erstaunlichen Weiss ist, dass es auch im Sommer so aussieht, als ob dort oben noch Schnee liegen würde.
Ein heftiger Mistral drückte mit seinen Böenfolgen immer wieder gegen den kleinen, silbergrau metallisierten Citroën BX 16 TRS, den der bald dreissig Jahre alte, aber eher jünger wirkende Mann fuhr, und zwang ihn, die Geschwindigkeit, die er schon nach dem Verlassen der Autobahn hatte drosseln müssen, auch weiterhin mässig zu halten.
Der berüchtigte, aus den Höhen des Massif Central ins Rhonetal hinunterfallende, magistrale kalte Wind fegt im südlichen Frankreich, wie Ribeau wusste, nicht nur den Himmel leer, sondern reinigt auch die Luft und trocknet das Land aus – mange fange, Schlammfresser, wird er von den Bauern genannt –, und er hält, wie es heisst, entweder drei oder sechs oder neun Tage an und macht dabei nicht selten einen der sensibleren Bewohner der Gegend verrückt oder fada, wie man hier sagt.
Auf der anderen Seite der Ebene, die das ursprüngliche Herrschaftsgebiet der Päpste in der Provence gewesen war, stieg die Départementale 942, der Ribeau folgte, auf das südlich ans Mont-Ventoux-Massiv anschliessende, im Gegensatz zum vorangegangenen fruchtbaren Gartenland verkarstete, aber in seinem westlichen Teil noch von dichtem Wald bewachsene Plateau de Vaucluse hinauf – und dort führte sie als kurvenreiche Höhenstrasse den in den Reiseführern in die Kategorie ›Verdient einen Umweg‹ eingestuften Gorges de la Nesque entlang, einem steil abfallenden und sich in unzähligen Grotten fortsetzenden canyonartigen Einschnitt, den der Fluss hier im Verlauf von Zehntausenden von Jahren tief in die Kalkschichten hineingefressen hat.
Obwohl es schwer vorstellbar ist, war auch dieses Gebiet, wie der Rest der heutigen Provence, vor etwa sechshundert Millionen Jahren von einem Binnenmeer bedeckt gewesen, und erst durch die Druckwirkung bei der Entstehung der Pyrenäen im Westen vor sechzig Millionen Jahren und der Alpen im Osten vor dreissig Millionen Jahren sowie durch das vor zwei Millionen Jahren erfolgte Absinken von Tyrrhenis, einem vom Menschen später so benannten Kontinent aus kristallinem Gestein, der den Raum des westlichen Mittelmeers eingenommen hatte, war nach und nach die Landschaft in derjenigen Form entstanden, wie sie sich in etwa auch heute noch ihren Besuchern darbietet.
Von keinem der vielen am Strassenrand aufgestellten Hinweisschilder liess sich der Doktorand der Psychologie jedoch dazu verleiten, auf einem der markanten Aussichtspunkte in der bizarren Felsenlandschaft anzuhalten – er bemühte sich vielmehr, mit nicht nachlassender Geschwindigkeit weiter ins Hinterland des Mont Ventoux vorzu dringen, ins sogenannte ›Lavendelland‹, das sich nach einem Weiler namens Monieux, einer Ansammlung von verfallenen grauen Häusern am Ausgang der Schlucht, denn auch plötzlich im gleissend hellen Sonnenlicht vor ihm auszubreiten begann.
Zwischen weit verstreuten, kahlen oder mit dunklen Waldstreifen bedeckten Höhenzügen dehnten sich hier überall riesige rechteckige Felder mit endlosen Reihen von stachligen, in ihrer abgeernteten Form grauschwarz er scheinenden Kugeln aus, und an den Rändern dieser geometrischen Flächenmuster, die Ribeau wie unzählige Igelplantagen vorkamen, weideten auf den angrenzenden, unbebauten, steinigen Landstücken, auf denen nur kurzes, trockenes Gras wuchs, hin und wieder auch kleinere Herden von dunkelbraunen Ziegen – sie glichen aus der Ferne winzigen Spielzeugtieren, die jemand auf eine behutsame Weise in ein naturgetreues Modell dieses speziellen Teils der Welt hineingesetzt hatte.
Die weite Landschaft, die da zwischen der weissköpfigen Ventoux-Pyramide und der langgestreckten, schon zu den Voralpen gehörenden, von Wald bewachsenen Montagne de Lure unter dem strahlenden Herbsthimmel vor ihm lag, war trotz oder gerade wegen ihrer Herbheit wirklich so eigenartig schön und farblich reizvoll, wie man sie Edgar Ribeau – der die Provence zwar recht gut kannte, aber merkwürdigerweise bisher noch nie in diese Gegend hinter dem Mont Ventoux gekommen war – beschrieben hatte, und vielleicht mochte sie in der Blütezeit des Lavendels, wenn dessen geheimnisvolles, tiefdunkles Lila hier überall wellenförmig hin und her wogte, auch tatsächlich, wie man sagte, etwas von einem Garten Eden an sich haben.
Ohne dass er die Autoroute du Soleil verlassen hätte, war Ribeau auf dem Weg an die Côte d’Azur, wo die Eltern seiner Freundin in der Nähe von Saint-Tropez eine direkt am Meer gelegene Ferienvilla und ein Segelschiff besessen hatten, jahrelang immer wieder an der eindrucksvollen Steinpyramide des Mont Ventoux vorbeigefahren – bis die Freundschaft mit dieser Frau, zu Ribeaus Bedauern, vor anderthalb Jahren auf eine unglückliche Weise abrupt und definitiv auseinandergegangen war.
Danach hatte eine schlimme Zeit für ihn begonnen, die nun aber, nicht zuletzt dank der Doktorarbeit, die er in Angriff genommen hatte und deren Fertigstellung ihn in eben diese Gegend führte, fast überwunden war – eine Zeit, der, falls ihm die Reise wirklich das, was er sich erhoffte, brachte, möglicherweise sogar eine zunehmend glanzvollere Zukunft folgen würde.
Denn wenn er dem bisherigen Studienmaterial, das er zusammengetragen hatte, noch seine hier gemachten Erfahrungen hinzufügen konnte, war es durchaus möglich, dass diese Arbeit schon bei ihrer öffentlichen Disputation beziehungsweise ihrer soutenance, vor allem aber nach ihrer Publikation in Buchform, eine kleinere oder sogar grössere Sensation hervorrufen würde, und zwar sowohl von ihrem Thema her wie natürlich auch wegen des Namens seines Lehrers und geistigen Vaters, des berühmten, als führende internationale Koryphäe auf seinem Gebiet geltenden Professors Louis Sagot-Duvauroux vom Collège de France in Paris.
Umso mehr als dieser ihm eine brillante Besprechung an prominenter Stelle in Aussicht gestellt hatte – ein weiteres Medienereignis, das ihm wiederum helfen könnte, eine jener bestbezahlten Spitzenpositionen in der Gesellschaft zu erhalten, die ihm eine Weiterführung des Lebensstils ermöglichen würde, an den er sich während der Jahre des Zusammenlebens mit seiner Freundin gewöhnt hatte und den wieder aufzugeben ihm nach der schmerzvollen Trennung doch ausserordentlich schwergefallen war.
Wenn der Professor recht hatte, war hier, in der Provence, in der man, wie er sagte, auch in den Dörfern eine grosse Achtung vor geistiger und künstlerischer Arbeit habe – war in dieser seit Jahrhunderten bevorzugten Zufluchtsstätte Europas möglicherweise, wenn vielleicht auch erst im Keim, tatsächlich eine Kraft und eine Bewegung im Entstehen, die der Menschheit würde helfen können, das hypertroph gewordene naturwissenschaftlich-technische Denken, das heute praktisch die ganze Welt beherrscht und die Lebensprozesse auf diesem Planeten in einer immer gefährlicheren Weise in eine globale Instabilität bringt, wieder auf ein lebensfreundliches Mass zurückzubinden, zu zügeln und zu zähmen.
Und im Grunde wäre ein solches Entstehen von Gegenkräften hier in Europa, wie Ribeau sich sagte, ja auch nichts als logisch, da die naturwissenschaftlich-technische Denkweise, die sich jetzt als lebensfeindlich und lebensbedrohend entpuppt, ja auch hier, auf ebendiesem Kontinent, in der jahrtausendealten, von den Griechen, den Römern, den Germanen, den Franzosen und den Engländern geprägten Kultur entstanden ist.
Das zivilisatorische Zentrum des eindrucksvollen, landschaftlich trotz der geometrischen Feldermuster noch urtümlich und wild wirkenden Lavendelanbaugebiets, das Edgar Ribeau bald darauf durchquerte, war das auf einem nördlichen Ausläufer des Plateau de Vaucluse gelegene schmucke, aber sonst, wie ihm schien, weiter nicht bemerkenswerte Provinzstädtchen Sault, dahinter zogen sich die intensiv in gelben, braunen und schwarzen Farbtönen leuchtenden Landstücke in einem breiten Streifen am Fuss der mächtigen, in ihrem unteren Teil von dunkelgrünen Pinienbäumen überwachsenen Südostflanke des Mont Ventoux entlang – und diesem Streifen folgte Ribeau nun.
Er überquerte eine niedrige Passhöhe, steuerte den Wagen, als der Feldergürtel zu Ende war, auf einer schmalen, kurvenreichen Strasse durch eine äusserst enge und schattige, auf ihn beklemmend wirkende, aber nur kurze Schlucht, und nach der anschliessenden Durchquerung eines wiederum flachen, aber vegetationsreicheren, in allen Herbstfarben leuchtenden Talbeckens, das nicht so ausgedehnt wie die vorangegangene Hochebene war, aber doch immer noch so weit, dass man seine Grösse als angenehm empfinden konnte, hatte er dann, sozusagen der östlichsten Ecke des Mont Ventoux gegenüber, kurz nach halb vier Uhr nachmittags das Ziel seiner Reise erreicht – einen kleinen, am Zusammenfluss zweier Bäche gelegenen, den Hang zwischen den beiden Seitentälern hinaufsteigenden, aus einem alten und einem neuen Teil bestehenden, sich höchst einladend präsentierenden Marktflecken namens Montbourg-les-Bains nämlich.
Der Doktorand der Psychologie hatte keine Mühe, sich hier zurechtzufinden – denn alles war so, wie sein berühmter Lehrer und, wie er sagen durfte, auch Freund es ihm geschildert hatte.
Im Talboden breitete sich der neue, von der sogenannten ›funktionalistischen‹, inzwischen über den ganzen Erdball verbreiteten modernen Architektur geprägte, sozusagen ›prosaischere‹ Teil des idyllisch gelegenen Ortes aus, der seinen Beinamen, wie der Professor erzählt hatte, immer noch trug, weil er dank kalter Schwefelquellen im neunzehnten Jahrhundert und noch bis weit ins zwanzigste hinein ein charmanter kleiner Kurort gewesen war – während die Häuser des alten, zum Glück noch ursprünglichen und nicht zu Tode renovierten Dorfkerns in traditioneller, seit Jahrtausenden bewährter Manier auf dem eng terrassierten, von kleinen, dicht überwachsenen Gärten durchsetztem Hang standen und bis zu vier mächtigen Rundtürmen hinaufreichten, die als einzige Ruinenreste von einer imposanten Schlossanlage aus dem dreizehnten Jahrhundert übriggeblieben waren.
Die teilweise gepflasterte und mit vielen Buckeln über säte, leicht gewölbte Hauptstrasse, von der immer wieder schmale und verwinkelte, steil ansteigende oder abfallende Seiten- und Nebengassen abzweigten, führte in mehreren Serpentinen zunächst an der Place du Beffroi, einer kleinen Aussichtsterrasse mit einem Uhrturm aus dem vierzehnten Jahrhundert, und danach an der aus dem siebzehnten Jahrhundert stammenden Kirche vorbei, die, laut dem Professor, einen sehenswerten geschnitzten Altar mit dem Gemälde eines von der Kunstgeschichte zu Unrecht übergangenen alten Meisters vorzuweisen hat – und am oberen Ende der Häuserreihen mündete die Strasse in ein mit rot und gelb leuchtenden Weinreben sowie mit silberblättrigen Olivenbäumen bepflanztes Landstück, bevor sie in den farbenprächtigen Mischwald eindrang, der oberhalb der Schlossruine den Rest des hohen Berghanges bewuchs.
Und direkt vor diesem Wald bog nun auch das seinem linken Rand entlangführende Strässchen ab, an dessen Anfang die vom Professor erwähnte Tafel mit der Aufschrift CHEMIN PRIVÉ stand.
In fast allen anderen Ortschaften, die der Doktorand seit dem Verlassen der Autobahn durchfahren hatte, waren ihm immer wieder die beiden bekannten, mit weisser Farbe gross auf einzelne Häuser und Gartenmauern gemalten Buchstaben OC aufgefallen – und auch hier, in diesem ehemaligen Kurort, hatte er sie, wie ihm schien, sogar noch zahlreicher als bisher, immer wieder zwischen den Betonflächen des neuen Ortsteils und zwischen den verwinkelten Gebäuden und Mauerzügen des alten Dorfkerns aufleuchten sehen –, und als er ans Ende des Privatwegs kam, der am Waldrand entlang zunächst in eine grössere Mulde und dann aus dieser hinaus zu einem Hügelvorsprung führte, wo sich eine hohe, massive Natursteinmauer vor die Bäume zu schieben begann und ein mächtiges, schmiedeeisernes Gittertor schliesslich jede Weiterfahrt verhinderte, war links und rechts dieses Tores, wie um das Ende einer Spur zu markieren, die zuvor immer nur mit ihrer Abkürzung angedeutete Parole nun in ungelenken grossen weissen Buchstaben in ihrem vollen Wortlaut auf die grobbehauenen Steine der Mauer gemalt: OCCITANIE LIBRE! und LE PAYS VEUT VIVRE!
Auf einer sich im Gegensatz zu diesen riesigen Zeichen bescheiden ausnehmenden, dunkel angelaufenen Messingtafel, die in halber Höhe auf dem rechten Torpfosten angebracht war, standen daneben jedoch auch die mit harten und klaren Lettern in sorgfältigster Weise eingravierten Vokabeln, die jeden Zweifel über ein allfälliges Verfehlen des endgültigen Reiseziels des jungen Mannes ausräumten: CLINIQUE CHÂTEAU EUROPE.
Als Edgar Ribeau, der ohne Zwischenhalt aus dem regnerisch kalten Paris bis hierher gefahren war, aus dem Wagen stieg, um sich nach einer Klingel umzusehen oder einer andern Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen, wurde er sofort von den kalten Luftmassen des Mistrals umfasst, der mit unverminderter Heftigkeit wehte – und als er durch das schwarze Gittertor über den dahinter, zwischen hochaufragenden Platanen wie durch einen Tunnel geradeaus führenden Weg blickte, glaubte er, etwa fünfzig Meter weiter hinten, dort, wo der Weg wieder ins Freie mündete, rechts, hinter dem bunt leuchtenden Laub der übrigen Bäume und Büsche, Teile eines grösseren, mit mehreren Türmen versehenen Gebäudekomplexes auszumachen.
Auf der dem Gittertor zugewandten Seite des rechten Torpfostens entdeckte er schliesslich einen unscheinbaren, kleinen schwarzen Knopf, und als er diesen einmal mit Nachdruck bis zum Anschlag hineingepresst hatte, wartete er, ob jemand reagieren würde.
Während er in der Sonne auf und ab ging, sich dabei die von der langen Fahrt ermüdeten Oberarme rieb und zwischendurch immer wieder auf die von seiner ehemaligen Freundin als erstes Geschenk erhaltene, in Edelstahl gefaste Rolex-Armbanduhr sah, bemerkte der gutaussehende, sportliche junge Mann plötzlich, wie sich ihm auf dem Strässchen, auf dem er hergefahren war, ein Mann mit einem Hund zielstrebig der Mauer entlang näherte – und er hatte dabei mit einem Mal, ohne dass er dafür irgendeinen Grund hätte ausmachen können, das Gefühl einer Bedrohung.
Der grosse Mann, der den heftig ziehenden Hund an kurzer Leine führte, trug braune Gummistiefel, eine tarnfarbene Militärjacke mit einem dazu passenden Képi und hatte auf der linken Seite ein Gewehr geschultert – schien also ein Jäger zu sein, obwohl Ribeau nicht sicher war, ob sich der Hund, der, wie er leicht erstaunt erkannte, ein Dobermann war, auch wirklich für die Jagd eignete.
Als der etwa sechzig Jahre alte, kräftige Mann nahe genug herangekommen war und in einigen Metern Abstand freundlich lächelnd vor ihm stehenblieb, sah Ribeau, dass er über der vermeintlich freien rechten Schulter zwei tote, an den Hinterläufen zusammengebundene Hasen herunterhängen hatte, so dass seine erste Einschätzung also wohl richtig war.
»Eine Fünfundsiebziger-Nummer«, sagte der Jäger dann unvermittelt, auf die beiden letzten Zahlen des Polizeikennzeichens von Ribeaus Wagen anspielend, mit einem starken, wie der Doktorand der Psychologie sofort und eindeutig erkannte, belgischen Akzent. »Sie kommen aus Paris!«
»Richtig« antwortete der junge Mann. »Und Sie wollen in die Klinik?« »Ich habe geklingelt«, meinte Ribeau nur. »Und? Hat sich noch niemand gemeldet? « »Bis jetzt nicht.«
Die Ohren spitz aufgerichtet, verfolgte der schnell atmende, feingliedrige, elegante, aber dennoch muskulöse, kurzhaarige Hund, der ausser dem Hecheln keinen Laut von sich gab, mit den schwarzglänzenden Augen aufmerksam jede Bewegung des ihm gegenüberstehenden jungen Mannes.
»Es wird schon jemand kommen«, meinte der Jäger nun wieder, wobei er erneut freundlich lächelte. »Das dauert hier immer eine Weile, denn man hat da so seine Vorschriften. Klingeln Sie doch einfach noch einmal!«
Ribeau, der dies eigentlich gerade, als der Mann mit dem Hund aufgetaucht war, hatte tun wollen, drehte sich um – und erschrak, als er hinter den schwarzen Gitterstäben einen kleinen, dicken Mann mit hochrotem Gesicht und einer bis über die Ohren herabgezogenen Baskenmütze stehen sah, der ihm ebenfalls freundlich, ja sogar etwas verschmitzt zulächelte.
»Wir freuen uns, dass Sie da sind, Monsieur Ribeau«, sagte der vielleicht vierzig Jahre alte Mann, dessen korpulenter Oberkörper in einer eleganten, aber etwas eng wirkenden dunkelbraunen Cordjacke steckte. »Steigen Sie wieder in Ihren Wagen und fahren Sie herein.«
Über das Aussehen dieser ihm sofort sympathischen Erscheinung amüsiert, gleichzeitig aber über den formlosen Empfang, den man ihm in der berühmten, bis jetzt kaum von aussenstehenden Ärzten und nur von einigen handverlesenen Journalisten besuchten Klinik bereitete, auch etwas verwundert, verabschiedete sich der Doktorand von dem neugierigen Jäger – worauf ihm dieser, ohne sich von der Stelle zu rühren, mit einem, wie es Ribeau schien, etwas merkwürdigen und nicht verständlichen Unterton in der Stimme ein fröhliches »Auf bald!« zurief.
Während Ribeau den Motor startete, stand der Mann mit dem Hund immer noch an der gleichen Stelle – und auch nachdem er durch das von dem kleinen dicken Mann geöffnete Tor gefahren war und dieser es wieder geschlossen hatte, sah er im Rückspiegel, wie der Jäger noch bewegungslos draussen stand und zu ihm hineinschaute.
Als Ribeau auf Anweisung des munteren, flink zu ihm ins Auto gekletterten kleinen Mannes, der, obwohl nur etwa zehn Jahre älter, bereits eine von einer Unzahl geplatzter blauroter Äderchen überzogene Nase hatte, durch den langen, schattigen Baumtunnel fuhr, den die links und rechts des Wegs aufragenden Platanen mit ihren ineinander übergehenden, mächtigen Kronen bildeten, verlor er den Jäger jedoch aus den Augen – und als er aus dem Tunnel schliesslich auf einen wieder im hellen Sonnenlicht daliegenden, von Kies bedeckten grossen freien Platz fuhr, übertraf, was er sah, alles, was der Professor beschrieben hatte.
Während sich auf der rechten Seite das sogenannte Neue Schloss von Montbourg-les-Bains erhob, bot sich ihm auf der linken Seite, über einer weiten, von einer steinernen Balustrade umrahmten Terrasse, ein geradezu atemberaubender Ausblick auf den Gipfel des Mont Ventoux mit dem sich gegen den tiefblauen Himmel abzeichnenden Observatorium und der daran anschliessenden Radarstation der französischen Luftwaffe und der seitlich von diesen Bauten schräg abfallenden, stark zerklüfteten, nackten Nordostseite des Berges.
In der Mitte des langen Terrassengeländers führte, wie Ribeau im Vorbeifahren sah, eine zweiläufige Freitreppe in höchst raffiniert und kunstvoll angelegte, vom herbstlich bunten Wald gesäumte hängende Gärten hinunter, aus denen immergrüne Buchsbaumhecken, buschhohe Kermeseichen und zum Teil ausserordentlich hochgewachsene Zypressen, Aleppokiefern und Zedern emporragten – und als er den Wagen vor dem Neuen Schloss, das von den derzeitigen Bewohnern schon seit Jahren auch stolz ›Château Europe‹ genannt wurde, abgestellt hatte, erschien dem in der nördlich gelegenen, oft kalten und nassen Industriestadt Lille geborenen und aufgewachsenen Doktoranden, der bis jetzt nur an Instituten und Kliniken in überbevölkerten und mit dem Lärm des täglichen Motorenverkehrs gefüllten Grossstädten gearbeitet hatte, die sich hier ringsum ausbreitende Natur doch als der eigentlich geeignetste Rahmen, um sich mit all den verschiedenen und unterschiedlichen, insbesondere natürlich auch den ausgefallenen und als krank bezeichneten Manifestationen des menschlichen Geistes zu beschäftigen.
Noch vor zehn Jahren, in der Zeit also, bevor er sein Psychologiestudium begonnen hatte, hätte sich der Arbeitersohn vor dem verschachtelt gebauten, weitläufigen Wohnsitz aus dem sechzehnten Jahrhundert, dessen drei stöckiges Hauptgebäude eine klassisch proportionierte Renaissancefassade aufwies, die links und rechts von zwei massiven Rundtürmen mit steinernen Fensterkreuzen flankiert wurde, zwar wohl noch etwas unangenehm und deplatziert gefühlt – aber jetzt ertappte sich der junge Mann in den verwaschenen Bluejeans und der alten, am Kragen und an den Ellbogen schon speckig gewordenen Wildlederjacke sogar bei dem Gedanken, ob er, nach dem derzeitigen, nur der Vorbereitung dienenden ersten Kurzbesuch und dem später folgenden längeren Studienaufenthalt, wenn seine Doktorarbeit abgeschlossen sein würde, nicht gerade hier eine Stelle zu kriegen versuchen sollte.
Er empfand die Ruhe, die auf diesem ganz von Wald umgebenen Anwesen herrschte, als ausgesprochen wohltuend und war, als er aus dem Wagen stieg und sich umsah, eigentlich überzeugt, dass ein Verstehen und eine humane, menschliche Pflege und Betreuung oder gar Heilung von im Geist erkrankten Menschen in einer solchen kleinen und übersichtlichen, jahrhundertealten Kulturoase inmitten einer noch urtümlichen Landschaft doch eher möglich und erreichbar sein musste als in den grossstädtischen Hochzivilisationszentren.
Der kleine rotgesichtige Mann, der trotz seines Übergewichts mit einer unglaublichen Schnelligkeit ums Auto geeilt und von einer wirklich aussergewöhnlichen Liebenswürdigkeit war – er hatte, wie der Doktorand konstatierte, in seinen Bewegungen und seiner Sprechweise sogar etwas leicht Feminines –, beharrte mit Nachdruck und ohne Widerrede zu dulden darauf, die grosse Reisetasche, die Ribeau als einziges Gepäckstück bei sich hatte, zu tragen und führte ihn so, sich mit dem schweren, sackförmigen Ungetüm abmühend, über die breiten, steinernen Treppenstufen, die sich unter dem massiven, dunkelglänzenden Eichenholzportal des Neuen Schlosses ausbreiteten, in eine hohe und weite Eingangshalle, in der farbenprächtig leuchtende, wie Ribeau annahm, aus Flandern und Brüssel stammende Wandteppiche hingen und wo in einer eigenwilligen, doch interessanten Anordnung auffallend viele grosse, grün bemalte Holzkübel mit üppigen, hoch aufspriessen den Zierpflanzen aller Art herumstanden.
Inmitten dieser verwirrenden Pflanzenvielfalt stellte der heftig atmende und nun auch stark schwitzende Mann die grosse Reisetasche dann einfach auf den mit geometrischen Mosaikmustern verzierten Fussboden und bat Ribeau höflich, ihm in einen langen, dunklen Korridor zu folgen, der auf der linken Seite der Halle begann und in dem der Doktorand schon bald gedämpftes Klavierspiel vernahm, das immer deutlicher wurde, je weiter sie vordrangen.
Bei einer mit Schnitzereien verzierten, von einer dunklen Sopraporta gekrönten zweiflügeligen weissen Holztür am Ende des fensterlosen Korridors vernahm man die Musik am deutlichsten – und hier lächelte der kleine Mann unter seiner dunkelblauen, bis über die Ohren herabgezogenen Baskenmütze hervor Ribeau noch einmal verschmitzt nach oben hin an und sagte: »Sie möchten da drin warten! Der Direktor kommt gleich!«.
Der Raum, in den der Doktorand trat, war eine Art grosszügiger, weiter und heller Salon, in dem auf einem hellbraun glänzenden Parkettboden einige prächtige Perserteppiche lagen und in dem erneut erstaunlich viele Töpfe und Kübel mit üppig wachsenden, zum Teil nur grünen, zum Teil aber auch farbenreich blühenden Pflanzen in einer nicht durchschaubaren Anordnung sowohl antike wie moderne Möbel umrahmten.
Neben einem schwarzen Klavier, das im Hintergrund von einigen der Pflanzen grösstenteils verdeckt schräg im Raum stand, so dass Ribeau zunächst nicht erkennen konnte, wer daran sass, waren im ganzen Raum noch die verschiedensten anderen Musikinstrumente verteilt – er sah Geigen, Flöten, Posaunen und Trommeln-, und neben diesen Geräten türmten sich überall Stapel von Partituren und Noten blättern auf.
In die rechte Seitenwand des Salons war ein mannshoher, von Feuerrauch geschwärzter alter provenzalischer Kamin eingebaut, während beidseits der Tür eine Unzahl von Büchern die Wände vom Fussboden bis zum weissen Stuckplafond bedeckten, und aus drei hohen, aussen vergitterten Fenstern auf der gegenüberliegenden Raumseite konnte man auch von diesem Teil des Schlosses über den grossen Kiesplatz zum weissen Gipfel des Mont Ventoux hinaufsehen – aber beherrscht wurde der Raum von einer riesigen, nicht besonders gelungenen Kopie des Ribeau wohlbekannten Bildes ›Regentessen van het Oude-Mannenhuis te Haarlem‹ des holländischen Malers Frans Hals, die über einer Sitzgruppe aus braunen Ledermöbeln an der linken Seitenwand hing.
Die fünf schwarzgekleideten alten Damen waren darauf im Unterschied zum Original – Hals hatte das schonungslose Gruppenbild der ›Vorsteherinnen des Altmännerhauses von Haarlem‹ vermutlich als Insasse dieses Heims noch im Alter von achtzig Jahren gemalt – nicht nur als isolierte Einzelpersonen dargestellt, sondern durch ein überhartes Licht sogar so weit reduziert, dass von ihnen nur noch die weissen Kleidkragen, die harten, zu keiner gefühlvollen Geste mehr fähigen Hände und die karikaturistisch gemalten Greisinnengesichter deutlich zu erkennen waren.
Die Frau, die links aussen sass, hielt als Finanzverwalterin, obwohl alle Rechnungen sicher beglichen und die Bücher geschlossen waren, immer noch die rechte Hand geöffnet – aber die ansonsten durchwegs noblen Haltungen, die diese grossen Damen einnahmen, widerspiegelten, neben ihrer Autorität, trotzdem auch eine Härte, Einsamkeit und Trostlosigkeit, die jene der armen Schlucker, denen sie in ihrem Heim Hilfe leisten wollten oder sollten, zweifellos noch übertraf.
Verwundert stellte der junge Mann aus Paris auch fest, dass auf der dem Bild gegenüberliegenden Seite des Salons bei einem topmodernen, geschickt zwischen Bücherwand und Kamin platzierten Turm, der aus einem grossen Fernseher, einem Videorecorder, einer mehrteiligen Hi-Fi-Anlage sowie einem modisch gestylten Telefon bestand, die Bildröhre des Fernsehapparats nur noch in Scherben vorhanden war.
Als er, nach einigen Momenten des Abwartens und Herumschauens, schliesslich ein paar Schritte nach vorne machte, um zu sehen, wer am Klavier sass, befand Ribeau sich zu seiner Überraschung einer vollständig in schwarz gekleideten, im Gegensatz zu den ›Vorsteherinnen‹ jedoch jungen Frau mit streng nach hinten gekämmten schwarzen Haaren und wundervollen, aber sehr bleichen Gesichtszügen gegenüber, die sich, wie ihm durch den Kopf fuhr, also in tiefer Trauer hätte befinden können und die ihr Spiel, nachdem sie den fremden Eindringling bemerkt hatte, sofort unterbrach, um ihn mit grossen, überraschend intensiv leuchtenden, hellblauen Augen fragend anzusehen.
»Spielen Sie doch weiter, Mademoiselle«, beeilte Ribeau sich nun sofort als Entschuldigung für seine Störung zu sagen. »Schubert, nicht wahr!«
»Das Impromptu As-Dur Opus neunzig Nummer vier«, sagte die am Klavier sitzende junge Frau daraufhin mit einem Leuchten in den Augen und einem leichten englischen Akzent in der Stimme. »Mögen Sie – Schubert?«
»Sehr«, antwortete Ribeau, der sich über die Richtigkeit seines Urteils freute. »Ich liebe die ›Winterreise‹.«.
»Die mag ich auch«, meinte die vielleicht drei oder vier Jahre jüngere Frau, die ihr enganliegendes Haar hinter dem Kopf in einem straffen Knoten zusammengebunden trug, und spielte gleich einige Takte aus diesem Liederzyklus, um dazu in einem, wie Ribeau glaubte, nicht ganz korrekten Wortlaut zu singen:
Fremd bin ich eingezogen,Fremd zieh’ ich wieder aus.Es zieht ein MondenschattenAls mein Gefährt voraus –
Dann brach die Frau ihren Gesang und ihr Spiel ebenso abrupt wieder ab: »Meinen Winter verbringe ich aber doch lieber hier, im Süden!«
»Verständlich«, meinte der Doktorand, der immer noch nicht wusste, wen er da vor sich hatte.
»Ich ziehe mich oft hierher zurück«, sagte die Frau nun wieder. »Klavierspielen entspannt mich.«
»Ich verstehe«, meinte Ribeau.
In der Pause, die danach entstand, glaubte der junge Mann für einen Moment, den jetzt wieder deutlich hörbaren heftigen Mistral, der draussen blies, in stark abgeschwächter Form auch hier drinnen, in dieser merkwürdigen Mischung von Musikzimmer, Treibhaus und Bibliothek, direkt auf seiner Haut zu spüren.
Die Frau hätte, wie er überlegte, ein höchst interessanter Fall sein können – ein erstes Beispiel dafür, wie die völlig neuartige Behandlungsmethode, die man hier entwickelt hatte, funktionierte, eine Patientin also, mit der er später möglicherweise auch einmal zu tun bekommen würde.
Aber bevor er mit dem Direktor dieser Klinik, dem Schöpfer des noch kaum je irgendwo, weder von seinem Erfinder selber noch von einem seiner Mitarbeiter oder einem aussenstehenden Fachmann umfassend und adäquat dargestellten, berühmten wie berüchtigten Beschwichtigungssystems, gesprochen hatte, wollte er sich natürlich noch nicht zu sehr vorwagen – zumal er auch die wohlproportionierten Körperformen der Frau bemerkt hatte, die sich unter der dünnen schwarzen Wolljacke, der schwarzen Seidenbluse, dem enganliegenden schwarzen Rock und den schwarzen Nylonstrümpfen abzeichneten, und er, was Frauen betraf, wie er sich eingestehen musste, schon einmal entschieden danebengegriffen hatte.
»Sind Sie hier?« fragte die Frau den stumm dastehenden Doktoranden unvermittelt – und dieser kam sich durch die Frage, die er nicht recht verstand, wie er amüsiert feststellte, sogar etwas überrumpelt vor.
»Bitte?« fragte er deshalb einfach. »Sind Sie ein Neuer?« »Was meinen Sie?« »Bleiben Sie länger hier?« »Das kommt darauf an.«
»Worauf?« wollte die Frau nun mit deutlichem Nachdruck wissen.
»Ich muss mit dem Direktor sprechen!«
Die auf ihn gerichteten, grossen und so intensiv hellblau leuchtenden Augen liessen den jungen Mann nicht wieder los, und nachdem die Frau noch gefragt hatte, woher er komme, rief sie sofort: »La bella Parigi! Città dei miei sogni! La ville lumière! Wie sie mir fehlt!«
»Sie haben in Paris gelebt?« fragte Ribeau, den ihre Sprachkenntnisse irritierten.
»Sie müssen mir erzählen, was in Paris los ist«, drängte die Frau, ohne auf seine Frage einzugehen. »Wir haben im Fernsehen kürzlich Yves Montands Auftritt im Olympia wiedergesehen« – und schon spielte sie auf dem Klavier und sang dazu:
Depuis qu’à Paris,On a pris la Bastille,Dans tous les faubourgs,Et à chaque carr’four,Il y a des gars,Et il y a des fill’sQui, sur les pavés,Sans arrêt, nuit et jour,Font des tours,Et des tours,À Paris ..
Ribeau, den die Wandlungsfähigkeit der Frau beeindruckte, klatschte kurz und meinte: »Sie haben eine wunderbare Stimme!«.
»Danke«, sagte die Frau, ohne dem Kompliment irgendwelche Beachtung zu schenken. »Sie müssen mir erzählen, welche Mode man in Paris trägt, welche Restaurants man besucht!«
»Ich war in der letzten Zeit selten in Paris«, antwortete Ribeau ausweichend. »Ich war viel auf Reisen.«
»Aber Sie müssen doch wissen, was in ist. Welche maisons – ich meine, wessen Stücke man spielt, an der Comédie Française zum Beispiel!«
»Meine Arbeit erlaubt mir leider nicht, viel auszugehen.«
»Aber Sie werden doch wissen, welche Dichter man liest, welche Philosophen man diskutiert. Sie haben doch Fernsehen!«
»O nein«, lachte Ribeau.
»Unser Apparat ist jetzt leider auch kaputt«, sagte die Frau daraufhin bedauernd. »Haben Sie vielleicht etwas zu rauchen?«
»Ich bin Nichtraucher.« »Und wie steht’s mit Schnee?«
»Schnee? « fragte Ribeau.
»Ja.«
»Ich verstehe –«
»Was machen Sie denn?« fragte die Frau nun höchst ungeduldig.
»Ich –«
Er zögerte – aber im gleichen Augenblick öffnete sich, ihm eine Entscheidung ersparend, die Tür, durch die er in den Salon getreten war, und ein grosser, wohlbeleibter, aber keineswegs dick wirkender Mann, der einen offenen weissen Ärztekittel trug und, wie Ribeau wusste, vor wenigen Wochen neunundfünfzig Jahre alt geworden war, kam schwungvoll hereinspaziert.
Wie die Umgebung und das Schloss entsprach Doktor Maillard, der Chef der Clinique Château Europe, zwar recht genau der Beschreibung, die man Ribeau gegeben hatte – sogar die Kleidung, die er unter dem offenen weissen Mantel trug, glich der auf den Fotos, die er von ihm gesehen hatte –, aber als der Doktorand den Mann, der jede Art von Publizität verabscheute und von dem nur wenige ältere Bilder existierten, nun direkt in Fleisch und Blut vor sich sah, beindruckte ihn die imposante Erscheinung doch mehr, als er erwartet hatte.
Vor allem die, wie er überrascht erkannte, mit jenen der jungen Frau am Klavier praktisch identischen, intensiv hellblau leuchtenden Augen, die ihn unter einem Paar buschiger, tiefschwarzer Brauen hervor äusserst lebhaft ansahen, waren es, die Ribeau so bemerkenswert schienen – und angenehm überraschte ihn auch das überhaupt nicht anmassende oder arrogante Benehmen, das der trotzdem Autorität und Würde ausstrahlende, wie man sagte, ganz und gar der alten Schule angehörende und grossen Wert auf gepflegte Umgangsformen haltende Mann ihm gegenüber an den Tag legte.
»Da ist er ja, unser junger Freund«, sagte der Klinikchef, der unter dem weissen Mantel einen dunkelblauen Anzug mit Gilet trug, über dessen Ausschnitt sich eine grellrote Krawatte und die hautfarbenen Schläuche eines altmodischen Stethoskops von einer weissen Hemdbrust abhoben, während er mit ausgestreckten Armen erfreut lachend auf den Doktoranden zuging. »Gut gereist? Keine Schwierigkeiten gehabt, uns hier zu finden?«
»Überhaupt nicht, Monsieur le directeur«, antwortete Ribeau und erwiderte den fast schmerzhaft kräftigen Händedruck des grossen Mannes. »Der Professor hat mir alles genau beschrieben!“.
»Der gute alte Sagot-Du!« rief der Klinikdirektor und strich sich mit beiden Händen über die stark gelichteten grauen Haare, die glatt zurückgekämmt auf seinem kantigen Schädel lagen. »Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Wie geht es ihm denn? Produziert er immer noch eine wissenschaftliche Arbeit nach der andern und sensationiert damit das literarische Paris?«
»Sie übertreiben, Monsieur«, meinte Ribeau, der sich ein leichtes Schmunzeln allerdings nicht verkneifen konnte.
»Aber nein«, lachte Maillard. »Wir sind hier im Süden zwar etwas abseits vom Zentrum, aber heutzutage ist man ja auch an der Peripherie ganz gut informiert. Und Sagot-Du’s vornehmer Doppelname und sein doppeldeutiges Eierkopfimage dringen durch die Medien ja bis in den letzten Winkel.«
»Der Professor sagte mir, dass Sie einen ausgeprägten Sinn für Humor hätten.«
»Humor?! Hast du gehört, Linda?« Wieder lachte der grosse Mann schallend. »Humor hat er gesagt! Ich wette, der gute Sagot-Du hat Sie vor mir gewarnt und Ihnen gesagt, ich sei ein alter Witzbold, der dauernd irgendwelche Scherze aushecke und sogar zu einer gewissen Boshaftigkeit neige!«
»Durchaus nicht«, versicherte der Doktorand – worauf der andere jovial meinte: »Ach, kommen Sie, mir gegen über können Sie völlig offen sein. Sagot-Du und ich sind schon viel zu lange miteinander befreundet, als dass wir uns noch irgendetwas vorzumachen brauchten. Er hat mir ja auch alles über Sie geschrieben und Sie mir eben noch einmal telefonisch ans Herz gelegt. Der begabteste Schüler und Mitarbeiter, den er bis jetzt gehabt habe! Mein Kompliment! Sehr schmeichelhaft!«
»Ich –« Ribeau blickte kurz zu der Frau, die am Klavier sass.
»Ach so, Linda«, meinte der Klinikchef. »Habt ihr euch überhaupt schon bekannt gemacht?«
»Wir haben uns ein wenig unterhalten«, sagte Ribeau.
»Sehr schön, wunderbar«, konstatierte Maillard zufrieden. »Dann sei doch so gut und bring uns einige Erfrischungen, liebste Linda!«
»Mit Vergnügen«, sagte die junge Frau lächelnd und ging auf ihren eleganten, hochhackigen schwarzen Schuhen so nahe an Ribeau vorbei zur Tür, dass dieser den Duft ihres diskreten, aber trotzdem ungewöhnlich aufreizend wirkenden Parfums riechen konnte.
»Eine interessante und, wie es scheint, auch recht talentierte Person«, sagte der Doktorand dann, höchst gespannt auf das Gespräch, das zwischen ihm und dem in Fachkreisen nicht nur gerühmten, sondern auch umstrittenen und stark angefeindeten Direktor folgen würde. »Ist sie –«
»Linda?!« lachte dieser nun wieder laut. »Nein, nein, mein Lieber! Linda ist keine Patientin. Sie ist die Tochter eines amerikanischen Multimillionärs und Medienzars. Das Kind hat zwar, wie viele junge Leute in unserer Zeit, unlängst auch einmal einige Wohlstandsprobleme gehabt – gewisse Sucht- und Abhängigkeitserscheinungen, Sie verstehen, was ich meine –, erledigt nun aber, nun ja, sagen wir, spezielle Sekretariatsarbeiten für mich, als meine ganz persönliche Mitarbeiterin sozusagen. Ein höchst reizendes und liebenswürdiges Wesen, wie Sie sicher bemerkt haben!«
»Oh, durchaus«, sagte Ribeau, nicht ohne gleichzeitig eine gewisse Genugtuung darüber zu empfinden, dass er sich im Gespräch mit dieser Frau, bevor der Direktor erschienen war, noch nicht zu weit vorgewagt hatte.
»Manchmal etwas überschwänglich, ja exzentrisch«, meinte Maillard mit einem, wie Ribeau schien, leicht ironischen Unterton. »Aber das erhöht den Reiz ja nur, oder nicht?«
»Sie müssen entschuldigen, dass ich unsicher war. Aber Sie werden verstehen –«
»Natürlich, mein Lieber, natürlich«, beschwichtigte ihn der Klinikdirektor. »Wie ich dem Brief von Sagot-Du entnommen habe, waren Sie ja auch schon bei Basaglias Nachfolger Doktor Rotelli in Triest und haben Laing auf seinem Alterssitz in Saint-Tropez besucht.«
»Richtig. Mein Auge ist, sagen wir, vielleicht nicht mehr ganz ungeschult.«
»Aber man kann nie vorsichtig genug sein, nicht wahr?!« »Sie sagen es!«
»Und nun schickt der alte Fuchs Sie also auch noch zu mir!«
»Aber nein, Monsieur«, protestierte Ribeau. »Ich bin auf meinen ganz persönlichen Wunsch hier – zur Vervollständigung meiner thèse d’État, wie Sie wissen. Ihre Arbeit und Ihre Methode sind in der Öffentlichkeit ja leider nicht so bekannt, wie sie es verdienen würden, aber in wissenschaftlichen Kreisen spricht man mit grossem Respekt von Ihnen und Ihrem System.«
»Bitte setzen Sie sich doch. Sie werden nach der langen Fahrt sicher müde sein!« Maillard deutete auf das bequem aussehende braune Ledersofa, das direkt unter der riesigen, wirklich nicht besonders gut gelungenen Kopie des ›Vorsteherinnen‹-Bildes stand, und fügte in der ihm eigenen, angenehmen und freundlichen Art hinzu: »Ich hoffe, die vielen Pflanzen stören Sie nicht zu sehr. Wir haben einfach noch keine Zeit gehabt, uns dieses Problems anzunehmen. Sobald wir für einige andere, wichtigere Dinge eine Lösung gefunden haben, werden wir uns aber auch um diese Sache kümmern und sie wieder in Ordnung bringen!«
Ribeau, der für die Aufforderung, sich zu setzen, dankbar war, verstand nicht recht – ihm kam es vor, als ob die üppige Vegetation, die das Schloss umgab, durch die überall aufgestellten Kübelpflanzen auf eine wundervolle Weise in dieses Gebäude hineinwachsen konnte, so dass man sich quasi auch in seinem Innern noch in der Natur befand –, und er sagte deshalb zu Maillard, der bald einige Schritte in dieser, bald in jener Richtung machte, dass ihn die Pflanzen überhaupt nicht störten, dass er sie, im Gegenteil, als ausgesprochen angenehm, ja wohltuend empfinde, und versuchte dann, das Gespräch wieder auf den Zweck seines Besuchs zurückzuführen, indem er meinte: »Sie sollten unbedingt mehr über Ihre Arbeit publizieren.«
»Ach was«, wehrte der Direktor einmal mehr nur beiläufig ab. »Es wird doch schon viel zuviel publiziert! Was ich zu sagen habe, habe ich gesagt, es ist gedruckt und greifbar, und ich sehe nicht ein, warum ich das alles noch in tausendfachen Variationen und Verkleidungen wiederholen soll, nur um mir damit einen sogenannt ›wissenschaftlichen‹ Namen zu machen.«
Da er nun den Augenblick für gekommen hielt, mit dem Mann, der ihm in seiner offenen und unkonventionellen Art immer sympathischer wurde, genauer über die Bedingungen seines Studienaufenthalts in diesem Haus zu sprechen – ein Praktikum, das er, nach dem Eindruck, den er bisher gewonnen hatte, möglichst rasch anzutreten wünschte –, gestand Ribeau ganz direkt: »Ihr Angebot und Ihr Bestehen auf einem Kurzbesuch von mir zur Vorbereitung meines Aufenthalts haben den Professor und mich etwas überrascht.«
»Oh«, meinte Maillard, während er schmunzelnd vor dem Doktoranden stehenblieb. »Wir dachten, dass wir auf diese Weise sowohl Sie wie uns vor Enttäuschungen bewahren können. Denn der letzte Besucher, den wir hier in unserem guten Château Europe hatten, war nämlich, wenn es Sie interessiert, ein kuhäugiger deutscher Journalist, ein gewisser Fritzi – ich weiss nur noch Fritzi – aus Hamburg, der recht forsch auftrat und dann einen uns sehr enttäuschenden, höchst überheblichen, durch und durch deutschen Artikel schrieb, in dem er alles und jedes, was er hier gesehen und gehört hatte, kritisch hinterfragte und rational brillant, aber trotzdem völlig oberflächlich verbalisierte und intellektualisierte. Im Stil: Der romanische Chauvinismus der Latinität bedroht die grösste Dichter- und Denkernation der Welt!«
Während der Klinikdirektor genussvoll das Zitat des Journalisten zum Besten gab, war die schwarzgekleidete Amerikanerin wieder in den Salon getreten und trug eine grosse, mit Früchten überladene Schale herein – Ribeau erkannte neben hoch aufgetürmten, hellgelb und dunkelblau leuchtenden Trauben auch prächtige Äpfel, Birnen und Pfirsiche.
»Der Wein kommt gleich«, sagte sie, während sie die Schale graziös vor dem Besucher aus Paris auf den Glastisch stellte – und als Maillard sie fragte, ob sie noch den Namen des deutschen Journalisten wisse, von dem ihm nur noch Fritzi, Fritzi aus Hamburg, in Erinnerung geblieben sei, meinte sie: »Nein. Eine Frucht?«
»Danke nein«, antwortete Ribeau.
»Ist aber sehr gesund!« Der an den Glastisch herangetretene grosse Mann nahm sich eine von den dunkelblauen Trauben und setzte sich dann dem Doktoranden schräg gegenüber in denjenigen der beiden zur Sitzgruppe gehörenden schweren braunen Ledersessel, der der Fensterfront des Salons zugewandt war.
»Die Servietten, sofort«, sagte die ihren Chef aufmerksam beobachtende Mitarbeiterin dienstbeflissen und eilte hastig wieder hinaus.
Der stattliche Klinikdirektor hatte sich einige grosse blaue Traubenbeeren in den Mund geschoben und zerkaute sie kraftvoll.
»Nehmen Sie doch auch eine«, ermunterte er den Doktoranden nochmals, während er ihm die Schale zuschob. »Aus dem eigenen Weinberg!«
»Oh, schön! Dann natürlich!« Ribeau entschied sich ebenfalls für eine dunkelblaue Traube, und diese schmeckte, wie er zugeben musste, wirklich ausgezeichnet – und nachdem er einige Beeren gegessen hatte, erlaubte er sich, dem Klinikdirektor eine etwas indiskrete Frage zu stellen.
»Sagen Sie – wie heisst sie eigentlich mit Nachnamen?«.
»Linda? Sie heisst Lovely, Linda Lovely. Ein schöner Name, finden Sie nicht auch?«
»Oh, doch«, meinte Ribeau. »Und Ihr Assistent ist Doktor Anseaume?«
»Sie kennen Doktor Anseaume?« fragte Maillard den ihm schräg gegenübersitzenden jungen Mann.
»Der Professor erwähnte ihn.«
»So so –«
»Er meinte, Sie würden mich wohl sicher in seine Obhut geben.«
»Meinte er –«
Die plötzliche Kurzsilbigkeit und das mit einer speziellen Betonung und einem ironischen Schimmern in den hellblau leuchtenden Augen verbundene kommentarlose, fast echohafte, schroffe Wiederholen der Worte verunsicherten Ribeau ein wenig.
»Ja –«, sagte er.
»Nun«, meinte der Klinikdirektor mit einem feinen Lächeln. »Ich bin nicht sicher, ob Doktor Anseaume da der geeignete Mann wäre.«
»Ich werde ihn ja kennenlernen«, sagte Ribeau.
»Das ist, fürchte ich, momentan leider nicht möglich«, antwortete Maillard betont langsam.
»Warum?« fragte Ribeau.
Der Klinikdirektor sah den jungen Mann, während er sich eine weitere Traubenbeere in den Mund schob, amüsiert an und erklärte dann wieder so langsam wie zuvor: »Doktor Anseaume befindet sich im Urlaub.«
»Wie bitte?«
»Neu-Kaledonien!«
Ribeau war etwas verwirrt. »Aber der Professor«, begann er- und Maillard fragte sofort mit einem eigenartigen Unterton: »Ja?«
»Nichts«, sagte Ribeau ausweichend, und im gleichen Augenblick trat wieder die Amerikanerin in den Salon und verschaffte ihm damit eine nicht unwillkommene Atem- und Denkpause.
»Die Servietten«, sagte die schöne junge Frau und begann zu seiner Überraschung, eines der grossen weissen Tücher zuerst sorgfältig auf dem Schoss Maillards und das andere gleich darauf, ohne irgendwelche Hemmungen zu zeigen oder eine Entschuldigung vorzubringen, auf dem seinen auszubreiten.
»Unser junger Freund hier hat sich nach Doktor Anseaume erkundigt«, sagte der Klinikdirektor zu Linda – aber diese reagierte überhaupt nicht darauf, sondern fragte Ribeau, während sie ihm in die Augen sah, ob er lieber weissen oder roten Wein trinke, und verliess, nachdem er sich für weissen entschieden hatte, ein weiteres Mal den Salon.
»Ist sie nicht zauberhaft, meine Linda«, sagte der grosse Mann, während er sich eine zweite, diesmal eine hellgelbe Traube nahm. »Sie wollen also, wenn ich den guten Sagot-Du richtig verstanden habe, über die sogenannte Anti-Psychiatrie schreiben?«
»Eine unglückliche Bezeichnung, die sich leider durchgesetzt hat«, wehrte Ribeau, der spürte, dass nun der Moment seiner Prüfung gekommen war, sofort ab.
»Bevorzugen Sie vielleicht die Bezeichnungen antiinstitutionell, antitechnokratisch, antiautoritär, radikaldemokratisch oder demokratisch-sozialistisch?