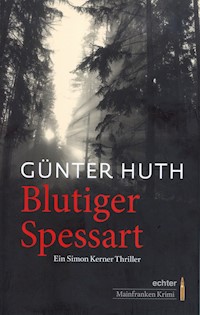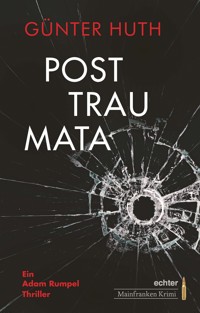Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine tote Rabenkrähe mit ausgestochenen Augen, ein Toter, dem in die Augen geschossen wurde - Simon Kerner kann sich zunächst keinen Reim auf diese Vorgänge machen. Doch weitere unheilvolle Zeichen und Morde folgen. Die Ermittlungen lassen vermuten, dass die Ursache in Kerners beruflicher Vergangenheit zu finden ist. Aber diesem bleibt nicht mehr viel Zeit für die Aufklärung, denn der Killer kommt ihm immer näher und treibt dabei ein perverses Katz- und Maus-Spiel. Als schließlich auch seine Freundin Steffi bedroht wird, ergreift er die Initiative! Die Story mündet in einem Showdown auf Leben und Tod. Ein neuer, packender Spessart-Thriller des Würzburger Schoppenfetzer-Autors Günther Huth!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GÜNTER HUTH
Das letzteSchwurgericht
Ein Simon Kerner Thriller
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog
Günter Huth wurde 1949 in Würzburg geboren und lebt seitdem in seiner Geburtsstadt. Er kann sich nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben. Er war von Beruf Rechtspfleger (Fachjurist), ist verheiratet und hat drei Kinder. Seit 1975 schreibt er in erster Linie Kinder- und Jugendbücher, Sachbücher aus dem Hunde- und Jagdbereich. Außerdem hat er bisher Hunderte Kurzerzählungen veröffentlicht. In den letzten Jahren hat er sich vermehrt dem Genre Krimi zugewandt und in diesem Zusammenhang einige Kriminalerzählungen veröffentlicht. 2003 kam ihm die Idee für einen Würzburger Regionalkrimi. »Der Schoppenfetzer« war geboren. Diese Reihe hat sich mittlerweile als erfolgreiche Serie in Mainfranken und zwischenzeitlich auch im außerbayerischen »Ausland« etabliert. 2013 ist der erste Band der Simon-Kerner-Reihe mit dem Titel »Blutiger Spessart« erschienen. Der Autor ist Mitglied der Kriminalschriftstellervereinigung »Das Syndikat«. Seit 2013 widmet er sich beruflich dem Schreiben.
Die Handlung und die handelnden Personen dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ist nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig.
»Der Rabenstein am Letzten Hieb war eine der wichtigsten Hinrichtungsstätten der Stadt Würzburg. Außerhalb der Stadtmauern, als gemauerte Richtstätte auf einem Hügel errichtet, wurden dort im Mittelalter über lange Zeit schwere Leibesstrafen vollstreckt. Hierzu zählten Erhängen, Vierteilen, Rädern, Pfählen, um nur einige aus dem möglichen Strafenkatalog zu nennen. Die Delinquenten wurden nach der Vollstreckung am Rabenstein, teilweise noch lebend, den Gewalten der Natur ausgesetzt, wozu auch die Rabenvögel zählten, denen der Ort seine Bezeichnung verdankte. Diese Vögel, auch Aaskrähen genannt, folgten ihrer natürlichen Bestimmung und fielen über die hilflosen Halbtoten oder die Leichen her, die häufig zur Abschreckung dort verblieben, bis nur noch Knochen von ihnen übrig blieben.
Die Raben waren daher bei den Menschen verhasst, weil man in ihnen Todesboten sah. Zahllose Sinnsprüche gaben von der besonderen Einstellung zu den Aaskrähen Zeugnis. Insbesondere: ›Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus‹ wies einerseits auf die speziellen Fraßgewohnheiten dieser Vögel und andererseits auf deren soziale Verträglichkeit am Kadaver hin. Eigenschaften, die gerne auch als Metaphern auf menschliche Verhaltensweisen übertragen wurden …«
Auszug aus dem Werk»Hinrichtungsstätten der Stadt Würzburgzur Zeit der Fürstbischöfe«,Kapitel: »Der Rabenstein« vonDr. jur. Wilhelm Kürschner
Prolog
Der Jäger hob sein Fernglas. Aus dem Tal kommend, flog ein Rabenvogel heran, drehte eine Schleife über der Wiese und ließ sich schließlich im ausladenden Geäst einer gegenüberstehenden Buche nieder. Kurz darauf entdeckte er zwei weitere Krähen, die sich im Tiefflug näherten und auf einen anderen Ast des Baumes als Vorhut niederließen. Auch sie stießen das durchdringende, arttypische Kräh-Kräh aus. Wie der Jäger feststellte, blickten alle in Richtung Wiese. Dort musste es etwas geben, das ihr Interesse geweckt hatte.
Plötzlich ließ sich die erste Krähe fallen, glitt im Tiefflug über die Wiese und verschwand im Gras. Der Jäger wartete darauf, ihre Artgenossen ebenfalls diese Stelle anfliegen zu sehen. Vermutlich lag dort ein verendetes Tier. Rabenkrähen nahmen gerne Aas auf. Nach dem Ansitz würde er den Platz einmal kontrollieren.
Kaum hatte er den Gedanken zu Ende gebracht, als eine der Krähen im Baum kurz mit den Flügeln schlug und dann wie ein Stein zu Boden fiel. Zwei Sekunden später stürzte der zweite Vogel aus unerfindlichen Gründen aus dem Geäst. Die Krähe am Boden schien Verdacht geschöpft zu haben, denn sie legte plötzlich mit klatschenden Flügeln einen Alarmstart hin und verschwand über den Baumwipfeln.
Der Jäger war einen Moment verblüfft, dann kam ihm ein schlimmer Verdacht: Wie es aussah, waren diese Vögel abgeschossen worden! Er hatte keinen Schuss gehört, was ihm den Schluss aufdrängte, dass mit einem schallgedämpften Gewehr geschossen worden war. Wilderer!, zuckte es durch sein Gehirn. Unwillkürlich langte er nach seinem Gewehr, das er griffbereit quer vor sich auf die Schießluke gelegt hatte. In dem Jäger stieg Zorn hoch. Die Chance, den Kerl auf frischer Tat zu ertappen, wollte er sich nicht entgehen lassen. Von seinem Hochsitz aus konnte er nichts Verdächtiges entdecken. Also schnappte er sich sein geladenes Gewehr und hastete eilig die Leiter hinunter. Am Boden angekommen, sprang er, das Gewehr quer vor der Brust, mit zwei Sätzen über den Weg und lief gebückt einige Meter in die angrenzende Wiese. Dort kniete er sich sofort nieder. In dieser Haltung konnte er gerade noch durch die Spitzen der höchsten Grashalme hindurchspähen. Die toten Krähen lagen am jenseitigen Waldrand. Wenn sich jemand den erschossenen Vögeln näherte, würde er das von seiner Position aus sehen. Der Jäger war wild entschlossen, den Straftäter zu stellen. So eine Chance würde er nicht wieder bekommen.
Plötzlich hatte er das unbestimmte Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Ehe er in irgendeiner Form reagieren konnte, bekam er von hinten einen harten Schlag auf den Kopf, und es wurde Nacht um ihn.
Der Mann, der ihn mit dem Hinterschaft seines Gewehres bewusstlos geschlagen hatte, schob die Gesichtsmaske nach oben und sah mit zorniger Miene auf den Jäger herab. Er ärgerte sich, ihn nicht in der Kanzel bemerkt zu haben, sonst hätte er natürlich auf seine Aktion verzichtet.
Der Unbekannte beugte sich hinunter und fühlte den Puls des Bewusstlosen. Das Herz schlug gleichmäßig. Die Platzwunde am Kopf blutete zwar stark, war aber nicht weiter gefährlich. Er hatte kein Interesse daran, dem Mann zu schaden, der lediglich zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen war. Sein Pech! Langsam richtete er sich wieder auf und verließ den Ohnmächtigen in Richtung Wiese. Lange würde die Betäubung nicht anhalten.
Auf dem Weg zu den erschossenen Krähen kam er an der Stelle vorbei, wo im Gras ein totes Reh lag. Am Tag vorher hatte er es geschossen und hier in der Wiese niedergelegt, um die Aaskrähen anzulocken. Der Kadaver war bereits von anderen Räubern angefressen. Vermutlich hatte sich ein Fuchs daran gütlich getan. Er ließ das Reh liegen und ging weiter zum Waldrand. Dort hob er die beiden toten Krähen auf, steckte sie in eine Plastiktüte und verstaute sie zusammen mit dem zerlegten, schallgedämpften Kleinkalibergewehr im Rucksack. Als er wenig später im Wald verschwand, begann es bereits zu dämmern.
Der Verletzte wurde zehn Minuten später von einem Mountainbikefahrer gefunden, der noch zur späten Stunde im Revierteil Bendelsgraben seine Trainingsrunden drehte.
1
Es war 16.37 Uhr. Die Tür zum Beratungszimmer, das sich an den großen Gerichtssaal anschloss, öffnete sich. Ein Raunen ging durch den bis auf den letzten Platz gefüllten Raum, und die Menschen erhoben sich, dann trat Stille ein. Die Prozessbeteiligten und Zuschauer im großen Schwurgerichtssaal des Landgerichts Würzburg musterten die fünf Personen, die nun entlang der Stirnwand des Raumes hintereinander eintraten. Der Richtertisch befand sich, im Vergleich zum normalen Saalniveau, auf einem etwas erhöhten Podest, sodass man von dort auf die Menschen im Saal hinunterblicken konnte. Eine sichtbare Manifestierung der Distanz, die ein Gericht zu den übrigen Verfahrensbeteiligten und zum Volk hatte, in dessen Namen es Recht sprach.
Hinter dem Richtertisch standen sechs Stühle. Fünf an der Längsseite, einer an der schmalen Kopfseite. Die Protokollführerin stand bereits an der linken Schmalseite des Tisches und stützte leicht ihre Fingerspitzen auf der Tischplatte auf. Die rot lackierten Fingernägel bildeten einen deutlichen Kontrast zu ihrer schwarzen Robe. Aufmerksam sah sie den Richtern entgegen. Die Urteilsberatung war heute wieder relativ kurz ausgefallen. Ein Zeichen dafür, dass der Vorsitzende seine Richter wieder einmal gut im Griff gehabt hatte. Sie war schon einige Zeit Protokollführerin in solchen Prozessen. Mittlerweile konnte sie an den Mienen der eintretenden Mitglieder des Schwurgerichts mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Urteil erraten.
Unterhalb des Richtertisches auf dem Niveau des restlichen Gerichtssaals befand sich der Tisch für den Angeklagten und seinen Verteidiger, ihm gegenüber, der Platz des Staatsanwalts. Verteidiger und Staatsanwalt trugen ebenfalls schwarzen Roben. Zwei Meter davon entfernt saßen die Vertreter der Presse.
Die Reihe der einziehenden Richter führte der ebenfalls im Amtstalar gekleidete Vorsitzende des Schwurgerichts an, der sich vor den mittleren Stuhl in der Mitte des Richtertisches stellte. Zwei weitere Berufsrichter in gleicher Robe, die ihm dichtauf folgten, positionierten sich links und rechts von ihm auf. Die beiden ihnen folgenden Personen in Zivil, ein Mann und eine Frau, erreichten wenig später ihre Sessel, jeweils an der linken und rechten Flanke.
Nachdem sich der Vorsitzende davon überzeugt hatte, dass alle an ihren Plätzen standen, musterte er mit unbewegter Miene die am Prozess beteiligten Personen. Zuletzt fixierte er das Gesicht des Angeklagten, der bleich neben seinem Verteidiger stand und den Blick gesenkt hielt. Er trug einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine weinrote Krawatte. Seine Haare waren kurz geschnitten. Sein Verteidiger hatte ihm erklärt, dass auch der äußere Eindruck bei der Urteilsfindung eine Rolle spielen würde, insbesondere dann, wenn weibliche Richter mit am Tisch saßen. Das markant männliche Gesicht spiegelte deutlich die Strapazen der Untersuchungshaft und des Prozesses wider.
Mit gemessenen Bewegungen setzte sich der Vorsitzende des Schwurgerichts eine Lesebrille auf, dann hob er ein Blatt Papier. Im Saal hätte man eine Nadel fallen hören können. Mit wohltönendem Bariton und tragender Stimme verkündete er das Urteil.
»Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil: Der Angeklagte Alexander Thannenberger wird wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.«
Es trat eine Pause ein.
Der Kopf des Angeklagten sank ein Stück nach vorne. Die Schultern des Verteidigers senkten sich resignierend um einige Nuancen, die Körpersprache des Staatsanwalts hingegen verriet seinen Triumph.
Der Vorsitzende wartete, bis seine Worte verklungen waren und ihr Sinn in die Köpfe der Anwesenden eingedrungen war. Schließlich ließ er das Blatt sinken und machte eine sparsame Handbewegung. »Nehmen Sie bitte wieder Platz.« Gleichzeitig ließ auch er sich auf seinem Stuhl nieder. Die neben ihm stehenden Mitglieder des Schwurgerichts folgten seinem Beispiel.
Die mündliche Urteilsbegründung dauerte knappe zwanzig Minuten, dann war der Prozess beendet. Die Gesichter der Menschen im Schwurgerichtssaal zeigten ein breites Spektrum an Gefühlen. Je nachdem, in welchem Verhältnis sie zu dem soeben Verurteilten bzw. dem Opfer standen.
Nachdem der Vorsitzende des Schwurgerichts die Verhandlung geschlossen hatte, mussten die beiden Justizwachtmeister den Verurteilten stützen, damit er nicht zusammenbrach. Langsam ließ er sich auf die Anklagebank sinken. Seine gesamte Willenskraft, die ihn während des zwei Tage dauernden Schwurgerichtsprozesses hatte Haltung bewahren lassen, war verbraucht. Sein Verteidiger beugte sich über ihn und redete beschwichtigend auf ihn ein. Die Wachtmeister gewährten ihm noch einen Augenblick, dann drängten sie zum Aufbruch. Das Gericht hatte die Fortdauer der Untersuchungshaft angeordnet. Der Verurteilte war wieder abzuführen.
2
Jahre später
Der Mann im weißen Arztkittel sah sein Gegenüber über die Schreibtischplatte hinweg ernst an. Vor ihm lag aufgeschlagen eine nicht sonderlich dicke Patientenakte. Seine Hand ruhte schwer auf der letzten Seite eines Befundes.
»Es tut mir schrecklich leid, dass ich Ihnen nichts Positiveres sagen kann.« Mit diesem Satz schloss der Arzt seine Ausführungen, mit denen er gerade seinem Patienten das umfangreiche Untersuchungsergebnis erläutert hatte. Einen Moment lang herrschte Sprachlosigkeit.
Der Patient spielte mit den Fingerspitzen an einer der beiden Metallschließen herum, mit denen die Träger seiner blauen Latzhose festgehalten wurden. Es war das einzige Zeichen von Nervosität, das dem Mann anzusehen war. Ansonsten saß er ruhig auf dem einfachen Holzstuhl und starrte auf die Buchstaben, die von der Hand des Arztes weitgehend verdeckt wurden. Es war schon erstaunlich, wie wenig Platz ein Todesurteil benötigte, dachte er.
»Wie lange noch?«, durchbrach er das Schweigen. Seine Stimme klang angespannt und heiser.
Der Arzt hob leicht die Schultern. Er war sich sehr wohl bewusst, dass die Antwort auf diese Frage in ihrer psychologischen Wirkung der Nennung einer Frist bis zur Vollstreckung einer Hinrichtung gleichkam.
»Es ist schwer, hier eine Prognose zu wagen.«
»Jetzt sagen Sie schon! Ein Jahr … oder weniger? Reden Sie, ich werde schon nicht zusammenbrechen.«
Die Worte des Mannes kamen gepresst und zerstörten damit den Versuch, Gelassenheit zu demonstrieren.
Der Arzt atmete tief durch und erklärte mit gesenkter Stimme: »Drei Monate … vielleicht ein halbes Jahr. Aber das sind nur Annahmen, die auf statistischen Erfahrungen beruhen. Eine verbindliche Auskunft kann Ihnen leider niemand geben …« Seine Stimme verklang. Die Antwort stand schwer im Raum und gewann an bedrückender Endgültigkeit durch das neuerliche Schweigen. Schließlich fuhr er fort: »Ich werde natürlich versuchen, Ihnen, soweit es in meiner Macht liegt, durch die Verabreichung entsprechender Medikamente Schmerzen zu ersparen. Wenn der Krebs allerdings weiter fortschreitet, wäre dann an eine Verlegung auf eine Palliativstation zu denken. Wir sind hier für die Betreuung derart schwerer Fälle nicht eingerichtet.« Er unterbrach sich erneut, dann fügte er hinzu: »Es tut mir wirklich sehr leid für Sie.«
Der Patient erhob sich. »Schon gut, Doktor.«
»Wir sehen uns in einer Woche wieder«, erklärte der Arzt und gab ihm über die Schreibtischfläche hinweg die Hand.
Der Mann verließ das Sprechzimmer. Der Arzt starrte geraume Zeit auf die geschlossene Tür. Er hasste solche Gespräche. Trotz aller Professionalität waren sie emotional immer sehr anstrengend.
Draußen, im kleinen Wartezimmer, erhob sich ein Mann in Uniform, der hier gewartet hatte.
»Und, wie sieht es aus?«, wollte er wissen.
»Ich habe gerade eine massive Haftverkürzung bekommen«, erwiderte er mit bitterer Ironie. Der Versuch eines Grinsens misslang im Ansatz. »Drei Monate bis ein halbes Jahr hat der Medizinmann gemeint. Also ein überschaubarer Zeitraum, bis ein neuer Mieter in meine Zelle einziehen kann.«
»Mist!«, gab der Vollzugsbeamte zurück. Was sollte er auch sagen? Dass der Strafgefangene Alexander Thannenberger, der wegen Mordes zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt war und diese Strafe hier, in der Justizvollzugsanstalt Straubing, seit sechs Jahren abbüßte, Krebs im Endstadium hatte, war ihm bekannt. Diese unerbittliche Prognose überraschte aber auch ihn. Gewiss, die Vollzugsbeamten, die regelmäßig mit den Lebenslänglichen zu tun hatten, waren gehalten, kein allzu persönliches Verhältnis zu den Gefangenen aufzubauen. Freundlich ja, aber immer mit einer gewissen Distanz, damit die Dienstpflicht nicht darunter litt. Die Grenzlinien mussten immer klar definiert sein. Trotzdem konnte es nicht ausbleiben, dass man zu bestimmten Gefangenen eine andere Beziehung aufbaute als zu den übrigen. Thannenberger war so einer. Er war ein sehr ruhiger, stets höflicher Zeitgenosse, der den Beamten nie Schwierigkeiten machte. Eigentlich ein Musterhäftling. Der Gefangene hielt seine Zelle in Ordnung, achtete auf seine Körperhygiene und legte sich nie mit seinen Mitsträflingen an. Seit er wegen seiner Krankheit nicht mehr in der anstaltseigenen Werkstatt arbeiten konnte, hatte man ihm eine leichte Tätigkeit in der Bibliothek übertragen, die er sehr sorgfältig ausübte.
Thannenberger und der Beamte waren an der Zelle angekommen, die seit Jahren der Lebensmittelpunkt des Gefangenen war. Der Uniformierte schloss die Tür auf und schob den Riegel zurück. Er öffnete sie bis zur Wand. Tagsüber wurden die Lebenslänglichen, die sich ordentlich führten, nicht eingeschlossen.
»Es ist Zeit für Ihre Medikamente«, stellte der Bedienstete fest, während er routiniert seinen prüfenden Blick durch die Zelle gleiten ließ. »Ich werde sie Ihnen gleich vorbeibringen.«
Thannenberger nickte und setzte sich auf sein ordentlich gemachtes Bett. Eine einfache Bettstatt aus Metall, verschweißt und nicht geschraubt, damit sie nicht zerlegt werden konnte, mit einer Matratze, einem dünnen Kissen und einer gleichfalls einfachen Zudecke. Beide mit einem blaukarierten Stoff bezogen. Er hörte, wie die Schritte des Vollzugsbeamten auf dem Gang verhallten.
Er warf einen Blick zum Fenster, das sich an der Schmalseite der Zelle zur Außenwand hin, dicht unter der Decke befand. Aus Sicherheitsgründen ließ es sich nur leicht kippen. An heißen Tagen war die Hitze im Raum nur schwer zu ertragen. Durch die verschmutzten Scheiben konnte man die stabilen Außengitter erkennen.
Thannenberger erhob sich. Zum Wasserbecken waren es nur zwei Schritte. Durstig trank er einen Schluck aus der hohlen Hand. Die Zelle hatte gerade mal knappe neun Quadratmeter, wovon ein Großteil von Bett, Tisch, Stuhl, einem schmalen Spind und der in der Ecke eingebauten Edelstahltoilette verbraucht wurde. Als Lebenslänglichem war es ihm grundsätzlich gestattet, ein Mindestmaß an individueller Einrichtung zu haben. Sie erschöpfte sich bei ihm allerdings in einem Landschaftsposter über dem Bett, das eine Flussaue zeigte, und zwei Fotografien, die er mit Klebepads am Spind befestigt hatte. Beide zeigten eine Frau mittleren Alters in verschiedenen Posen, die freundlich in die Kamera lächelte.
Als er sich auf dem Stuhl am Tisch niederließ, fuhr ein zuckender Schmerz durch seinen Leib. Unwillkürlich krümmte er sich zusammen und stieß ein unterdrücktes Stöhnen aus. Sein körpereigener Mitbewohner brachte sich wieder brutal in Erinnerung. Schlagartig trat ihm kalter Schweiß auf die Stirn. Mühsam schleppte er sich zum Bett. In Embryonalhaltung blieb er liegen und biss die Zähne zusammen. Diese Anfälle kamen in der letzten Zeit immer häufiger und heftiger. Nach einigen Minuten ebbte die Schmerzwelle wieder ab, und er konnte sich aufrichten. Gerade rechtzeitig hatte er sich wieder in der Gewalt, als der Vollzugsbeamte in der Tür stand.
»So, hier habe ich Ihre Tabletten«, erklärte er. Er hob eine kleine durchsichtige Schale aus Kunststoff hoch, in der sich zwei rosa Kapseln befanden. »Sie kennen ja das Prozedere.«
Thannenberger nickte, ging zum Waschbecken und ließ Wasser in einen Plastiktrinkbecher laufen. Der Beamte schüttete ihm dann die beiden Kapseln in die Handfläche, und der Gefangene warf sie sich mit einer schnellen Bewegung in den Mund. Darauf spülte er mit Wasser nach.
»Okay, lassen Sie mich nachsehen«, sagte der Beamte und machte eine auffordernde Handbewegung.
Thannenberger öffnete den Mund weit, und der Mann warf einen flüchtigen Blick in seine Mundhöhle. Damit war den Bestimmungen Genüge getan.
»In Ordnung«, erklärte er, nahm das Tablettenbehältnis und steckte es in die Tasche seiner Uniformjacke. »Ich hoffe, es wird dadurch für Sie etwas erträglicher.« Sein Bemühen um menschliche Anteilnahme war offensichtlich.
Thannenberger nickte knapp, dann legte er sich wieder auf sein Bett. Der Bedienstete drehte sich um und verließ die Zelle.
Kaum war der Mann draußen, richtete sich Thannenberger wieder auf, griff zum Mund und brachte die beiden Kapseln zum Vorschein. Er hatte sie bei der Kontrolle mit einer geschickten Bewegung seiner Zunge in die Wangentasche geschoben. Er wusste, dass der Beamte nicht sonderlich genau kontrollierte. Eine steckte er wieder in den Mund und schluckte sie. Das Morphin, das er seit drei Wochen verordnet bekommen hatte, würde seine Schmerzen zumindest so dämpfen, dass er es einigermaßen ertragen konnte. Mit der anderen ging er zum Spind und öffnete ihn. Er entnahm ihm ein Paar frisch gewaschene Socken, die ineinander zusammengerollt waren. Vorsichtig schob er die Kapsel zwischen die Baumwolle. Dabei fühlte er die anderen Kapseln, die er schon angespart hatte. Noch eine Woche, dann hatte er genug zusammen, um es riskieren zu können. In der Gefängnisbibliothek hatte er nachgelesen. Wenn die Überdosis groß genug war, würde eine Atemlähmung eintreten und damit der von ihm gewünschte Tod. Er hatte nicht vor, hier elend zu krepieren.
Der Gefangene legte sich nieder und wartete, bis die Wirkung des Medikaments einsetzte. Nach einer Weile erhob er sich. Aus seinem Spind holte er einen Stapel Briefe, einen Schreibblock und einen Einwegkugelschreiber, damit ließ er sich am Tisch nieder. Er fächerte die Briefe wie Spielkarten vor sich auf. Die Adresse auf jedem Umschlag war mit der zierlichen Handschrift einer Frau geschrieben. Schließlich nahm er den letzten Brief in die Hand, den er etwa vor einer Woche bekommen hatte. Obwohl er den Inhalt fast auswendig kannte, las er jeden Satz und genoss erneut die liebevolle Botschaft, die die Zeilen enthielten. Dann legte er die beiden auf der Vorder- und Rückseite beschriebenen Blätter zur Seite und griff sich den Schreibblock. Einige Zeit starrte er auf das leere, linierte Blatt, dann beugte er sich vor und begann zu schreiben. Schweren Herzens hatte er sich entschieden, endlich die ungeschminkte Wahrheit zu sagen.
3
Fünf Monate später
Die Nachmittagssonne schien leicht schräg durch das Blätterdach der hohen Buchen und malte bizarre Muster auf den Asphalt des Weges. Es war brütend heiß, es ging kaum ein Luftzug.
Nur eine einzige Person folgte in kurzem Abstand dem dunkel gekleideten Mann, der würdevoll, gemessenen Schrittes über den Weg des Friedwalds im Waldfriedhof von Würzburg ging. Der Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens Ewiger Frieden trug die schlichte Urne mit beiden Händen umfasst. Den Blick hielt er gesenkt.
Für den Bestatter war dies eine Urnenbeisetzung wie jede andere. Dass es Verstorbene gab, die keine Angehörigen mehr besaßen, war in der heutigen Zeit gar nicht so selten, wie man dachte.
Für die Leiche dieses Verstorbenen hatte die Person hinter ihm eine Feuerbestattung bestellt und auch den entsprechenden Baum für die Urnenbeisetzung ausgewählt. Bis zu dem kleinen Loch im Waldboden, das einer seiner Mitarbeiter gestern Nachmittag am Fuße der alten Buche ausgehoben hatte, waren es nur noch wenige Schritte.
Der Bestatter blieb, nachdem sie die Öffnung erreicht hatten, in Respekt bekundender, leicht gebeugter Haltung stehen, ehe er die Urne an zwei Bändern in das Grab senkte. Er verneigte sich kurz, dann drehte er sich um und gab der Person hinter ihm die Hand. Wortlos wandte er sich ab und verließ langsam den Ort der Beisetzung. In einer Stunde würde die kleine Grube durch einen Mitarbeiter des Unternehmens wieder geschlossen werden. Eine unscheinbare Tafel an der Buche würde darauf hinweisen, dass hier die sterblichen Überreste eines gewissen Alexander Thannenberger bestattet waren. Die Tatsache, dass man den Toten in einer Justizvollzugsanstalt abgeholt hatte, war allerdings etwas von der üblichen Routine bei derartigen Bestattungen abgewichen.
Die Person trat vor und starrte eine ganze Weile mit brennenden Augen in das Erdloch. Ihr fiel es schwer, die aufkommenden Emotionen einigermaßen in den Griff zu bekommen. Schließlich gab sie sich einen Ruck, drehte sich um und verließ den Friedhof. In ihrem Herzen herrschte abgrundtiefe Trauer, die als Nährboden für den abgrundtiefen Hass diente, den die Person empfand. Ein paar Tage der Trauer würde sie sich erlauben, dann hatte sie ein Vermächtnis zu erfüllen.
4
Seit Simon Kerner zum Direktor des Amtsgerichts Gemünden am Main ernannt worden war, nahm er sich an einem Tag in der Woche nachmittags Akten mit nach Hause, um dort zu arbeiten. Dabei wählte er Tage, an denen er keine Strafsitzungen leiten musste und seine Abwesenheit vom Büro vertretbar war. An diesen Tagen zog er es vor, im angenehmen Ambiente seiner Jagdhütte zu arbeiten. Hier in der freien Natur war das Studium der Unterlagen fast schon erholsam. Zuvor fuhr er jedoch nach Lohr in ein Studio für Kampfsport, um sich körperlich fit zu halten. Danach erst setzte er sich vor die Jagdhütte und arbeitete. Kurz bevor die Dämmerung hereinbrach, vertauschte er dann das Diktiergerät mit dem Jagdgewehr und ging auf die Pirsch.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!