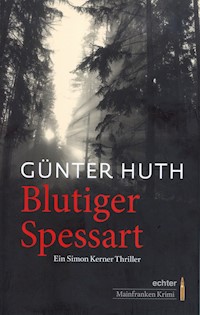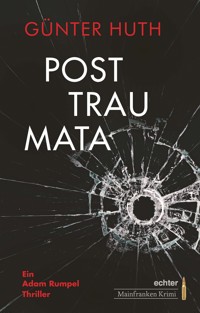Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Würzburger Ringpark entdeckt Erich Rottmann die Leiche eines Radfahrers. Er wurde offen-sichtlich ermordet. Seltsame Verletzungen geben Florian Deichler, Leiter der Mordkommission und Rottmann, Rätsel auf. Alarmierend: Es ist bereits die zweite Leiche mit derartigen Spuren. Hintergrund: Seit Wochen wird die Stadt von einer Bande Radfahrer terrorisiert. Rücksichtslos bret-tern sie in der Dunkelheit mit unbeleuchteten Hochleistungsbikes über die Gehsteige, Radwege und Straßen der Mainmetropole. Die Meldungen von Unfällen und sogar sexuellen Übergriffen häufen sich. Die Stadtregierung wiegelt zunächst einmal ab, da ja prinzipiell das Radfahren massiv geför-dert werden soll. Erich Rottmann wird persönlich betroffen, als er eines Abends mit Öchsle und Schöpple, Elviras jungem Hund, im Ringpark Gassi geht. Plötzlich rast aus dem Nichts ein Radfah-rer heran, übersieht die dünne Leine mit der Rottmann Schöpple führt und fährt mit Karacho zwi-schen dem Hund und Rottmann hindurch. Dabei verfängt er sich, zerrt Schöpple ein Stück mit und rammt Rottmann in ein Gebüsch. Unerkannt flüchtet der Täter. Wütend beschließt Rottmann der Bande und der Tatenlosigkeit des Rathauses den Kampf anzusagen. Im Rahmen ihrer Ermittlungen stoßen Rottmann und Deichler auf eine finstere, bedrohliche Macht. Ein Rottmann-Krimi, der den Schlaf raubt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Huth
Der Schoppenfetzerund die Gottesanbeterin
Zur Erinnerung an Thomas Häußner
Die Handlung und die handelnden Personen dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ist nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig.
Foto: Christian Hörl
Der Autor:
Günter Huth wurde 1949 in Würzburg geboren und lebt seitdem in seiner Geburtsstadt. Er kann sich nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben. Er war Rechtspfleger (Fachjurist), ist verheiratet, hat drei Kinder und sieben Enkel.
Seit 1975 schreibt er in erster Linie Kinder- und Jugendbücher, Sachbücher aus dem Hunde- und Jagdbereich (ca. 60 Bücher). Außerdem hat er bisher Hunderte Kurzerzählungen veröffentlicht. In den letzten Jahren hat er sich vermehrt dem Genre Krimi zugewandt. 2003 kam ihm die Idee für einen Würzburger Regionalkrimi. „Der Schoppenfetzer“ war geboren, der heute bereits mit dem einundzwanzigsten Band vorliegt.
2013 erschien sein Mainfrankenthriller „Blutiger „Spessart“, mit dem er die Simon-Kerner-Reihe eröffnete, mit der er eine völlig neue Facette seines Schaffens als Kriminalautor zeigt. Durch den Erfolg des ersten Bandes ermutigt, brachte er 2014 mit dem Titel „Das letzte Schwurgericht“ den zweiten Band, 2015 mit „Todwald“ den dritten Band, 2016 mit „Die Spur des Wolfes“ den vierten Band, 2017 mit „Spessartblues“ den fünften Band und mit „Jenseits des Spessarts“ den sechsten Band dieser Reihe auf den Markt. 2021 entwickelte er die Idee für eine weitere Frankenthriller-Reihe um den ehemaligen SEK-Scharfschützen Adam Rumpel. Erscheinungstermin des ersten Bandes, POSTTRAUMATA, war Frühsommer 2023.
Der Autor ist Mitglied der Kriminalschriftstellervereinigung „Das Syndikat“.
Günter Huth
Der Schoppenfetzerund die Gottesanbeterin
Würzburger Regional-Krimi
Der einundzwanzigste Fall desWeingenießers Erich Rottmann
Der Umwelt zuliebe verzichten wir bei diesem Buch auf die Folienverpackung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Günter Huth
Der Schoppenfetzer und die Gottesanbeterin
© Echter Verlag, Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Konzept Peter Hellmund
Ausführung: Tobias Klose, Würzburg
Innenteil: satzgrafik Susanne Dalley, Aachen
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
1. Auflage 2023
ISBN 978-3-429-05885-2
ISBN 978-3-429-05276-8 (PDF)
ISBN 978-3-429-06619-2 (ePub)
www.echter.de
Inhalt
Prolog
Nächtlicher Schock
Vor einigen Wochen
Konspiratives Treffen
Eine Woche später
Erschreckender Fund
Ein seltsamer Patient
Am Morgen nach dem Entführungsversuch
In der Hitze derselben Nacht
Stunden zuvor
Epilog
Prolog
Der Ringpark der unterfränkischen Mainmetropole lag jetzt, kurz vor Mitternacht, in tiefer Finsternis. Durch das dichte Blätterdach der alten Bäume drang kaum das Licht des abnehmenden Mondes. Stille herrschte in der menschenleeren Parkanlage gegenüber dem alten Justizgebäude. Nur gelegentlich drang das Motorengeräusch eines einzelnen Autos auf dem nahen Friedrich-Ebert-Ring durch die Nacht. Hin und wieder vernahm man das verschlafene Rufen eines Vogels, der durch irgendetwas gestört worden war. Die Hitze des Tages hatte sich zu dieser Stunde in eine erträgliche Wärme verwandelt.
Da näherte sich auf der vor kurzem innerhalb des Parks neu eingerichteten Schnellfahrtrasse aus Richtung Klein-Nizza langsam ein einzelnes Fahrradlicht. Ein Stück dahinter tauchte ein weiterer Scheinwerfer auf, der zügig zu dem ersten aufholte. Eine Minute später befanden sich beide Lichter auf gleicher Höhe. Eine wütende heisere Stimme brüllte etwas Unverständliches. Unmittelbar darauf gellte ein spitzer, schmerzerfüllter Schrei durch die Nacht, begleitet von metallischem Scheppern, Äste brachen. Eines der Lichter wirbelte durch die Dunkelheit und kam kurz darauf zum Stillstand. Das andere entfernte sich schnell. Ein unheilschwangeres Schweigen lastete über dem Ort.
Zurück blieb das einsame Licht einer Fahrradlampe am Boden. Der Strahl war nur wenige Meter weit zu sehen. Niemand hatte von dem Drama Kenntnis genommen – die Stadt schlief.
Das Licht in dem fensterlosen Raum war stark herabgedimmt. Das große Terrarium mit dem subtropischen Biotop dominierte die Mitte des Zimmers. Ein stark gebündelter Lichtstrahl aus einer der oberen Ecken des Glasbehältnisses fokussierte sich auf die Szene, in deren Mittelpunkt eine schmale, etwa zehn Zentimeter lange Kreatur saß, die einem Albtraum entsprungen zu sein schien. Regungslos verharrte sie auf einem Ast, mit dem sie fast völlig verschmolz. Ihre beiderseits des dreieckigen Kopfes befindlichen Augen ließen ihre Umgebung keine Sekunde unbeobachtet. So wartete sie seit geraumer Zeit. Sie war eine Jägerin und lauerte auf Beute. Zeit und Raum spielten für sie keine Rolle. Für sie gab es nur ein Ziel: Sie wollte töten! Töten, um zu fressen, weil sie sehr hungrig war! Die weibliche Fangschrecke trug eine große Anzahl reifer Eier in ihrem Körper, die befruchtet werden mussten.
Ihre feinen Sinne hatten das Männchen schon lange wahrgenommen. Mit ihren Pheromonen signalisierte sie ihm ihre Paarungsbereitschaft. Obwohl seine Instinkte es vor dieser Begegnung warnten, konnte es dieser Verlockung nicht widerstehen. Das Ziel seiner Begierde befand sich dicht vor ihm. Der Akt der Befruchtung würde für den Liebhaber ein ungemein gefährliches Unternehmen sein, auf das er sich einlassen musste, weil seine Natur ihn dazu zwang. Gefährlich, weil es für ihn das Risiko beinhaltete, getötet zu werden. Reglos verharrte er in geringer Entfernung auf einem anderen Zweig. Er erschien deutlich kleiner und zierlicher als das weibliche Insekt. Als der Trieb die Regie übernahm, ging alles schnell: Das Männchen war aus seiner angespannten Starre erwacht, näherte sich dem Weibchen zügig von hinten und bestieg es. Schnell verankerte es sich mit seinen Fangarmen auf ihrem Rücken. Sie duldete seine Annäherung mit angriffsbereit angespannten Vorderbeinen. Als der Akt sich dem Ende näherte, bereitete sich das Männchen darauf vor, sich blitzschnell zurückziehen. Seine einzige Chance, den Begattungsakt zu überleben, bestand darin, schneller zu sein als das Weibchen. Doch sie ließ ihm keine Chance! Während sich das Männchen von ihrem Körper lösen wollte, vollführte sie eine heftige Wendung, ihre Fangarme schnellten vor und packten es. Quer vor ihrem Kopf hielt sie es mit den Dornen ihrer Fangarme fest. Ein schneller, kräftiger Biss mit den scharfen Fresswerkzeugen an der richtigen Stelle und der Körper wurde in zwei Teile getrennt. Gierig begann sie ihren zur Beute gewordenen Liebhaber zu verschlingen. Sie folgte damit einem seit Urzeiten in ihren Genen angelegten Programm. Es stellte sicher, dass sie durch diese spezielle Nahrung besonders viele gesunde Eier legen konnte.
Ein Paar blaue menschliche Augen beobachtete konzentriert den Vorgang aus der Dunkelheit des Raumes heraus. Es verfolgte mit einer gewissen Ehrfurcht, wie die Gottesanbeterin mit bemerkenswerter Geschwindigkeit das Männchen auffraß. Anschließend zog sich die Fangschrecke mit getragenen Bewegungen in den dichten Pflanzenwuchs des geräumigen Terrariums zurück. Dort erstarrte sie wieder in der für sie typischen Haltung mit angelegten Fangarmen und wurde wieder eins mit der Umgebung.
Diesen wie zum Gebet angewinkelten Armen verdankte sie ihren Namen: Gottesanbeterin. Der Ursprung der lateinischen Bezeichnung Mantis religiosa entstammt dem Griechischen und bedeutet Seherin. Nicht mehr lange und diese Riesen-Mantis, die eine ganze Handspanne maß, würde eine Art Kokon, ein Eierpaket mit bis zu zweihundert Eiern, an der Unterseite eines der Blätter im Terrarium festkleben. In diesem widerstandsfähigen Behältnis waren die Eier gut geschützt, bis nach etwa vierzig Tagen die jungen Fangschrecken schlüpfen würden.
Mit einem knackenden Geräusch wurde der Scheinwerfer von der anwesenden Person ausgeschaltet und das Terrarium fiel in völlige Dunkelheit. Lediglich die kleine rote Kontrollleuchte an dem Gerät in der Ecke des gläsernen Behälters, durch das die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in der künstlichen Umgebung überwacht und auf konstanten Werten gehalten wurden, wirkte in der Finsternis wie ein glühendes Auge. Man hörte das metallische Geräusch eines Türschlosses und ein helles Rechteck fiel durch die geöffnete Tür auf den Boden. Die Person verließ den Raum hinaus in die Helligkeit. Die Tür fiel ins Schloss. Zurück blieben Dämmerung … und ein exotischer Duft nach Sandelholz, der vom Rauch eines in der Ecke schwelenden Räucherstäbchens ausging und den gesamten Raum sanft einhüllte.
Nächtlicher Schock
Wenn Erich Rottmann ein luftiges kariertes Funktionshemd auswählte, täglich seine durchgeschwitzte Feinrippunterhose wechselte und anstatt seiner geliebten Breitcordhose eine aus leichtem Stoff bestehende Kniebundversion trug, musste man das als eindeutiges Zeichen dafür werten, dass die Klimaveränderung mit Saharatemperaturen in Unterfranken angekommen war. Seine Haferlschuhe ersetzte er durch Sandalen ohne Socken und auch auf seine geliebte Lodenjoppe verzichtete er schweren Herzens, aber nur bei Höchsttemperaturen. Zum Glück besaß die Hose eine Beintasche, in der er seine Bruyère nebst Tabak und Pfeifenstopfer unterbringen konnte.
Kurz nach Mitternacht schleppte sich der Schoppenfetzer mit seinem Mischlingsrüden Öchsle und Schöpple, Elviras Welpen, durch den düsteren Ringpark. Vor einer Viertelstunde hatte sich der Stammtisch für heute aufgelöst. Ein deutliches Zeichen für die hitzebedingte Beeinträchtigung der Schoppenbrüder war die Tatsache, dass alle etwas verschämt zum Schoppen eine Flasche Wasser bestellten. Der Flüssigkeitshaushalt konnte mit Wein allein einfach nicht mehr reguliert werden!
Elvira Stark hatte Rottmann gebeten, heute auf Schöpple aufzupassen, weil sie am Abend ein Treffen mit einem Dr. Grassmüller hatte. Der Mann war Rottmann gänzlich unbekannt, schien aber in der Stadt ein soziales Projekt zu betreiben, für das sich Elvira in ihrem Rentnerdasein gerne engagieren wollte.
Bei dieser Besprechung hätte der junge, lebhafte Schöpple doch etwas gestört. Rottmann nahm ihn gerne in seine Obhut, da ihn der kleine Welpe mit seinem fröhlichen Wesen sehr an Öchsle in seinen jungen Jahren erinnerte. Kein Wunder, schließlich war Öchsle sein Erzeuger. In Gedanken versunken ging Rottmann durch den nächtlichen Park, während Vater und Sohn Hund durch die Büsche streiften. Wegen ihres dunklen Fells waren die beiden in der Nacht praktisch unsichtbar. Nur hin und wieder hörte man das Rascheln von Blättern und das Knacken dürrer Äste, wenn sie durch die Botanik sprangen. Der Schoppenfetzer bewegte sich dabei mit dampfender Pfeife quer über die ausgedörrte Rasenfläche, parallel zu der vor einiger Zeit von der Stadt mit viel Medienrummel eröffneten Schnellfahrtrasse für Fahrräder aller Art. Dies war wieder einmal ein seiner Meinung nach ziemlich hirnrissiges Projekt grüner Verkehrslenkungspolitik. Während er so durch das dürre Gras schlurfte, drang ein merkwürdiges Geräusch an sein Ohr. Rottmann blieb stehen, legte den Kopf schief und lauschte. Es klang wie Ächzen und Wimmern. Hatte sich einer der Hunde verletzt? Erich beschleunigte und eilte in die Richtung, aus der die Laute kamen, einer Ansammlung von Büschen in der Nähe der Kreuzung Ottostraße/Sanderring. Da hörte er auch schon das tiefe Bellen von Öchsle, in das Schöpple mit seiner hohen Welpenstimme sehr bemüht einfiel.
„Bestimmt eine freilaufende Katze!“, grantelte Rottmann. Es wäre nicht das erste Mal, dass Öchsle einem Stubentiger hinterherjagte. „Da bringt er dem Kleinen gleich diese Unart bei!“ Leise vor sich hin brummelnd, näherte er sich mit erhöhter Geschwindigkeit dem Geschehen, was bei der hohen Umgebungstemperatur einen verstärkten Schweißausbruch zur Folge hatte. Schließlich erreichte er die beiden Vierbeiner, die neben der Schnelltrasse in einem Gebüsch etwas verbellten. Im Gras entdeckte er einen Lichtschein.
„Jetzt gebt aber mal Ruhe!“, kommandierte der Schoppenfetzer, dabei trat er näher, um nachzusehen, was die beiden so aufregte. Das Fahrradlicht zeigte ihm die Richtung. Zuerst konnte er eines dieser modernen Lastenfahrräder erkennen, das am Rande des Gebüsches auf der Seite lag. Beim zweiten Hinsehen entdeckte er zu seinem Erstaunen ein menschliches Bein, das teilweise unter dem Kasten des Rads hervorschaute. Das sah ganz nach einem Unfall aus!
„Aus jetzt …!“, befahl er, nun deutlich strenger, weil Öchsle und Schöpple noch immer herumkläfften. Nachdem er die Zweige geteilt hatte, konnte er Einzelheiten erkennen. Von den Büschen verdeckt, teilweise unter dem Rad eingeklemmt, lag da eine junge Frau. Sie trug keinen Fahrradhelm und man konnte ihre blutige linke Gesichtshälfte erkennen.
„Hallo …“, unternahm Rottmann einen Versuch, sie anzusprechen, „hallo, können Sie mich hören?“ Keine Reaktion. Sie war offensichtlich ohne Bewusstsein. „Zurück mit euch!“ Er drängte die mittlerweile verstummten Hunde weg, die sich neugierig genähert hatten, und befreite sich von der Umklammerung der Zweige. Dann griff er zu seinem Mobiltelefon und wählte die Notrufnummer. Er teilte der Einsatzzentrale seinen Standort mit, dann kroch er erneut zu der Verletzten. Vorsichtig zog er das schwere Fahrrad etwas zur Seite, um die Frau zu entlasten. Er löste die festgeklippte, batteriebetriebene Fahrradlampe. Damit konnte er den Fundort besser ausleuchten. Die Frau hatte eine stark blutende Kopfverletzung. Neben ihrem Kopf lag ein blutiger Stein, auf den sie wohl aufgeprallt war. Als er sich wieder über sie beugte, gab sie ein Stöhnen von sich. Mühsam versuchte sie die Augen zu öffnen.
„Hallo … hallo … ich bin Erich“, sagte er leise. „Ich habe Sie gefunden. Bleiben Sie ganz ruhig liegen, Sie sind verletzt. Sie sind anscheinend mit dem Fahrrad gestürzt und haben sich am Kopf gestoßen. Ich habe bereits den Notarzt gerufen. Hilfe wird schnell hier sein. – Haben Sie starke Schmerzen?“
Die letzte Frage war eher rhetorischer Natur und Rottmann erwartete eigentlich keine Antwort. Er fasste nach ihrer Hand und hielt sie zur Beruhigung. – Langsam wurde sie klarer.
„Mein … Kopf …“, klagte sie leise, „… er tut so weh!“
„Das wird schon wieder“, entgegnete Rottmann sanft und tätschelte ihr die Hand.
„Plötzlich … plötzlich war da … ein schwarzer Schatten …“, stieß sie erregt hervor. Ihre Stimme wurde lauter. „Ich bin auf dem Radweg gefahren …“ Sie machte eine Pause. „Dann bekam ich einen harten Tritt in die Seite … ich kam ins Trudeln, dann flog ich in die Büsche … dann weiß ich nichts mehr.“ Sie verstummte.
„Regen Sie sich bitte nicht auf, gleich ist Hilfe da.“ Erich Rottmann wurde schlagartig klar, dass es sich hier nicht um einen bloßen Unfall handelte. Die junge Frau war einem bewussten Angriff ausgesetzt gewesen! Das änderte die Lage, denn das war ein Fall für die Polizei. Eine Minute später hörte er näherkommende Sirenen. Der Schein der Fahrradlampe diente den Rettern als Orientierung auf dem Weg zu der Verletzten. Während sich der Notarzt um die junge Frau kümmerte, griff Rottmann abermals zum Handy und rief die Einsatzzentrale der Polizei an. Er schilderte kurz den Tatbestand, dann bat er um Eile, weil bereits der Notarzt vor Ort sei. Anscheinend war eine Streife in unmittelbarer Nähe der Ottostraße unterwegs gewesen, denn nur wenige Minuten später näherte sich erneut ein Martinshorn. Die Sanitäter schnallten die Verletzte auf eine Trage, als zwei uniformierte Beamte herbeieilten. Rottmann stellte sich vor und erläuterte den Polizisten kurz den Sachverhalt. Öchsle lag in Rottmanns Nähe und beobachtete die Szene. Schöpple war vor dem Eintreffen der Rettung sicherheitshalber von Rottmann angeleint worden. Die Verletzte war noch immer ansprechbar, so konnte einer der Polizisten ihre Personalien aufnehmen, während der andere mit einem Fotoapparat Aufnahmen von der Fundstelle machte. Als die Retter in Richtung Krankenhaus davonfuhren, gesellte sich einer der Polizisten zu Rottmann und nahm auch dessen Personalien auf, dann ließ er sich von ihm den Sachverhalt schildern.
„Was geschieht jetzt mit dem Fahrrad?“, wollte Rottmann im Anschluss wissen.
„Wir sagen dem Kriminaltechnischen Dienst sofort Bescheid, dass sie es gleich abholen sollen. Schließlich ist es ein Beweisstück – und von Ihnen brauchen wir dann morgen auf der Dienststelle eine Aussage.“
„Geht klar“, gab Rottmann zurück und nahm die Visitenkarte des Beamten entgegen. Der steckte sein Notizbuch ein, dann seufzte er: „Sie werden es nicht glauben, aber das ist in diesem Monat bereits der zweite Vorfall, bei dem Radfahrer von Unbekannten attackiert wurden. Das alles, seitdem die Stadt diese Rennstrecke für Radfahrer eingerichtet hat. Anscheinend ist das für einige Fahrrad-Rowdys jetzt ein Freibrief, andere Verkehrsteilnehmer zu belästigen. Ich könnte mir vorstellen, dass uns das noch einigen Ärger bereiten wird.“ Er grüßte, dann begab er sich wieder zu seinem Kollegen.
Rottmann sah zu, wie die beiden Beamten das Lastenrad ein Stück an den Wegrand zogen, damit man es besser sehen konnte. Wenig später setzten sie sich wieder in ihren Streifenwagen und fuhren davon. Ihre Nachtschicht war noch lange nicht vorüber.
Langsam, noch immer gefangen von den Geschehnissen, ging Erich Rottmann mit seinen beiden vierbeinigen Begleitern nach Hause. Schöpple würde heute Nacht bei ihm übernachten. Elvira schlief in ihrer Wohnung einige Stockwerke höher mit Sicherheit schon tief und fest. Dem Welpen stand in Rottmanns Wohnung ja auch ein Körbchen zur Verfügung. Der Schoppenfetzer stellte den beiden Hunden ihr Futter hin und füllte den Wassernapf mit frischem Wasser. Letztlich riss er vor dem Schlafengehen alle Fenster auf und lüftete gründlich durch. Wenig später gab er gleichmäßige Schnarchgeräusche von sich.
Vor einigen Wochen
Der Würzburger Kessel und seine Bewohner stöhnten einmal mehr unter einer drückenden Hitzeglocke. Das Thermometer bewegte sich schon seit Tagen gnadenlos auf die 40-Grad-Marke zu. Über Nordbayern lag ein stabiles Hochdruckgebiet, das kaum von der Stelle kam. Das gesamte Maintal dürstete schon seit Wochen nach Regen. Die sonst so lebenspendenden Fluten des Mains glichen bei niedrigem Wasserstand einer braungrauen, träge dahinfließenden Brühe. Der Fluss stand kurz vor dem Umkippen. Die Mauern der Häuser heizten sich massiv auf und fanden auch in der Nacht nur geringe Abkühlung. Der Asphalt warf Blasen und blieb an den Schuhsohlen haften. Selbst den größten Klimaleugnern kam in stillen, schweißtriefenden Minuten der Gedanke, dass an den globalen Klimaveränderungen etwas Wahres dran sein könnte.
Im Rathaus unterlag die Leistungsfähigkeit der ansonsten stets hochmotivierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung im Tagesverlauf einem exponentiellen Sinkflug. Der Personalrat gab die besorgte Empfehlung aus, sich bei der Arbeit nicht zu sehr zu erhitzen, um die Temperatur in den Büros nicht in gesundheitsschädliche Höhen steigen zu lassen. Das Regierungstriumvirat, bestehend aus dem Oberbürgermeister, dem zweiten Bürgermeister und der dritten Bürgermeisterin, konnte sich derartige Leistungsverluste nicht erlauben, schließlich hatten sie eine Metropole zu regieren. Der Kämmerer erhielt daher als Ergebnis eines kleinen Gipfels dieser drei Leistungsträger den Auftrag, drei Fußwannen anzuschaffen, mit deren Hilfe die Regierenden diskret unter dem Schreibtisch ihre Füße abkühlen konnten, um dadurch die Körpertemperatur von „fast Fieber“ auf „leicht erhöhte Temperatur“ zu senken. Als die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen davon Kenntnis erlangten, regten sie in der Kämmerei in seltener Einigkeit ebenfalls eine Sammelbestellung von Fußwannen an. Sie versprachen sich davon, die Leistungsfähigkeit der Rätinnen und Räte während der in der Hitzeperiode grundsätzlich nach Sonnenuntergang stattfindenden Sitzungen zumindest rudimentär zu erhalten. Äußerst problematisch gestaltete sich dabei die Farbgebung der Wannen, weil sich natürlich jede Partei mit ihrer spezifischen Farbe wiederfinden wollte. Schwierig war es beispielsweise, die Farbe Blau zu bekommen, weil offenbar damit schon viele andere Käufer baden gegangen waren.
Die beiden hochqualifizierten Mitarbeiterinnen der Kämmerei lösten das Problem, indem sie nach längerer interner Beratung kurz entschlossen Wannen in reinem Weiß bestellten, da diese im Handel am günstigsten waren. Einwände von Betroffenen dagegen wischten sie vom Tisch mit der Begründung, Weiß sei die Farbe der Unschuld. Wobei sie sich nicht dazu äußerten, wie ihrer Meinung nach die Arbeit des Stadtrats mit diesem Begriff in Einklang zu bringen sei. Wasser und Handtuch mussten die Räte selbst mitbringen. Dem eigens geschaffenen Amt des Wannenwarts und seinen drei Helferinnen und Helfern oblag es, nach den Sitzungen für die Entsorgung der kontaminierten Flüssigkeiten zu sorgen. Diese übernahm erstaunlicherweise freiwillig der Reinigungsdienst des Hauses. Des Rätsels Lösung? Die findigen Reinigungskräfte hatten herausgefunden, dass das gebrauchte Kühlwasser einen gewissen Prozentsatz Sulfite enthielt, die über die schwitzenden Füße der mit Frankenwein gestärkten Rätinnen und Räte ausgeschwemmt wurden. Wegen der darin enthaltenen antioxidativen und antimikrobiellen Schwefelbestandteile war dieses Abwasser im ganzen Haus hervorragend als wirksamer Bodenreiniger einsetzbar.
Wie immer und überall in der Politik gibt es auch im kommunalpolitischen Raum Kräfte, die nur darauf lauern, dass beim jeweiligen politischen Gegner Schwächen auftreten, die man für die Durchsetzung eigener Ziele nutzen kann. Schon seit geraumer Zeit ging der Oberbürgermeister der Stadt Würzburg mit dem Wunsch schwanger, seine Stadt zur ersten völlig autofreien Kommune Bayerns auszugestalten. Insgeheim hoffte er, die Grünen für sein Bestreben zu gewinnen, doch bisher schreckte die Mehrheit der Vertreter dieser Partei davor zurück, einen entsprechenden Antrag im Rat einzubringen. Sie befürchteten, die rebellischen Bürger Würzburgs könnten sie erneut mit einem Bürgerbegehren konfrontieren. Noch einmal wollten sie eine solche Schlappe nicht riskieren! Aber nicht nur Butter schmilzt in der Sonne – auch der Wille politisch Verantwortlicher erfuhr in der Hitze des Klimawandels eine deutliche Schwächung. Daher sah der OB die Chance gekommen, das Wagnis einzugehen, einen entsprechenden Antrag ins Bürgerparlament einzubringen. Es ist den Damen und Herren im Ratssaal sicher nachzusehen, dass sie in diesem Tropenklima, das ihnen den Schweiß aus den Poren trieb und die Saugfähigkeit getragener Baumwollbekleidung bis an die Grenzen der Belastbarkeit ausreizte, anstehende schwierige Entscheidungen gerne einmal vertagten. Doch das Stadtoberhaupt blieb hartnäckig, und so landete folgender Antrag auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung:
„Der Stadtrat möge beschließen, dass im gesamten Ringpark, beginnend an der Friedensbrücke, vorbei am Bahnhof, unterbrochen durch den Berliner Ring, am Hauptfriedhof vorbei und das Klein-Nizza querend, bis hin zur Auffahrt Löwenbrücke eine befestigte, für den Gegenverkehr zweispurig befahrbare, zentrale Schnellfahrtrasse für Fahrräder jeglicher Bauart, mit und ohne elektrische Unterstützung, einzurichten sei. Alle anderen Wege im Ringpark, mit Ausnahme der Zu- und Abfahrten der Schnelltrasse, sind in der Konsequenz für den gesamten Fahrradverkehr zu sperren und ausschließlich den Fußgängern vorzubehalten.
Begründung:
Damit soll einerseits das herrschende wilde Radfahren in den gesamten Grünanlagen unterbunden und sollen andererseits die Radfahrer in die Lage versetzt werden, zügig diese Verbindung zu nutzen, um wichtige Punkte der Stadt ohne Beeinträchtigung durch Fußgänger oder Autos zu erreichen. Insgesamt soll sich durch diese Maßnahme der Autoverkehr in der Stadt deutlich reduzieren. Vor einer endgültigen Regelung ist für drei Monate eine Pilotphase vorzuschalten.“
Irgendwie landete dieser Antrag an letzter Stelle der Tagesordnung der nächsten Sitzung – ein Schelm, wer Böses dabei denkt – und kam auch prompt erst zum Aufruf, als schon die meisten der noch körperlich anwesenden Mitglieder des Stadtrats völlig erschöpft in ihren Sitzen hingen und kaum noch zu intellektuellen Leistungen fähig waren. Das Wasser in den Fußwannen hatte mittlerweile Körpertemperatur angenommen und brachte keinerlei Erfrischung mehr. Wen wundert es da, dass eine Aussprache über den Antrag nicht mehr gewünscht wurde? So rutschte der Antrag durch die neurologischen Filter der Anwesenden. Ihm wurde zu später Stunde von den noch wachen Ratsmitgliedern mehrheitlich stattgegeben. Gegenstimmen und Enthaltungen gab es keine, da niemand mehr die Energie aufbrachte, hierfür seine Hand zu heben. Bei einer neutralen, durch Hitze unbeeinträchtigten Betrachtungsweise wäre dies eine Entscheidung gewesen, die hochbrisanten gesellschaftlichen Sprengstoff enthielt!
Schon am nächsten Tag leisteten die Buschtrommeln in Würzburg ganze Arbeit und verbreiteten die Nachricht in allen Bevölkerungsschichten. Tage danach, als diese Ratsentscheidung bereits in Presse, Rundfunk und Fernsehen Einzug gehalten hatte, erwachten einzelne Ratsmitglieder und es regnete heftige Dementis. In Interviews erklärten sie, sie seien bei dieser ominösen Sitzung, soweit sie sich erinnern könnten, gar nicht anwesend gewesen, sonst wäre dieser verrückte Antrag natürlich niemals durchgegangen! Jetzt war diese Entscheidung in der Welt und man musste damit umgehen. Die Damen und Herren Stadträte konnten ja schlecht zugeben, dass sie von gewissen Kräften richtiggehend über den Ratstisch gezogen worden waren. So erlangte diese Entscheidung Rechtskraft und wurde an das städtische Tiefbauamt mit der Bitte um baldige Erledigung weitergeleitet.
Der Leiter dieser Behörde nahm den Auftrag am nächsten Tag kopfschüttelnd zur Kenntnis. Hatte die Hitze den Herrschaften bzw. Frauschaften völlig das Hirn weichgekocht? Hatten die eine Ahnung, welche Mengen von Material da aufgeschüttet werden mussten, um eine ordnungsgemäße, stabile Trasse herzustellen? Von den horrenden Kosten gar nicht zu sprechen! War das überhaupt mit dem Kämmerer abgesprochen, der ja die Haushaltsmittel hierfür bereitstellen musste? Letzterer hatte sich vor der betreffenden Ratssitzung zwei Wochen Urlaub genommen und lag zwecks Abkühlung zuhause unter dem Frischwasserzulauf eines Beckens der familieneigenen Fischzuchtanstalt, wo er, von jungen Zandern umschwärmt, ein Karibikgefühl entwickelte. Telefonisch war er leider nicht zu erreichen. Der Leiter des Tiefbauamtes beschloss, in der Probephase erst mal nur ein paar kostengünstige Schilder aufzustellen.
Konspiratives Treffen
Während die Bürger der Mainmetropole in den Häusern schwitzten, Klimageräte das Stromnetz an die Grenzen der Belastbarkeit brachten und schwüle Gedanken allenthalben durch die Köpfe geisterten, aber kaum zur physischen Verwirklichung reiften, gab es in einem Gartenhaus in der Kleingartenanlage Hubland in der Nähe der Uni eine Zusammenkunft. Die Hütte und der Kleingarten waren vom Großvater einer der Anwesenden gepachtet, der das Areal so gut wie nie benutzte. Die Einrichtung war rustikal, stark abgenutzt, aber irgendwie gemütlich. Um einen massiven Holztisch standen einige Holzstühle, auf denen sich mehrere Personen lümmelten. Eine Handvoll junger Männer und eine Frau, alle zwischen zwanzig und dreißig einzuordnen, trafen sich hier regelmäßig in ihrer Freizeit, um zu feiern. Die Nachbarn waren sehr angetan von den höflichen jungen Leuten, an deren Verhalten es nichts auszusetzen gab. Die Kleingärtner wussten natürlich nicht, dass alle zur Gang der Buffalo Bikers gehörten, die in Würzburg schon häufiger durch aggressives Verhalten gegenüber Bürgern in Erscheinung getreten waren. Diese Hütte hier hatten sie als ihren Treffpunkt, ihren sicheren Rückzugsort auserkoren. Hier gaben sie sich als harmlose Gruppe, als Wölfe im Schafspelz! Heute Abend trafen sie sich, um die revolutionäre Entscheidung des Stadtrats zu feiern, die es ihnen endlich ermöglichte, ihren Hang zur exzessiven Nutzung ihrer Hochleistungs-E-Bikes innerhalb des Ringparks auszuleben. Beleuchtet wurde die Szene von zwei fauchenden Gaslampen, die an angerosteten Ketten von der Decke hingen. In Griffweite stand ein Kasten Bier. Eine ganze Reihe geleerter Flaschen auf der Tischplatte zeugte davon, dass die Biker bereits seit einiger Zeit zusammensaßen. In der Mitte des Tisches stand eine Shisha, deren Tabakkopf mit Rotem Libanesen, einer milderen Haschischsorte, gestopft war. Drei der Anwesenden zogen an den Schläuchen und stießen den Rauch durch die Nase aus. Aus einem Digitalradio dröhnte die harte Musik von Rammstein. Um die Nachbarn mussten sie sich keine Sorgen machen, da zu dieser Tageszeit niemand mehr in den Gärten war. Alle Biker waren sportlich durchtrainiert. Sie trugen lockere Sommerkleidung, da ihnen die schwarzen, zwar dünnen, aber eng anliegenden Lederoveralls, die sie beim Radfahren trugen, zu warm waren. Sie verwahrten sie hier in einem breiten Metallspind. Bevor sie zu ihren Fahrten durch Würzburg aufbrachen, zogen sie sich im Gartenhaus um. Auch ihre ärmellosen, mit silberfarbenen Nieten besetzten Jeanskutten hingen hier. Sie bildeten auf dem Rücken ein Emblem, das einen massigen Büffel mit ausladenden Hörnern zeigte, der seine Vorderhufe auf einen Fahrradlenker aufstützte. Darunter stand in gotischen Lettern: BUFFALO BIKERS. Schwarze Einsatzstiefel mit Metallbeschlägen, die sie in einem anderen Abteil des Spinds lagerten, vervollständigten die Kluft. Auf einer Bierbank, die an der Schmalseite des Raumes stand, lagen aufgereiht nebeneinander leichte schwarze Motorradhelme. Der Inhalt ihrer Gespräche wäre mit Sicherheit geeignet gewesen, den hitzegeplagten Verantwortlichen im Rathaus die Körpertemperatur bis in fiebrige Höhen zu treiben. Einer der jungen Männer mit Dreadlocks, der an der Schmalseite des Tisches saß, hob die Hand und ließ sie knallend auf die Tischplatte fallen, wodurch das Stimmengewirr schlagartig verstummte.
„Also Leute, ihr habt jetzt lange genug gequatscht. Sind wir uns einig, dass dieser Stadtratsbeschluss für uns im Prinzip eine Supersache ist?“ Er sah fragend in die Runde. „Jetzt werden natürlich die ganzen Spießer mit ihren Rädern dort herumgondeln, für uns kann von einer ungehemmten Fahrweise kaum mehr die Rede sein. Wir wollen schließlich richtig Gas geben! Ich denke, jetzt müssen wir diesen Tränen erst einmal zeigen, wo der Hammer hängt. Dann überlassen sie uns freiwillig das Feld!“
Dread, wie sie ihn nannten, musterte seine Kumpels mit durchdringendem Blick. Von allen Beteiligten kam mehr oder weniger hässliches Gelächter. Die einzige Frau am Tisch strich sich eine Strähne ihrer knallroten Haare aus dem Gesicht, dann bremste sie etwas den Enthusiasmus ihrer Kumpels: „Es kommt darauf an, wie groß der Hammer ausfallen soll. Wenn wir es übertreiben, haben wir schnell die Staatsmacht am Hals …“
Es erhob sich allgemeines Gemurmel.
„Nicki“, erklärte der Wortführer mit erhobener Hand, „so wie die Lage jetzt ist, müssen wir uns in der nächsten Zeit vermehrt mit irgendwelchen Schleichern herumschlagen. Familien, die mit ihrem Nachwuchs auf Kinderrädern herumgurken, Greise, die sich kaum noch auf dem Rad halten können, und Muttis, die ihre Brut in Transporträdern herumkarren. Das entlastet zwar die Innenstadt vom Autoverkehr, weil jetzt viele ihre Karre stehen lassen und über die Trasse radeln. Aber wir wollen ja die Schnelligkeit unserer Räder auf dieser Trasse ausreizen und nicht ständig abbremsen müssen!“
Die Teilnehmer der Runde verkündeten ihre Zustimmung, indem sie mit den Fäusten auf den Tisch trommelten.
„Also wenn ihr mich fragt“, fuhr Dread fort, „liegt es jetzt an uns, dafür zu sorgen, dass den Leuten die Benutzung ‚unserer Trasse‘ einfach keinen Spaß macht. Wenn es dort oft genug zu Unannehmlichkeiten kommt, spricht sich das schnell herum! Braucht sich doch nur mal eine Mutti bedrängt zu fühlen, wenn sie von einem von uns zu dicht überholt wird, dann …“ Den Rest ließ er offen, stattdessen stieß er ein meckerndes Lachen aus, in das fast alle einfielen.
Nickis Bedenken waren damit absolut nicht ausgeräumt. Sie war dieser Gang beigetreten, weil sie in erster Linie Spaß haben, nicht aber Gewalt ausüben wollte. In Ruhe mal einen Joint rauchen, sich mal alkoholisch die Kante geben, das war in Ordnung, aber keine Gewalttätigkeiten gegen harmlose Menschen. Erst wollte sie noch etwas gegen diese allgemeine Euphorie der Gang einwenden, unterließ es dann jedoch. Das hatte zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn, dazu waren die Jungs zu aufgedreht. Wenn ihr Vater wüsste, bei welchen Chaoten seine Tochter da mitmischte, wäre er bestimmt not amused. Sie durfte es nicht übertreiben!
Eine Woche später
Seit Erich Rottmanns Umzug in sein neues Domizil im Parterre der Rosengasse 25, nur ein Haus von seiner alten Wohnung entfernt, waren mittlerweile mehrere Monate vergangen. Die Probleme, die es ihm bereitet hatte, im selben Haus zu wohnen wie Elvira Stark – seine „gute Bekannte“, als die sie noch immer bei ihm firmierte –, waren mittlerweile auf ein Problemchen zusammengeschmolzen. Elvira hielt sich auch sehr zurück, um bei Erich nicht den Eindruck zu erwecken, sie würde ihm auf die Pelle rücken oder ihn gar überwachen wollen. Die Parterrewohnung hatte für Erich auch ihre Vorteile. Jetzt war er schon mit ein paar Schritten an der Haustür und auf der Straße. Früher musste er mehrmals am Tag die Stockwerke zu seiner alten Wohnung erklimmen, was besonders mit einigen Schoppen intus eine Herausforderung gewesen war. Am Stammtisch schilderte Rottmann diese Vorteile gerne und oft, wobei er darauf hinwies, dass sie in erster Linie Öchsle zugutekamen, der ja auch nicht mehr die jüngsten Knochen besaß. Dabei überging er geflissentlich, dass es auch ihm zunehmend schwer gefallen war, seinen silvanergeformten Modellkörper über die zahlreichen Treppen ins oberste Stockwerk zu wuchten. Die neue Wohnung verfügte über einen Raum mehr, alle Zimmer waren frisch getüncht und, das war besonders erfreulich, Elvira konnte ihn von ihrer Dachgeschosswohnung aus nicht mehr sehen, wenn er das Haus verließ – und ebenso, wenn er es wieder betrat. Lief er von der Haustür weg nach rechts, direkt an den Häusern entlang in Richtung Main, befand er sich stets im „toten Winkel“. Das bereitete ihm jedes Mal eine diebische Freude! Obwohl es, bei Lichte betrachtet, eigentlich ziemlich kindisch war, weil er ja kommen und gehen konnte, wann er wollte. Aber es vermittelte ihm ein gewisses Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit, beides Empfindungen, die er brauchte wie die Luft zum Atmen. Im Augenblick war Elvira allerdings nicht im Lande. Sie hatte sich gestern von Rottmann verabschiedet, weil sie in Dresden für drei Tage Freunde aus früherer Zeit besuchen wollte. Danach würde sie ihr soziales Engagement im Frauenhaus von Dr. Grassmüller aufnehmen, wie sie kürzlich mit dem Arzt vereinbart hatte. Während ihrer Abwesenheit war Schöpple bei Rottmann untergebracht, der natürlich gerne bereit war, Öchsles Sohn Asyl zu gewähren. Schöpple war die Frucht der Liebe. Weniger romantisch veranlagte Menschen würden vielleicht sagen: das Ergebnis eines Fehltritts zwischen Öchsle und einer Pudelhündin. Elvira verliebte sich sofort in einen der Welpen und holte ihn zu sich nach Hause. Insgeheim hoffte sie natürlich, Erich würde sie bei der Erziehung des kleinen Rackers unterstützen. Allerdings hatte sie dabei übersehen, dass Rottmann, was Hundeerziehung betraf, absolut unfähig war. Mit Öchsle hatte der Schoppenfetzer seinerzeit einen ausgesprochenen Glücksgriff getan. Der Rüde war von Anfang an ein völlig unkomplizierter Hund gewesen, der die Wünsche seines Herrchens stets erahnte und sich entsprechend verhielt. Im Augenblick stand Rottmann in seiner neuen Küche und betrachtete stirnrunzelnd einen kleinen braunen Haufen auf dem neuen Laminat, der vor einigen Minuten noch nicht vorhanden gewesen war. Eine strenge Duftnote erreichte Rottmanns Nase und verriet den Urheber. Der Verursacher dieser Hinterlassenschaft lag in seinem neuen Körbchen in der Ecke, hatte den Kopf auf die Vorderläufe gelegt und schaute mit treuherzigen Augen in die Landschaft. Ich war das nicht!, verkündete sein unschuldiger Blick.
„Mensch Öchsle, du könntest auf deinen Sohn wirklich besser aufpassen!“, schimpfte Rottmann vorwurfsvoll. Der Rüde, der in seinem eigenen Körbchen in einer anderen Ecke lag, atmete geräuschvoll ein, erhob sich, drehte sich um und verschwand.
„Und deine Unschuldsmiene nützt dir auch nichts!“, grollte Rottmann in Richtung des Welpen, der laut Elviras Zusicherung eigentlich stubenrein war. Eigentlich … Rottmann beförderte Schöpples Hinterlassenschaft in eine Plastiktüte, dann öffnete er die Wohnungstür und legte das Päckchen draußen ab. Er würde es beim nächsten Gassigehen mitnehmen und in einem öffentlichen Abfalleimer entsorgen. Anschließend putzte er den Boden mit einem Desinfektionsmittel. Er konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass sich Öchsle einmal in der Wohnung „vergessen“ hatte. Sehr schnell merkte der kleine Schöpple, dass sich das Gewitter verzogen hatte. Mit einem lustigen Luftsprung hüpfte er schwanzwedelnd aus seinem Körbchen und wuselte Rottmann zwischen den Beinen herum. Verspielt versuchte er, den Schoppenfetzer in die Waden zu kneifen.
„Ja, ja, kleiner Tunichtgut, ist ja schon gut! Wir werden jetzt erst mal Gassi gehen, damit nicht auch noch eine Pfütze dazukommt!“
Was Gassi gehen bedeutete, hatte Schöpple schon lange verinnerlicht, und so stellte er sich neben der Wohnungstür in Positur. Rottmann leinte ihn an, kurz darauf marschierten die drei durch die Rosengasse in Richtung Main. Rottmann war es ja nicht gewohnt, einen Hund an der Leine zu führen. Öchsle war auch ohne dieses Utensil immer brav neben ihm hergelaufen. Nun war nicht dran zu denken, während des Spaziergangs gemütlich seine Pfeife zu rauchen. Innerlich fluchte Rottmann, weil Elvira Schöpple noch nicht beigebracht