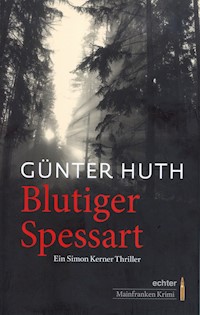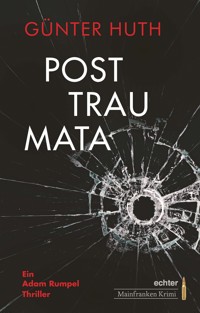Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Plötzlich verharrte Öchsle in der Nähe des riesigen Wurzelstocks, als wäre er gegen eine Mauer gelaufen, und gab ein tiefes Bellen von sich. Erich Rottmann hob verwundert den Kopf. Wenn sein vierbeiniger Freund so bellte, hatte er etwas Verdächtiges entdeckt. Wenig später stand der ehemalige Leiter der Würzburger Mordkommission am Rande des Erdlochs, in dem früher einmal die alte Eiche im Boden verankert gewesen war. Angestrengt spähte Rottmann hinunter in den Krater, um herauszufinden, was die Aufmerksamkeit seines Hundes geweckt hatte. Dann entdeckte er eine weißliche Stelle im Erdreich. War das etwa ein Gesicht? …« Und da war es wieder, das bekannte Kribbeln in der Nase, das Erich Rottmann immer dann verspürt, wenn sich ein neuer Kriminalfall ankündigt. Ein Fall, der ihn diesmal bedrohlich mit dem Reich des Übersinnlichen in Berührung bringen sollte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Huth
Der Schoppenfetzerund die blutrote Domina
Foto: Rico Neitzel – Büro 71a
Günter Huth wurde 1949 in Würzburg geboren und lebt seitdem in seiner Geburtsstadt. Er kann sich nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben.
Er ist Rechtspfleger (Fachjurist), verheiratet, drei Kinder.
Seit 1975 schreibt er in erster Linie Kinder- und Jugendbücher, Sachbücher aus dem Hunde- und Jagdbereich (ca. 60 Bücher). Außerdem hat er bisher Hunderte Kurzerzählungen veröffentlicht. In den letzten Jahren hat er sich vermehrt dem Genre Krimi zugewandt. 2003 kam ihm die Idee für einen Würzburger Regionalkrimi. „Der Schoppenfetzer“ war geboren.
2013 erschien sein Mainfrankenthriller „Blutiger Spessart“, mit dem er die Simon-Kerner-Reihe eröffnete, mit der er eine völlig neue Facette seines Schaffens als Kriminalautor zeigt. Durch den Erfolg des ersten Bandes ermutigt, brachte er 2014 mit dem Titel „Das letzte Schwurgericht“ den zweiten Band, 2015 mit „Todwald“ den dritten Band, 2016 mit „Die Spur des Wolfes“ den vierten Band und 2017 mit „Spessartblues“ den fünften Band dieser Reihe auf den Markt.
Der Autor ist Mitglied der Kriminalschriftstellervereinigung „Das Syndikat“.
Die Handlung und die handelden Personen dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lenbens ist nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig.
Günter Huth
Der Schoppenfetzerund dieblutrote Domina
Der elfte Fall des WürzburgerWeingenießers Erich Rottmann
BuchverlagPeter Hellmundim Echter Verlag
Günter Huth
Der Schoppenfetzer und die blutrote Domina
© Echter Verlag, Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Gestaltet von Peter Hellmund
Gedruckt und gebunden von Pressel, Remshalden
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
Dritte Auflage 2021
ISBN
978-3-429-05637-7
978-3-429-06533-1 (PDF)
978-3-429-05157-0 (ePub)
www.echter.de
Inhalt
WÜRZBURG ZUR ZEIT DER BAUERNKRIEGE
IN DIESEN TAGEN
WÜRZBURG ZUR ZEIT DER BAUERNKRIEGE
Die drei Männer, die sich an einem Maiabend des Jahres 1525 im schwachen Schein des Halbmondes zur mitternächtlichen Stunde vom Main her durch die Gassen von Würzburg bewegten, achteten sorgfältig darauf, keinen Lärm zu machen. Das war nicht sonderlich schwer, da aus der Ferne, vom jenseitigen Ufer des Mains, die Geräusche des Feldlagers der Belagerungstruppen der aufständischen Bauern zu hören waren. Eine Geräuschkulisse, die von tausenden von Stimmen, Trommeln und Pfeifen erzeugt wurde und die Schritte der drei Männer fast vollständig überdeckte.
Der beginnende Mai hatte der Stadt gerade einen Platzregen beschert. Der Boden war aufgeweicht und schlammig. Die Feuchtigkeit in der Nacht und der durch die Maisonne Tags zuvor aufgewärmte Boden ließen die Fäkalien und Abfälle, die in der ganzen Stadt neben den Wohnhäusern entsorgt wurden, einen penetranten Gestank entwickeln, der wie eine Glocke schwer über der Gasse hing. Die Männer waren diese Gerüche jedoch gewohnt und bemerkten sie nicht einmal.
Um Lautlosigkeit bemüht, hielten sie ihre Hiebwaffen fest, damit das Wehrgehänge kein verräterisches Klirren von sich gab. Ihre Sorge galt nicht der Obrigkeit der Stadt, da der Bürgermeister und die Stadträte im Grafeneckart, dem Würzburger Rathaus, auf ihrer Seite standen. Das Problem waren die zahlreichen Spitzel des Fürstbischofs, die überall lauern konnten und ihren Besuch in der Stadt sofort ihrem Herrn auf der Festung verraten und so ihre Pläne durchkreuzt hätten.
Einer der Männer, offenbar der Anführer, hob die Hand und gab ein warnendes Zischen von sich. Die beiden anderen blieben sofort stehen. Vorsichtig spähte der erste um eine Hausecke. Plötzlich raunte er: „Deckung!“
Sofort drückten sich seine beiden Kumpane, seinem Beispiel folgend, mit dem Rücken gegen die Hauswand, die Faust am Dolch.
Jetzt hörten auch sie schlurfende Schritte und ein unverständliches Brabbeln. Die drei hielten den Atem an. Einen Moment später kam ein Mann aus der Gasse, die sie gerade betreten wollten. Er hatte eindeutig zu viel getrunken, denn sein Gang war unsicher und leicht schwankend. Ohne auf seine Umgebung zu achten, stolperte er an den dreien vorbei. Unvermittelt ließ er einen kräftigen Furz fahren, den er mit einem Kichern quittierte.
„Wohl bekomm’s“, kommentierte einer der Männer flüsternd den Darmwind des Betrunkenen, was ihm einen Ellbogenstoß seines neben ihm stehenden Kumpans eintrug. Der späte Zecher war jedoch völlig versunken in seiner alkoholisierten Welt und torkelte weiter.
Der Anführer sicherte erneut um die Ecke in die Gressengasse. Diesmal war niemand mehr zu sehen. Ihr Ziel lag direkt vor ihnen. Trotzdem zögerte der Mann. Mit zusammengekniffenen Augen versuchte er das Zeichen zu erkennen.
„Er hängt“, gab er schließlich leise seinen Kumpanen bekannt. „Der Morgenstern ist draußen.“
Die drei atmeten auf. Ihr Informant hatte sich also nicht getäuscht, als er ihnen mitteilte, dass das Treffen der Anführer heute stattfinden würde.
Jetzt gab es kein Zögern mehr. Die drei verließen ihre Deckung und eilten zu einer Schänke, von der sie nur noch wenige Schritte trennten. Eine Minute später betraten sie den düsteren Schankraum, der nur durch einige heruntergebrannte Kerzen dürftig erhellt wurde.
„Ihr seid spät. Die anderen warten schon“, stellte der einzige Gast fest, der an einem Tisch saß und einen Humpen Wein vor sich stehen hatte. Der bärtige Mann trug die typische Kleidung eines Landsknechts: ein buntes Wams und eine mehrfarbige Pluderhose. Sein Katzbalger, das kurze Landsknechtsschwert, lag blank neben ihm auf dem Tisch. Auf der Klinge spiegelte sich schwach das Kerzenlicht.
Ohne auf die Begrüßung des Mannes einzugehen, befahl der Anführer der Dreiergruppe: „Ihr beiden bleibt hier bei ihm. Fangt mir aber keine Händel an!“
„Lasst euch nieder“, sagte der Bärtige mit einer einladenden Handbewegung. „Der Wein ist zwar sauer und schmeckt nach Pech, aber er ist billig und löscht den Durst.“ Er rief in den finsteren Teil der Gaststube: „Wirt, noch zwei Humpen für diese Männer!“
Aus dem Hintergrund tauchte eilfertig ein rundlicher, glatzköpfiger Mann auf und brachte zwei Humpen und einen Krug, aus dem er die Gefäße füllte.
„Lasst den Krug gleich hier“, sagte einer der Neuankömmlinge. „Das Warten macht durstig.“ Er drückte dem Wirt eine Münze in die Hand. „Sicher habt ihr auch noch etwas zum Beißen in eurer Küche. Tragt auf, wir haben Hunger.“ Mit fragendem Blick musterte er den Bärtigen. „Ihr esst doch mit uns?“
Mit Schwung warf er seinen breitkrempigen Hut auf einen Nebentisch und ließ sich nieder. Sein Gefährte folgte seinem Beispiel.
Die beiden waren erkennbar ebenfalls Landsknechte, ihre Kleidung war jedoch schwarz. Sie gehörten zum berüchtigten Schwarzen Haufen des Florian Geyer von Giebelstadt. Eine Art Elitetruppe, die der Edle aus eigenen Mitteln zusammengestellt hatte.
„Ihr seid Männer nach meinem Geschmack“, stellte der Bärtige fest, nahm das Schwert vom Tisch und ließ es in der Scheide an seinem Gürtel verschwinden.
Wenig später trug der Wirt ein Holzbrett mit kaltem Fleisch, einem halben Kapaun und Käse auf den Tisch. Daneben legte er einen Laib Brot. Die drei Männer ließen sich nicht lange bitten und begannen zu essen.
Als sie satt waren, zog einer Würfel aus der Tasche und sie begannen zu spielen.
Ein Stockwerk höher saß in einer geräumigen Stube der Hauptmann des Odenwälder Bauernhaufens, Götz von Berlichingen. Neben ihm warteten zwei weitere Männer. Man erkannte auf den ersten Blick, dass es keine Bauern oder Soldaten waren. Sie trugen die Kleidung der wohlhabenden Bürger und befanden sich hier in Wahrnehmung ihres Amtes als Stadträte. Der Abstand, den sie zwischen sich und Götz wahrten, sprach Bände. Der raubeinige Ritter flößte ihnen Respekt ein. Von Berlichingen hatte seinen Humpen anscheinend schon mehrmals geleert, denn sein Blick war schon etwas glasig.
Auch schockierte sie die angeschnallte eiserne Hand, die er auf den Tisch aufgelegt hatte. Es handelte sich um eine Prothese aus Metall, die ihm ein Kunstschmied nach dem Verlust seiner rechten Hand angefertigt hatte. Ein einschüchterndes Monstrum. Sein Schwert hatte er abgelegt, es stand in Reichweite gegen die Wand gelehnt.
„Geyer, Ihr kommt spät“, stellte er knapp zur Begrüßung fest und reichte ihm die Linke zum Gruß. Seine Stimme klang rau.
„Die Umstände haben mich aufgehalten“, erwiderte Florian Geyer und gab den beiden anderen Männern die Hand. Wolfhart Beierlein und Bonifaz Grätig waren Räte der Stadt, die als Abordnung des Stadtrats zur Lagebesprechung hinzugezogen worden waren. Der Hauptmann des Schwarzen Haufens zog sich einen der freien Stühle heran und ließ sich am Tisch nieder. Wortlos schob ihm der Einarmige einen Krug hin. Er schenkte sich einen Humpen voll und nahm einen kräftigen Schluck.
„Es gibt Neuigkeiten.“ Man konnte spüren, dass Wolfhart Beierlein eine bedeutsame Nachricht auf der Seele brannte und es ihn drängte, sie endlich loszuwerden.
Die besondere Betonung seiner Worte veranlasste die beiden Anführer, ihm in Erwartung einer wichtigen Botschaft ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken.
„Ihr hattet doch gestern dem Fürstbischof ein Ultimatum gestellt und ihn aufgefordert, binnen vier Tagen in Verhandlungen einzutreten.“ Beierlein sah die beiden Anführer an. Diese nickten zustimmend.
„Nun, das hat Wirkung gezeigt. Aber anders, als ihr dachtet. Der Fürstbischof hat sich, wie wir von unseren Verbindungsleuten hörten, heute Nacht abgesetzt und ist jetzt angeblich über Boxberg nach Heidelberg unterwegs.“
Die Nachricht traf die beiden Bauernführer unvorbereitet.
„Verdammt, dieser Feigling!“, stieß Götz hervor und schlug mit seiner Eisenhand auf den Tisch. Die Humpen wackelten und die Ratsherren zuckten zusammen.
„Wer ist jetzt noch oben auf dem Marienberg?“, wollte Florian Geyer wissen. Er hatte sich besser im Griff.
„Der Festungskommandant, Markgraf Friedrich von Brandenburg, verteidigt mit achtzehn gut ausgebildeten Rotten die Wälle. Unsere Informanten sprechen von ungefähr zweihundertvierzig Mann unter Waffen.“ Bonifaz Grätig runzelte ernst die Stirn. „Sie haben genügend Lebensmittel und Wasser und können eine Belagerung längere Zeit durchhalten. Außerdem verfügen sie über zahlreiche Kanonen und Feldschlangen. Die Wälle und Mauern über die steilen Weinbergshänge zu stürmen wäre daher blanker Selbstmord und ist praktisch unmöglich.“
„Die Belagerung kann nicht mehr viel länger aufrechterhalten werden“, stellte Florian Geyer fest. „Die Bauern sind ungeduldig und nicht sehr diszipliniert, sie wollen endlich die Festung stürmen. Aber es fehlt am nötigen Nachschub. Die Männer sind voller Wut und die Haufen marodieren allenthalben im ganzen Bistum. Es liegen noch große Bauerngruppen bei Höchberg und Heidingsfeld. Wenn der Zustrom so anhält, haben wir bald zwanzigtausend Mann für den Sturm vor der Festung liegen. Das Problem ist nur, dass wir noch keine mauerbrechenden Geschütze haben. Ohne die werden wir uns blutige Köpfe holen.“
„Wie viele Männer hat die Stadt unter Waffen?“, wollte Götz wissen.
„Einige Hundert werden es schon sein“, gab Beierlein vage zur Antwort. „Aber alles keine ausgebildeten Soldaten mit schlechter Bewaffnung.“
Götz gab ein schwer ergründbares Knurren von sich.
„Die Tauberbischofsheimer haben mir einige Kanonen und einen Geschützmeister versprochen“, berichtete Florian Geyer. „Ich weiß allerdings nicht, wann sie eintreffen. Bis dahin sollten wir versuchen, die Bauern stillzuhalten.“
„Die Bauern sind ungeduldig“, warf Götz von Berlichingen grollend ein. „Seit sie einige Erfolge gehabt haben, denken sie, es würde immer so weitergehen. Ich fürchte, der Fürstbischof wird mit Truppen wiederkommen.“
Die vier beschlossen, sich von nun an täglich hier unter dem Stachel, wie sie den Morgenstern nannten, zu treffen.
Die Räte, Götz von Berlichingen und sein Landsknecht gingen zurück ins Feldlager. Florian Geyer schickte seine beiden Männer ebenfalls zurück, er selbst blieb noch.
Er ließ sich vom Wirt einen weiteren Krug mit Wein und zwei Trinkbecher geben, dann ging er zu einem Zimmer im hinteren Teil, das er nach leisem Anklopfen betrat.
Eine billige Talgkerze erleuchtete mit rußender Flamme schwächlich den Raum, der nur mit einer einfachen Bettstatt, einem Schrank und einem Tisch mit zwei Hockern dürftig möbliert war.
Nachdem er die Tür geschlossen hatte, löste sich aus dem Schatten neben dem Schrank eine Gestalt, die wie ein Landsknecht gekleidet war.
„Du hast mich warten lassen“, sagte die Person mit einem leicht vorwurfsvollen Unterton in der Stimme. Sie griff nach dem breitkrempigen Hut, zog ihn vom Kopf und warf ihn auf den Tisch. Wie ein Wasserfall löste sich sofort eine Flut blutroter, langer Haare und fiel ihr wie ein dichter Schleier auf die Schultern. Im Kerzenlicht waren nun die ebenmäßigen Züge einer jungen Frau zu erkennen. Die Haut hatte die typisch helle Färbung Rothaariger. Die Augenbrauen unter der hohen Stirn waren zwei zarte rötliche Linien über grünlichen Augen, die den Ankömmling über eine kleine Nase hinweg streng ansahen.
„Du hast mich warten lassen!“, wiederholte sie, diesmal lauter und mit einem leicht scharfen Unterton in der Stimme.
„Domina, Herrin meines Herzens, verzeiht mir, aber die Ereignisse verlangten meine Anwesenheit.“
„Trotzdem muss Strafe sein!“, sagte sie mit erhobener Stimme und zog aus einem ihrer Stiefel eine Reitgerte, die sie klatschend gegen dessen Stiefelschaft schlug.
Wortlos löste er die Bänder seines Wamses und zog es aus, dann drehte er ihr den Rücken zu und beugte leicht den Kopf.
„Herrin, ich bitte um Verzeihung.“
Sie hob die Gerte und gab ihm fünf nicht allzu starke Streiche auf den Rücken, die feine Striemen auf der Haut hinterließen. Während der Bestrafung gab er keinen Laut von sich.
Als sie die Gerte zur Seite legte, drehte er sich um und sah sie mit glühenden Augen an. „Du hast es gewagt, mich zu schlagen!“ Dann trat er auf sie zu und löste behände die Bänder ihres Mieders. Ein paar Minuten später wälzten sich die beiden in enger Umarmung nackt auf der Strohmatratze des Bettes.
Die Kerze war fast heruntergebrannt, als sich Florian Geyer erhob. Er trank einige tiefe Züge Wein, dann griff er nach seinen Hosen. „Ich muss zurück zu meinen Bauern, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen“, erklärte er. „Komm morgen früh in mein Zelt. Es kann sein, dass ich einen Auftrag für dich habe.“
Sie nickte und stand ebenfalls auf. Während sie sich mit den Fingern durchs Haar fuhr, konnte er ihren wohlgeformten Körper bewundern, den das Wams und die Landsknechtshosen vollkommen verborgen hatten. Florian Geyer musste an sich halten, um sie nicht noch einmal zu lieben, rief sich aber zur Ordnung. Er musste wirklich zurück.
Während er seine Stiefel anzog und das Schwert am Gürtel befestigte, bückte sie sich und benutzte ohne Scham das tönerne Nachtgeschirr, das unter dem Bett stand. Dann trat sie ans Fenster und schüttete den Inhalt auf die Gasse. Eine übliche Gepflogenheit dieser Zeit.
Domina begann sich anzukleiden. Ihre Schweigsamkeit war ungewöhnlich, deshalb fragte er: „Bedrückt dich etwas?“
„Es sind schlimme Zeiten, in denen wir leben. Die Stürme des Krieges haben uns zusammengetrieben. Werden sie uns auch wieder trennen?“
Florian Geyer trat zu ihr und nahm ihr Gesicht in die Hände. „Denk nicht darüber nach. Heute leben wir und konnten für eine kurze Zeitspanne glücklich sein. Niemand weiß, was der morgige Tag bringt.“ Er gab ihr einen letzten Kuss, dann griff er nach seinem Hut, hob seine Hand zum Gruß und verließ die Stube.
Domina hatte er vor zwei Wochen kennengelernt. Sie war eine der zahlreichen Marketenderinnen im Tross, die den Haufen der aufständischen Bauern folgten. Viele der Marketenderinnen waren Ehefrauen der mitziehenden Soldaten, andere folgten so den Haufen und lebten mit und von den Aufständischen. Sie verkauften den Männern allerlei Utensilien des täglichen Lebens, die die Soldaten nicht mit sich führen konnten. Sie kochten vor ihren Zelten und versorgten sie, wenn sie verwundet waren. Die eine oder andere bot auch ihre Liebesdienste an.
Domina war eine jener Frauen, die sich die Männer bisher beherzt vom Leib gehalten hatte, was bei ihrer Schönheit nicht immer leicht war. Erst als sie Florian Geyer begegnet war, war ihr Widerstand zusammengebrochen. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen. Seitdem trafen sie sich in Gasthäusern, um bei den Bauern des Schwarzen Haufens keine Neidgedanken aufkommen zu lassen.
Im Schankraum legte Florian Geyer eine Münze auf den Tisch, dann trat er nach draußen auf die Gasse. Es war niemand zu sehen. Mit weit ausholenden Schritten marschierte er in Richtung Zeltlager. Am Horizont zeigte sich schon der erste Silberstreif des neuen Tages.
Tags darauf, am 7. Mai des Jahres 1525, näherten sich weitere aufständische Bauern aus östlicher und nördlicher Richtung Würzburg. Der Taubertal-Fränkische Haufen lagerte bei Heidingsfeld, der Neckartal-Odenwälder-Haufen versammelte sich bei Höchberg.
Die Führer der beiden Haufen trafen sich mit dem Würzburger Rat der Stadt und verlangten, dass sich die Stadt den Aufständischen anschloss. Sie drohten, dass man anderenfalls die Weinberge rund um die Stadt und damit eine wesentliche Lebensgrundlage der Bürger zerstören würde. Wohl oder übel beugten sich die Würzburger. Später kamen noch Haufen aus dem Steigerwald, aus Karlstadt und Schweinfurt hinzu und schlossen sich in und um Würzburg zusammen. Sie begannen, die Besatzung auf der Festung Marienberg zu belagern. Insgesamt stand hier eine Streitmacht von etwa zwanzigtausend Mann.
Am 9. Mai 1525 überbrachten die Belagerer der Festungsbesatzung die Aufforderung, die Burg zu übergeben. Die Verhandlungen führten jedoch zu keinem Ergebnis.
Am nächsten Tag bildete sich aus den Bauernhaufen ein Oberster Rat, der erneut mit der Festungsbesatzung wegen einer Übergabe verhandelte, diese wurde jedoch erneut abgelehnt. Daraufhin verlangte die Würzburger Bürgerschaft die Zerstörung der Festung. Götz von Berlichingen und Florian Geyer versuchten, dies zunächst zu verhindern. Insgesamt bestanden unter den Führern der Haufen Meinungsverschiedenheiten über die Strategie und Vorgehensweise. Hinzu kam ein Zwist zwischen den Bauernhaufen und den Würzburger Bürgern, die nach wie vor kategorisch die Zerstörung der Festung forderten.
Als Götz von Berlichingen am 14. Mai 1525 einen Sturm auf die Festung verhinderte, begann man, ihm gegenüber misstrauisch zu werden. Betrieb der Ritter ein falsches Spiel? Man verdächtigte ihn, den Kommandanten der Festung von den Eroberungsplänen der Bauern unterrichtet zu haben. Weiter stand er unter dem Verdacht, die Späher der Festungsbesatzung durch die eigenen Reihen schlüpfen zu lassen, um die Bauern auszukundschaften. Dieser Verdacht sollte sich später bestätigen.
Mittlerweile wurden weitere Geschütze aus Tauberbischofsheim herangeführt und der Beschuss der Festung begann. Als Antwort darauf beschoss die Festungsbesatzung nicht die Bauern, sondern die Stadt selbst. Viele Bürger flüchteten und brachten sich auf Flößen unter den Brückenbögen der Alten Mainbrücke in Sicherheit.
Als in der Nacht des 15. Mai 1525 der Tauberbischofsheimer Haufen den Frauenberg stürmte, waren die Belagerten gut vorbereitet und schlugen den Angriff zurück. Die Bauern erlitten hohe Verluste.
Da die Kanonen der Bauern zu schwach waren, um aus größerer Distanz den Mauern merkliche Schäden zuzufügen, begann man, in den Weingärten neue Schanzen auszuheben, und beschoss die Festung erneut. Aber auch dieser Angriff brachte keine besseren Ergebnisse für die Bauern.
Die Festungsbesatzung hielt so lange durch, bis Truchsess von Waldburg mit dem verbündeten schwäbischen Fürstenheer zum Entsatz heranrückte. Unterwegs schlug er das Bauernheer bei Königshofen, Tauberbischofsheim und Ingolstadt vernichtend. Götz von Berlichingen hatte sich rechtzeitig davongestohlen und entkam so der Rache der Bauern.
Wilhelm von Grumbach, der ein Schwager Florian Geyers war und im Bauernkrieg auf Seiten des Fürstbischofs kämpfte, hatte sich mit einigen Männern unter dem Vorwand, ein Überläufer zu sein, in das Heerlager der Bauern eingeschlichen. Wenig später war es ihm gelungen, den verwundeten Florian Geyer zu überwältigen und in die Festung Marienberg zu verschleppen. Der Fürstbischof hatte angeordnet, ihn vom Turm der Festung zu stürzen. Florian Geyer war es jedoch gelungen, zu fliehen. Nach der völligen Auflösung des Bauernheeres hatte er sich mit wenigen Getreuen, darunter auch die Marketenderin Domina, nach Würzburg in den Gressenhof geflüchtet. Zusammen mit einigen Gesinnungsgenossen überlegte er, wie man die Stadt gegen die herannahenden fürstlichen Truppen verteidigen könne. Doch es war zu spät. Der Rat hatte bereits die Übergabe der Stadt und die Schließung der Tore beschlossen.
„Liebster, wir müssen fliehen, sonst ist es zu spät!“ Domina saß an Florians Lager, auf das er sich für kurze Zeit niedergelassen hatte, damit sie ihm seine schwere Wunde verbinden konnte. „Der Rat hat die Stadttore schließen lassen. Sie werden sich auf Gedeih und Verderb ergeben. Der Gressenwirt hat mir gesagt, dass er heute Nacht noch eine Möglichkeit hat, uns aus der Stadt hinausbringen zu lassen.“ Sie warf einen besorgten Blick auf die Wunde, die immer noch stark blutete und den frischen Leinenverband bereits wieder durchtränkte.
Der Ritter stöhne leise, als er sich aufrichtete und gestützt von Domina vom Lager erhob.
„Dann muss es wohl sein“, stellte er verbittert fest und befestigte das Schwertgehänge am Gürtel. Mit zusammengebissenen Zähnen folgte er Domina hinaus.
„Trinkt noch einen Schluck zur Stärkung“, empfahl der Wirt und reichte Florian Geyer einen Humpen mit Wein. „Hier ist noch eine Wegzehrung. Geht zum westlichen Stadttor. Dort hat heute Nacht mein Vetter Wache. Er weiß Bescheid und wird Euch passieren lassen. Draußen steht ein kleiner Leiterwagen mit einem Pferd. Seht zu, dass Ihr schnell in die Wälder kommt. Nur so gibt es ein Entkommen.“
Nachdem Florian Geyer getrunken hatte, reichte er den Humpen an Domina weiter, die ebenfalls einen langen Zug nahm, dann bedankten sie sich bei dem Wirt und verließen das Gasthaus. In einem Bündel trug Domina das Nötigste mit sich, ein Stück Brot, etwas harten Käse, einen Holzbecher, Feuersteine und einige Streifen sauberes Leinen, um die Wunde versorgen zu können. Ihre einzige Waffe war ein Messer, das sie in einer Scheide am Gürtel trug.
Die Nacht des 9. Juni lag über Würzburg. Die Stadt erwartete mit Sorge die Ankunft des siegreichen Fürstenheers und des Fürstbischofs, dem sie sich auf Gedeih und Verderb unterworfen hatte. Conrad von Thüngen zog am nächsten Tag mit seinen Truppen in Würzburg ein und hielt ein grausames Gericht. Auf dem Marktplatz, vor dem „Grünen Baum“ und am Rennweg ließ er bei Schauhinrichtungen Hunderten von Gefangenen den Kopf abschlagen.
Florian Geyer und Domina hatten das Stadttor ohne Probleme passieren können. Wie versprochen hatten sie das alte Bauerngefährt vorgefunden. Das Pferd war eine alte Schindmähre, die sich erst nach mehrmaliger Aufforderung widerwillig ins Zuggeschirr legte. Domina hatte die Zügel übernommen, damit sich ihr Geliebter auf dem Stroh, das auf der Ladefläche aufgeschüttet war, niederlegen konnte. Und obwohl das alte Pferd nur im Schritt vorankam, erreichten die beiden Flüchtigen bis zum Abend des nächsten Tages die Ausläufer des Gramschatzer Waldes. Mehrmals hatten sie sich verstecken müssen, wenn unbekannte Reiterei in ihrer Nähe auftauchte. Sie waren sich sicher, dass Wilhelm von Grumbach Geyer verfolgen ließ.
Dieser litt mittlerweile unter leichtem Fieber. Domina sah die Wunde in seiner Seite mit Besorgnis. Sie hatte im Krieg schon zahllose Verwundungen gesehen und wusste, dass die Verletzung ihres Geliebten kritisch war. Auf jeden Fall musste sie etwas unternehmen, um Wundfäule zu verhindern. Leider hatte sie ihre Kräuterapotheke zurücklassen müssen. Es blieb ihr nur die Möglichkeit, die Wunde auszubrennen. Eine Tortur, die auch für einen starken Mann nur schwer zu ertragen war.
An einem schmalen Bachlauf hielt Domina an. Das Pferd brauchte Ruhe und der Verletzte musste versorgt werden. Vorsichtig half sie Florian vom Wagen und bettete ihn am Rande des Baches unter dem Blätterdach einer ausladenden Eiche. Mit Hilfe von Zunder und den Feuersteinen entzündete sie ein kleines Lagerfeuer. Aus dem Bach schöpfte sie frisches Wasser und gab Florian Geyer zu trinken. Dann legte sie ihm einen nassen Lappen auf die heiße Stirn.
„Liebster, ich muss dir jetzt heftige Schmerzen zufügen, denn deine Wunde muss ausgebrannt werden. Sonst vergiftet sie dein Blut und du musst sterben.“
Florian Geyer nickte nur erschöpft. Er wusste, was auf ihn zukam. Schon oft hatte er diese Prozedur bei Wundärzten auf dem Schlachtfeld beobachtet.
Domina zog Geyers Dolch aus der Scheide und legte ihn in die Glut des Feuers. Dann öffnete sie das Wams des Liegenden und legte die Wunde frei. Die Verletzung, die von einem Hellebardenstich stammte, zeigte nur noch eine leichte Sickerblutung, war aber dunkelrot und angeschwollen.
Als die Schneide des Dolches weißrot glühte, legte sie Florian Geyer einen gut daumendicken Ast in den Mund, damit er sich im Schmerz nicht auf die Zunge biss. Dann nahm sie das glühende Eisen aus der Glut und legte sich mit ihrem gesamten Gewicht auf den Oberkörper des Verletzten. Ohne Zögern presste sie dann den Dolch mit der Breitseite auf die Wunde. Sie spürte, wie sich der Verletzte krampfartig unter ihr aufbäumte und aus seinem Mund gepresste Schreie kamen, die durch den Holzknebel unterdrückt wurden. Das verbrannte Gewebe zischte und der beißende Gestank von versengtem Fleisch stieg ihr in die Nase. Sie biss die Zähne zusammen und drückte das Eisen so lange auf die Wunde, bis jede Stelle gründlich ausgebrannt war.
Florian Geyer hatte sich in den letzten Augenblicken nicht mehr gerührt. Als sie sich schweißüberströmt von der Anstrengung von ihm löste, bemerkte sie, dass ihn eine gnädige Ohnmacht ereilt hatte. Erneut verband sie die Verletzung. Jetzt konnte sie nur hoffen, mit dieser Behandlung die Wundfäule rechtzeitig aufgehalten zu haben. Wenig später legte sie Holz nach, dann schmiegte sie sich eng an den Verwundeten, der nun plötzlich von Schüttelfrost befallen wurde, und wachte. Irgendwann in der Nacht wurde sie vom Schlaf übermannt.
Sie erwachte vom lauten Wiehern eines Pferdes. Erschrocken riss sie die Augen auf und versuchte, schlaftrunken auf die Füße zu kommen. Florian Geyer lag nicht mehr neben ihr. In der Morgendämmerung, die langsam durch die Äste der Bäume sickerte, konnte sie ihn schemenhaft ein Stück entfernt stehen sehen. Als er bemerkte, dass sie wach geworden war, legte er einen Finger auf die Lippen. Dann deutete er in den Wald hinein.
Jetzt hörte auch sie das Aneinanderschlagen von Metallzeug und dumpfen Hufschlag. In diesem Augenblick stieß ihr eigenes Pferd, das sie am Leiterwagen angebunden hatten, ein lautes Wiehern aus, das sofort aus dem Wald beantwortet wurde.
„Es sind mindestens zwei Berittene. Vermutlich Männer des Grumbach“, raunte er ihr zu und zog langsam sein Schwert aus der Scheide. Man konnte sehen, welch heftige Schmerzen ihm diese Bewegung bereitete.
„Versteck dich“, verlangte der Ritter. „Sie haben uns bemerkt.“
Domina schüttelte den Kopf. Sie zog ihr Messer aus dem Gürtel und machte sich bereit. „Wenn du stirbst, sterbe ich auch“, sagte sie entschlossen. Florian war klar, dass sie sich nicht davon abbringen lassen würde.