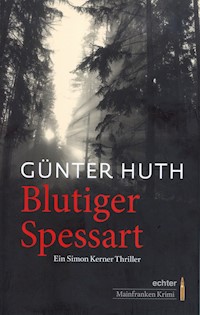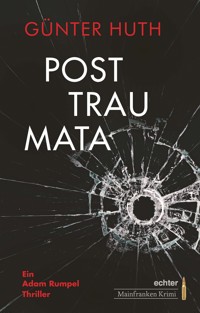Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges schickt der Würzburger Bischof Matthias Ehrenfried zwei Getreue auf eine geheime Mission nach Gramschatz. Von der Fahrt in das Dorf kehren die beiden Männer nicht mehr zurück. Über sechzig Jahre später werfen zwei merkwürdige Todesfälle und eine geheimnisvolle Nachricht aus der Vergangenheit ihre Schatten auf die damaligen Ereignisse. Daraufhin bittet der Generalvikar der Diözese Würzburg den pensionierten Kommissar Erich Rottmann, Licht ins Dunkel dieser Geschichte zu bringen. Ebenso zeigen die Kandidaten für das Amt des Würzburger Oberbürgermeisters reges Interesse an dieser Angelegenheit, und auch die Münchner Staatskanzlei hat ihre Finger im Spiel. Bei seinen Ermittlungen stößt Erich Rottmann in Gramschatz auf ein tödliches Geheimnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Huth
Der Schoppenfetzer und der Messweinfluch
Foto: Rico Neitzel – Büro 71a
Günter Huth wurde 1949 in Würzburg geboren und lebt seitdem in seiner Geburtsstadt. Er kann sich nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben.
Er ist Rechtspfleger (Fachjurist), verheiratet, drei Kinder.
Seit 1975 schreibt er in erster Linie Kinder- und Jugendbücher, Sachbücher aus dem Hunde- und Jagdbereich (ca. 60 Bücher). Außerdem hat er bisher Hunderte Kurzerzählungen veröffentlicht.
In den letzten Jahren hat er sich vermehrt dem Genre Krimi zugewandt. 2003 kam ihm die Idee für einen Würzburger Regionalkrimi. „Der Schoppenfetzer“ war geboren.
2013 erschien sein Mainfrankenthriller „Blutiger Spessart“, mit dem er die Simon-Kerner-Reihe eröffnete, mit der er eine völlig neue Facette seines Schaffens als Kriminalautor zeigt. Durch den Erfolg des ersten Bandes ermutigt, brachte er 2014 mit dem Titel „Das letzte Schwurgericht“ den zweiten Band, 2015 mit „Todwald“ den dritten Band, 2016 mit „Die Spur des Wolfes“ den vierten Band und 2017 mit „Spessartblues“ den fünften Band dieser Reihe auf den Markt.
Der Autor ist Mitglied der Kriminalschriftstellervereinigung „Das Syndikat“.
Die Handlung und die handelden Personen dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lenbens ist nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig.
Günter Huth
Der Schoppenfetzer und der Messweinfluch
Der sechste Fall des WürzburgerWeingenießers Erich Rottmann
Günter Huth
Der Schoppenfetzer und der Messweinfluch
© Echter Verlag, Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Gestaltet von Peter Hellmund
Gedruckt und gebunden von Pressel, Remshalden
Siebte Auflage 2019
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
ISBN
978-3-429-05389-5 (print)
978-3-429-05035-1 (PDF)
978-3-429-06445-7 (ePub)
www.echter.de
Inhalt
IN EINER SCHWEREN ZEIT
MEHR ALS 60 JAHRE SPÄTER, IM SOMMER
15. AUGUST
16. AUGUST
17. AUGUST
18. AUGUST
19. AUGUST
20. AUGUST
IN EINER SCHWEREN ZEIT
Der unscheinbar wirkende Mann im schwarzen Anzug stand am Fenster des großen unbeleuchteten Raumes. Er hatte die dichten Vorhänge, die vor den hohen Fensternischen des Bischofspalais hingen und eine absolute Abdunklung des Arbeitszimmers ermöglichten, einen kleinen Spalt auseinandergeschoben und blickte hinaus auf die lichtlose Stadt am Main. Die Dächer der umliegenden Häuser schimmerten im fahlen Schein des zunehmenden Mondes. Er blickte nach oben. Die hinteren Türme des Kiliansdoms hoben sich schwach wie zwei mahnende Finger gegen den Nachthimmel ab.
Seine Exzellenz Matthias Ehrenfried, Bischof von Würzburg, trat von der Fensternische zurück und schloss die Vorhänge wieder korrekt. Dann ging er zu seinem Schreibtisch und knipste die kleine Stehlampe an.
Der Lichtschein fiel auf das hagere Gesicht eines jungen Mannes, der auf einem Stuhl vor dem mit Papieren überhäuften Arbeitsplatz des Oberhirten saß. Er trug zwar die einfache Kleidung eines Arbeiters, aber ein Blick auf seine Hände verriet, dass er sein Brot nicht mit harter Arbeit verdienen musste.
Der Bischof sah den jungen Mann durchdringend an. „Konstantin, Sie wissen, was zu tun ist.“ Es war eine Feststellung und keine Frage.
Der Mann öffnete den Mund, um etwas zu entgegnen, doch der Bischof hob die Hand. „Einzelheiten will ich nicht wissen. Ich rechne jeden Tag damit, dass mich die Nazis verhaften und verhören. Was ich nicht weiß, kann ich auch nicht verraten. Die Vernehmungsmethoden dieser Verbrecher sind ja bekannt.“ Langsam ließ er sich auf seinem Sessel nieder, dann sagte er mit Bitterkeit in der Stimme: „Wir leben in einer Zeit, in der die Gottlosen die Macht an sich gerissen haben. Da ist es schwer, die Interessen unserer Kirche zu wahren. Leider macht dies auch solche lebensgefährliche Aktionen notwendig. – Es werden hoffentlich auch wieder andere Zeiten kommen.“
Konstantin Brockmann nickte leicht. Obwohl er noch sehr jung war, hatte ihn Bischof Ehrenfried vor zwei Jahren als Sekretär zu sich ins Ordinariat berufen. Er besaß das volle Vertrauen des Oberhirten.
„Wann geht es los?“
„Wir fahren kurz vor Mitternacht, Exzellenz.“
„Das Fahrzeug?“
„Ein Kleinlaster. Ein alter Holzvergaser aus den Beständen der Würzburger Stadtverwaltung. Der Mann, der mir das Fahrzeug zur Verfügung stellt, ist ein loyaler Christ aus der Dompfarrei. Ich habe ihm klargemacht, dass es besser ist, wenn er keine Ahnung hat, wofür ich den Laster benötige. Wenn ich das Fahrzeug in der Nacht zurückbringe, wird niemand Fragen stellen.“
„Was machen Sie, wenn Sie unterwegs kontrolliert werden? Die Schergen der Gestapo sind überall.“
„Wir transportieren eine Ladung Feuerholz für das Gemeindehaus. Dort wird am Wochenende eine Parteiversammlung stattfinden. Auf der Strecke hatten wir Probleme mit dem Holzvergaser, deshalb sind wir in die Nacht geraten.“
Bischof Ehrenfried erhob sich und wanderte unruhig durch sein Arbeitszimmer. Sein Sekretär verfolgte die leicht gebeugte Gestalt des Oberhirten mit den Augen.
Er bewunderte den Mann, der sich in dieser schweren Zeit ohne Rücksicht auf seine eigene Unversehrtheit laut hörbar und kompromisslos gegen die Vertreter der Naziherrschaft in Würzburg stellte.
„Lieber Konstantin, ich danke Ihnen und Ihrem Begleiter für Ihren Mut und Ihre Opferbereitschaft. Wahrscheinlich wird nie jemand erfahren, welche Gefahren Sie heute für unsere Kirche auf sich nehmen.“ Er trat einen Schritt näher. „Ich möchte Sie segnen.“
Langsam erhob sich der Sekretär vom Stuhl und kniete sich nieder. Der Bischof legte ihm beide Hände auf den Kopf und sprach die Segensworte, dann schlug er über dem Scheitel des Mannes das Kreuzzeichen. „Geh mit Gottes Segen, mein Sohn.“
Konstantin Brockmann griff nach der Hand seines Bischofs und küsste dessen Ring, dann erhob er sich und verließ wortlos das Büro.
Als er auf dem Flur stand, blieb er kurz stehen und überlegte. Schließlich fasste er einen Entschluss und betrat sein Arbeitszimmer, das sich nur einige Türen weiter befand. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und holte ein Blatt Papier aus der Schublade. Wegen der schlechten Qualität des Papiers schrieb er nicht mit Tinte, sondern mit einem Bleistift. Jedes Wort wollte gut überlegt sein.
Als er fertig war, las er den Text noch einmal durch, dann setzte er das Datum und seine Unterschrift darunter. Er faltete das Blatt, steckte es in einen grauen Umschlag und klebte ihn zu. Nach kurzem Überlegen schob er das Briefkuvert unter die lederne Schreibunterlage seines Schreibtisches.
Wenig später passierte ein junger Mann in Arbeitskleidung einen Nebenausgang des Bischofspalais. Er blickte vorsichtig um sich und eilte dann in Richtung Dom davon.
Die beiden Gestapo-Männer in dem schwarzen Mercedes, die gerade ihren Dienst vor dem Haupteingang des Bischofssitzes versahen, konnten ihn nicht sehen. Ihre Aufmerksamkeit galt den Aktivitäten des Oberhirten. Schon seit Wochen wurde er rund um die Uhr überwacht. Sobald sich Bischof Ehrenfried außer Haus begab, folgten sie ihm zu Fuß oder im Wagen. Ehrenfried war als gefährlich eingestuft. Bis jetzt hatte man ihn nur verschont, weil seine Verhaftung eine Sturmwelle der Empörung unter der Bevölkerung ausgelöst hätte. Eine derartige Unruhe konnte man im Augenblick nicht brauchen.
Eine Dreiviertelstunde später verließ ein klappriger Kleinlaster, der mit gesägtem Brennholz beladen war, Würzburg. Im Fahrzeug saßen zwei Männer.
Die Ladung war mit Stricken gut befestigt, so dass nichts herunterfallen konnte. Aus dem Holzvergaser, der wie ein überdimensionaler Topf hinter dem Führerhaus des Fahrzeugs angebaut war, quollen dicke Rauchwolken. Wegen der Verdunkelungsvorschriften waren die Lampen des Fahrzeugs durch Pappscheiben bis auf jeweils einen schmalen Schlitz zugeklebt. Entsprechend dürftig war die Sicht. Die Geschwindigkeit musste den Verhältnissen angepasst werden.
Konstantin Brockmann und sein Fahrer, ein spätberufener Student aus dem Priesterseminar, unterhielten sich nicht. Zu stark war ihre Anspannung. Beide waren sich des Risikos bewusst, das sie bei dem Unternehmen eingingen. Wenn sie bei dieser nächtlichen Aktion erwischt würden, wären sie unweigerlich ein Fall für die Gestapo. Da würde ihnen auch der Bischof nicht helfen können.
Mit zusammengekniffenen Mienen starrten die beiden auf die Straße, die außerhalb Würzburgs immer schlechter wurde.
Einige Zeit später erreichten sie ihr Ziel. Das laute Motorengeräusch des Holzvergasers schallte laut von den Häuserwänden des Dorfes wider.
Schließlich lenkte der Fahrer den Laster in den Hof eines Anwesens in der Ortsmitte nahe der Kirche. Die beiden stiegen aus und begannen sofort damit, die Verschnürung der Ladung zu lösen. Licht benötigten sie dabei nicht. Ihre Augen hatten sich längst an die Dunkelheit gewöhnt.
Fast geräuschlos tauchten aus dem im Nachtschatten verborgenen Eingang des Hauses zwei junge Männer auf. Wortlos nickten sie den beiden Neuankömmlingen zu, dann legten sie mit Hand an. Jetzt begann der schwierige Teil der Mission.
Es dauerte einige Zeit, bis die eigentliche Ladung sicher vor dem Zugriff Unbefugter versteckt war. Danach reinigten die vier Männer an einem Brunnentrog gründlich ihre Hände und ihre lehmverdreckten Schuhe.
Als die beiden Würzburger wieder zum Aufbruch bereit waren, sah der Sekretär des Bischofs seine drei Helfer eindringlich an: „Schwört mir in die Hand, dass ihr das Versteck niemals wieder betreten oder an eine dritte Person verraten werdet. Nur der Bischof allein ist berechtigt, die Öffnung des Verstecks anzuordnen.“ Flüsternd leisteten die vier den Schwur.
Die beiden Männer aus dem Dorf versuchten die Boten des Bischofs zu überreden, über Nacht zu bleiben und erst nach Tagesanbruch zurückzufahren. Der Sekretär und sein Fahrer lehnten jedoch ab. Sie mussten den Transporter wieder abgeben. Eine knappe Stunde später war das Gefährt mit beiden Insassen wieder auf dem Rückweg nach Würzburg.
Die beiden Helfer sahen dem Gefährt mit sorgenvollen Blicken hinterher.
Der Kleinlaster war etwa eine halbe Stunde unterwegs, als der Fahrer anhielt. „Ich muss Holz nachlegen“, erklärte er knapp. Er stieg aus, um den Holzvergaser wieder mit Holzscheiten zu füttern, die sie auf der Ladefläche mitführten. Mit einem Satz war er auf der Ladefläche und öffnete das Feuerloch des Vergasers.
Plötzlich stach das Licht einer Taschenlampe durch die Nacht und sprang zwischen den beiden Männern am Auto hin und her. Trotz der Blendwirkung konnte der Fahrer drei dunkle Gestalten erkennen, die wie aus dem Nichts zwischen den Bäumen erschienen waren. Die Männer trugen Uniformen und hielten Maschinenpistolen in den Händen.
Soldaten!, fuhr es dem Fahrer durch den Kopf. Jetzt wurde es ernst!
Konstantin Brockmann warf einen Blick auf die Kragenspiegel der Uniformen. SS-Runen! Oh Gott, steh uns bei, dachte er. Todesangst ergriff ihn und trieb ihm kalten Schweiß auf die Stirn.
„Los, aussteigen und am Fahrzeug antreten!“, brüllte der Anführer, seinen Abzeichen nach ein Unterscharführer.
Die beiden wussten, dass es keinen Sinn hatte, sich zu weigern. Der Fahrer schloss das Feuerloch des Holzvergasers und sprang mit erhobenen Händen von der Ladefläche. Konstantin öffnete vorsichtig die Wagentür und stieg aus. Die Waffen der drei SS-Männer verfolgten jede ihrer Bewegungen.
„Papiere!“, schnauzte der Unterscharführer Konstantin an und hielt ihm auffordernd die Hand hin.
„Wir …, wir haben keine Papiere dabei“, entgegnete Konstantin heiser. Sie hatten absichtlich keine Ausweispapiere mitgenommen. Ihre Identität durfte auf keinen Fall herauskommen.
„So, so, keine Papiere dabei“, wiederholte der SS-Mann die Worte des Priesters mit zynischem Unterton. Seinen Männern befahl er: „Los, Wagen durchsuchen! – Ich glaube, da haben wir zwei dreckige Feiglinge erwischt! Deserteure! Vaterlandsverräter!“
Einer der Soldaten riss die Wagentür auf und leuchtete ins Innere. „Nichts!“, erklärte er.
„Bewegt euch!“, kommandierte der Anführer der Gruppe und gab mit der Mündung seiner Waffe die Richtung an. „Geht da rüber! Mit Geschmeiß wie euch machen wir kurzen Prozess!“
Er trat einen Schritt näher und rammte dem Fahrer den Lauf seiner Maschinenpistole in die Seite. Der Atem des SS-Mannes stank beißend nach Alkohol.
Brockmann und seinem Begleiter wurde mit schrecklicher Gewissheit klar, dass ihr Leben hier enden würde.
„Lass uns beten“, murmelte Konstantin leise und faltete die Hände. Der Fahrer tat ihm gleich. Ohne Widerstand zu leisten, gingen sie zum Rand der Waldstraße. Ehe sie zum Stehen kamen, fuhren ihnen die Salven aus zwei Maschinenpistolen in den Rücken. Tödlich getroffen brachen beide zusammen.
„Was machen wir mit ihnen?“, wollte einer der SS-Männer wissen.
Der Unterscharführer zuckte mit den Schultern. „Die Füchse werden sich freuen.“ Er zog das Magazin aus seiner Maschinenpistole und ersetzte es durch ein volles. „Hauptsache, wir haben den Laster.“
Die drei setzten sich in das Fahrzeug und fuhren in Richtung Würzburg davon.
Das Schicksal hatte es gewollt, dass den SS-Leuten, die ebenfalls auf dem Weg nach Würzburg gewesen waren, das Benzin ausgegangen war. Sie hatten ihren Kübelwagen im Wald stehen lassen müssen und sich schon fluchend damit abgefunden, zu Fuß weiterzumarschieren, als sie den Holzvergaser kommen hörten. Der Rest war kein Problem gewesen.
Die beiden Ermordeten hatten ihr Geheimnis im wahrsten Sinne mit in den Tod genommen. Zwei Tage später wurden ihre Leichen von einem alten Waldarbeiter gefunden. Er holte zwei Bauern, und man brachte die erschossenen Männer in den Ort zurück. Mangels einer Leichenhalle wurden die beiden Toten zunächst in einer Scheune untergebracht und am Tag darauf in aller Stille auf dem Friedhof beigesetzt.
Die Nachricht von dem Leichenfund ging wie ein Lauffeuer durch den Ort. So erfuhren auch die beiden nächtlichen Helfer von den Morden. Sie wussten, um wen es sich bei den Erschossenen handelte. Deren grausamer Tod würde die beiden Männer aus dem Ort ein Leben lang nicht mehr loslassen.
Am Abend feierte der Würzburger Bischof in seiner Hauskapelle für die beiden Opfer des Naziterrors eine Messe.
MEHR ALS 60 JAHRE SPÄTER, IM SOMMER
Gotthilf Weißhügel aus Gramschatz, einem kleinen Ort nördlich von Würzburg, lag zuhause in seinem Bett und rang seit Tagen mit dem Tod. Auch mit seinen sechsundachtzig Jahren war Gotthilf bis vor wenigen Tagen noch kerngesund gewesen. Die Ärzte hatten an ihm nicht viel verdient. Darum hatte es auch alle im Dorf sehr verwundert, als seit Anfang der Woche die Kunde umherging, dass der Weißhügel aus der Seestraße schwerkrank im Bett liege.
Auch der aus dem Nachbarort Rimpar geholte Arzt konnte nicht verstehen, dass der rüstige Gramschatzer plötzlich seiner Dienste bedurfte. Gewiss, der starrsinnige Alte hatte in der letzten Zeit eine massive Erkältung gehabt und natürlich nichts dagegen getan. Aber das konnte nach Ansicht des Mediziners nicht der Grund sein, dass der zähe Bauer jetzt auf dem Sterbebett lag.
Obwohl der Doktor alles in seinen Kräften Stehende getan hatte, um Gotthilf wieder auf die Beine zu bekommen, ging es dem Patienten von Tag zu Tag schlechter. Eine Einweisung ins Krankenhaus hatte der alte Starrkopf strikt abgelehnt.
Ohne dass die Ursache für diese plötzliche Erkrankung zu erkennen war, hatte der Patient zu seiner Erkältung eine ungewöhnlich aggressive Lungenentzündung bekommen, die ihn trotz hoher Medikamentendosis so schwächte, dass er nicht mehr zu retten war. Nun ging es deutlich dem Ende entgegen.
Der Hausarzt sah jeden Tag zweimal nach seinem Patienten. Dr. Matern stand am Krankenlager, fühlte den Puls und schaute mit ernster Miene auf den schwer atmenden Mann herunter.
„Hat er’s nicht bald überstanden?“ Diese Frage stellten die Enkel von Gotthilf Weißhügel dem Arzt seit Tagen. Sie konnten den langen Todeskampf ihres Großvaters nicht mehr ertragen. Gotthilfs Frau war bereits seit sieben Jahren tot. Sein einziger Sohn und seine Schwiegertochter waren Jahre vorher bei einem Autounfall ums Leben gekommen, so dass seine vier mittlerweile erwachsenen Enkelkinder eine Zeitlang bei ihm aufgewachsen waren. Jetzt hatten sich die drei jungen Männer und die junge Frau am Sterbebett ihres Großvaters versammelt.
Dr. Matern zuckte nur mit den Schultern. „Nach menschlichem Ermessen müsste es schon lange zu Ende sein, so schwach und hinfällig, wie er beieinander ist. Euer Großvater hat allerdings ein starkes Herz, das nicht so schnell aufgibt. Helfen kann ich ihm nicht mehr. Ich kann ihm nur das Sterben etwas erleichtern“, sagte er leise. „Ich habe ihm wieder eine Spritze gegeben. Schmerzen hat er sicher keine.“
Hier war für ihn als Arzt wieder einmal der Punkt erreicht, an dem die Möglichkeiten der Medizin erschöpft waren. Ein Umstand, den er immer nur schwer akzeptieren konnte.
Wenig später verließ Dr. Matern das Haus. Draußen wanderte sein Blick zum Himmel. Die dunklen Wolken kündigten ein Gewitter an. Er setzte sich ins Auto und fuhr davon. Es war später Nachmittag, und er musste noch eine Reihe anderer Patienten besuchen. Er hoffte nur, dass es Gotthilf Weißhügel bald überstanden hatte.
Aus medizinischem Interesse wollte der Arzt gern wissen, was die Ursache für den ungewöhnlich schnellen und schweren Verlauf der Krankheit war. Er fasste an die Brusttasche seines Jacketts. Obwohl es sicher nicht korrekt war, hatte er eine Probe des Auswurfs, den der Kranke während seiner Hustenanfälle aussonderte, in ein Reagenzglas gegeben. Ein Studienkollege von ihm, Rechtsmediziner in Würzburg, würde ihm sicher den Gefallen tun und die Probe untersuchen lassen. Dr. Matern wollte einfach wissen, was dahintersteckte.
Veronika, die Enkeltochter, wischte dem Großvater mit einem feuchten Waschlappen den fiebrigen Schweiß von der Stirn. Ihre Brüder standen hilflos in der Ecke des Raumes zusammen. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Mit Sterbenden hatten sie keine Erfahrung.
Der Großvater war immer ein strenger, disziplinierter Mann gewesen. Der Tod seiner Frau und der Unfalltod seines Sohnes und seiner Schwiegertochter hatten dem alten Weißhügel allerdings einen Knacks verpasst, von dem er sich niemals so richtig erholt hatte.
Gotthilf Weißhügel, der zeit seines Lebens keinen Urlaub gekannt hatte, hatte sich in seiner Wohnstube in den Sessel gesetzt und war in Tatenlosigkeit verfallen. Mit Sorge hatten die Enkelkinder beobachtet, wie er immer schwermütiger wurde. Ihm fehlte die Arbeit auf dem Feld unter Gottes freiem Himmel. Aber das war es nicht allein. Da gab es noch etwas, das den alten Bauern ins Grübeln brachte: ein Ereignis aus der Vergangenheit, das nun, da er keiner ablenkenden Beschäftigung mehr nachging, aus der Versenkung aufgetaucht war und seine Gedanken gefangen nahm.
Auf die vorsichtigen Fragen seiner Enkeltochter Veronika, der gegenüber er immer offen gewesen war, antwortete er nur mit einem unwilligen Knurren.
Jetzt lag er da, bleich, schwer atmend, die Augen geschlossen, und näherte sich unaufhörlich der Pforte, die in eine andere Welt hinüberführte.
Veronika tauchte den Waschlappen in eine Schüssel mit Wasser und wrang ihn aus. Dann legte sie ihn erneut auf die heiße Stirn ihres Großvaters.
Plötzlich öffnete der Alte unerwartet die Augen. Er betrachtete einen Augenblick die Zimmerdecke über sich, dann wanderte sein Blick langsam zu seiner Enkelin. Mit Verwunderung stellte die junge Frau fest, dass er sie offenbar erkannte. Veronika hatte den Eindruck, dass er etwas sagen wollte. Sie beugte sich nach vorn und näherte ihr Ohr seinem Mund.
„Pfarrer“, drang es wie ein schwacher Hauch an ihr Trommelfell.
Die drei Enkelsöhne traten leise näher.
„Pfarrer“, wiederholte der alte Mann erneut. Diesmal war seine Stimme vernehmlicher. Er aktivierte seine letzten Kräfte, um seinen Wunsch zu artikulieren. „Fähr…, Fährbrück …“
Veronika sah ihre Brüder an, dann versicherte sie sich leise. „Du möchtest unseren Pater aus dem Kloster Fährbrück?“
Da Gramschatz schon lange keinen eigenen Pfarrer mehr besaß, wurde es seelsorgerisch von den Patres des naheliegenden Augustinerklosters mitbetreut.
„Pater … Leopold“, keuchte der Alte, dann schloss er erschöpft die Augen. Sein Atem ging rasselnd. Für einen Augenblick sah es so aus, als hätte ihm diese Kraftanstrengung die letzten Reserven geraubt. Doch dann öffnete er die Augen wieder und sah seine Enkelin bittend an.
„Georg“, übernahm Veronika einmal mehr die Initiative, „fahr hinüber nach Fährbrück. Ich habe zwar von einem Pater Leopold noch nichts gehört, aber vielleicht ist das ein neuer Pater, den wir noch nicht kennen. Einem Sterbenden werden die Patres wohl den letzten Wunsch nicht versagen.“
„Ich weiß auch nichts von einem Pater Leopold“, stellte Rainer, der Zweitgeborene, mit gesenkter Stimme fest. „Vielleicht sind das nur die Wahnvorstellungen eines Sterbenden. Für uns hier ist doch Pater Konrad zuständig. Ist doch wahrscheinlich auch egal. Bestimmt merkt er gar nicht mehr, wer an seinem Bett steht.“
Veronika, die sich gegenüber ihren Brüdern schon immer als die Stärkere gezeigt hatte, schüttelte energisch den Kopf. „Vielleicht bringt Großvater tatsächlich etwas durcheinander. Aber egal, wenn er diesen Pater Leopold vom Kloster haben will, dann soll er ihn bekommen! Zumindest müssen wir es probieren.“ Sie gab ihrem Bruder Georg einen Wink.
Georg, der Jüngste, erhob sich wortlos und verließ den Raum. Er war dankbar für diesen Auftrag, kam er dadurch doch für einige Zeit aus dieser bedrückenden Atmosphäre heraus, die in dem Sterbehaus herrschte. Er war froh, endlich etwas tun zu können, und musste nicht hilflos mit ansehen, wie das Lebenslicht seines Großvaters langsam verlosch.
Draußen war es mittlerweile Nacht geworden. Hastig stieg der junge Mann in seinen kleinen Sportwagen und fuhr eilig vom Hof. Hoffentlich konnte er den Auftrag noch rechtzeitig vor dem Tod seines Großvaters erfüllen.
Das kleine Augustinerkloster Fährbrück lag nur wenige Kilometer von Gramschatz entfernt und war von einem Ortskundigen über betonierte Feldwege schnell zu erreichen.
Georg fuhr vor die Pforte des Klosters und klingelte. Er musste dies noch zweimal wiederholen, ehe sich hinter der Tür endlich etwas tat. Im Türspalt erschien das Gesicht eines grauhaarigen Mannes. Er trug eine schlichte Ordenskutte, ansonsten gab es keinerlei Hinweise darauf, dass er der Prior der kleinen Mönchsgemeinschaft war.
„Was in Gottes Namen gibt es denn um diese Tageszeit so Eiliges, dass man nicht einmal in Ruhe ein Gebet zu Ende sprechen kann?“, fragte der Pater und sah den jungen Burschen verwundert an. Trotz der Störung wirkte er nicht ungehalten, eher neugierig. Es kam nur selten vor, dass jemand um diese Uhrzeit an der Klosterpforte vorsprach.
Hastig sprudelte der junge Mann sein Anliegen hervor. Der Pater hatte einige Mühe, seinen Worten zu folgen. Als Georg schließlich den Wunsch seines Großvaters vortrug, Pater Leopold sprechen zu wollen, runzelte der Prior erstaunt die Stirn.
„Pater Leopold lebt nicht hier im Kloster“, erklärte der Augustiner knapp. Er wollte sich schon umdrehen und Georg stehen lassen, als dieser ihm die Hand auf die Schulter legte. „Es gibt diesen Pater Leopold also? Bitte, können Sie mir nicht sagen, wie ich ihn erreichen kann? Es geht doch um den letzten Willen eines Sterbenden.“
Der Prior zögerte, schließlich entgegnete er: „Es gibt Pater Leopold tatsächlich. Woher dein Großvater allerdings weiß, dass er wieder in Deutschland ist, ist mir ein Rätsel. Leopold ist erst vor zwei Wochen aus Afrika zurückgekehrt. Er war dort ein halbes Leben lang für uns in der Mission tätig. Bruder Leopold ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgekehrt.“
„Kann ich Pater Leopold bitte sprechen?“
Der Prior zögerte einen Augenblick. Die nächsten Sätze kosteten ihm offensichtlich eine gewisse Überwindung.
„Keiner von uns kennt die tieferen Gründe, aber er hat den ungewöhnlichen Entschluss geäußert, seine ihm noch verbleibende Lebenszeit nicht im Kloster verbringen zu wollen. Er bat mich, ihm zu gestatten, seinen Lebensabend in Abgeschiedenheit als Eremit verbringen zu können. In Anbetracht seiner angegriffenen Gesundheit habe ich es ihm gestattet, obwohl dies eigentlich gegen unsere Ordensregeln verstößt. Er lebt jetzt in einer Hütte in den Weinbergen von Retzstadt.“
Der Prior sah den späten Besucher zweifelnd an. „Ich weiß nicht, ob Leopold bereit ist, deinem Großvater diesen letzten Wunsch zu erfüllen. Für Gramschatz ist ja Pater Konrad als Seelsorger zuständig. Es wäre kein Problem, ihn zu schicken.“
Georg schüttelte energisch den Kopf. „Großvater hat ausdrücklich nach Pater Leopold verlangt!“
Der Prior seufzte, dann sagte er: „Warte einen Augenblick, mein Sohn, ich werde dir eine Wegbeschreibung mitgeben.“
Georg blieb im Vorraum stehen, während der Pater in einem Zimmer verschwand. Nervös kaute er an seinen Fingernägeln. Retzstadt war die Nachbargemeinde von Gramschatz. Wenn er Feldwege benutzte, konnte er in kurzer Zeit dort sein.
Es dauerte wirklich nur einen Moment, bis der Prior zurückkam. „Hier. Ich hoffe, dass du Bruder Leopold überzeugen kannst.“
Georg bedankte sich knapp, dann war er schon wieder draußen. Er warf einen Blick auf den Zettel und war sich sicher, die beschriebene Hütte zu kennen.
Eine Minute später raste das Auto wieder durch die Nacht. Der Motor des Wagens heulte, als der junge Mann wenig später die gewundenen Weinbergswege hinaufjagte. Es dauerte nur wenige Minuten, dann kam er in einer Staubwolke vor der Hütte zum Stehen. Es handelte sich tatsächlich um das alte Weinbergshaus, das er in Erinnerung hatte.
Georg sprang aus dem Wagen und klopfte laut an die Tür. Durch die Ritzen der geschlossenen Fensterläden erkannte er einen leichten Lichtschimmer. Es musste also jemand da sein.
Es dauerte einen Moment, bis die Tür knarrend geöffnet wurde. Der Mann, der von einem schwachen Lichtschein umgeben im Türrahmen erschien, war alt. Er hatte eine schlanke, hochaufgerichtete Gestalt. Sein Gesicht war hager und von einem grauen Mehrtagesbart bedeckt. Trotzdem waren die zahlreichen tiefen Falten zu sehen, die sein Gesicht wie Furchen durchzogen. Seine Augen wirkten in der Dunkelheit fast schwarz. Sie fixierten den späten Besucher mit einer Direktheit, die den jungen Mann erschaudern ließ.