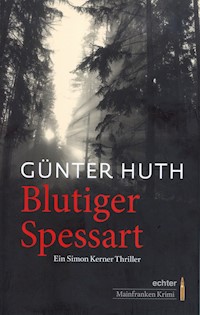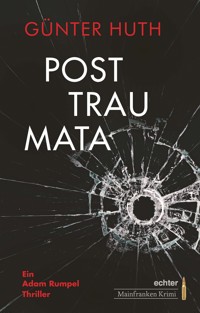Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Kommunalwahlkampf in Würzburg plätschert eher flau dahin – bis über Nacht eine bisher unbekannte Gruppierung auftaucht, die alle Parteien in Würzburg aus ihrem Dornröschenschlaf aufrüttelt. Diese Aktionisten starten auf dem Unteren Markt eine nächtliche Verbrennungsaktion der viel zu vielen Wahlplakate, mit denen die Stadt zugepflastert ist. Fast zeitgleich mischt sich die Nichtwählervereinigung Würzburg NWW in das Geschehen ein, eine von Stadtrat Duwe Golgatha gegründete Gruppe, die sich als Sprachrohr der Würzburger Nichtwähler bezeichnet. Kaum zur Wahl zugelassen, erhält die NWW so enormen Zulauf, dass die etablierten Parteien die Notbremse ziehen wollen. Plötzlich verschwindet Duwe Golgatha von der Bildfläche. Zur gleichen Zeit kommt ein Schwede nach Würzburg. Er will ein dunkles Geheimnis seiner Familie aufklären, dessen Ursprung in der Gründungszeit des Würzburger Ringparks und in der Person seines Schöpfers Jöns Person Lindahl liegt. Ist Duwe Golgatha in diese Angelegenheit verstrickt? Ist er deshalb abgetaucht? Erich Rottmann wird von Stadtrat Fettschräuble und dem Schweden gebeten, nach dem Verbleib von Duwe Golgatha zu fahnden. Dabei stößt Öchsle am Main überraschend auf eine Wasserleiche. Wer ist der Tote? Ist er ein Opfer des inzwischen mit harten Bandagen geführten Kampfes um den Würzburger Oberbürgermeistersessel? Dieser Krimi endet genauso überraschend, wie das Ergebnis der Wahl …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Huth
Der Schoppenfetzerund das dunkle Geheimnis
Foto: Rico Neitzel – Büro 71a
Günter Huth wurde 1949 in Würzburg geboren und lebt seitdem in seiner Geburtsstadt. Er kann sich nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben.
Er ist Rechtspfleger (Fachjurist), verheiratet, drei Kinder.
Seit 1975 schreibt er in erster Linie Kinder- und Jugendbücher, Sachbücher aus dem Hunde- und Jagdbereich (ca. 60 Bücher). Außerdem hat er bisher Hunderte Kurzerzählungen veröffentlicht. In den letzten Jahren hat er sich vermehrt dem Genre Krimi zugewandt. 2003 kam ihm die Idee für einen Würzburger Regionalkrimi. „Der Schoppenfetzer“ war geboren.
2013 erschien sein Mainfrankenthriller „Blutiger Spessart“, mit dem er die Simon-Kerner-Reihe eröffnete, mit der er eine völlig neue Facette seines Schaffens als Kriminalautor zeigt. Durch den Erfolg des ersten Bandes ermutigt, brachte er 2014 mit dem Titel „Das letzte Schwurgericht“ den zweiten Band, 2015 mit „Todwald“ den dritten Band, 2016 mit „Die Spur des Wolfes“ den vierten Band und 2017 mit „Spessartblues“ den fünften Band dieser Reihe auf den Markt.
Der Autor ist Mitglied der Kriminalschrift stellervereinigung „Das Syndikat“.
Die Handlung und die handelden Personen dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lenbens ist nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig.
Günter Huth
Der Schoppenfetzerund das dunkle Geheimnis
Der dreizehnte Fall des WürzburgerWeingenießers Erich Rottmann
BuchverlagPeter Hellmundim Echter Verlag
Günter Huth
Der Schoppenfetzer und das dunkle Geheimnis
© Echter Verlag, Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Gestaltet von Peter Hellmund
Gedruckt und gebunden von Pressel, Remshalden
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
Zweite Auflage 2021
ISBN
978-3-429-05638-4
978-3-429-05158-7 (PDF)
978-3-429-06534-8 (ePub)
www.echter.de
Inhalt
1887
21. November 1887, kurz nach sechs Uhr morgens, auf einer Lichtung im Guttenberger Forst nahe Würzburg
22. November 1887
28. November 1887, kurz nach zehn Uhr
2014
Aus den Akten der Staatsanwaltschaft Würzburg
Zwei Wochen zuvor, in der heißen Phase eines unterkühlten Kommunalwahlkampfes
Samstag, der 22. Februar
Montag, der 24. Februar
Dienstag, der 25. Februar
Mittwoch, der 26. Februar
Donnerstag, der 27. Februar
Freitag, der 28. Februar
Montag, der 3. März
Dienstag, der 4. März
Mittwoch, der 5. März
Freitag, der 7. März
Samstag, der 8. März
Montag, der 10. März
Dienstag, der 11. März
Sonntag, der 16. März — Wahltag
Drei Wochen später
1887
21. November 1887, kurz nach sechs Uhr morgens, auf einer Lichtung im Guttenberger Forst nahe Würzburg
Dort, wo sich um diese Zeit sonst die Rehe gütlich taten, standen nun zwei schwarze Pferdekutschen. Die Rösser hatten einen anstrengenden Lauf hinter sich. Ihren Nüstern entströmte die in der Kälte sichtbare Atemluft und von ihren Körpern stieg Dampf auf. Knirschend kauten die Pferde auf ihren Trensen und stampften nervös mit den Hufen. Ein Stück abseits standen zwei Gruppen von dunkel gekleideten Männern, die sich gedämpft unterhielten: Theodor von Güntersleben, Mitglied des Würzburger Magistrats, und sein Sekundant Friedrich von Golgatha sowie, in einiger Entfernung, Ansgar von Löwenstein als Unparteiischer und der Arzt Dr. Wilfried Schätzlein – Letzterer, falls nach dem anberaumten Duell ein Verletzter zu versorgen sein würde.
Drei Tage zuvor hatte Friedrich von Golgatha im Auftrag des Herrn von Güntersleben die Aufforderung zum Duell an Jöns Person Lindahl überbracht, den schwedischen Gartenarchitekten, der mit der Gestaltung der Würzburger Ringparkanlagen beauftragt war. Der Magistratsrat fühlte sich durch beleidigende Äußerungen, die Lindahl in der Öffentlichkeit getan hatte, in seiner Ehre herabgewürdigt. Bereits seit längerer Zeit schwelte ein heftiger Streit zwischen dem Rat der Stadt und dem Schweden. Der Magistrat sah die Kosten bei der Realisierung des Ringparkprojekts als vollkommen überzoen an. Von Güntersleben war daraufhin zum Leiter einer Kommission bestimmt worden, die Lindahl scharf auf die Finger schauen sollte, um die Ausgaben zu begrenzen. Der betrachtete diese Einschränkung als unter seiner Würde und wetterte in der Öffentlichkeit heftig gegen diese Kontrolle. Dabei hatte er auch deftige Worte gegen den Leiter der Kommission geäußert, die diesem zugetragen worden waren. Theodor von Güntersleben hatte darin eine willkommene Möglichkeit gesehen, sich dieses unbequemen Zeitgenossen auf elegante Weise zu entledigen: Als Beleidigter hatte der Kommissionsleiter nach ungeschriebenem Gesetz das Recht der Waffenwahl. Da er in einer schlagenden Studentenverbindung war, wählte er den Säbel. Sein ungeübter Gegner würde gegen ihn keine Chance haben. Lindahl wusste das auch. Trotzdem bat er seinen Freund Robert von Huttingen, ihm beim Duell zu sekundieren.
Die beiden Sekundanten verabredeten daraufhin die Einzelheiten des Waffengangs. Da die Obrigkeit derartige „Ehrenhändel“ nicht gern sah, hatte man sich auf den abgelegenen Ort im Guttenberger Forst geeinigt.
„Wir sind schon deutlich über der Zeit“, stellte Friedrich von Golgatha mit einem Blick auf seine Taschenuhr fest und warf einen Blick in Richtung des bewachsenen Waldwegs, auf dem Lindahl eigentlich kommen musste. Theodor von Güntersleben murmelte eine abfällige Bemerkung in seinen Bart.
„Er kommt!“, rief da von Löwenstein. Jetzt hörten auch die anderen den dumpfen Hufschlag eines Pferdes. Keine Minute später bog eine einspännige Kutsche auf die Lichtung. Als der Kutscher das Pferd dicht bei den anderen Karossen zum Halten gebracht hatte, öffnete sich die Tür und ein Mann sprang heraus.
„Guten Morgen, meine Herren“, grüßte von Huttingen mit gezogenem Zylinder. „Herr Lindahl lässt sich entschuldigen. Wegen einer Unpässlichkeit kann er leider nicht erscheinen. Ich bedauere wirklich sehr …“ Dem Mann war anzusehen, wie peinlich ihm das Überbringen dieser Nachricht war.
Für einen Augenblick herrschte betretenes Schweigen auf der Waldwiese. Schließlich stieß von Güntersleben seinen Gehstock auf den Boden und erklärte mit eisiger Miene: „Herr von Huttingen, sagen Sie diesem Lindahl, dass er ein ehrloser Feigling ist. Sollte er sich noch einmal beleidigend äußern, werde ich ihn wie einen räudigen Hund aus der Stadt hinausprügeln lassen! Er kann davon ausgehen, dass ihm der Auftrag zur Gestaltung des Ringparks entzogen wird. Für Schäden, die der Stadt dadurch entstehen, werden wir ihn mit allen juristischen Mitteln zur Rechenschaft ziehen! Er wird noch den Tag verfluchen, an dem er den Namen Würzburg erstmals gehört hat. Falls er noch einen Funken Ehrgefühl in sich hat, wird er selbst die Konsequenzen ziehen!“
Mit diesen Worten marschierte der Magistratsrat mit schnellen Schritten zu seiner Kutsche. Sein Sekundant beeilte sich, ihm zu folgen. Einen Augenblick später galoppierten die Pferde über den Waldweg davon.
Im Innern der Kutsche vergingen ein paar Minuten, in denen von Güntersleben wortlos zum Fenster hinausstarrte. Dann sah er Friedrich von Golgatha durchdringend an. „Wir müssen das Problem Lindahl ein für alle Mal aus der Welt schaffen! Kümmern Sie sich darum! In ein paar Wochen steht die Nachwahl zum stellvertretenden Kämmerer an. Sie wissen, dass ich dem Magistrat einen Personalvorschlag machen muss.“
Am späten Nachmittag desselben Tages traf sich ein gut gekleideter Herr mit einem etwas heruntergekommenen Individuum in einer verräucherten Kneipe im Mainviertel von Würzburg. Um diese Zeit war hier noch nicht viel los. Die Männer setzten sich an einen runden Tisch in einer Ecke des Lokals. Der Wirt servierte zwei Bier. Dann steckten die beiden ungleichen Besucher die Köpfe zusammen und unterhielten sich leise und intensiv. Eine Viertelstunde später wechselte ein Umschlag den Besitzer und der vornehme Herr verließ grußlos die Kneipe. Beim Gehen legte er dem Wirt einen Geldschein auf den Tresen. Sein Bier, das er nicht angerührt hatte, trank sein Gesprächspartner.
22. November 1887
Ein lauter Schuss zerriss die nächtliche Stille. Der Schuss, der sich nahe der Alten Schweizerei, einem heruntergekommenen landwirtschaftlichen Gutshof in der Nähe des Übergangs von der Ottostraße zum Glacis, löste, trug wegen der heftigen Windböen sehr weit. Da der Wind jedoch aus nördlicher Richtung kam, wurde der Schall von den Häusern in der Ottostraße ferngehalten, so dass die dort im Tiefschlaf liegenden Bewohner nichts mitbekamen.
Die Temperatur pendelte um den Gefrierpunkt. Die Feuer in den Öfen waren bis auf eine geringe Glut heruntergebrannt, die Menschen drückten sich tief in die Federn ihrer Betten.
Kein Mensch hatte die einsame Gestalt im warmen Wintermantel gesehen, die nun regungslos auf dem Bauch neben dem Weg lag, der sich kilometerlang durch die Ringparkanlage schlängelte. Die Revolverkugel war in die rechte Schläfe eingedrungen, ohne jedoch den Schädel zu durchschlagen. Die im schwachen Mondlicht unwirklichen schwarzen Schlagschatten der nahestehenden Sträucher wirkten im Wind wie menschliche Gestalten.
Eine Stunde zuvor
Der einsame Mann im langen dunklen Mantel und mit hohem Zylinderhut bewegte sich in leichten Schlangenlinien von der Uferpromenade des Mains kommend über den Sandweg der Ringparkanlagen. Leicht nach vorne gebeugt, kämpfte er gegen die Windböen, die ihn von der Seite trafen. Der Wind allein war es aber nicht, der seinen Gang unsicher erscheinen ließ. Offenbar war er stark angetrunken. Sein eleganter Spazierstock gab ihm etwas Halt. An einer der einige Jahre zuvor in den Parkanlagen installierten gusseisernen Gaslampen blieb er stehen und hielt sich an ihrem Pfahl fest. Das milchige Licht der brennenden Leuchtstrümpfe gewährte nur eine begrenzte Strecke weit Sicht.
Plötzlich beugte sich der Mann ruckartig nach vorne und übergab sich würgend in mehreren heftigen Schüben ins Gras. Als er keuchend durchatmen konnte, wischte er sich langsam mit dem Handrücken seines Lederhandschuhs die Reste aus dem gepflegten Bart. Er richtete sich wieder auf und taumelte einige Schritte weiter. In der Dunkelzone zwischen zwei Lichtkreisen blieb er erneut schwankend stehen und versuchte mit stierem Blick die nächtliche Parkanlage zu durchdringen. Vor seinem geistigen Auge entstanden die Konturen einer erst vor wenigen Jahren im Glacis der ehemaligen Festungswälle geschaffenen künstlichen Parklandschaft. Er, Jöns Person Lindahl, renommierter schwedischer Landschaftsarchitekt, war der Schöpfer dieses Werks. Seit 1880 hatte er im Auftrag des Magistrats der Stadt, unter der Federführung von Bürgermeister Georg von Zürn, die Umgestaltung des vorhandenen Grüngürtels der Stadt durchgeführt. Das Glacis diente einst dazu, den Verteidigern der Stadt vor den Wällen ein freies Schussfeld zu verschaffen. Angreifenden Gegnern sollte möglichst wenig Deckung geboten werden.
Langsam wankte der Mann weiter. Dabei brabbelte er einige Worte auf Schwedisch vor sich hin, gelegentlich wild mit dem Stock gegen einen unsichtbaren Gegner schlagend.
Sein Unglück hatte begonnen, als sein Förderer, Bürgermeister von Zürn, 1884 starb. Dieser hatte Lindahls Entwürfe für eine großzügige Parklandschaft immer unterstützt. Obwohl es in der Bevölkerung erhebliche Widerstände gegen das Projekt gab, nicht zuletzt weil für die Umsetzung auch das Fällen zahlreicher alter Bäume erforderlich war. Von Zürns Nachfolger, Bürgermeister Johann Georg Ritter von Steidle, war da erheblich kritischer eingestellt. Er sah in erster Linie die horrenden Kosten.
„Diese elenden Geldsäcke!“, stieß der Betrunkene heftig hervor und starrte mit wässrigen Augen in die Nacht. „Sie zerstören mein ganzes großartiges Werk …!“
Unvermittelt begann er zu schluchzen und wurde von einem regelrechten Weinkrampf geschüttelt. Lindahl war mit den Nerven völlig am Ende. Die Enthemmung durch den Alkohol nahm ihm jede Selbstbeherrschung. Wegen der massiven Anfeindungen durch den Magistrat hatte er einen Nervenzusammenbruch erlitten. Vor einer Woche war er von einem Kuraufenthalt zurückgekehrt. Bei seiner Rückkehr musste er entsetzt feststellen, dass seine Gegner im Magistrat seine Abwesenheit dazu genutzt hatten, Teile seines großartigen Werkes zu zerstören beziehungsweise nach ihren Vorstellungen zu verändern. Seine Einwände waren nicht gehört worden. Im Gegenteil, man warf ihm Größenwahn und Geldverschwendung vor! Der Magistrat hatte ihm obendrein eine Kommission mit diesem Herrn von Güntersleben als Leiter vorgesetzt. Sie war dazu berechtigt, jede seiner Ausgaben zu überprüfen und ihre Notwendigkeit in Frage zu stellen – was von Güntersleben nach Lindahls Ansicht auch exzessiv und provokativ praktizierte. Für einen Künstler seiner Klasse ein erniedrigender und inakzeptabler Zustand. Da war ihm irgendwann der Kragen geplatzt und er hatte heftig gegen von Güntersleben gewettert. Einen Tag später überbrachte der Sekundant des Herrn von Güntersleben die Herausforderung zum Duell. Lindahl, der in seiner Studentenzeit ein wenig gefochten hatte, war sofort klar, dass er gegen von Güntersleben keine Chance haben würde. Trotzdem ließ er dem Herausforderer mitteilen, dass er zum Duell bereit sei. Je näher die Stunde des Kampfes aber rückte, desto verzweifelter war Lindahl geworden. In seiner Niedergeschlagenheit hatte er sich in der Nacht vor dem angesetzten Waffengang sinnlos betrunken. Als ihn sein Sekundant am frühen Morgen abholen wollte, fand er ihn in einem erbärmlichen Zustand vor. So konnte Lindahl unmöglich antreten. Von Huttingen hatte ihn nach der Absage des Duells aufgesucht und ihm pflichtgemäß die Worte seines Duellgegners ausgerichtet, dann war er gegangen. Er fühlte sich selbst durch die Feigheit Lindahls beschämt.
Lindahl trank den ganzen Tag weiter. Ihm war klar, dass sein Verhalten Konsequenzen haben würde. Von Güntersleben würde nun alle Hebel in Bewegung setzen, um seine Existenz zu vernichten. Am späten Nachmittag kleidete sich Lindahl an. Seinem Kammerdiener erklärte er, er würde ausgehen. Er solle nicht auf seine Heimkehr warten. Lindahl steckte einen schweren Gegenstand in seine Manteltasche und verließ unsicheren Ganges das Haus. Wenig später saß er in einer zwielichtigen Kneipe und trank ungehemmt weiter. Der Wirt zuckte mit den Schultern. Der Mann zahlte sofort nach jedem Getränk, alles andere ging ihn nichts an. Die übrigen Gäste musterten Lindahl mit neugierigen Blicken, ließen ihn aber in Ruhe. Irgendwann sank sein Kopf auf die Tischplatte und er schlief ein. Weit nach Mitternacht bugsierte ihn der Wirt dann doch hinaus. Stark betrunken torkelte er durch die Straßen, bis er schließlich auf den Weg stieß, den er selbst hatte anlegen lassen.
Wieder blieb er stehen und starrte in die Nacht. Mittlerweile war der halbe Mond aus dem Wolkenschatten hervorgetreten und erhellte die Gebäude der Alten Schweizerei. Lindahl wusste, dass die Stadt den Grund an das Königreich Bayern verkauft hatte. Die Regierung wollte auf dem Grundstück einen pompösen Justizpalast und ein Gefängnis errichten.
Lindahl war psychisch und physisch am Ende. Ihm war klar, dass sein gesellschaftliches Ansehen und sein Ruf als Künstler zerstört waren. Niemand würde ihn mehr mit einem solch bedeutenden Projekt beauftragen. Für ihn gab es nur noch einen Weg, seine Ehre wiederherzustellen. Er griff in seine Manteltasche. Der schwere metallene Gegenstand, den seine Finger umschlossen, fühlte sich kalt und bedrohlich an. Er zog den Revolver heraus und betrachtete ihn im schwachen Mondlicht. War dies wirklich die einzige Lösung, die ihm noch blieb? Er war kein sehr mutiger Mann, und er hatte Angst. Todesangst. Schweiß trat ihm auf die Stirn. Die Hand mit der Waffe sank herunter. Er war so allein. Schwerfällig hob er den Kopf und blickte hinter sich. Seine vom Alkohol umnebelten Sinne hatten im Unterholz das Knacken brechenden Holzes registriert. Ein trockener Ast, den der Sturm von einem der Bäume gebrochen hatte? Er stieß ein lautes Stöhnen aus, das vom Wind davongetragen wurde. Lindahl musste hier und jetzt eine Entscheidung treffen. Ganz langsam nahm er die Waffe wieder hoch.
Gegen zehn Uhr in der Nähe der Alten Schweizerei
Der Fundort der Leiche wurde von Gendarmen abgesperrt. Sie sollten neugierige Bürger fernhalten. Die Polizeit war von einem Postreiter verständigt worden, dass in den Parkanlagen ein Toter läge.
Der Leiter der Ermittlungen, Gendarmerieleutnant Johannes Rieger, beugte sich über die leblose Gestalt, die mit dem Gesicht nach unten auf dem Sandweg lag. Der Zylinder des Mannes befand sich ein Stück vom Kopf entfernt. Die linke Gesichtshälfte hatte sich teilweise in den Sand des Weges gedrückt. Sein sichtbares Auge war halb geöffnet und starrte blicklos ins Leere. Der Einschuss an der rechten Schläfe war gut sichtbar. Ein dünnes schwärzliches Rinnsal lief vom Einschussloch über das Gesicht und verschwand im Vollbart des Mannes.
„Sieht nach Selbstmord aus“, stellte Rieger fest, wobei er den Revolver in der rechten Hand des Mannes prüfend betrachtete. Ihn irritierte, dass der Tote Lederhandschuhe trug. Die Waffe war augenscheinlich eine fünfschüssige großkalibrige Vorderladerwaffe. Bei dieser Art Revolver musste der Hahn vor jedem Schuss mit dem Daumen der Schusshand gespannt werden. Mit Handschuh war das Spannen der Waffe unzweifelhaft schwieriger. Aber bei Selbstmördern war ja nicht unbedingt rationales Handeln voraus-zusetzen.
Rieger erhob sich und gab dem Polizeifotografen einen Wink, der daraufhin den erst vor einigen Jahren bei der Gendarmerie eingeführten modernen fotografischen Apparat aufstellte – einen wuchtigen Kasten auf drei Beinen, mit dessen Hilfe man eine Aufnahme des Tatorts auf eine Glasplatte bannen konnte. Als der Fotograf fertig war, fasste Rieger einen Arm der Leiche. „Helfen Sie mir!“, befahl er seinem Assistenten. Gemeinsam drehten sie den Toten auf den Rücken. Die Leichenstarre war bereits voll ausgeprägt. Die Finger des Mannes krampften sich fest um den Griff der Waffe. Der starre Arm wies gen Himmel.
„Sehen Sie hier“, erklärte Rieger und wies auf einen blutunterlaufenen, zirka handspannenlangen Streifen quer über der Stirn auf Höhe des Haaransatzes. „Sieht wie ein Schlag aus.“
„Oder er ist nach dem Schuss auf diesen Ast dort aufgeschlagen.“ Der Assistent deutete auf einen halb verdeckten Ast, der einige Zentimeter von der Stelle entfernt, an der der Kopf lag, im Sand zu erkennen war.
Beide beugten sich herab und untersuchten das Holz genauer. „Kein Blut zu sehen“, stellte Rieger fest. „Aber auf jeden Fall werden wir den Ast sicherstellen.“ Er gab dem Assistenten einen entsprechenden Wink, dann nickte er dem Fotografen auffordernd zu. Der legte eine neue Glasplatte ein und machte eine frontale Aufnahme des Toten.
Der Gendarmerieleutnant betrachtete das Gesicht der Leiche genauer. „Der Mann kommt mir bekannt vor“, murmelte er in seinen Bart. Er rückte seine runde Nickelbrille zurecht und beugte sich wieder über den Körper. „Er riecht stark nach Alkohol“, stellte er dabei fest. Dann durchsuchte er dessen Manteltaschen. Der Brusttasche entnahm er eine Lederbrieftasche, die mehrere Geldscheine und ein Ausweispapier enthielt.
„Wusste ich es doch“, stellte Rieger zufrieden fest. „Das wird in der Stadt einen ziemlichen Wirbel geben. Das hier ist Jöns Person Lindahl. Schon seit Wochen berichtet der Würzburger Telegraph fast in jeder Ausgabe vom Streit des Bürgermeisters und des Magistrats mit diesem Herrn.“ Rieger dachte einen Augenblick nach, dann befahl er: „Schicken Sie einen der Gendarmen zum Leichenbestatter. Der soll den Toten abholen und in die Gerichtsmedizin bringen. Wir müssen seinen Tod auf jeden Fall genau untersuchen lassen. Der Suizid muss hieb- und stichfest bewiesen sein.“
Eine Minute später galoppierte einer der Uniformierten in Richtung Ottostraße davon.
Rieger und sein Assistent machten sich unterdessen an die genauere Untersuchung der näheren Umgebung. Rieger war klar, dass er seinen Vorgesetzten in Kürze Rede und Antwort stehen musste und jedes Versäumnis in diesem heiklen Fall Folgen für seine Karriere haben würde.
Eine Stunde später bog die Kutsche des Bestatters in die Ringparkanlagen ein. Zwei Männer stiegen vom Bock und stellten einen Sarg auf den Weg. Um den Deckel schließen zu können, mussten sie den totenstarren Arm mit der Revolverhand herunterbiegen. Die Schusswaffe übergaben sie Rieger. Wenig später war der Leichnam Lindahls auf dem Weg in die Gerichtsmedizin.
In derselben Nacht
Sich nervös die Spitzen seines Schnurrbartes zwirbelnd, saß Friedrich von Golgatha im Schein einer Petroleumlampe am Schreibtisch, vor sich ein leeres Blatt Papier. Der Federhalter in seiner Hand zitterte leicht, als er die Feder in das Tintenfass eintauchte. Einen Moment lang zögerte er, dann begann er zu schreiben. Nun, da er sich zu diesem Schritt entschieden hatte, floss ihm der Text zügig aufs Papier. Nach knapp drei Seiten legte er das Schreibzeug aus der Hand und trocknete die noch feuchte Tinte mit einer Löschwiege. Danach starrte er geraume Zeit auf die verfassten Zeilen. Sollte dieses Schreiben zu seinen Lebzeiten an die Öffentlichkeit gelangen, würden Köpfe rollen. Nicht nur seiner. Allerdings musste er dafür sorgen, dass diese Zeilen, sollte ihm etwas zustoßen, gefunden wurden. Nur so war er vor einer bestimmten Person sicher. Ihm war klar, dass er dieses Dokument sicher aufbewahren musste. Er faltete die Blätter zusammen, schob sie in einen Umschlag und klebte das Kuvert zu. Mit großen Buchstaben schrieb er auf den Umschlag „IM FALLE MEINES TODES ZU ÖFFNEN“. Nach kurzem Überlegen zündete er eine Kerze an und ließ etwas Wachs auf den Verschluss des Kuverts tropfen. Bevor das Wachs erkaltete, drückte er seinen Siegelring darauf. Nun bestand an seiner Urheberschaft kein Zweifel mehr. Mit einem Griff öffnete er das fast unsichtbar eingepasste Geheimfach seines Schreibtisches und schloss den Umschlag ein. In seinem Testament würde er einen entsprechenden Hinweis hinterlassen. Jetzt, nachdem er sich seine Schuld von der Seele geschrieben hatte, fühlte er sich regelrecht befreit. Er räumte den Schreibtisch auf, löschte die Lampe, ging in sein Schlafzimmer und kleidete sich aus. Lange Zeit starrte er im Dunkeln an die Decke. Der Wind peitschte die nackten Äste der Linde vor dem Haus und der Schein der Gaslaterne davor projizierte bizarre Schattenspiele gegen den Stuck. Irgendwann fiel er in einen unruhigen Schlaf.
28. November 1887, kurz nach zehn Uhr
Gendarmerieleutnant Johannes Rieger stand militärisch stramm vor dem wuchtigen Schreibtisch des Grafen von Luxburg, Regierungspräsident von Unterfranken und Aschaffenburg. Dem Grafen unterstand das Gendarmeriekorps, dem Rieger angehörte. In einem Ledersessel neben ihm saß Dr. Johann Georg Ritter von Steidle, der Bürgermeister von Würzburg. Beide Herren rauchten Zigarren.
„Rieger, jetzt stehen Sie schon bequem“, forderte ihn der Graf auf und winkte mit der Zigarre in Richtung eines zweiten Sessels, „und setzen Sie sich. Ich habe Sie hierherbefohlen, damit Sie uns Rapport zur Causa Lindahl erstatten. Sein Tod hat ja allenthalben für ärgerliche Gerüchte gesorgt. Wie man mir berichtete, wurde die Leiche vom Gerichtsmediziner gründlich untersucht. Können wir jetzt de facto davon ausgehen, dass es sich um einen Selbstmord handelt?“
Beide Herren sahen Rieger, der sich mittlerweile gesetzt hatte, gespannt an. Dieser räusperte sich.
„Meine Herren, die Beweislage ist leider nicht ganz eindeutig. Viele Anhaltspunkte sprechen für einen Selbstmord Lindahls. Seine Gemütslage muss in diesen Tagen extrem angespannt gewesen sein. Nach unseren Ermittlungen hatte der Magistratsrat von Güntersleben Lindahl einen Tag vor seinem Tod zu einem Duell herausgefordert. Lindahl war aber nicht erschienen. Aus gesundheitlichen Gründen, wie die offizielle Version lautete. Von Herrn von Huttingen, dem Sekundanten Lindahls, wissen wir, dass Lindahl einfach gekniffen hat. Wir haben dann, soweit möglich, seinen Tagesablauf bis zum Todeszeitpunkt ermittelt. Er hat offenbar den ganzen Tag über getrunken. Der Wirt der Kneipe, in der er zuletzt war, bestätigte, dass Lindahl sein Lokal schon angetrunken betreten hatte und es nach Mitternacht noch betrunkener wieder verließ. Offenbar ist er dann in die Ringparkanlagen gegangen und dort zu Tode gekommen. Aus seinem Umfeld wurde bestätigt, dass er in diesen Tagen nervlich angegriffen, um nicht zu sagen depressiv gewesen sei. Dabei hat der Ärger mit dem Magistrat und der Kontrollkommission eine wesentliche Rolle gespielt. Das entsprechende Vorspiel, der Kuraufenthalt et cetera ist den beiden Herren ja bekannt.“
Bürgermeister von Steidle zog hörbar die Luft ein, sagte aber nichts.
„Sie sagten ‚zu Tode gekommen‘“, warf der Regierungspräsident ein. „Sie meinten natürlich ‚sich selbst getötet‘, nicht wahr?“
„Der Schuss in die Schläfe“, fuhr Rieger fort, ohne sich beirren zu lassen, „erfolgte in der Tat aufgesetzt. Rund um das Einschussloch gibt es typische Verbrennungsmerkmale vom Schießpulver, wie dies für derartige Nahschüsse typisch ist. Auch der Schusswinkel spricht dafür, dass sich Lindahl die tödliche Verletzung selbst beigebracht hat.“
„Na also“, brummte der Regierungspräsident erleichtert.
Rieger hob die Hand. „Was den Gerichtsmediziner allerdings verwunderte, war die Tatsache, dass auf dem Handschuh, den der Tote bei der Schussabgabe getragen haben muss, keinerlei Pulverrückstände festzustellen waren. Bei einer Selbsttötung hätte dies aber zwingend der Fall sein müssen. Auch auf den Fingern der Schusshand gab es keine entsprechenden Schmauchspuren. Dies lässt nur den Schluss zu, dass Jöns Person Lindahl nicht selbst geschossen hat!“
Im Raum herrschte betroffene Stille. Der Regierungspräsident und der Bürgermeister reflektierten blitzschnell die Konsequenzen dieses überraschenden Ermittlungsergebnisses. Graf von Luxburg stieß schließlich ein unwilliges Schnauben aus.
„Lindahl hatte auch eine nicht offene Kopfverletzung am vorderen Haaransatz“, fuhr Rieger fort, „die vom Sturz auf einen vor ihm liegenden Ast herrühren könnte, als er nach der Schussabgabe zusammenbrach. Auf dem in Frage kommenden Ast war aber kein Blut erkennbar. Es ist daher nicht auszuschließen, dass ihm jemand die Verletzung vor seinem Tod, als er noch aufrecht stand, zugefügt hat. Eine Gewalttat ist also nicht völlig auszuschließen.“ Hier beendete Rieger seine Ausführungen.
Der Regierungspräsident erhob sich und schritt in seinem Dienstzimmer umher. „Steidle, was sagen Sie denn dazu?“
Der Angesprochene schüttelte den Kopf. „Man sollte sich unbedingt vor zweifelhaften Theorien hüten und diese auf keinen Fall in die Öffentlichkeit tragen. Lindahl war ein hochsensibler, begabter, aber auch sehr eigenwilliger Künstler, der dem Magistrat Unsummen gekostet hat. Mit dem Mann war einfach nicht zu reden, deshalb mussten wir ihm nachdrücklich die finanziellen Grenzen aufzeigen. Wahrscheinlich hat er das nicht verkraftet und sich wegen der Verletzung seiner übersteigerten Künstlerehre selbst getötet. Alles andere sind Spekulationen, die meines Erachtens jeglicher Grundlage entbehren. Wir sollten die Akten möglichst schnell schließen, damit endlich Ruhe in die Stadt kommt!“
„Rieger, Ihre Meinung?“
„Mit den Mitteln der Kriminalistik können wir keine eindeutigen Beweise für eine Mordtat finden“, antwortete der Gendarmerieleutnant ausweichend. „Bei unseren Ermittlungen haben sich jedoch noch weitere Verdachtsmomente ergeben, denen wir unbedingt nachgehen sollten. Selbstverständlich haben wir auch die Beteiligten des Duells befragt. Dabei hat sich herausgestellt, dass Magistratsrat von Güntersleben über das Verhalten Lindahls in höchstem Maße aufgebracht war. Wir haben daraufhin die Alibis der betroffenen Herren überprüft.“
Der Regierungspräsident zeigte sich verärgert.
„Dabei“, fuhr Rieger fort, „ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass sich ein Mann höheren Standes noch am gleichen Tag in einer Kneipe mit einem Kriegsveteranen namens Berthold Kupfer getroffen haben soll. Die Beschreibung könnte auf Herrn von Golgatha, den Sekundanten des Herrn von Güntersleben, zutreffen. Kupfer ist amtsbekannt gewalttätig. Unsere Fahndung nach ihm war bisher allerdings erfolglos. Er ist verschwunden.“
„Rieger, das sind alles keine Beweise! Wir können doch auf einen vagen Hinweis hin nicht ehrenwerte verdiente Bürger dieser Stadt einem Verdacht aussetzen! Nein!“ Der Regierungspräsident schlug mit der Hand auf den Lederrücken seines Schreibtischstuhls. Er hatte eine Entscheidung getroffen.
„Rieger, Sie werden den Fall abschließen, und die Leiche wird zur Bestattung freigegeben! Die Akten nehmen Sie unter Verschluss, damit sie nicht in falsche Hände geraten. Haben Sie verstanden?“
Rieger hob die Hand. „Herr Präsident, ich denke, ich sollte noch weitere Ermittlungen tätigen. Verschiedene Dinge bedürfen da noch der Klärung …“
Der Regierungspräsident schüttelte den Kopf. „Nein, Rieger, es bleibt bei meiner Entscheidung. Sie schließen den Fall ab. Danke für Ihren Rapport. Sie können wegtreten.“
Der Gendarmerieleutnant sprang auf, grüßte zackig und verließ das Dienstzimmer. Seine Miene war unbeweglich.
Als die Tür geschlossen war, sah der Regierungspräsident den Bürgermeister nachdenklich an. „Wir sollten die Toten ruhen lassen. Ein Skandal ist das Letzte, was wir jetzt brauchen können. Rieger ist ein zuverlässiger Mann. Er wird tun, was ich ihm aufgetragen habe.“ Der Regierungspräsident wechselte abrupt das Thema. „Wer wird jetzt die Ringparkanlagen vervollständigen?“