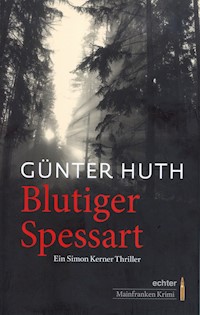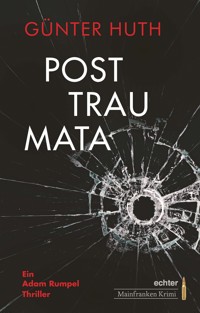Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Sprichwörtlich eine Stimme aus der Vergangenheit löst bei Xaver Marschmann, Mitglied beim Stammtisch Die Schoppenfetzer, schlimme Erinnerungen an seine Zeit als verdeckter Ermittler aus. Damals gehörte die Stimme einem Drogenboss, den er bisher glaubte bei einem Polizeieinsatz erschossen zu haben. Um die Sache aufzuklären, beginnt er selbst zu ermitteln und bittet dabei seinen Stammtischbruder Erich Rottmann um Hilfe. Der pensionierte Leiter der Würzburger Mordkommission stellt selbst gerade Nachforschungen im Fall einer unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommenen Studentin an - und ahnt noch nicht, welchen kriminellen Machenschaften er dadurch auf die Spur kommt. Die führen in die Unterwelt der Festung Marienberg. Dort kommt es schließlich zu einem lebensgefährlichen Einsatz von Rottmann und seinem vierbeinigen Begleiter Öchsle, in dessen Verlauf der Exkommissar von seiner Schusswaffe Gebrauch machen muss - mit schwerwiegenden Folgen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Huth
Der Schoppenfetzer
und der tödliche Rausch
Foto: Rico Neitzel – Büro 71a
Günter Huth wurde 1949 in Würzburg geboren und lebt seitdem in seiner Geburtsstadt. Er kann sich nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben.
Er ist Rechtspfleger (Fachjurist), verheiratet, drei Kinder.
Seit 1975 schreibt er in erster Linie Kinder- und Jugendbücher, Sachbücher aus dem Hunde- und Jagdbereich (ca. 60 Bücher). Außerdem hat er bisher Hunderte Kurzerzählungen veröffentlicht. In den letzten Jahren hat er sich vermehrt dem Genre Krimi zugewandt. 2003 kam ihm die Idee für einen Würzburger Regionalkrimi. „Der Schoppenfetzer“ war geboren.
2013 erschien sein Mainfrankenthriller „Blutiger Spessart“, mit dem er die Simon-Kerner-Reihe eröffnete, mit der er eine völlig neue Facette seines Schaffens als Kriminalautor zeigt. Durch den Erfolg des ersten Bandes ermutigt, brachte er 2014 mit dem Titel „Das letzte Schwurgericht“ den zweiten Band, 2015 mit „Todwald“ den dritten Band, 2016 mit „Die Spur des Wolfes“ den vierten Band und 2017 mit „Spessartblues“ den fünften Band dieser Reihe auf den Markt.
Der Autor ist Mitglied der Kriminalschriftstellervereinigung „Das Syndikat“.
Die Handlung und die handelden Personen dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lenbens ist nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig.
Günter Huth
DerSchoppenfetzer
und der
tödliche Rausch
Der zwölfte Fall des WürzburgerWeingenießers Erich Rottmann
Buchverlag
Peter Hellmund
im Echter Verlag
Günter Huth
Der Schoppenfetzer und der tödliche Rausch
© Echter Verlag, Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Gestaltet von Peter Hellmund
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
Zweite Auflage 2020
ISBN
978-3-429-05511-0 (Print)
978-3-429-05099-3 (PDF)
978-3-429-06491-4 (ePub)
www.echter.de
WÜRZBURG ZUR ZEIT DER HEXENPROZESSE
Der wuchtig geführte Hieb des Scharfrichters mit dem schweren Richtschwert traf zielgenau den Nacken der wegen Hexerei verurteilten Adelheid Schuster aus dem Würzburger Mainviertel. Mit einem Streich trennte er den Kopf der knienden Frau vom Rumpf. Durch die Menschenmenge, die sich um das Schafott vor der Marienkapelle versammelt hatte, ging ein jäher Aufschrei. Der Henkersknecht, der den Kopf der Frau an den Haaren festgehalten hatte, um ein Ausweichen der Verurteilten in letzter Sekunde zu verhindern, präsentierte dem Volk das abgetrennte Haupt. Währenddessen kippte der Körper der Hingerichteten nach vorne. Ihr Blut verteilte sich im Rhythmus des noch immer schlagenden Herzens über das hölzerne Schafott und versickerte im Erdreich.
Dies war die letzte Hinrichtung für den heutigen Tag gewesen. Insgesamt lagen nun fünf enthauptete Körper in dem großen Weidenkorb neben dem Schafott. Zwei Priester aus der Dompfarrei und drei Frauen, eine Nonne, eine Hebamme und die Frau eines Stadtrats, waren von der Inquisition der Hexerei und Zauberei für schuldig befunden worden. Daraufhin waren sie durch das weltliche Gericht zum Tod durch Verbrennen auf dem Scheiterhaufen verurteilt worden. Fürstbischof Philipp Adolf von Ehrenberg war in der letzten Zeit immer häufiger dazu übergegangen, Gnade vor Recht walten zu lassen und das Verbrennen der Verurteilten bei lebendigem Leib durch Enthaupten zu ersetzen.
Meister Peinlich, wie der Scharfrichter im Volk genannt wurde, zog aus einer Felltasche einen Lappen und wischte ohne eine Gemütsbewegung das Blut von der Klinge seines Richtschwerts ab. Anschließend schob er es in die Lederscheide zurück. Währenddessen wuchteten seine vier Gehilfen den Korb mit den kopflosen Leichen auf den Henkerskarren. Sie würden die Hingerichteten zum Sanderrasen hinausfahren, wo bereits die Scheiterhaufen für ihre Verbrennung aufgeschichtet waren.
Der Scharfrichter nahm seine Kapuze ab, die lediglich mit zwei Schlitzen für die Augen versehen war. Diese Haube diente keineswegs dem Zweck, seine Identität zu verbergen. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen; jeder in der Stadt kannte den hochgewachsenen kräftigen Mann, der hier als Vollstrecker der Urteile fungierte, die die Richter des Brückengerichts sprachen. Mit dieser Vermummung wollte sich der abergläubige Mann, an dessen Händen das Blut so vieler Menschen klebte, vor dem bösen Blick der armen Seelen schützen, denen er das Leben nehmen musste. Die Bürger der Stadt begegneten ihm mit großer Scheu. Die Gesellschaft brauchte ihn und seine Standeskollegen zwar, betrachtete die Henker jedoch als unrein und unehrenhaft. Aus diesem Grund lag seine Behausung auch fern des Stadtkerns an einem abgelegenen Teil der Stadtmauer.
Begegneten die Menschen ihm in den Gassen, wichen sie ihm aus. Ein Wirtshaus durfte er nur betreten, wenn die anderen Gäste keine Einwände erhoben. Selbst dann war es ihm nur gestattet, an einem für ihn bestimmten Tisch in einer Ecke zu sitzen. Sein Getränk wurde ihm in einem nur für ihn bestimmten Krug gereicht, den kein anderer benutzte.
Bartholomäus, wie sein Vorname lautete, verließ das Schafott und begab sich zu seinen Knechten. Sie würden später die Verbrennung durchführen, dazu war seine Gegenwart nicht erforderlich. Er gab ihnen einige Anweisungen, die das Inventar der Häuser der Hingerichteten einfachen Standes betraf. In der Regel fiel ein vorhandenes Vermögen an den Fürstbischof. Bei einfachen Leuten räumten die Stadtbüttel die Wohnungen und behielten Verwertbares. Blieb dann noch etwas übrig, konnte sich der Henker bedienen.
Das Volk hatte sich zwischenzeitlich verlaufen. Seitdem sich die Hexenbrut in der Stadt wie eine Seuche verbreitete, waren Hexenprozesse an der Tagesordnung. Der Fürstbischof war sehr bemüht, die Zauberer und Teufelsverbündeten, die sich gegen Gott vergingen, auszurotten. Meister Bartholomäus war daher ein viel beschäftigter Mann. Während der vorausgehenden Verhöre war er auch verantwortlich für die peinlichen Befragungen der Angeschuldigten, da ein Beschuldigter erst nach der Ablegung eines Geständnisses verurteilt werden durfte. Hierbei hatte der Scharfrichter sorgfältig darauf zu achten, dass er den Verdächtigen nicht zu viele Qualen zumutete, damit sie das Urteil und dessen Vollstreckung noch lebend entgegennehmen konnten.
Das Schwert in der Hand, eilte der Scharfrichter seinem Haus zu. Neben seiner Tätigkeit im Dienste des Rechts war er auch noch als Abdecker tätig. Er hatte verendete Tiere abzuholen, ihnen das Fell abzuziehen und die Kadaver zu verbrennen. Außerdem gehörte es zu seinen Pflichten, in der Nacht, wenn die Bürger schliefen, deren Kloaken und Abtritte zu reinigen. Das erledigten jedoch seine Knechte.
Als Bartolomäus sich seinem Haus näherte, konnte er schon aus der Ferne den Gestank wahrnehmen, der sein Anwesen wie eine bedrohliche Wolke umgab. Hinter dem Haus hingen an Haken ein Rind und zwei Schafe, die er heute noch abhäuten und verwerten musste. Im Gerberviertel der Stadt gab es Handwerker, die ihm die Häute abnehmen würden.
Treff, der massige Hofhund, hob seinen Kopf, als sein Herr das Grundstück betrat. Soweit die Kette es erlaubte, kam er dem Mann schwanzwedelnd entgegen. Dabei verschreckte er einige Hühner, die aufgeregt gackernd davonstoben. Bartholomäus tätschelte kurz den dicken Kopf der Dogge, dann betrat er das düstere Innere seines Hauses. Die Wände waren vom Ruß des Herdfeuers geschwärzt. Seine Frau Waltrud stand wie jeden Abend am Kessel, der über der offenen Feuerstelle hing.
„Setz dich nieder und iss!“, sagte sie knapp. „Du bist bestimmt hungrig.“
Das blutige Handwerk ihres Mannes war für sie nichts Besonderes. Sie war die Tochter des Scharfrichters von Schweinfurt und von Kindesbeinen an mit diesem Beruf vertraut. Die Nachkommen von Henkern konnten wegen der Unehrenhaftigkeit ihres Amtes nur innerhalb ihres Standes heiraten. Dieser Beruf wurde in der Regel auch vom Vater an den Sohn weitergegeben. Aus diesem Grunde hatten sich in vielen Regionen regelrechte Henkersdynastien entwickelt.
„Ich muss mich zuerst um mein Schwert kümmern“, gab Bartholomäus brummig zurück. Bei der Pflege seines Handwerkszeugs war er äußerst gewissenhaft, hing doch von der Schärfe des Schwertes die saubere Ausführung einer Hinrichtung ab.
Er ging in den Hof, wo ein steinerner Wassertrog stand, an dessen Schmalseite eine Handpumpe angebracht war. Mit einer vielfach geübten Bewegung zog er das Schwert aus der Scheide und hielt es mit der Rechten unter den Wasserstrahl. Mit der anderen Hand pumpte er. Obwohl er die Klinge abgewischt gewischt hatte, färbte sich das Wasser rot. Sorgfältig reinigte er das Schwert, wobei er es genau auf Scharten untersuchte. Doch die hochwertige Klinge, die der Rat der Stadt vor Jahren bei einem Solinger Waffenschmied hatte herstellen lassen, war unversehrt. Anders als ein Kriegsschwert war dieses Schwert an der Spitze abgerundet und stumpf.
Der Griff des Schwertes war so beschaffen, dass es beidhändig geführt werden konnte. Mit Leder umwickelt, lag es rutschfest und sicher in den Händen. Unter der Parierstange aus Messing befanden sich in der Klinge drei Löcher sowie ein Galgenmotiv und der Spruch: „Wenn ich das Schwert aufheben tu, wünsch ich dem Sünder ewige Ruh“.*
Bartholomäus trocknete das Schwert gründlich ab und fettete die Klinge mit einem Stück Fettschwarte dick ein, damit sie keinen Rost ansetzte. Schärfen würde er sie erst wieder vor dem nächsten Einsatz. Als er fertig war, ging er ins Haus zurück und stellte das Richtschwert in einen Wandständer gegenüber dem Eingang, so dass jeder, der sein Haus betrat, dieses Symbol der Gerechtigkeit gut sehen konnte. Anschließend setzte er sich an den Tisch und aß mit großem Appetit den Eintopf, den seine Frau gekocht hatte.
Bartholomäus stammte ursprünglich nicht aus einer Henkersdynastie; er selbst hatte eine begründet. Im Alter von neun Jahren hatten Gesetzlose seine Eltern überfallen und sie und seine beiden Brüder getötet. Bartholomäus war verletzt und bewusstlos liegengeblieben. Die Mörder hatten ihn für tot gehalten. Wenig später war er von Wandermönchen gefunden und mit in das nächstgelegene Zisterzienserkloster genommen worden. Sie hatten ihn gesund gepflegt und ihn in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Dort hatte er Schreiben und Rechnen gelernt und später eine Ausbildung als Schreiner erhalten.
Mit sechzehn Jahren hatte ihn ein neuerlicher Schicksalsschlag getroffen, der sein gesamtes weiteres Leben verändern sollte. Das Kloster war zwischen die Fronten einer Fehde zweier Landesfürsten geraten und ein Raub der Flammen geworden.
Der wieder heimatlos gewordene junge Bartholomäus war nach zwei Wanderjahren, in denen er sich mit Hilfe von Gelegenheitsarbeiten als Schreiner über Wasser gehalten hatte, nach Schweinfurt gekommen und vom dortigen Scharfrichter als Knecht eingestellt worden. Dieser lehrte ihn das Henkershandwerk. Mit achtzehn Jahren hatte Bartholomäus die Meisterprüfung abgelegt, die aus der Durchführung von drei Hinrichtungen bestand. Drei Jahre später hatte der Rat der Stadt Würzburg einen Scharfrichter gesucht. Um dieses Amt hatte er sich beworben. Nachdem Bartholomäus sein Können bei einer Hinrichtung unter Beweis gestellt hatte, durfte er die Stelle antreten.
Man schrieb das Jahr 1618 und Johann Gottfried von Aschhausen war Fürstbischof von Würzburg. Da er mit großem Nachdruck das grassierende Hexenunwesen in der Bischofsstadt bekämpfte, hatte Bartholomäus reichlich zu tun und war dadurch schnell zu bescheidenem Wohlstand gekommen. Jede peinliche Befragung und jede Hinrichtung wurde honoriert. Seine finanzielle Situation hatte es ihm ermöglicht, um die Hand von Waltrud anzuhalten, die er während seiner Lehre kennengelernt hatte. Sie heirateten und ein knappes Jahr später war sein erster Sohn geboren worden.
Die Knechte kehrten am späten Nachmittag vom Sanderrasen zurück und meldeten die ordnungsgemäße Verbrennung der Hingerichteten. Als es im Hof so dämmerig wurde, dass sie nicht mehr arbeiten konnten, trafen sie sich in der Küche. Dort nahmen sie gemeinsam bei Kerzenschein das Abendessen ein. Danach zogen sich die Knechte in den Anbau neben dem Pferdestall zurück. In abgetrennten Verschlägen lagen ihre Schlafstellen. Sie arbeiteten gerne für Bartholomäus, denn er zahlte nicht schlecht und war ein verträglicher Meister.
Waltrud wusch im Kessel das Geschirr ab, dann legte sie sich in der gemeinsamen Schlafkammer zur Ruhe. Bartholomäus stellte den Kerzenleuchter auf den Tisch, ging zu einer Truhe und holte einen kleinen Stapel Blätter heraus. Diese waren zwischen zwei Lederdeckel gepresst und wurden mit einem Riemen zusammengehalten. Vorsichtig öffnete er das Bündel und schlug die Stelle auf, wo er zuletzt gelesen hatte. Die dreiundfünfzig Blätter waren mit einer zierlichen Handschrift beschrieben. Bartholomäus hatte diese Aufzeichnungen im Haus einer wegen Hexerei hingerichteten alten Frau gefunden, die eine Kräuterkundige gewesen war und ihr Können angeblich zum Schaden ihrer Nachbarn in den Dienst des Teufels gestellt hatte. Bartholomäus faszinierte die Wirkung der vielen Kräuter, die hier in allen Einzelheiten aufgeschrieben waren, einschließlich der Krankheiten, gegen die sie wirkten, und die erforderlichen Dosen, in denen sie eingesetzt werden konnten. Seine Frau beschäftigte sich auch mit Kräuterkunde, hatte aber niemals dieses Wissen erreicht. Die Rezepte der Alten waren ihr von großem Nutzen.
Er hatte noch keine halbe Seite gelesen, als draußen der Hund anschlug. Tagsüber lag der Rüde an der Kette, in der Nacht lief er allerdings frei im Hof herum. Als der Hund sich gar nicht beruhigen wollte, legte Bartholomäus die Aufzeichnungen in die Truhe zurück, zündete mit Hilfe des Leuchters die Kerze einer Laterne an und trat vor das Haus.
„Wer ist da?“, rief er laut, nachdem er den Rüden mit einem scharfen Befehl zum Schweigen gebracht hatte.
„Meister Bartholomäus, wir müssen Ihre Hilfe in Anspruch nehmen“, kam eine dünne weibliche Stimme über das Tor. Das Grundstück war mit einem geschlossenen Holzzaun umgeben, so dass er nicht sehen konnte, wer ihn zu so später Stunde aufsuchte.
„Ich komme!“, erwiderte der Scharfrichter, packte den Hund am breiten Lederhalsband und legte ihn an die Kette. Dann eilte er zum Tor und öffnete. Im Schein seiner Laterne erkannte er eine Frau, die einen Mann stützte, dessen linke Hand von einem blutdurchtränkten Verband umhüllt war.
„Kommt herein“, sagte Bartholomäus und trat zur Seite. Das Knurren des Hundes unterband er mit einem knappen Zuruf.
Es war kein außergewöhnliches Ereignis, dass ihn zu später Stunde, wenn die Dunkelheit die Identität der Menschen verbarg, Kranke aufsuchten, um seine medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hierbei handelte es sich überwiegend um einfache Bürger, die sich einen Arzt nicht leisten konnten. Durch seine Tätigkeit als Scharfrichter und Folterer hatte sich Bartholomäus einige Kenntnisse über die Beschaffenheit des menschlichen Körpers angeeignet, so dass er in der Lage war, kleinere chirurgische Eingriffe vorzunehmen.*
Es war den beiden Besuchern anzusehen, wie unwohl sie sich im Haus des Henkers fühlten. Das Jammern des Mannes verstummte, als er im Lichtschein das Richtschwert erblickte.
„Was ist passiert?“, fragte Bartholomäus ruhig.
„Mein Mann arbeitet oben auf der Burg als Steinmetz“, erklärte die Frau. Sie war mittleren Alters und ziemlich mager. Ihr Gesicht lag im Schatten eines tief hereingezogenen Kopftuchs. „Heute, beim Richten eines großen Steines, ist dieser abgerutscht und hat seinen linken Unterarm getroffen. Er ist völlig durchgebrochen.“
„Setzt euch!“, sagte Bartholomäus bestimmt und wies auf die Stühle am Tisch. Schnell räumte er die Blätter zur Seite, dann forderte er den Verletzten auf, den gebrochenen Arm auf den Tisch zu legen. Stumm gehorchte er. Langsam löste Bartholomäus den blutigen Verband. Er ging dabei mit einer erstaunlichen Sanftheit vor, die ihm die beiden Besucher gar nicht zugetraut hätten.
Als die Wunde freigelegt war, erkannte er sofort den offenen Bruch. Beide Knochen des Unterarms waren kurz hinter dem Handgelenk abgeknickt. Einer stand spitz aus dem Fleisch. Die Wunde blutete nur noch schwach. Bartholomäus hatte schon häufiger derartige Verletzungen behandelt.
„Wird mein Mann seine Hand verlieren?“ Die Stimme der Frau zitterte.
Der Scharfrichter gab keine Antwort. Stattdessen stellte er die Laterne näher, so dass er besser sehen konnte. Vorsichtig tastete er den Bruch ab. Der Verletzte stieß ein gepresstes Stöhnen aus.
„Ich denke, man kann die Hand erhalten. Dazu muss ich aber den Bruch richten, damit die Knochen wieder zusammenwachsen können. Das wird sehr schmerzhaft werden.“
„Tut bitte, was Ihr könnt“, flehte die Frau. „Wir haben fünf Kinder und mein Mann muss arbeiten, damit wir leben können.“
Bartholomäus nickte, dann drehte er sich um, nahm den Leuchter vom Tisch und ging ins Schlafzimmer. Er rüttelte seine schlafende Frau unsanft an der Schulter. „Frau, steh auf, ich brauche deine Hilfe.“
Es dauerte einen Moment, ehe Waltrud aus dem Tiefschlaf in die Gegenwart zurückfand.
„Was ist?“, fragte sie mit belegter Stimme.
„Du musst mir helfen, einen Bruch zu richten. Der Knochen hat die Haut durchbohrt.“
„Ich komme“, murmelte sie und schob sich unter der Bettdecke hervor.
„Beeil dich!“, erwiderte Bartholomäus. „Wir brauchen den betäubenden Tee aus dem Kräuterbuch und deine Wundsalbe.“
Waltrud wusste, was er meinte. Schon seit Jahren hatte sie sich mit der Herstellung schmerzlindernder und heilender Salben beschäftigt, die ihr Mann in den Fällen einsetzte, in denen er einen Angeklagten zwar körperlich strafen musste, der Betroffene aber an den Folgen nicht sterben sollte. Ihre Kenntnisse hatte sie dank der Aufzeichnungen, die Bartholomäus aus dem Haus der verbrannten Hexe mitgebracht hatte, deutlich erweitern können. Hierzu gehörte auch die Herstellung des Betäubungstees.
Waltrud nickte den beiden Besuchern kurz zu, dann schürte sie das Feuer an. Während die beiden ängstlich und schweigend auf ihren Stühlen saßen und mit großen Augen die Vorbereitungen verfolgten, ergriff sie einen kleinen Kessel, schöpfte am Brunnen eine geringe Menge Wasser und hängte ihn über die Flammen. Aus einem Regal nahm sie den Topf mit der Heilsalbe und stellte ihn bereit. Währenddessen richtete ihr Mann ein kleines scharfes Messer, Binden und Stöcke her, um den Bruch nach dem Richten schienen zu können.
Sobald das Wasser kochte, hob Waltrud den Kessel vom Feuer, stellte ihn auf einen Stein und gab die abgemessene Menge eines Pulvers und verschiedene Kräuter ins Wasser. Dieser Trunk nach dem Rezept der Hexe war eine Mischung aus getrocknetem Maulbeersaft, Mohnextrakt, Bilsenkraut und Schierling. Dazu gab sie eine geringe Prise getrockneter Alraunwurzel. Diese Mischung hatte eine betäubende Wirkung und würde dem Patienten den Schmerz der Operation erträglicher machen.
Nach einigen Minuten war das Gebräu zubereitet. Mit Hilfe einer Schöpfkelle tränkte sie ein Tuch mit dem Sud, dann ging sie zu dem Verletzten und hielt es ihm unter die Nase.
„Atme das ein, dann wirst du einschlafen und den Schmerz nicht spüren!“
Zögernd folgte der Mann ihrer Anweisung. Nach einigen Minuten sank sein Kopf zur Seite. Die Dämpfe der Mischung hatten ihre betäubende Wirkung entwickelt. Waltrud gab ihrem Mann ein Zeichen.
„Du, Weib, umfass den Oberkörper deines Mannes, damit er nicht vom Stuhl rutscht, und du, Frau, hältst den verletzten Arm. Es muss jetzt schnell gehen!“
Die beiden Frauen befolgten seine Anweisungen. Bartholomäus hob das kleine Messer und erweiterte mit einem kurzen Schnitt die offene Wunde. Sofort floss das Blut wieder stärker. Dann ergriff er die Hand des Steinmetzes und zog den Bruch mit einer flüssigen Bewegung gerade. Seine Frau hielt dagegen. Trotz der Betäubung stöhnte der Mann laut vor Schmerz, wachte aber nicht auf. Mit dem Daumen drückte Bartholomäus den herausstehenden Knochen in den Arm zurück, wobei er darauf achtete, dass die beiden Teile wieder zueinanderfanden.
Behutsam strich seine Frau jetzt von der blutstillenden Heilsalbe auf die Wunde und umwickelte sie mit einem schmalen Leinenstreifen. Um den Bruch ruhigzustellen, legte der Scharfrichter nun die Schienen an und fixierte sie mit Binden.
„Du musst einmal in der Woche hierherkommen, damit ich den Verband und die Schienen erneuern kann“, erklärte Bartholomäus der Frau. „Dein Mann darf zwischenzeitlich mit der Hand nicht arbeiten. Zwei Monate, dann kann er sie wieder benutzen.“
Waltrud öffnete ein Fläschchen mit hochkonzentriertem Essig und hielt sie dem Betäubten unter die Nase. Einen Augenblick später begannen seine Augenlider zu flackern. Langsam kam er zu sich.
Nachdem der Mann wieder voll bei Sinnen war, bedankten sich die beiden bei dem Henkerehepaar. Die Frau des Steinmetzes legte zwei Gulden auf den Tisch und sie verließen das Anwesen. Morgen, bei Tage, wenn sie dem Scharfrichter oder seiner Frau in der Stadt über den Weg laufen würden, würden sie die Straßenseite wechseln.
Bartholomäus und seine Frau wuschen sich die Hände am Brunnen, dann legte sich Waltrud wieder ins Bett. Bartholomäus schloss noch die Truhe, dann suchte er ebenfalls das Lager auf. Für morgen hatte der Inquisitor des Fürstbischofs die peinliche Befragung zweier der Hexerei beschuldigter Frauen angeordnet. Diese anstrengende Arbeit verlangte einen ausgeruhten Henker.
Am 16. Juli 1631 starb Philipp Adolf von Ehrenberg auf der Feste Marienberg. Am 7. August wählte das Domkapitel von Würzburg Franz von Hatzfeld als seinen Nachfolger. Am 18. Oktober desselben Jahres fielen die Schweden unter Gustav Adolf in Würzburg ein und eroberten die Festung auf dem Marienberg. Zu diesem Zeitpunkt war der Fürstbischof bereits nach Köln geflüchtet.
Als die Schweden herannahten, flüchteten Würzburger Bürger, darunter auch der Scharfrichter Bartholomäus mit Familie, auf die als uneinnehmbar geltende Burg. Es war ihm gelungen, auf dem Henkerswagen einen Teil seiner Habe, darunter auch die Truhe mit den Aufzeichnungen der Hexe, in Sicherheit zu bringen.
Die Verteidiger der Festung unternahmen mehrmals Ausfälle gegen die Belagerer. Hierfür nutzten sie Tore, die in den äußeren Befestigungsring eingebaut waren. In den zahlreichen unterirdischen Gängen sammelten sich die Kämpfer und stürzten sich überraschend auf die Belagerer, um sie zurückzudrängen. Alle wehrhaften Männer der Burg beteiligten sich bei diesen Angriffen, auch Bartholomäus. Bei einem dieser Ausfälle geriet er in Gefangenschaft. Ein Denunziant verriet seine Identität an die Schweden. Da man ihm vorwarf, zahlreiche angeblich mit dem Teufel im Bunde stehende Lutheraner hingerichtet zu haben, wurde er vom schwedischen Obristen kurzerhand zum Tode verurteilt. Noch in der gleichen Stunde schlug ihm ein schwedischer Soldat den Kopf ab.
Nachdem die Festung gefallen war, vertrieb man viele Menschen, die dort Zuflucht gefunden hatten, ohne Hab und Gut. Dieses Schicksal erfuhr auch die Familie des Scharfrichters. Ihre Spuren verwehten mit dem Staub der Geschichte.
Die Aufzeichnungen der alten Kräuterhexe landeten auf Umwegen bei einem Mönch, der in der Bibliothek des Fürstbischofs beschäftigt war. Da er sie für aufbewahrenswert befand, stellte er sie in ein Regal zu anderen Kräuterbüchern, wo sie unbeachtet verstaubten.
* Inschrift eines Richtschwertes im Scharfrichtermuseum Pottenstein, Bayern
* Historisch belegt.
IM SOMMERLICHEN WÜRZBURG
Hinter Xaver Marschmann schloss sich langsam die automatische Eingangstür zum Bau D8 der Universitätsklinik Würzburg, in dem die Hautklinik untergebracht war. Marschmann atmete befreit die frühsommerliche Brise ein. Seit er hier vor vier Jahren an einem bösartigen Hauttumor operiert worden war, unterzog er sich vierteljährlich einer Nachsorgeuntersuchung. Jedes Mal folgte ein befreites Aufatmen, wenn die Diagnose für ihn, so wie heute wieder, positiv ausgefallen war. Der pensionierte Kriminalbeamte setzte seine Sonnenbrille auf und schlenderte über das Klinikgelände in Richtung seines Autos, das er ein ganzes Stück entfernt geparkt hatte. Marschmann musste insgeheim grinsen. Die Finger der Ärztin, die ihn untersucht hatte, waren trotz der sommerlichen Temperaturen eiskalt gewesen. Die Gute sollte vielleicht öfter mal zur Anregung ihres Kreislaufs einen Schoppen trinken, dachte er. Er nahm sich vor, ihr bei seinem nächsten Termin einen Bocksbeutel aus seinem Weinkeller mitzubringen.
Auf dem Weg zu seinem Auto kam Marschmann am öffentlichen Klinik-Café vorbei. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Es war noch früh am Vormittag, bis zum Stammtisch fast noch zwei Stunden Zeit. Marschmann entschied, sich zur Feier des erfreulichen Untersuchungsergebnisses einen Kaffee und ein Stück Kuchen zu gönnen.
Weil er seit seiner Erkrankung direkte Sonneneinstrahlung möglichst mied, setzte er sich vor dem Café in eine schattige Ecke. Während er auf die Bedienung wartete, schob er seine Sonnenbrille auf die Stirn und studierte die Karte.
Es dauerte einen Augenblick, bis sich die Stimme so in sein Bewusstsein drängte, dass sie seine Kuchenfantasien verdrängte. Der ehemalige Kriminalbeamte stutzte, dann konzentrierte er sich. Diese Stimme! Niemals in seinem Leben würde er diese Stimme vergessen! Aber das konnte doch gar nicht sein! Der Mann, dem seiner Erinnerung nach diese Stimme gehörte, war seit Jahren tot!
Langsam hob er den Blick und spähte über den Rand der Kuchenkarte hinweg. Einige Meter von ihm entfernt erschienen zwei Männer. Der ältere der beiden saß in einem Rollstuhl. Sein geschientes Bein lag auf einer Fußauflage. Der Mann, dessen Stimme Xaver Marschmann so elektrisiert hatte, schob das Gefährt.
Die beiden entschieden sich für einen Tisch ein Stück entfernt. Der Begleiter des Rollstuhlfahrers setzte sich mit dem Rücken zu Marschmann. Marschmann konnte zwar nicht verstehen, worüber sie sich unterhielten, aber die Melodie der Stimme bohrte sich in seine Wahrnehmung und weckte eine höchst unangenehme Erinnerung. Wie es sich anhörte, sprachen die beiden Englisch.
In diesem Augenblick wurde die Terrasse von drei jungen Krankenschwestern aufgesucht, die sich zwischen Marschmann und den beiden Personen, die seine Aufmerksamkeit geweckt hatten, niederließen. Darüber hinaus wurde der Kriminalbeamte von der Bedienung, die ihn nach seinen Wünschen fragte, in seiner Konzentration gestört. Marschmann bestellte eine Tasse Kaffee. Den Kuchen verkniff er sich jetzt, weil er einsatzbereit bleiben wollte, falls die beiden die Terrasse wieder verließen. Als ihm die Bedienung kurz darauf den Kaffee servierte, zahlte er gleich.
Marschmann griff sich vom Nebentisch eine liegengebliebene Zeitung. Ein altes, aber probates Mittel der Tarnung bei der Observierung von Personen. Unbewusst war der pensionierte Kriminalbeamte wieder in die Rolle des Ermittlers geschlüpft.
Knapp zwanzig Minuten später rief der Mann mit der auffälligen Stimme die Bedienung, zahlte, erhob sich und fasste den Rollstuhl bei den Griffen. Marschmann wartete, bis sie die Terrasse verlassen hatten, dann setzte er seine Sonnenbrille auf und folgte ihnen in einiger Entfernung.
An der nächsten Straßenecke blieben die beiden Männer stehen. Marschmann stellte sich in den Eingangsbereich der hier angrenzenden Kinderklinik und tat so, als studierte er einen Aushang. Die beiden Männer wechselten noch einige Worte. Im nächsten Augenblick wandte sich der Mann im Rollstuhl ab und trieb sein Gefährt mit den Händen in Richtung Uni-Zentrum. Der Typ, der Marschmanns Interesse geweckt hatte, blickte kurz hinterher, dann drehte er sich um und marschierte den gleichen Weg wieder zurück. Der ehemalige Polizeibeamte beeilte sich, den Eingangsbereich der Kinderklinik zu betreten, damit er nicht gesehen wurde. Als der Mann vorbei war, verließ Marschmann seine Deckung und folgte ihm. Wie es aussah, hatte der Mann sein Auto auf dem gleichen Parkplatz abgestellt wie er.
Marschmann sollte Recht behalten. Zehn Minuten später beobachtete er, wie der Verfolgte auf dem Parkplatz der Kopfklinik in ein schwarzes Fahrzeug gehobener Klasse stieg, wo er sofort anfing zu telefonieren. Dies gab Marschmann die Möglichkeit,