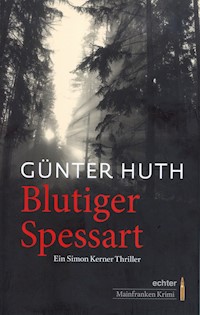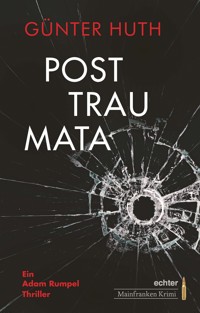Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein geheimnisumwittertes Schloss im Spessart, in das eine Schönheitsklinik eingezogen ist, ein skrupelloser Bestatter, aufgetauchte, unbekannte Leichen: Simon Kerner wird in seinem dritten Fall mit Abgründen an menschlicher Brutalität und grenzenloser Gier konfrontiert. Seine Ermittlungen führen ihn in die morbide Welt der Schönen und Reichen, die für ihr persönliches Wohlergehen sprichwörtlich über Leichen gehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GÜNTER HUTH
Todwald
GÜNTER HUTH
Todwald
Der Spessart tötet leise
Ein Simon Kerner Thriller
Günter Huth wurde 1949 in Würzburg geboren und lebt seitdem in seiner Geburtsstadt. Er kann sich nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben. Er war von Beruf Rechtspfleger (Fachjurist), ist verheiratet und hat drei Kinder. Seit 1975 schreibt er in erster Linie Kinder- und Jugendbücher, Sachbücher aus dem Hunde- und Jagdbereich. Außerdem hat er bisher Hunderte Kurzerzählungen veröffentlicht. In den letzten Jahren hat er sich vermehrt dem Genre Krimi zugewandt und in diesem Zusammenhang einige Kriminalerzählungen veröffentlicht. 2003 kam ihm die Idee für einen Würzburger Regionalkrimi. »Der Schoppenfetzer« war geboren. Diese Reihe hat sich mittlerweile als erfolgreiche Serie in Mainfranken und zwischenzeitlich auch im außerbayerischen »Ausland« etabliert. 2013 ist der erste Band der Simon-Kerner-Reihe mit dem Titel »Blutiger Spessart« erschienen. Der Autor ist Mitglied der Kriminalschriftstellervereinigung »Das Syndikat«. Seit 2013 widmet er sich beruflich dem Schreiben.
Die Handlung und die handelnden Personen dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ist nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig.
»Die Organtransplantationenschaffen verzwickte theologische Problemefür den Tag der Auferstehung.«
Gerard Hartley
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Epilog
Prolog
Er schwebte in absoluter Dunkelheit. Das Bewusstsein der eigenen Existenz kehrte nur sehr langsam zurück. Für eine nicht messbare Zeit empfand er sich in einem angenehmen körperlosen Schwebezustand, der ihm das unbestimmte Gefühl von Wärme und Geborgenheit suggerierte. Zögerlich, fast widerwillig, fand er in die Gegenwart zurück. Sein erstes reales Empfinden war höchst unangenehm und dominierte schlagartig seine übrigen Wahrnehmungen: Seine Zunge war geschwollen und fühlte sich wie ein Fremdkörper an. Er kannte diese sandige Trockenheit und den damit verbundenen ekelhaften Geschmack zur Genüge. Schon viele Male war er nach einem Alkoholexzess so aufgewacht. Er schluckte hart. Es dauerte etwas, bis er so viel Speichel gesammelt hatte, dass das Schlucken einigermaßen schmerzfrei geschah.
Mühsam öffnete er die Augen. Er erschrak zutiefst. Seine Wahrnehmung veränderte sich nicht! Mehrmals hintereinander senkte und hob er die Augenlider, aber die völlige Dunkelheit blieb. War er erblindet? Hastig wollte er sich mit der Hand über die Augen fahren. Aber das war nicht möglich! Es dauerte einige Zeit, bis er begriff. Seine Hände waren fixiert, unverrückbar festgebunden. Jetzt spürte er auch seinen übrigen Körper. Er musste nackt sein, denn seine Haut hatte direkten Kontakt mit der glatten, kühlen, aber nicht harten Unterlage, auf der er festgeschnallt war. Deutlich fühlte er mehrere über seinen Körper gespannte breite Bänder, die so gut wie keine Bewegungen zuließen. Die Arme waren an seiner Seite fixiert. Lediglich den Kopf konnte er etwas hin und her bewegen. Die wohlig warme Geborgenheit verflüchtigte sich. Mit seinen frei beweglichen Fingerspitzen berührte er die nackte Haut seines Oberschenkels. Er war teilweise mit einem Tuch zugedeckt.
Langsam kroch Panik in ihm hoch. Was war mit ihm geschehen? Wo befand er sich? Er öffnete den Mund und gab einige krächzende Laute von sich. Das Ergebnis war ein trockener Husten, der seinen Brustkorb erschütterte. Er wollte tief Atem holen, doch das wurde durch den unnachgiebigen Brustgurt erschwert. Für einen Moment hatte er das schlimme Gefühl, ersticken zu müssen.
»Hallo …«, krächzte er kläglich. Dann lauter: »Hallo, ist da jemand?«
Das Geräusch einer sich öffnenden Tür fiel mit dem Aufflammen mehrerer greller Neonlampen zusammen, deren Licht wie Blitze auf seine Netzhaut traf und ihn zwang, geblendet die Augen zu schließen.
Er hörte harte Schritte, die sich ihm näherten. Mit zusammengekniffenen Augen versuchte er den Menschen zu erkennen, der sich jetzt über ihn beugte.
»Bitte … bitte …«, stammelte er. »Was ist …?«
Die blonde Frau, deren Gesicht hinter einer Schutzmaske verborgen war, blieb neben ihm stehen und musterte ihn aus kalten Augen. Jetzt sah er, dass sie einen weißen Kittel trug. War sie eine Ärztin?
»Bitte, wo bin ich? Was geschieht mit mir?« Die trockenen Stimmbänder versagten ihm fast den Dienst. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Die Angst trieb seinen Blutdruck in die Höhe. Neben ihm begann ein Kontrollgerät im Rhythmus seines rasenden Herzens zu piepsen.
Die Frau zeigte keinerlei Reaktion auf seine Fragen. Langsam griff sie in ihre Kitteltasche und holte eine aufgezogene Spritze hervor. Ohne ein Wort der Erklärung schob sie das Tuch vom Arm des Gefesselten und trieb die Nadel in einen Zugang, den er an seinem Handrücken erkennen konnte. Gleichmäßig, ohne Hast, drückte die Frau den Kolben herunter und die klare Flüssigkeit in der Spritze gelangte in seinen Blutkreislauf. Alle seine Abwehrversuche wurden von den Fesseln unterbunden. Die Frau blieb stehen und beobachtete über den Monitor des Kontrollgeräts wortlos, wie das Medikament wirkte.
Die Betäubung kam wie eine heftige Welle und schwemmte jegliche Gedanken weg. Das Letzte, was er spürte, war die Rückkehr eines unbestimmten Gefühls von Wärme und Geborgenheit.
1
Dr. Simon Kerner, Direktor des Amtsgerichts Gemünden am Main und in dieser Eigenschaft auch Vorsitzender des Schöffengerichts dieser Behörde, sah leicht verärgert auf seine Armbanduhr. Es war zehn Uhr zwölf. Die Protagonisten des Prozesses gegen Georg Habermann wegen Verdachts des Raubes, der Staatsanwalt, die Schöffen, der Angeklagte und die Zeugen, waren alle versammelt und saßen auf ihren Plätzen. Auch einige Zuschauer dieser öffentlichen Strafsitzung warteten auf den Prozessbeginn. Dieser war für zehn Uhr angesetzt gewesen.
Der Angeklagte, ein eher schmächtiger Mann von achtundzwanzig Jahren, der in seinem billigen grauen Anzug wie verkleidet aussah, saß etwas verloren auf der Anklagebank. Nervös fuhr er sich zum wiederholten Male mit der Hand über sein pomadisiertes Haar. Seine Augen in dem schmalen, blassen Gesicht streiften ständig den Eingang des Sitzungssaals. Sie suchten nach seinem Verteidiger, der als einziger Prozessbeteiligter bisher noch nicht aufgetaucht war.
»Frau Wetterstein, gehen Sie doch bitte mal raus und erkundigen Sie sich bei der Pforte, ob Rechtsanwalt Schnitter bereits im Hause ist. Sollte das nicht der Fall sein, dann rufen Sie bitte in seiner Kanzlei an und fragen Sie nach, wo er bleibt.«
Die angesprochene Protokollführerin nickte und erhob sich von ihrem Platz am Kopf des Richtertisches. Mit fliegender Amtsrobe eilte sie hinaus. Kerner wandte sich an die Menschen im Sitzungssaal.
»Tut mir leid, meine Damen und Herren, aber ich werde den Beginn der Sitzung um fünfzehn Minuten verschieben. Ich möchte diesen Strafprozess, wenn irgend möglich, heute zu Ende bringen. Herr Staatsanwalt, meine Herren Schöffen, wir warten am besten oben in meinem Dienstzimmer. Meine Sekretärin wird Ihnen gerne einen Kaffee anbieten.«
Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sowie die beiden Laienrichter und Kerner erhoben sich und verließen den Sitzungssaal. Im Hinausgehen winkte Kerner den Dienst habenden Justizwachtmeister zu sich.
»Herr Nottger, sorgen Sie bitte dafür, dass die Prozessbeteiligten hier vor dem Sitzungssaal bleiben und sich der Angeklagte von den Zeugen fernhält.« Der Justizwachtmeister nickte und baute sich mit verschränkten Armen vor dem Sitzungssaal auf.
Kerner saß mit den beiden Schöffen am Besprechungstisch seines Dienstzimmers und unterhielt sich mit ihnen über den Prozess. Der Staatsanwalt hatte sich entschuldigt. Er war vor das Gerichtsgebäude gegangen, um eine Zigarette zu rauchen. Innerhalb des Hauses herrschte Rauchverbot.
Kurz vor Ablauf der fünfzehn Minuten klopfte es an die Tür des Büros und die Protokollführerin trat ein.
»Tut mir leid, Herr Kerner«, erklärte sie etwas gestresst, »es hat bis jetzt gedauert, bis ich eine telefonische Verbindung mit der Kanzlei Schnitter bekommen habe. Die Leitung war ständig belegt.«
»Und…?«, fragte er ungeduldig.
»In der Kanzlei scheint alles drunter und drüber zu gehen. Wie mir die Bürochefin sagte, ist Rechtsanwalt Schnitter heute nicht dort erschienen. Seine Akten für den heutigen Strafprozess liegen unberührt auf seinem Schreibtisch. Sie versuchen ständig ihn zuhause zu erreichen, aber er geht nicht ans Telefon. Die Mitarbeiterinnen sind ziemlich ratlos.« Sie sah Kerner abwartend an.
Dieser erhob sich und zog ärgerlich seine Robe wieder an. »Die hätten uns ja auch verständigen können! In diesem Fall bleibt mir nichts anderes übrig, als den Termin zu vertagen. Der Angeklagte hat selbstverständlich das Recht auf die Anwesenheit seines Verteidigers. Bin gespannt, welche Erklärung Schnitter für sein Versäumnis hat.« Er sah die wartende Protokollführerin an. »Sagen Sie bitte dem Staatsanwalt Bescheid. Wir gehen schon mal in den Sitzungssaal.«
Zehn Minuten später war der Prozess vertagt und alle Prozessbeteiligten entlassen. In sein Büro zurückgekehrt, legte Kerner das Aktenbündel auf seinen Schreibtisch, hängte seine Robe in den Schrank und zog die weiße Krawatte aus. Langsam setzte er sich in seinen Bürostuhl und kippte die Lehne nach hinten. Das Verhalten von Rechtsanwalt Werner Schnitter verwunderte ihn schon sehr. Der Anwalt war nach seiner Erfahrung ein zuverlässiger Strafverteidiger, der sehr um seine Mandanten bemüht war. Unentschuldigtes Fernbleiben von einem Prozess war bisher noch nie vorgekommen. Bei einer Erkrankung hätte er doch sicher angerufen.
Außerhalb des Gerichtssaals duzten sich Kerner und Schnitter. Sie waren Mitglieder im selben Fitnessclub, hatten schon öfters gegeneinander Squash gespielt und nach der anschließenden Sauna ein Bierchen getrunken. Aus Gesprächen wusste er, dass Schnitter unverheiratet war und keine Kinder hatte. Der Beruf war sein Lebensinhalt, allerdings gönnte er sich jedes Jahr eine längere Reise ins Ausland. Mehr wusste Kerner nicht über den Anwalt.
Simon Kerner hatte für einen Moment ein merkwürdiges Gefühl. Mit einem Kopfschütteln schob er diese Empfindung beiseite. Sicher gab es für den Vorfall eine ganz simple Erklärung. Er beugte sich nach vorne, schlug die Akte Habermann auf und formulierte handschriftlich eine entsprechende Aktennotiz.
2
Der kräftige Mann hinter der dicken Glasscheibe erhob sich und kam sichtlich verärgert aus der Portiersloge.
»Professor, du kennst die Regeln! Wenn du besoffen bist, kommst du hier nicht rein!«
Der mit »Professor« Angesprochene war ein hagerer Mann mittleren Alters, den die Spuren eines Lebens auf der Straße deutlich älter aussehen ließen. Die untere Gesichtshälfte verschwand unter einem ungepflegten Vollbart. Den Rest seiner wettergegerbten Physiognomie schirmte ein breitrandiger Hut ab, dessen Krempe er sich tief in die Stirn gezogen hatte. An den Händen trug er trotz der angenehmen frühsommerlichen Temperaturen fingerlose Wollhandschuhe, die allerdings bereits leicht in Auflösung begriffen waren. Seine übrige Kleidung, planlos zusammengewürfelte Sachen aus einer Kleiderspende, befand sich in ähnlichem Zustand. Der intensive Alkoholgeruch, den sein Atem mit sich trug, überdeckte kaum den unangenehmen, säuerlichen Geruch nach altem Schweiß, der ihn umgab wie eine Aura. Auf dem Rücken trug er einen größeren olivfarbenen, fleckigen Rucksack, dem ein Schlafsack untergeschnallt war.
Er ließ die zwei Plastiktüten in seinen Händen, die einen weiteren Teil seines spärlichen Hab und Guts enthielten, einfach auf den Boden rutschen. Mit wässrigem Blick fixierte er den Leiter der Obdachlosenunterkunft. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand deutete er drohend auf dessen Brust.
»Meyer, du Arschloch, lass mich rein, sonst gibt’s was auf die Zwölf!«, stieß er verwaschen hervor. »Ich bin nicht besoffen!«
»… und ich bin der Kaiser von China«, gab Ronald Meyer scharf zurück. Die Beleidigung perlte an ihm ab wie Wasser. Da war er Schlimmeres gewöhnt. Er hatte seine einschlägigen Erfahrungen mit den Übernachtungsgästen, die zur Schlafenszeit in die Pension Heimkehr kamen, wie die Würzburger Obdachlosenunterkunft für Männer offiziell hieß. Es gab Stammkunden, aber auch einige, die nur gelegentlich von dem Angebot Gebrauch machten. Sie kamen, um sich wieder einmal satt zu essen, zu duschen und zu schlafen. Viele aber auch deshalb, weil dieser Ort einfach sicherer war als die Straße, wo sie immer der Gefahr ausgesetzt waren, von irgendwelchen Schlägern zum Spaß verprügelt zu werden. Der Professor gehörte zur zweiten Gruppe.
Meyer griff durch das Fenster seiner Portiersloge in einen Karteikasten und zog eine Karte. Nachdem er kurz darauf geschaut hatte, taxierte er den Professor mit einem kalten Blick. Er überlegte. Dann traf er eine Entscheidung. Einen Moment lauschte er ins Haus. Im nächsten Stockwerk hörte man vereinzelte Männerstimmen, ansonsten war Ruhe. Er senkte die Stimme.
»Ausnahmsweise will ich mal nicht so sein, weil wir nicht voll belegt sind. Wenn du dich zusammenreißt und keinen Ärger machst, lass ich dich heute Nacht hier schlafen.«
»Alles klar!«, gab der Professor zurück und schlug Meyer mit der Hand kumpelhaft auf den Rücken. »Bist kein Arschloch!« Er stieß ein raues Lachen aus.
»Mensch, mach nicht solchen Lärm«, zischte der Heimleiter wütend, packte ihn am Arm und drängte ihn durch eine Tür, die in das Parterre des Wohnheims führte. Hier befanden sich der Speisesaal und das Büro Meyers. Daneben gab es noch einen Behandlungsraum für medizinische Notfälle. Dorthinein bugsierte Meyer den Obdachlosen. Seine beiden Plastiktüten hatte er ihm mitgebracht.
»Was soll das …?«, wollte der Professor protestieren. Er wusste, die Schlafräume lagen im ersten Stock.
»Hier auf der Liege kannst du pennen«, erklärte Meyer. »Ich will nicht, dass die anderen merken, dass ich bei dir eine Ausnahme mache. Morgen früh bist du aber vor den anderen wieder weg. Und mach hier ja keine Sauerei!« Die Liege war mit einer dicken, straffen Kunststofffolie überzogen, so dass sie bei Bedarf leicht desinfiziert werden konnte. Der Professor murmelte etwas Unverständliches. Hier, im Warmen, wurde er schlagartig müde. Mit einer routinierten Bewegung zog er den Rucksack vom Rücken und ließ ihn auf den Boden fallen. Ihm folgten der Mantel und eine untergezogene Jacke.
»Du kannst nebenan meine Toilette benutzen«, erklärte Meyer, der ihn aufmerksam beobachtete. Während der Obdachlose das WC benutzte, blieb der Heimleiter auf dem Flur stehen und wartete. Meyer war nervös. Er musste auf jeden Fall verhindern, dass der Mann mit anderen Übernachtungsgästen zusammentraf. Als er schon nachsehen wollte, wo der Professor so lange blieb, öffnete sich die Tür und er kam heraus, mit ihm ein Schwall schlechter Luft.
Meyer ignorierte sie und schob den maulenden Professor mit Nachdruck in den Behandlungsraum. »So, jetzt Ruhe, sonst fliegst du wieder raus.«
»Ja, ja«, brabbelte der Professor, legte sich in seinen Kleidern nieder und deckte sich mit einer Wolldecke zu, die Meyer ihm gegeben hatte. Als der Heimleiter das Licht löschte und wortlos das Zimmer verließ, begann der Mann auf der Liege bereits zu schnarchen. Das lautlose Drehen des Schlüssels im Schloss bekam er nicht mehr mit.
Angespannt auf seiner Unterlippe kauend ging Meyer zurück in seine Loge. Sofort griff er sich wieder den Karteikasten. Dies war seine persönliche Kundenkartei. Die Daten der Männer, die hier eincheckten, wurden von ihm so weit wie möglich erfasst. Meyer griff bei dem Buchstabenreiter »S« in die Karteikarten. Der Professor hatte ihm bei seinem ersten Besuch der Heimkehr einen alten Blutspendeausweis vorlegen können. Ein anderes Ausweisdokument besaß er nicht. Danach hieß er im bürgerlichen Leben Werner Senglitz, war am 12. Mai 1968 geboren und wohnte früher in der Pestalozzistraße 166 in Lohr am Main. Blutgruppe AB, Rhesus negativ. Aus Gesprächen mit ihm hatte Meyer herausgehört, dass er anscheinend über eine akademische Bildung verfügte. Welches Schicksal ihn auf die Straße getrieben hatte, war ihm allerdings unbekannt. Meyer zögerte noch einen Moment, schließlich gab er sich einen Ruck, griff zum Telefon und wählte. Das Gespräch bestand nur aus wenigen Sätzen.
Eine gute Stunde nach Mitternacht vibrierte Meyers lautlos gestelltes Mobiltelefon. Es war der erwartete Anruf. Mit einem knappen »Ja.« meldete er sich. Er lauschte kurz in den Hörer, dann erwiderte er: »Ich komme.«
Meyer verließ sein Büro und eilte zum Hintereingang der Heimkehr. Es handelte sich dabei um eine ganz gewöhnliche Haustür, die als Notausgang ausgewiesen war und auch von den wenigen Lieferanten genutzt wurde. Der Ausgang führte in eine schmale, düstere Gasse des Mainviertels, die um diese Uhrzeit menschenleer war. Als Meyer die Straße betrat, hielt bereits ein Rettungswagen des Roten Kreuzes dicht vor der Tür. Meyer warf einen nervösen Blick die Straße entlang, aber wie erwartet war keine Menschenseele zu sehen. Er nickte den beiden Männern, die im Wagen saßen, zu. Beide stiegen aus. Sie trugen die Kleidung von Rettungssanitätern. Der Beifahrer ging wortlos zum Heck des Fahrzeugs, öffnete die beiden Flügeltüren und zog eine zusammengeklappte Trage heraus. Der Fahrer sah Meyer durchdringend an.
»Alles klar?« Sein schwäbischer Akzent war unüberhörbar.
Meyer nickte. Vor Nervosität war sein Mund so trocken, dass er kaum sprechen konnte. »Kommt mit, aber seid leise!«
Sie folgten dem Heimleiter zu dem Behandlungszimmer, in dem der Professor schlief. Meyer schloss leise auf, öffnete die Tür einen Spalt und lauschte. Die drei Männer hörten lautes Schnarchen. Meyer öffnete die Tür weit und der Lichtschein des Flurs fiel auf die auf dem Bauch liegende Gestalt des schlafenden Obdachlosen. Meyer trat einen Schritt zur Seite. Von jetzt an verlief alles sehr schnell und routiniert. Der Schwabe zog eine fertig aufgezogene Spritze aus der Tasche und entfernte die Schutzhülle von der Nadel. Sein Kollege, der die Trage auf den Boden gelegt hatte, trat an den Schlafenden heran, dann warf er sich mit seinem gesamten Körpergewicht auf den Professor. Mit einer Hand hielt er ihm den Mund zu. Die verschreckten Grunzlaute des Überwältigten wurden erstickt. Da war der andere schon heran, schob die Decke zur Seite und ein Hosenbein in die Höhe. Gelassen jagte er ihm die Nadel in eine Vene der Kniekehle. Der Kolben wurde heruntergedrückt und das schnell wirkende Betäubungsmittel drang in den Blutkreislauf des Obdachlosen ein. Es dauerte nur kurze Zeit, dann entwickelte das starke Narkotikum seine Wirkung. Als der Professor erschlaffte, erhob sich der Angreifer von seinem Rücken. Sie lauschten einen Moment auf den Atem des Mannes. Er ging leise, aber gleichmäßig. Ohne Zeitversäumnis luden sie den betäubten Mann auf die Trage, deckten ihn zu, schnallten ihn fest und trugen ihn hinaus zu ihrem Fahrzeug. Meyer trug die Kleidungsstücke, den Rucksack und die Plastiktüten hinterher und legte sie dazu. Die Flügeltüren wurden leise geschlossen und die beiden Männer setzten sich in den Wagen. Der Fahrer drückte Meyer aus dem Fenster heraus einen Umschlag in die Hand.
»Bis zum nächsten Mal«, erklärte er knapp, dann startete er den Motor und das Fahrzeug glitt aus der Gasse. Der ganze Vorgang hatte kaum zehn Minuten in Anspruch genommen.
Dem Heimleiter stand der Angstschweiß auf der Stirn. Als er sich zum Haus umdrehte, glaubte er hinter einem der Fenster im oberen Stockwerk eine schemenhafte Bewegung wahrgenommen zu haben. Dort war einer der Schlafräume. War da ein Gesicht gewesen? Er fixierte das Fenster eine ganze Weile. Aber da war nichts. Wahrscheinlich der Vorhang, beruhigte er sich. Unten im Flur blieb er stehen und lauschte nach oben. Nichts. Bekam er langsam schon Wahnvorstellungen? Er wusste, welche Männer dort oben schliefen. Morgen würde er sie scharf beobachten, ob sie irgendwelche auffälligen Reaktionen zeigten.
Langsam ging er in die Pförtnerloge und zog mit zitternden Händen den Karteikasten zu sich heran. Er entnahm die Karte mit dem Namen Werner Senglitz, dann schlurfte er in sein Büro. Mit fahrigen Fingern schaltete er den kleinen Aktenvernichter ein und schob die Karteikarte des Professors in den Aufnahmeschlitz. Mit einem kurzen ratternden Geräusch verwandelte sich Werner Senglitz in kleinste Schnipsel. Meyer holte eine bauchige Flasche aus dem Seitenschrank des Schreibtisches und gönnte sich einen kräftigen Schluck Weinbrand direkt aus dem Flaschenhals. Brennend lief das hochprozentige Getränk die Kehle hinunter und beseitigte den schalen Geschmack im Mund. Danach fühlte er sich entspannter. Langsam öffnete er den Umschlag und entnahm ihm ein Bündel Banknoten. Ein noch viel besseres Mittel, seine Nerven zu beruhigen und sein Gewissen zum Schweigen zu bringen.
In der Szene nannten sie ihn nur den alten Christoph. Sicher eine treffende Bezeichnung, da der alte Stadtstreicher schon so lange in der Würzburger Innenstadt lebte, dass er von dort nicht mehr wegzudenken war. Jeden Tag saß er an verschiedenen Punkten der Stadt und … strickte. Socken, Schals und Topflappen waren die Produkte, die er von Wolle anfertigte, die ihm Frauen schenkten. Mittlerweile hatte sich eine Art kleiner Kundenstamm gebildet, der ihm seine Produkte abnahm. Die Qualität seiner Arbeiten war erstaunlich. Das wenige Geld, das er mit seiner Handarbeit verdiente, gestattete ihm eine sehr bescheidene Existenz. Kaum einer wusste, dass er sich diese Fertigkeit im Knast angeeignet hatte. Vor vielen Jahren war er wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu mehreren Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden. Als er das Gefängnis wieder verließ, war sein Leben zerstört. Frau und Kinder waren weg, seine berufliche Existenz war verloren mit der Folge, dass er auf der Straße landete, von der er nie mehr loskam.
Allerdings gönnte sich Christoph einen kleinen Hauch von Bürgerlichkeit. Er übernachtete regelmäßig in der Heimkehr. Diese Unterkunft gab ihm ein wenig das Gefühl, am Abend nach Hause zu kommen. Duschen und saubere Bettwäsche waren angenehme zivilisatorische Attribute. Alkohol war ihm verpönt.
Auch heute hatte Christoph rechtzeitig eingecheckt. Nach der Dusche suchte er sein Bett auf. Da er Stammkunde war, bekam er immer dasselbe Lager zugewiesen. Nach dem Duschen hatte er seine Socken gewaschen, die er nun über dem metallenen Kopfteil des Bettes zum Trocknen aufhängte. Es dauerte nur wenige Minuten, dann war Christoph eingeschlafen.
Als er erwachte, war es finstere Nacht. Durch das Fenster des Schlafraumes fiel der Lichtschein einer Straßenlaterne. Seine drückende Blase hatte ihn wieder einmal geweckt. Vermutlich die Anzeichen eines beginnenden Prostataleidens. Er seufzte leise. Auch er musste dem Alter Tribut zollen. Außer ihm schliefen noch zwei Gäste im Raum. Die beiden anderen Betten waren unbelegt. Im Sommer war das nicht ungewöhnlich, weil viele Obdachlose lieber im Freien schliefen. Das laute Schnarchen seiner Zimmergenossen störte ihn nicht weiter. Wahrscheinlich gab er im Schlaf ähnliche Geräusche von sich. Er schwang die Beine aus dem Bett, seine Füße berührten den kalten Plattenboden. Hausschuhe besaß er nicht. Barfuß bewegte er sich zur Tür. Die Toilette lag dem Zimmer schräg gegenüber. Kein langer Weg. Nachdem er sich erleichtert hatte, wollte er gerade wieder den Schlafraum betreten, blieb dann aber stehen. Es war ihm, als hätte er aus dem unteren Stockwerk ein Geräusch gehört. Ein Laut, der nicht zu den üblichen Schlafgeräuschen der Gäste der Heimkehr gehörte. Neugierig, wie Christoph war, schlich er sich zum Treppenhaus und lauschte nach unten. Es wurde zwar nicht gesprochen, aber da waren eindeutig mehrere Menschen aktiv. Er besaß zwar keine Uhr, aber da sich seine Blase immer ungefähr zur selben Zeit meldete, musste es weit nach Mitternacht sein. Das Knarren der Hintertür war unverkennbar. Wie er wusste, wurde das Haus in der Nacht verschlossen, um unerwünschte Besucher fernzuhalten, also war da etwas Ungewöhnliches im Gange.
Christoph überlegte einen Augenblick, dann huschte er zu seinem Schlafraum zurück. Von dort aus konnte er auf die Gasse hinter dem Haus sehen. Wenn er sich beeilte, bekam er vielleicht noch etwas mit. Leise, um seine Zimmergenossen nicht zu wecken, schloss er die Tür und schlich sich zum Fenster. Vor dem Hinterausgang stand ein Rettungsfahrzeug mit dem Roten Kreuz, dessen Heckklappe weit geöffnet war. Zwei Rettungssanitäter schoben gerade eine Trage hinein, auf der eindeutig eine menschliche Gestalt festgeschnallt war. Anschließend schlossen sie die Hecktür und stiegen ein. Christoph lief ein kalter Schauer den Rücken hinunter. Plötzlich tauchte der Heimleiter in der Szene auf. Der Fahrer reichte Meyer etwas durchs Wagenfenster. Das Auto fuhr los. Meyer verschwand. Offenbar war er zurück ins Haus gegangen. Wenig später lag die Gasse wieder verlassen da.
Christoph starrte noch einen Moment auf den dunklen Asphalt, dann beeilte er sich, wieder ins Bett zu schlüpfen. Obwohl die Zudecke warm war, fror Christoph plötzlich bis ins Mark. Sein auf der Straße entwickelter Instinkt für Gefahren sagte ihm, dass sich hier etwas abgespielt hatte, was das Licht des Tages scheute und nicht für seine Augen bestimmt war. Es ging ihn nichts an, wer oder was da auf der Trage gelegen haben mochte. Er würde das Gesehene schleunigst vergessen. Schließlich wollte er keinen Ärger. Es dauerte allerdings ziemlich lange, bis er schließlich wieder in einen unruhigen Schlummer fiel.
Am nächsten Morgen fiel Christoph auf, dass Meyer sich beim Frühstück längere Zeit im Speiseraum aufhielt und die Anwesenden musterte. Dabei starrte er auch ihn an. Der Alte ließ sich nichts anmerken, aber innerlich war er total angespannt. Hatte der Heimleiter ihn heute Nacht bemerkt? Nach dem Frühstück checkte der alte Obdachlose aus und verließ die Heimkehr. Der kritische Blick Meyers folgte ihm bis zum Schluss.
3
Es war dreiundzwanzig Uhr. Die attraktive blonde Frau im eng sitzenden dunkelblauen Kostüm betrat das großzügig geschnittene Wohnzimmer im Erdgeschoss des kubistisch gestalteten, einstöckigen Hauses am Rande des Frankfurter Ostends. Ihr ganzes Auftreten und ihre Ausstrahlung vermittelten Dynamik, Selbstsicherheit und Kompetenz. Mit einem Blick erfasste sie die hochwertige, in SchwarzWeiß gehaltene Einrichtung des Raumes, der von verborgenen Leuchten indirekt erhellt wurde. Die späte Besucherin war erwartet worden. Der Hausherr, der ihr geöffnet hatte, wies auf die Frau, die mit ernster Miene auf der schwarzen Couch saß.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!