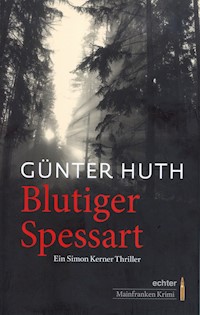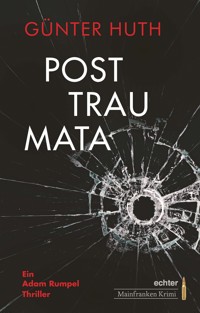Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ein neues Mitglied bei den Schoppenfetzern bricht nach dem ersten Stammtischbesuch zusammen und stirbt kurz darauf. Der mysteriöse Tod des Mannes weckt Erich Rottmanns kriminalistischen Spürsinn, und schon steckt der Exkommissar in einem neuen verzwickten Fall. Dabei kommt er einem selbsternannten Rächer auf die Schliche, der es auf weitere Opfer abgesehen hat - und gerät selbst in dessen Fänge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Huth
Der Schoppenfetzer und die Satansrebe
Günter Huth wurde 1949 in Würzburg geboren und lebt seitdem in seiner Geburtsstadt. Er kann sich nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben. Von Beruf ist er Rechtspfleger (Fachjurist). Günter Huth ist verheiratet und hat drei Kinder.
Seit 1975 schreibt er in erster Linie Kinder- und Jugendbücher sowie Sachbücher aus dem Hunde- und Jagdbereich. Außerdem veröffentlichte er zahlreiche Kurzerzählungen. In den letzten Jahren hat sich Günter Huth vermehrt dem Genre »Krimi« zugewandt und bereits einige Kriminalerzählungen veröffentlicht. 2003 kam ihm die Idee für einen Würzburgkrimi. Der Autor ist Mitglied der Kriminalschriftstellervereinigung Das Syndikat.
Die Handlung und die handelnden Personen dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ist nicht beabsichtigt und rein zufällig.
Günter Huth
DerSchoppenfetzerund die Satansrebe
Der zehnte Fall des Würzburger Weingenießers Erich Rottmann
Buchverlag Peter Hellmund im Echter Verlag
Günter Huth
Der Schoppenfetzer und die Satansrebe
© Echter Verlag, Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Gestaltet von Peter Hellmund
E-Book-Herstellung und Auslieferung von Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
Dritte Auflage 2018
E-Book ISBN 978-3-429-06399-3
www.echter.de
Würzburg im Jahr 1525
Der Bauernaufstand wird durch die Hilfstruppen des Fürstbischofs blutig niedergeschlagen. Ungefähr 8000 Bauern verlieren an den Hängen der Festung Marienberg ihr Leben. Alle Rädelsführer werden hingerichtet oder in Kerkerhaft genommen, darunter auch die Ratsherren der Stadt, die mit den Bauern gemeinsame Sache machten. Unter ihnen befindet sich auch der bekannte Bildhauer Tilman Riemenschneider.
❖
Das Kellerverlies, in das die beiden Kerkerknechte den erschöpften Mann schleppen, ist nicht ganz so düster wie die langen Gänge, durch die er gezerrt worden ist. Er spürt die Hitze auf seinem Gesicht, die von einer Art Esse ausgeht, in der Holzkohlen glühen. Auf den ersten Blick könnte der Keller auch eine Schmiede sein. Aber das Feuer ist nicht dafür bestimmt, Eisen auf dem Amboss formbar zu machen oder Menschen Wärme zu spenden – dies ist die Glut der Hölle. An den Wänden des Kellers hängen zahlreiche Werkzeuge, die bei genauem Hinsehen schnell ihre einzige Bestimmung verraten: Menschen unaussprechliche Qualen zu bereiten.
Fünf Männer erwarten den Gefangenen. Der Gerichtsschreiber, der mit gespitzter Feder hinter einem eichenen Pult steht, blickt dem Delinquenten mit gleichgültiger Miene entgegen. Dieser ist nicht zum ersten Mal in diesem Raum, dessen aus Kalkstein gemauerte Wände vom Ruß der in eisernen Halterungen steckenden Pechfackeln geschwärzt sind.
Auf ein Zeichen des Scharfrichters hin packen zwei der Gesellen den Mann, dessen zerrissene und schmutzige Kleidung davon kündet, dass er sich schon seit längerer Zeit in Kerkerhaft befindet. Er zeigt keinerlei Gegenwehr, als die Männer ihm die Kleidung grob vom Körper reißen.
Der Schreiber sieht auf seine Papiere. „Meister Til, dies ist nun die vierte peinliche Befragung, derer Ihr Euch unterziehen müsst. Zu Beginn wieder die Frage: Seid Ihr nunmehr bereit, Eure Führerschaft beim Aufstand der Bauern gegen unseren hochwürdigen Herrn Fürstbischof zu gestehen? Ihr könntet Euch weitere Torturen ersparen, indem Ihr Eure Schandtaten zugebt. Wenn Ihr Euch weiterhin verstockt zeigt, wird der Scharfrichter das Verhör mit härteren Mitteln fortsetzen.“ Er weist mit dem Finger auf den Henker, der mit vor der Brust verschränkten Armen im Raum steht und den Gefangenen mit grimmiger Miene mustert.
Dieser gibt ein leises Schluchzen von sich, dann schüttelt er jedoch entschieden den Kopf.
Der Schreiber macht sich eine Notiz, dann erklärt er mit emotionsloser Stimme: „Scharfrichter, waltet Eures Amtes.“
Auf einen Wink des Henkers zerren die beiden Knechte den Gefangenen zur Streckbank an der Längsseite des Kerkers.
„Setzt den gespickten Hasen ein!“, befiehlt der Henker knapp. Einer der Knechte holt eine hölzerne Rolle von einem Regal, durch die der Länge nach ein eiserner Stab als Achse hindurchführt. Wie die Rolle zu ihrer ungewöhnlichen Bezeichnung kam, war offensichtlich, denn sie ist gleichmäßig mit langen spitzen Nägeln gespickt. Der Folterknecht fügt die Rolle in eine entsprechende Aussparung in der Streckbank ein. Er kontrolliert, ob sie sich auch leicht drehen lässt, dann packt er den Gefangenen von hinten an den Schultern, während der andere das gleiche an den Beinen macht. Sekunden später liegt der Inhaftierte auf der Streckbank und die Nagelspitzen des gespickten Hasen dringen tief in seinen Rücken. Während die Folterknechte seine Füße und Arme an der Streckvorrichtung der Folterbank festbinden, hallen die Schmerzensschreie des gequälten Mannes von den Wänden des Folterkellers wider. Anschließend tritt der Henker an das seitlich befestigte Rad, mit dem man die Riemen, die an den Handgelenken des Mannes befestigt sind, aufrollen und dadurch eine Streckung des ganzen Körpers erreichen kann – für sich allein schon eine äußerst schmerzhafte Tortur, die durch die Nagelrolle nochmals verstärkt wird.
Der Scharfrichter wirft dem Schreiber einen fragenden Blick zu. Dieser wendet sich an den Gefangenen: „Meister Til, Ihr solltet Euch die Schmerzen durch ein Geständnis ersparen. Es ist ganz einfach. Gesteht und Ihr seid erlöst.“
Der Gefangene wirft den Kopf in heftiger Verneinung von einer Seite auf die andere, woraufhin der Schreiber dem Henker ein Zeichen gibt, das Rad zu drehen. Die Schreie des Mannes steigern sich zu einem unmenschlichen Brüllen.
Margarete fuhr erschrocken aus dem Tiefschlaf hoch. Noch immer hallte in ihren Ohren der Schrei, der sie aus dem Schlaf gerissen hatte. Es dauerte einen Augenblick, ehe sie in die Wirklichkeit zurückfand. Sie setzte sich im Ehebett auf und warf einen besorgten Blick hinüber zu ihrem Mann, der sich unruhig im Bett wälzte und dessen Arme krampfartig zuckten.
Sie legte ihre Hand sanft auf seinen Brustkorb und rüttelte ihn leicht. Sein Nachthemd war völlig nassgeschwitzt. „Til, wach auf!“, sagte sie leise. Sie musste ihre Worte mehrfach wiederholen, ehe Tilman Riemenschneider mühsam aus seinem schlimmen Albtraum erwachte.
„Es war nur ein Traum“, flüsterte sie ihm ins Ohr und drückte seinen Kopf gegen ihre Brust. „Es ist ja alles gut.“ Sanft wiegte sie ihn in ihren Armen.
Tilman Riemenschneider, der bekannte Würzburger Holzschnitzer und Bildhauer, wurde seit dem Tag vor einem Dreivierteljahr, als er aus der fürstbischöflichen Kerkerhaft entlassen worden war, beinahe täglich von derartig schlimmen Träumen gequält. Es hatte Wochen gedauert, bis es Margarete und dem Wundarzt gelungen war, die körperlichen Wunden und Verletzungen der Folter halbwegs zu heilen. Manche Folgen der Verhöre würden wohl nie mehr verschwinden. Man hatte ihm mehrfach die Schultergelenke ausgerenkt. Noch immer hatte er Schwierigkeiten, sich allein anzukleiden. Unermesslich waren die seelischen Verletzungen. Margarete konnte nur ahnen, was ihr Mann hatte erleiden müssen. Er selbst sprach nicht darüber.
Für sie zählte nur, dass der Fürstbischof dem Mann, dessen vierte Ehefrau sie war, das Leben geschenkt hatte. Dafür hatte er zur Strafe den Großteil seines Vermögens und seiner Ländereien verloren. Die meisten Gesellen seiner einstmals florierenden Werkstatt hatte er entlassen müssen. Und auch das Hausgesinde mussten sie bis auf zwei Mägde reduzieren.
Mit dem Ärmel ihres Nachthemdes wischte Margarete ihm den Schweiß aus dem Gesicht.
„Danke“, murmelte er leise und löste sich aus ihrer Umarmung. Schwerfällig erhob er sich und setzte sich auf den Bettrand.
„Wo willst du hin?“, fragte Margarete besorgt.
„Schlaf weiter“, gab er knapp zurück. „Ich muss einen Schluck trinken. Ich habe einen trockenen Mund.“ Mit einer langsamen Bewegung strich er sich die langen gelockten Haare aus dem Gesicht, dann griff er zu seinen Beinkleidern.
„Warte, ich helfe dir“, sagte Margarete und machte Anstalten, das Bett zu verlassen.
„Lass“, gab er fast barsch zurück. Sie wusste, wie sehr er es hasste, seine Gebrechlichkeit vor Augen geführt zu bekommen. Bedrückt blieb sie liegen. Es war für sie nur schwer zu ertragen, dass er nach diesen Träumen von Schlaflosigkeit gequält wurde, die ihn hinunter in seine Werkstatt trieb, wo er dann bis zum Tagesanbruch saß und seine Werkzeuge anstarrte, die er einst so meisterlich zu führen gewusst hatte.
Tilman Riemenschneider verließ das Schlafgemach und tastete sich durch das dunkle Haus in die Küche. An der Glut des Küchenherdes entzündete er einen Kienspan und damit die Kerzen eines Leuchters. Langsam tappte er hinunter in das Kellergewölbe seines Hauses, in dem sich seine private Werkstatt befand. Die große Werkstatt, in der bis vor noch nicht allzu langer Zeit zahlreiche Gesellen gearbeitet hatten, befand sich in einem Anbau des Hofes zum Wolfmannsziechlein in der Franziskanergasse, wo er einstmals als leuchtender Stern am Firmament der bildenden Künste in Würzburg und Umgebung gestrahlt hatte.
Er stellte den Leuchter auf einen Tisch und ließ sich auf einen Hocker nieder. Aus einem Krug schenkte er sich Wein in einen Becher ein und nahm einen Schluck. Der Lichtschein fiel auf die Werkzeuge, die ordentlich an der Wand aufgehängt waren. In eine Werkbank eingespannt, befand sich ein Block aus Lindenholz, der bereits Spuren einer Bearbeitung zeigte. Vorsichtig fuhren seine Finger über das Holz. Monate war es her, dass er einen Stichel und einen Schlegel in der Hand gehalten hatte. Er nahm einen weiteren Schluck.
Um das Jahr 1500 hatte er als Künstler in der näheren Umgebung von Würzburg einen hervorragenden Ruf erlangt und war zu einem wohlhabenden und angesehenen Bürger aufgestiegen. Die Aufträge waren reichlich gekommen, so dass er sie kaum hatte bewältigen können. Er hatte in Würzburg mehrere Häuser besessen, reichlich Grundbesitz mit eigenen Weinbergen und eine florierende Werkstatt. Als er 1504 in den Rat der Stadt Würzburg berufen worden war, befand er sich auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Durch diese öffentlichen Ämter und die Privilegien als Ratsherr, die er zwanzig Jahre lang genoss, hatte er nicht nur sein gesellschaftliches Ansehen gemehrt, sondern auch viele große und lukrative Aufträge bekommen. Von 1520 bis 1524 hatte er sogar das Amt des Bürgermeisters der Stadt inne.
Das Übel und sein Niedergang hatten begonnen, als in den zwanziger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts auch in Würzburg die Reformation Einzug gehalten hatte.
Der Fürstbischof residierte hoch über der Stadt in der Feste Marienberg und führte ein strenges Regiment gegen alle aufwieglerischen Entwicklungen. Zu jener Zeit hatte der Rat der Stadt mit zunehmender Tendenz immer wieder im Zwist mit dem mächtigen Herrn gelegen. Die Situation war außer Kontrolle geraten, als sich 1525 aufständische Bauern vor der Stadt versammelt hatten, gegen den Fürstbischof ins Feld gezogen waren und dieser schließlich fliehen musste. Die Würzburger Bürger hatten sich mit den Bauern verbündet, aber mit diesen eine schreckliche Niederlage erlitten, als das Bauernheer in einer großen Schlacht vernichtet wurde. Die Erde des Schlachtfelds war vom Blut der getöteten Bauern getränkt worden. Die Truppen des Fürstbischofs hatten die Stadt angegriffen und zurückerobert. Der Fürstbischof hatte grausames Gericht unter den Bürgern gehalten und deren vollständige Unterwerfung gefordert. Auch die beteiligten Ratsherren waren eingekerkert und teilweise grausam bestraft worden.
So war auch Tilman Riemenschneider in Haft geraten und gerichtet worden. Zwar war er mit dem Leben davongekommen, hatte aber große Teile seines Hab und Guts verloren – und auch seinen guten Ruf als Künstler. Seine meist kirchlichen Auftraggeber hatten ihn links liegen lassen und so dafür gesorgt, dass er immer mehr in Vergessenheit geraten war.
Tilman Riemenschneider erhob sich schwerfällig und ging in die Ecke seiner Werkstatt, wo sich das Steinlager befand. Der hochgewachsene Mann ging dabei so gebeugt, als müsse er eine schwer Last auf seinen Schultern tragen. Der gesellschaftliche Absturz hatte seine Seele zerstört. Freunde, die einstmals gern seine Gesellschaft gesucht und seine Gastfreundschaft genossen hatten, mieden ihn und sein Haus.
Riemenschneider war ein gläubiger Mensch gewesen. Die Folgen seiner Haft und seiner Bestrafung hatten jedoch seine Gesinnung gewandelt. Was der hohe Herr auf der Festung im Namen Gottes für Grausamkeiten an den Bauern, den Menschen der Stadt und letztlich auch an ihm begangen hatte, war einfach nicht zu verzeihen.
Tilman Riemenschneider betrachtete die Steine, die in verschiedenen Größen vorrätig waren. Er entschied sich schließlich für eine kleine Tafel aus Kalkstein, die ihm für seine Zwecke geeignet erschien.
Er setzte sich wieder auf seinen Hocker und vertiefte sich in die Maserungen der Steintafel. Er wollte ein letztes Werk schaffen, das er jenen widmen würde, die an seinem Unglück Schuld trugen. Kein Werk der Liebe und der Verehrung Gottes, wie es immer seine Motivation gewesen war. Nein, in diese Arbeit wollte er all den Hass und den Zorn hineinlegen, den er tief in seinem Inneren empfand. Er wollte ein Werk schaffen, das den Fluch verkörpert, mit dem er Tag und Nacht in seinen schmerzerfüllten, schlaflosen Nächten die verhasste Obrigkeit auf dem Marienberg belegte.
Meister Til spannte die Steintafel in eine Werkbank ein, dann suchte er sorgfältig einen geeigneten Meißel aus. In seinem Kopf war schon seit Tagen ein Bild herangereift, das er nun zu realisieren gedachte. Dies sollte seine letzte Bildhauerarbeit werden. Mit steifen Fingern führte er die ersten Schläge mit dem Holzschlägel aus. Niemand würde dieses Werk vor seinem Tod zu Gesicht bekommen.
Fast 500 Jahre später in Würzburg
Der Mann betätigte den Lichtschalter und die paarweise angeordneten Neonleuchten ergossen ihr grelles Licht über die Regale, Schränke und aufgestapelten Kisten. Dieser Raum war einer der zahlreichen klimatisierten Magazinräume des Mainfränkischen Museums, in denen eine Vielzahl von Exponaten aufbewahrt wurde, die noch nie den Weg in die Ausstellungsräume des Museums gefunden hatten.
Der Mann musste sich keine große Mühe geben, seinen Aufenthalt in diesem Bereich des Museums zu verheimlichen. Er besaß völlig legal einen Schlüssel. Zudem war es Montag und das Museum für den Publikumsverkehr geschlossen. Es war bereits nach 19 Uhr und die Wahrscheinlichkeit, dass sich um diese Uhrzeit jemand vom wissenschaftlichen Personal hierherverirrte, tendierte gegen null.
Schnell hatte er den gesuchten Gegenstand gefunden. Der Grabstein lagerte fachmännisch auf mehreren gepolsterten Balken und war sorgfältig abgedeckt. Der Mann lüftete die Folie und warf einen flüchtigen Blick auf die vom Zahn der Zeit stark angegriffene Inschrift:
„Anno domini 1531 am abent Kiliani starb der ersam und kunstreich Tilman Riemenschneider bildhauer, burger zu Würzburg, dem got genedig sey. Amen.“
An der Decke des Raumes befand sich eine Laufkatze, mit deren Hilfe sich schwere Gegenstände in diesem Magazin heben und bewegen ließen. Der Mann führte zwei stabile, weich gepolsterte Gurte unter dem Stein hindurch und betätigte die Hebevorrichtung. Als er den Stein an der Außenkante anhob, um ihn erst auf die Seite zu stellen und dann auf die Vorderfront zu legen, traten ihm vor Anstrengung die Sehnen am Hals hervor. Er keuchte. Schließlich hatte er es geschafft. Langsam ließ er die Steinplatte wieder herab. Nun holte er aus der mitgeführten Werkzeugtasche einen Akkubohrer, der mit einem sehr dünnen Steinbohrer bestückt war. Er nahm kurz Maß, dann setzte er den Bohrer an. Das Material war nicht sonderlich hart und der Bohrer drang problemlos ein. Nach wenigen Zentimetern fuhr der Bohrer ins Leere. Er war offensichtlich richtig informiert: In der Rückseite des Grabsteines befand sich tatsächlich ein Hohlraum. Der Mann legte den Bohrer in die Tasche zurück und griff sich einen spitzen Meißel und einen Holzschlägel. Mit wenigen gekonnten Schlägen vergrößerte er das Loch. Bei jedem Schlag sprangen Steinsplitter von der Grabplatte ab.
Als er das Loch vorsichtig so weit geöffnet hatte, dass er in den Hohlraum sehen konnte, holte er eine Taschenlampe hervor und leuchtete hinein. Ein zufriedenes Grunzen entfuhr ihm. Seine Mühe wurde belohnt: Hinter der Rückwand waren die Konturen eines kleinen Steinreliefs zu erkennen. Vorsichtig arbeitete er weiter. Jetzt waren auch die Konturen eines steinernen Einsatzes zu erkennen, mit dessen Hilfe der Steinmetz, der diesen Grabstein einst geschaffen hatte, den Hohlraum im Stein geschickt verschlossen hatte – so kunstfertig, dass man auch bei genauerer Betrachtung keine Anschlussstellen erkennen konnte. Schon bald hatte er diesen Deckel so weit entfernt, dass er eine kleine Steintafel entnehmen konnte.
Aus dem Stein war ein Bildnis herausgearbeitet, das so gut erhalten war, als hätte man es erst gestern in sein Versteck gelegt. Er hielt sich aber nicht lange mit der Betrachtung auf, weil er möglichst schnell wieder von hier verschwinden wollte. Die Tafel schlug er in ein weiches Handtuch ein und schob sie in ein leeres Seitenfach seiner Werkzeugtasche. Dieser Fund war von unschätzbarem Wert. Jetzt machte sich der Mann daran, seine Spuren zu beseitigen. Er kehrte die Steinsplitter zusammen und füllte sie in den Hohlraum der Platte. Aus seiner Tasche holte er die bereits fertige Mischung eines Schnellbinderbetons, aus einer Plastikflasche goss er Wasser in das Pulver und rührte gründlich mit einem Spachtel um. Dann goss er den Brei in den Hohlraum im Stein. Wenige Minuten später war das Loch ausgegossen. Weil er zudem ein Farbpulver untergemischt hatte, war der ausgetrocknete Beton vom natürlichen Stein der Grabplatte bei flüchtigem Hinsehen kaum zu unterscheiden. Sobald der Beton ausgehärtet war, konnte er die Grabplatte wieder umdrehen und endlich verschwinden.
❖
Der international bekannte amerikanische Regisseur Christos Kelleroulos, dessen Wurzeln im unterfränkischen Rimpar lagen, schob mit einem heftigen Ruck den Schild seiner Baseballkappe nach hinten und wischte sich mit einem knallroten Stofftaschentuch den Schweiß von der Stirn. Dann sprang er trotz seiner durchaus fülligen Figur mit einer unerwarteten Dynamik, um nicht zu sagen überraschenden Leichtigkeit aus seinem Klappstuhl. Alle Beschäftigten am Filmset zogen ruckartig den Kopf ein und bewegten sich unauffällig außer Reichweite des Filmemachers. Diejenigen unter ihnen, die schon öfters mit ihm gearbeitet hatten, wussten, dass sich Kelleroulos’ recht dünner Geduldsfaden kurz vor dem Zerreißen befand. Sein Gesicht unter dem dicht an den Kopf gegelten Haar hatte eine unnatürliche rote Farbe angenommen. Kelleroulos war bei der Arbeit ein wahrer Vulkan, der zu heftigen Ausbrüchen neigte. Ein solcher stand offenbar kurz bevor.
„Cut! Cut!“, schrie er mit sich überschlagender Stimme und wedelte dabei heftig mit den Armen in der Luft herum, wobei er fast einen Scheinwerfer umgeworfen hätte. „No, no, so geht des fei werkli nit!“ Seit Kelleroulos sich wieder in heimischen Gefilden aufhielt, vermischte er mit einer gnadenlosen Selbstverständlichkeit breites Amerikanisch mit unterfränkisch-ländlichem Dialekt – für diejenigen seiner Filmcrew, die er aus den Staaten mitgebracht hatte, nicht gerade einfach zu verstehen. Aber das war dem Meister egal. Kelleroulos schob den Kameramann, der mit der Handkamera am Boden kniend gerade eine Szene aufnehmen sollte, so heftig zur Seite, dass dieser fast umfiel.
„Mister Rottmann, ich hab’s Ihne jetzt doch scho zum dritte Mal explained. Sie komme zügich von links, lasse Ihrn Dog, ich meen des Hündle, ordentlich rechts an der Leine geh und halte Ihr Pfeife in der linke Hand. Dann mache Se en Schwenk to the right in Richtung von dem Eingang vom Maulaffenbäck. Dort klopfe Se Ihr Pfeife in dem Aschebecher da vorne aus. Dabei müsse se carefully druff acht, dass mer Ihre rechte Seite gut sieht, sonst kann der Kameramann des Ausklopfe nit in der gewünschte Großaufnahme eicatch. You know? Anschließend stecke Se die Pfeife in Ihre Jacketasche und entern mit Ihrm Hündle die Weinstube. Damit wär die Szene dann endlich im Kaste und wir für heut da herause in der Maulhardgass ready. Des kann doch realy nit so schwer sei! Also, jetzt concentration Se sich! Des muss jetzt klapp, sonst bekomme mer da in dere düstere Gasse Probleme with the light, ich meen mit dem Licht!“
Erich Rottmann fuhr sich gereizt durch seinen kurzen Haarschopf. Er verfluchte den Tag, an dem er sich von dem bekannten Würzburger Sensationsreporter Schöpf-Kelle hatte überreden lassen, in diesem Film eine kleine Rolle zu übernehmen. Rottmann hatte es zuerst gar nicht glauben wollen, als er erfuhr, dass eine solche Filmgröße wie Christos Kelleroulos bereit war, bei einem Film Regie zu führen, für den Schöpf-Kelle das Drehbuch geschrieben hatte und der in Würzburg spielen sollte – bis er dann herausbekommen hatte, dass Kelleroulos ein Vetter zweiten Grades von Schöpf-Kelle war. In jungen Jahren war er aus Rimpar aufgebrochen, hatte auf einer Filmakademie in den Staaten das Handwerk von der Pike auf gelernt und später unter seinem Künstlernamen in den USA als Regisseur Karriere gemacht. Nur deshalb und weil Kelleroulos Heimweh hatte und gerne wieder einmal ein paar Wochen in seiner Heimat verbringen wollte, war es Schöpf-Kelle gelungen, ihn zu beschwatzen, diesen Film mit dem Titel „Der Mörderschoppen“ zu drehen. Nach Schöpf-Kelles Vorstellungen sollte die Geschichte ausschließlich an Schauplätzen in Würzburg und Umgebung und – wegen der Authentizität – mit unterfränkischen Darstellern gedreht werden. Der Ausgangspunkt der Geschichte war der Maulaffenbäck, eine der ältesten und traditionsreichsten Weinstuben der Stadt. Einige Laiendarsteller standen nach der Vorstellung des Drehbuchautors von Anfang an fest: Erich Rottmann und sein Stammtisch Die Schoppenfetzer. Es hatte eine riesige Begeisterung unter den Mitgliedern des Stammtisches ausgelöst, als sie von ihrer Berufung erfahren hatten. Dass sich besonders Rottmann zu dieser Sache bereit erklärt hatte, grenzte an ein Wunder. Alle anderen Schauspieler, die selbstverständlich Profis waren, mussten ihre unterfränkischen Sprachkenntnisse im Rahmen eines harten Castings unter Beweis stellen.
Was war der eigentliche Grund dieses wagemutigen Projekts? Der Bayerische Rundfunk hatte aus unerfindlichen Gründen und für die bayerische Filmszene völlig überraschend seine bisher gepflegte Ignoranz gegenüber Unterfranken als Spielort von Fernsehfilmen aufgegeben. Insider vermuteten, dass der Grund dafür war, dass Hollywood einen Großteil seiner Neuverfilmung des Klassikers „Die drei Musketiere“ in Würzburg abgedreht hatte und dieser Film weltweit ordentlich Kasse machte. Jedenfalls beauftragte der BR irgendwann die kleine, aber leistungsfähige Produktionsgesellschaft RMP – Rümprer Movie Production, das Drehbuch von Schöpf-Kelle umzusetzen. Besonders verwunderlich war, dass man den Film sogar mit einem ordentlichen Budget ausgestattet hatte. Es wurden auch keine Einwände erhoben, als der Drehbuchautor und der Regisseur wegen der von ihnen angestrebten Authentizität darauf bestanden, in einigen kleineren Rollen geeignete Laiendarsteller einzusetzen. Die Schoppenfetzer als unterfränkische Patrioten hatten natürlich die bisherigen kläglichen Versuche des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, Fränkisches auf die Mattscheibe zu bringen, schmerzlich zur Kenntnis genommen. Nach einem langen Abend am Stammtisch mit viel Wein und langen Gesprächen mit Autor und Regisseur hatten sich die Stammtischbrüder dann breitschlagen lassen, einen neuen Versuch zu starten.
Im Augenblick drehte die Filmcrew gerade die Szenen, in denen Rottmann und Öchsle und später auch der Stammtisch eine Rolle spielten.
In groben Zügen ging es bei der Story darum, dass der Stammtisch an einem Abend den Geburtstag eines seiner Mitglieder feierte. Dabei handelte es sich um die Filmfigur Dr. Bernhard Schlegelmilch, den ehemaligen Leiter der Staatsanwaltschaft Würzburg, dargestellt von Horst Ritter. An dem Abend kommt Ritter alias Schlegelmilch später zum Stammtisch als gewohnt. Nachdem er einen kräftigen Schluck von seinem Schoppen genommen hat, verschwindet er auf der Toilette. Als er nach geraumer Zeit nicht zurückkommt, muss der Schoppenfetzer Arno Wegner, gespielt von Xaver Marschmann, nach dem Verbleib des Stammtischbruders sehen. Er findet ihn dort zusammengebrochen vor. Der sofort verständigte Notarzt kann nur noch seinen Tod feststellen.
Erich Rottmann verkörpert mit der Filmfigur Arno Falk praktisch sich selbst. Laut Drehbuch verständigt Falk sofort die Polizei, die ihre Ermittlungen aufnimmt. An dieser Stelle endet die Aufgabe Rottmanns und der Stammtischbrüder. Den Rest erledigen die Profi-Kommissare, dargestellt von echten unterfränkischen Schauspielern.
Die Maulhardgasse war für den Dreh völlig abgesperrt worden, da die Ausrüstung der Filmcrew die gesamte Breite der Gasse in Anspruch nahm. Hinter den Absperrungen hatten sich zahlreiche Schaulustige eingefunden, die neugierig das Geschehen verfolgten. Rottmann hatte zu seiner großen Freude schon einige seiner Bekannten gesehen, die ihm zuwinkten. Er konnte sich sehr gut vorstellen, was da hinter vorgehaltener Hand geflüstert und gelästert wurde. Wenn er sich nicht sehr täuschte, hatte er in der Menge auch Elvira Stark ausgemacht. Das hätte er sich ja denken können, dass sich seine ehemalige Jugendliebe den Anblick eines schauspielernden Erich Rottmann nicht entgehen lassen würde. Von ihm hatte sie es zwar nicht erfahren, aber die örtlichen Medien berichteten sehr ausführlich über das große Filmereignis.
Öchsle stand etwas verloren zwischen den vielen Menschen und ließ seine Rute hängen. Laut Drehbuch musste er in den Szenen an der Leine gehen, was der Rüde ja gar nicht gewohnt war.
„Öchsle“, sagte Rottmann leise, während er sich zu seinem Hund herunterbeugte, „da müssen wir jetzt durch. Ich gebe mir auch richtig Mühe, damit ich mich nicht wieder vertue. Wenn wir das überstanden haben, gibt’s für uns beide eine ordentliche Portion Leberkäs.“ Öchsle rang sich ohne große Begeisterung einen schwachen Schwanzwedler ab.
Kaum hatte sich Rottmann wieder aufgerichtet, kam auch schon die Maskenbildnerin angerauscht. In der einen Hand hielt sie eine Puderdose, in der anderen einen Schminkpinsel. Ohne viel Federlesens baute sie sich vor Rottmann auf. „Jetzt halten Sie doch mal still!“ Mit schnellen Pinselstrichen bearbeitete sie sein Gesicht. „Sie dürfen nicht so viel schwitzen“, mahnte sie spitz, „sonst verläuft Ihr ganzes Make-up!“
Rottmann zog eine Grimasse. „Sie haben leicht reden. Wir haben Sommer und dann noch die Hitze von den Scheinwerfern. Das ist ja schlimmer als in einer Sauna!“
„Attention, Attention, Ladies and Gentlemen“, tönte da auch schon wieder die knarrende Stimme des Regisseurs aus einem Megafon, „alles auf Position, please! Herr Rottmann, un mir reiße uns jetzt a little bit zamm! Okay?“
Rottmann nickte ergeben, lockte Öchsle und begab sich an den Ausgangspunkt der kurzen Wegstrecke, die er vor der Kamera zurückzulegen hatte. Mit Schrecken dachte er an die ihm noch bevorstehenden Innenaufnahmen im Maulaffenbäck. Bei diesen kam erschwerend hinzu, dass er dabei auch noch an drei Stellen Text zu sprechen hatte. Nicht viel, nur ein paar Sätze. Aber wenn er daran dachte, wie lange es gedauert hatte, bis er sie sich in den letzten Tagen eingetrichtert hatte, trat ihm schon wieder der Schweiß auf die Stirn. Rottmann riss sich zusammen, blendete alle störenden Gedanken aus und konzentrierte sich.
Der Regisseur vergewisserte sich, dass alle Kameras liefen und der Ton bereit war, dann gab er Rottmann ein Zeichen und rief: „Action!“
„Szene 13, Aufnahme 5“, rief der Regieassistent und schlug mit einem klatschenden Geräusch die Filmklappe zusammen. Nun war Rottmann dran. Er und Öchsle legten nun zum fünften Mal dieselbe Wegstrecke zurück. Der Kameramann lief gebückt mit der Handkamera vor ihm her. Rottmann war so konzentriert, dass er das Kommando „Stopp!“, das Kelleroulos am Ende der Strecke fast jubelnd ausrief, gar nicht mitbekam.
„Alles okay, Mister Rottmann, die Szene ist im Kasten.“ Er nahm das Megafon wieder an den Mund und schmetterte in die Gasse: „A shorts Päusle, dann bauen wir im Lokal auf.“ Zu Rottmann gewandt erklärte er: „Sie hamm jetzt a guts Stündle Pause, dann geht’s drinne weiter.“
Erich Rottmann atmete auf. Es wurde höchste Zeit, sich ein paar Kalorien zuzuführen. Bei diesem Filmstress fiel man ja regelrecht vom Fleisch. Er bückte sich und erlöste Öchsle von der Leine. Sofort vollführte der Rüde ein paar Freudensprünge, die so lustig aussahen, dass einige Leute hinter der Absperrung spontan applaudierten.