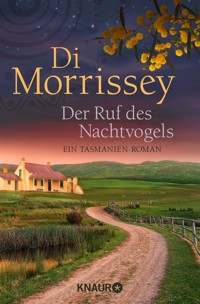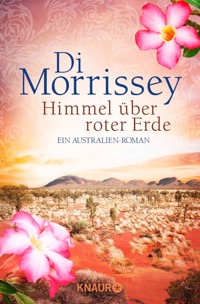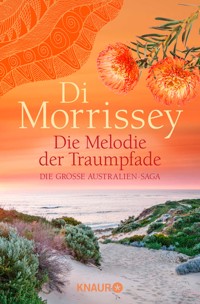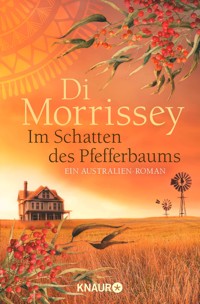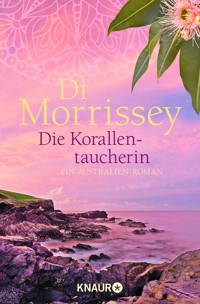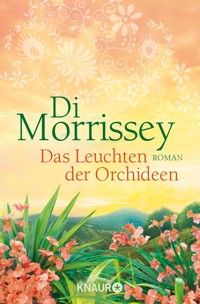
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die Australierin Julie zufällig auf ein Buch aufmerksam wird, das ihre Großtante Bette geschrieben hat, ist ihre Neugier geweckt. Doch ihre Nachfragen innerhalb der Familie stoßen auf eisiges Schweigen. Wodurch wurde Bette zum schwarzen Schaf? Julie verfolgt die Spur der abenteuerlichen Frau nach Malaysia, wo ihre Familie ihre Wurzeln hat. Staunend entdeckt sie nicht nur ein farbenprächtiges, exotisches Land, sondern stößt auch auf das düstere Geheimnis zweier ungleicher Schwestern, eine Geschichte um Liebe, Verrat und Tod …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Di Morrissey
Das Leuchten der Orchideen
Roman
Aus dem australischen Englisch von Gerlinde Schermer-Rauwolf, Sonja Schuhmacher und Robert A. Weiß, Kollektiv Druck-Reif
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als die Australierin Julie zufällig auf ein Buch aufmerksam wird, das ihre Großtante Bette geschrieben hat, ist ihre Neugier geweckt. Doch ihre Nachfragen innerhalb der Familie stoßen auf eisiges Schweigen. Wodurch wurde Bette zum schwarzen Schaf? Julie verfolgt die Spur der abenteuerlichen Frau nach Malaysia, wo ihre Familie ihre Wurzeln hat. Staunend entdeckt sie nicht nur ein farbenprächtiges, exotisches Land, sondern stößt auch auf das düstere Geheimnis zweier ungleicher Schwestern, eine Geschichte um Liebe, Verrat und Tod …
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Für meine beiden verstorbenen Onkel
Jim Revitt, von 1968 bis 1970 Auslandskorrespondent des australischen Hörfunks und Fernsehens in Malaysia, der mich stets inspirierte, mich förderte und mir beistand und immer hoffte, dass ich eines Tages dieses Buch schreiben würde;
und Ron Revitt, meinen »großen Bruder«, der mich zum Lachen brachte, mich neckte, seine Träume mit mir teilte und mich lehrte, die Welt mit den Augen eines Künstlers zu sehen.
Mögen beide in Frieden ruhen, wo wir alle geboren wurden, im Manning Valley, New South Wales.
Und für meinen jüngsten Enkel Everton Peter Hansen, der in mein Leben getreten ist, um uns Freude zu bringen.
Prolog
Sarawak, 1960
Es war das dunstige, vom Blätterdach des Regenwalds gefilterte Licht, das sie faszinierte. Grün illuminiert ragten die Bäume, von Kletterpflanzen umschlungene lebende Säulen, wie Wolkenkratzer gen Himmel. Es herrschte Stille.
Die Frau saß, Kamera und Notizblock griffbereit, in Hemd und robusten Baumwollhosen bequem auf einer Schicht von moderndem Laub. Neben ihr spross frisches Grün aus einem uralten Baumstumpf. Sie fühlte sich nicht mehr wie eine Fremde in diesem Dschungel, und sie hatte auch keine Angst, hier allein zu sein.
Während sie emporblickte, wo hoch über dem Waldboden riesenhafte Farne, Orchideen und Flechten auf den Bäumen wucherten, um einen Platz an der Sonne zu ergattern, staunte sie über die hundertfachen Grünschattierungen, die vielfältigen Blattformen, die zum Platzen reifen Samen und Früchte und die Heerscharen von Insekten, Vögeln und Tieren, die, ob groß oder klein, wie jeden Tag mit ihrem Überleben beschäftigt waren.
Sie wartete auf das leichte Zittern der Äste, Blätterrascheln, das Knacken eines Zweigs hoch über ihr, das ihr sagte, dass sie hier nicht vergeblich ausharrte. Stattdessen vernahm sie unvermutete Geräusche. Sie kamen vom Fluss her, von dem kleinen Pfad zum Zelt- und Palmenhüttenlager. Mit angehaltenem Atem horchte sie, in der Hoffnung, dass es sich doch um eins der erwarteten Geschöpfe handelte oder um ein umherstreifendes Zwergrhinozeros, einen Malaienbär oder einen wilden Eber.
Doch dann sah sie zwei Männer, die sich fast lautlos zwischen den Bäumen bewegten. Der eine war ein Europäer, der andere kleiner und dunkler, mit dem typischen Profil und Haar eines Einheimischen. Doch er gehörte nicht zum hiesigen Iban-Stamm.
Gerade als sie aufstehen wollte, hörte sie ein Rascheln in den schwankenden Baumkronen.
Die beiden Männer hielten ebenfalls abrupt inne und schauten nach oben, wo sich ein Orang-Utan-Weibchen mit einem Baby, das sich an die Mutter klammerte, von einem Baum zum nächsten schwang.
Beglückt von diesem Anblick, sprang die Frau auf, doch im selben Moment erstarrte sie vor Schreck.
Der Europäer hob ein Gewehr und zielte nach oben. Der andere Mann ergriff ein Blasrohr und wollte offenbar einen Giftpfeil in die Baumkrone schicken.
»Halt! Was macht ihr da?«, rief sie auf Malaiisch.
Erschrocken fuhren die Männer herum. Das Orang-Utan-Weibchen bahnte sich mit seinem Baby krachend einen Weg durch die Äste und verschwand.
Verwirrt und wütend zugleich brüllte der Europäer die Frau an: »Verschwinde! Was hast du hier zu suchen?«
Die Frau schritt auf die Männer zu, wobei sie den Wurzeln auswich und Schlingpflanzen und Äste beiseiteschob. »Ich bin aus dem Camp Salang. Wer sind Sie? Wie können Sie auf Orang-Utans schießen! Auf so wunderschöne Geschöpfe!«
»Wer behauptet, dass wir auf Affen schießen? Wir jagen für unser Abendessen. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram, Lady.«
Von dem feindseligen, drohenden Ton eingeschüchtert, blieb sie stehen. Sie beobachtete, wie der Einheimische sich langsam davonmachte und binnen Sekunden verschwunden war. Der Europäer hingegen hielt die Waffe auf sie gerichtet und ließ sie nicht aus den Augen, bis er plötzlich blitzschnell seinem Gefährten in den Dschungel folgte.
Aufgewühlt eilte die Frau auf ihrem Pfad zurück. Die beiden Männer hatten den Frieden und die Einsamkeit der Umgebung empfindlich gestört. Als sie sich schließlich dem kleinen Dschungelcamp näherte, das am Flussufer dem Wald abgetrotzt worden war, sah sie an der winzigen Anlegestelle lebhaftes Treiben. Der Klotok, das kleine Flussschiff der Siedlung, wurde beladen, um weiter flussabwärts Waren zu tauschen. Dahinter war das Motorboot festgemacht, mit dem sie und ihr Mann an diesen entlegenen Ort gekommen waren. Er unterhielt sich gerade mit dem Oberhaupt der Siedlung. Sie trat zu ihnen und wechselte leise ein paar Worte mit ihrem Mann, der ein besorgtes Gesicht machte.
Er beendete sein Gespräch, so schnell es die Höflichkeit erlaubte. Dann gingen sie zusammen mit einem der Iban aus dem Langhaus zu dem Ort, wo die Frau auf die beiden Männer gestoßen war. Der junge Iban war in diesem Dschungel zu Hause und bewegte sich mühelos vorwärts, zu rasch für das Paar, das bald außer Atem geriet und zurückblieb. Von weitem sahen sie, wie der Iban im dämmrigen Licht zwischen den Bäumen innehielt und sich hinabbeugte.
Die Frau erreichte ihn zuerst und stieß einen Schrei aus. Die Hand vor den Mund gepresst, stolperte sie zurück zu ihrem Mann, der seine entsetzte Frau schützend in die Arme schloss.
Vor ihnen lag ein blutüberströmter orangefarbener Fellklumpen. Man hatte das Tier ausgeweidet, aber mehr noch verstörte es die Frau, dass Kopf, Füße und Hände des Orang-Utan-Weibchens brutal abgehackt worden waren.
»Wo ist ihr Kleines?«, flüsterte sie.
Der junge Iban hob die Schultern und sah ihren Mann an. »Weg, Tuan. Für Geld verkauft.«
»Wilderer. Wie furchtbar!«
Die Frau vergrub den Kopf an der Brust ihres Mannes, der ihr Haar streichelte. »Geh zurück, Liebes. Leonard und ich begraben das arme Tier.«
»Ach, wenn wir diese Kerle doch nur erwischen könnten! Es ist so entsetzlich«, stieß sie hervor, und Tränen liefen ihr übers Gesicht. »So grausam. Ich will fort von hier.«
Kapitel 1
Brisbane, 2009
Der Regen fiel in Strömen, er stand wie eine Wand vor ihrer Windschutzscheibe und glänzte im Scheinwerferlicht der entgegenkommenden Fahrzeuge. Julie Reagan war heilfroh, dass sie diese Vorortstraßen schon ihr Leben lang kannte, und bog in eine von dem sommerlichen Guss überflutete Auffahrt ein. Sie hielt vor einem schönen alten Haus, das auf hohe Pfähle gesetzt war, damit die Luft kühlend unter dem soliden Holzfußboden hindurchströmen konnte. Das Gebäude umgab eine große Veranda, zu der Sandsteinstufen hinaufführten. Auf dem schrägen Dach saß ein verziertes Türmchen. Das alte Queenslander hatte eine herrschaftliche Ausstrahlung, es überragte die anderen Häuser in der Nähe. Auf der Veranda mit den von leuchtend gelben Goldtrompeten umrankten Säulen hatte man einen schönen Blick in die Ferne.
Die junge Frau schlug den Kragen ihrer Baumwolljacke hoch, bevor sie über den durchweichten Rasen zu einem tropfenden Flamboyantbaum und von dort die Treppe hoch auf die vordere Veranda lief. Sie schlüpfte aus den Schuhen und schüttelte sich die tropfnassen schulterlangen braunen Locken, die sich ganz bestimmt in der feuchten Wärme kräuseln würden.
Als Julie die weiße Eingangstür mit den Schnitzereien und den Buntglasscheiben aufzog, hielt sie einen Augenblick inne, um die Fernsehnachrichten aus dem Wohnzimmer zu hören und den Geruch nach überbackenem Käse einzuatmen. Offenbar war ihre Mutter beim Kochen. Die langgestreckte luftige Eingangshalle mit dem polierten Holzboden, dem weißen durchbrochenen Schnitzwerk, der Decke aus den geprägten Metallplatten mit Blumenmuster und dem Läufer, der ihrer Urgroßmutter gehört hatte – alles war ihr seit ihrer Kindheit vertraut.
Ihre Urgroßeltern hatten Bayview vor über hundert Jahren gekauft. Hier hatte ihre Großmutter Margaret gelebt, und jetzt war es das Zuhause ihrer Eltern. Auch wenn alte Queenslander teuer im Unterhalt waren, wollte Julies Mutter Caroline das gemütliche, großzügige Haus, in dem sich seit ihrer Schulzeit kaum etwas verändert hatte, keinesfalls aufgeben. Für Julie war es immer ein ruhender Pol in ihrem Leben gewesen. Auch wenn sie ihre Karriere, ihren Freundeskreis und ihre Unabhängigkeit schätzte, konnte sie sich ein Leben ohne dieses wundervolle Heim als Anlaufpunkt nicht vorstellen.
»Mum? Ich bin’s.«
»In der Küche, Jules.«
»Nicht bei den Nachrichten?«
»Ich musste das Essen aus dem Rohr nehmen. Nichts Besonderes, aber dein Vater kommt heute spät, da hab ich für mich selbst eine Kleinigkeit gemacht.« Caroline Reagan betrachtete ihre zweiunddreißigjährige Tochter in der Tür, und es wurde ihr warm ums Herz. Zwar sah sie Julie regelmäßig, doch hin und wieder hielt sie wie jetzt inne und staunte, was für eine hübsche Frau Julie doch geworden war mit ihrem dichten welligen Haar, den leuchtend blauen Augen, dem entschlossenen Kinn und dem großen fröhlichen Mund. Aber da war noch etwas an ihr, was anderen, die ihr zum ersten Mal begegneten, hoffentlich ebenfalls auffallen würde. Sie strahlte Ruhe und Stärke und Warmherzigkeit aus, noch bevor sie ein Wort gesagt hatte.
»Bleibst du zum Essen?«
Julie kam mehrmals in der Woche bei ihren Eltern vorbei, die keinen großen Wert auf Förmlichkeiten legten. Sie wusste, dass ihre Mutter sich stets freute, wenn sie sie bekochen durfte. Im Kühlschrank fanden sich immer leckere Reste oder die Zutaten zu einem schnellen Gericht.
»Ich hatte es eigentlich nicht vor, aber es riecht so gut, und der Regen ist scheußlich. Wenn ich nicht störe, bleib ich ein bisschen.«
»Du störst doch nie, Liebes. Ich hatte gehofft, dass du vorbeikommst.«
»Aus einem bestimmten Grund?« Julie hörte am Ton ihrer Mutter, dass es Neuigkeiten gab. »Hast du etwas von Adam und Heather gehört?« Denn Caroline hoffte, dass ihr in Südaustralien verheirateter Sohn endlich verkünden würde, dass ein Baby unterwegs war.
»Ja. Aber nichts Weltbewegendes. Sie haben ein paar wunderbar erhaltene alte Balken aufgetrieben, die sie bei ihrer Renovierung gut gebrauchen können.«
Julie schmunzelte in sich hinein. Für ihre Mutter war es vielleicht nichts Besonderes, aber sie ahnte, wie sich Adam gefreut hatte, einen solchen Schatz für das Lehmziegelhaus zu entdecken, das er und Heather in den Adelaide Hills herrichteten. »Und gibt’s was Neues bei dir?«
»Ich erzähl’s dir gleich. Gieß uns doch bitte einen Schluck zu trinken ein. Und wie geht’s in der Arbeit«, fragte Caroline.
»Immer dasselbe. Hektik. Neue Firmen auf dem Markt zu plazieren ist hartes Brot.«
»Na ja, genau dafür wird ein Marketing Consultant wohl bezahlt. Für seine guten Ratschläge.« Die Mutter wischte sich die Hände am Geschirrtuch ab und ging vor ins Wohnzimmer. Julie folgte ihr mit zwei Gläsern kühlem Weißwein.
Caroline schaltete den Fernsehapparat aus und setzte sich aufs Sofa. »Gleich bring ich das Essen. Nur Käsemakkaroni und ein bisschen Salat. Aber lies zuerst das.« Sie reichte Julie einen Brief, der auf dem Couchtisch gelegen hatte.
Julie stellte ihr Glas hin. »Kennst du den Absender?«
»Nein. Aber es ist ein interessantes Schreiben.«
Julie überflog den Briefkopf. Ein Dr. David Cooper von einer Universität in Queensland hatte geschrieben. Neugierig fing sie zu lesen an:
Liebe Mrs. Reagan,
Ich hoffe, Sie stören sich nicht daran, dass ich Ihnen schreibe. Ich bin außerordentlicher Professor für Anthropologie und befasse mich zurzeit mit den Iban in Borneo, wobei mein besonderes Interesse den veränderten Methoden des Ackerbaus und dem Wandel der Sozialstruktur und des Lebensstils nach dem Verlust ihres Lebensraums und der Umsiedlung aus Sarawak gilt, wo sie früher am Fluss und im Dschungel gelebt haben. Bei meinen Forschungen in Malaysia bin ich auf ein dünnes Buch von Bette Oldham gestoßen, Mein Leben bei den Kopfjägern von Borneo. Es ist in den Siebzigern erschienen, und sie schildert darin, wie sie eine Zeitlang bei einem Iban-Stamm in Sarawak gelebt hat.
Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, war Bette Oldham Ihre Tante. Natürlich bin ich sehr daran interessiert, mehr über sie und ihre Arbeit zu erfahren. Falls Sie mir dabei helfen könnten, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Bitte setzen Sie sich doch unter oben genannter Adresse, E-Mail oder Telefonnummer mit mir in Verbindung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. David Cooper
»Guter Gott!«, rief Julie aus. »Ist das die Tante Bette, über die Gran immer die Nase gerümpft hat? Hast du gewusst, dass sie in Borneo bei den Kopfjägern war? Das klingt ja total spannend.«
»Mutter hat immer erzählt, ihre Schwester wäre nicht zu bändigen gewesen und hätte Schande über die Familie gebracht«, antwortete Caroline. »Aber ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was sie eigentlich getan hat.«
»Gran hat es nie erwähnt?«
»Bis zu dem Brief habe ich nichts davon geahnt.«
»Erinnerst du dich an Tante Bette?«
»Vage. Aus der Zeit, als ich noch ganz klein war und in Malaysia lebte. Bevor Mutter wieder hierherzog.«
»Na ja, Gran hat von ihr immer nur als ›meine grässliche Schwester‹ oder ›dieses schreckliche Weib‹ gesprochen, wenn sie sie überhaupt mal erwähnt hat«, überlegte Julie. »Sie scheint sie nicht besonders gemocht zu haben.«
»Kann man nicht behaupten, nein. Komisch, dass jetzt dieser David Cooper das Thema Tante Bette aufbringt. Um ehrlich zu sein, denke ich nicht oft an meine Familie in Malaya. Beziehungsweise Malaysia, wie es jetzt heißt«, meinte Caroline.
»Kein Wunder. Wir sind viel zu sehr mit unserem Alltagskram beschäftigt, oder?«, erwiderte Julie. »Wirst du dich bei ihm melden?«
»Nein. Was könnte ich ihm schon erzählen? Ich erinnere mich kaum an sie. Und Mutter konnte sie auf den Tod nicht ausstehen, sie brachte es ja kaum über sich, auch nur ihren Namen zu erwähnen.«
»Ich wüsste gern, wie dieser David Cooper auf uns gekommen ist.« Julie faltete den Brief zusammen und steckte ihn in ihre Tasche. »Aber können wir jetzt essen? Ich sterbe vor Hunger.«
Es dauerte ein paar Tage, bis sie sich die Zeit nahm, David Coopers Brief aus der Handtasche zu kramen und ihn anzurufen.
»Dr. Cooper? Hier spricht Julie Reagan. Sie haben meiner Mutter geschrieben, wegen meiner Großtante Bette …«
»Ja, genau. Wie schön, so schnell von Ihnen zu hören. Wenn man dem Buch glauben darf, scheint Ihre Tante ja eine ganz bemerkenswerte Frau gewesen zu sein. Ich würde wirklich gern mehr über sie erfahren. Darf ich fragen, ob sie noch lebt?«
»Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Es würde mich wundern, denn dann wäre sie steinalt. Sie war zwar die Schwester meiner Großmutter, aber leider hatten die beiden sich so sehr entfremdet, dass ich gar nichts über sie weiß und meine Mutter sich kaum an sie erinnern kann. Deshalb waren wir so überrascht, von ihrem Buch zu hören. Wo kann man denn ein Exemplar bekommen?«
»Das dürfte schwierig werden. Ich kannte den Titel und habe über ein Jahr im Netz danach gesucht. Und dann habe ich es zu meiner großen Freude im Buchladen des Sarawak-Museums in Kuching entdeckt. Aber Sie dürfen sich gern mein Exemplar ausleihen. Es ist nur ein dünnes Bändchen, aber sehr aufschlussreich.«
»Ja, das würde ich gern. Darf ich fragen, wie Sie meine Mutter aufgespürt haben?«
»Das war nicht schwer. Vorn im Buch steht eine Widmung: Für Philip Elliott auf der Plantage Utopia in Malaysia. Ich habe mit der Plantage Kontakt aufgenommen, sie ist recht bekannt und wird von seinen Söhnen Shane und Peter, Ihren Cousins, geführt. Sie haben mir die Adresse Ihrer Mutter gegeben. Offenbar haben sie Ihre Mutter nie kennengelernt«, setzte er hinzu.
»Ja, das stimmt«, erwiderte Julie. »Meine Großmutter und meine Mutter sind nach dem Krieg nach Brisbane zurückgekehrt, aber Onkel Philip ist mit meinem Großvater in Malaysia auf der Plantage geblieben. Daher hat meine Mutter den größten Teil ihres Lebens hier verbracht und wird Ihnen wohl leider keine große Hilfe sein.«
»Danke trotzdem, dass Sie mich angerufen haben. Meine E-Mail-Adresse steht im Briefkopf. Nur für den Fall, dass Ihnen etwas unterkommt oder Ihrer Mutter noch etwas einfällt«, meinte David.
»Das glaube ich kaum. Wie gesagt, meine Mutter hat Malaya schon in sehr jungen Jahren verlassen und mit ihren dortigen Angehörigen fast keinen Kontakt. Sie haben sich höchstens mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten Karten geschrieben.«
»Wie schade. Mir gefällt Malaysia so gut, dass ich ständig nach Gründen suche, wieder hinzufahren.«
»Forschen Sie auch über die Kopfjäger?«, fragte Julie. Die Stimme des Mannes klang ziemlich jung, und sie stellte ihn sich ein bisschen spießig vor.
Er lachte leise und antwortete dann: »Ja, ich habe insbesondere eine ganze Menge über die Iban geforscht. Borneo ist faszinierend. Und ich habe etliche Orang-Utans in einem Schutzgebiet adoptiert. Ihr Lebensraum ist ebenso gefährdet wie der der Ureinwohner. Beides nehme ich zum Anlass, so oft wie möglich hinzufahren. Falls Sie einmal nach Borneo reisen wollen, sagen Sie mir Bescheid, dann gebe ich Ihnen ein paar Tipps und Adressen.«
»Danke, aber momentan steht das nicht an. Viel Glück bei Ihren Forschungen.«
»Herzlichen Dank … Julie, oder?«
»Ja. Und ich würde mir das Buch wirklich gern ausleihen.«
»Natürlich. Wie ist Ihre Adresse? Und haben Sie E-Mail?«
Sie diktierte ihm beides. »Auf Wiederhören, Dr. Cooper.«
»Bitte nennen Sie mich David. Auf Wiederhören, Julie.«
Sie legte auf und hoffte, dass er nicht vergessen würde, ihr das Buch ihrer Großtante zu schicken. Bette Oldham fing an, sie zu interessieren.
Als Julie am nächsten Samstag bei ihren Eltern reinschneite, entdeckte sie ihre Mutter im Nähzimmer, wo sie neben einer Schachtel, einer Akte mit Eselsohren und einem Stapel Fotoalben auf dem Boden saß. Ursprünglich war es wirklich das Nähzimmer ihrer Urgroßmutter gewesen, aber Margaret und dann Caroline, die beide nicht nähten, benutzten es als Abstellkammer, als Bibliothek und für sonstige Zwecke.
»Was machst du da?«
»Hallo, Jules, Komm, setz dich zu mir. Das hier ist ziemlich interessant.« Caroline sprach laut, um den dröhnenden Rasenmäher ihres Mannes draußen zu übertönen. »Du weißt ja, dass ich nicht der Typ bin, der in der Vergangenheit wühlt, aber der Brief von diesem David Cooper hat mich nachdenklich gemacht. Ich erinnere mich nur an so wenig von der Familienplantage in Malaysia. Da standen ein paar Stühle unter einem riesigen Regenbaum, und Mutter hat auf einem weißen Korbtisch Tee serviert, aber sonst weiß ich kaum noch was. Also hab ich gedacht, ich stöbere mal in Mutters alten Fotos, vielleicht hilft ja irgendetwas meinem Gedächtnis auf die Sprünge.«
»Das hier sieht wie ein Regenbaum aus«, sagte Julie, die mehrere Fotografien in die Hand genommen hatte und sie durchsah. »Ist das Gran? Piekfein herausgeputzt. Wer sind die anderen Leute? Sieht aus, als wären sie bei einem Pferderennen.«
»Das ist mein Vater, Roland, ich erkenne ihn an seinem Schnurrbart«, sagte Caroline.
»Hier in der Gruppe sind mehrere Einheimische. Da ein Inder und ein Chinese. Und hier … ist das …?« Julie kniff die Augen zusammen.
»Ja, das ist Bette. Mal wieder gegen jede Konvention – kein Hut, keine Handschuhe, nur ein Schirm zum Schutz vor der Sonne.«
»Sie ist sehr hübsch. Gran ist hochelegant, aber Bette wirkt viel natürlicher.«
»Sie hat dieselben Haare wie du«, bemerkte Caroline. »Mutter hatte ganz feines Haar, immer hochgesteckt oder mit Dauerwelle. Bette macht einen viel zwangloseren Eindruck, stimmt’s?«
»Ich hätte sie gerne gekannt, als sie noch jung waren. Das Einzige, was ich wirklich über Großtante Bette weiß, ist, dass sie irgendeine entsetzliche Schande über die Familie gebracht hat. Ich habe Gran nie gefragt, was sie eigentlich so vor den Kopf gestoßen hat. Weißt du es, Mum?«
»O ja. Laut meiner Mutter ist Bette durchgebrannt und hat einen Chinesen geheiratet«, antwortete Caroline. »So wie meine Mutter darüber sprach, klang es, als habe der Leibhaftige persönlich Besitz von ihrer Schwester ergriffen.«
»Das muss damals für ziemliche Aufregung gesorgt haben. Wann war das genau?«, fragte Julie.
»Oh, nach dem Krieg. Aber Näheres weiß ich auch nicht, denn meine Mutter war so erbost über das Verhalten ihrer Schwester und wegen der angeblichen Familienschande, dass ich immer einen großen Bogen um das Thema gemacht habe.«
Julie schaute weiter die Fotos durch. »Die sind verblüffend. Muss eine unglaubliche Zeit gewesen sein damals vor dem Krieg. All die Herren in weißen Anzügen und mit Panamahüten! Ganz britische Kolonialzeit, oder?«
»Pflanzer und Memsahibs, nehme ich an. Mir gefällt, wie fein sich alle gemacht haben«, sagte Caroline. »Es war ein ganz anderes Leben damals, und Mutter hat prima dazugepasst. Dieses vornehme Getue.« Sie betrachtete eingehend ein Foto, dann gab sie es Julie.
»Schau hier, Mutter und Bette, die beiden Schwestern. Siehst du auch, was ich sehe?«
Julie betrachtete das steife Porträt der beiden Frauen und sah dann Caroline an, die das Haar zu einem mädchenhaften Pferdeschwanz zurückgebunden, aber die Augenbrauen hochgezogen und die Lippen ein bisschen zusammengekniffen hatte, während sie das Kinn entschlossen vorschob. Und dann studierte sie das Gesicht der jüngeren Bette mit dem offenen Haar, den funkelnden Augen mit den dichten Wimpern, dem breiten lächelnden Mund und den kantigen Zügen. »Oh, mein Gott! Mein Ebenbild! Und du siehst aus wie Gran. Ich weiß noch, wie ähnlich ihr euch wart. Aber bis heute hatte ich noch nie ein Foto von Großtante Bette in der Hand.«
»Du kommst nach der hübscheren von den beiden«, sagte ihre Mutter.
»Mum, du siehst umwerfend aus. Ich hab in der Schule immer gedacht, meine Mutter ist die allerschönste«, erwiderte Julie und meinte es ernst.
»Danke, Schatz. Aber ich finde, dass Bette zu den Frauen gehört, die immer toll aussehen, ganz egal, ob sie perfekt geschminkt oder gerade erst aufgestanden sind, sogar noch krank oder müde machen sie was her. Mutter und ich waren ganz annehmbar, nachdem wir in den Schminkkasten gefallen sind, wie dein Vater es immer nennt.« Caroline lächelte ihre Tochter an. »Du dagegen siehst immer großartig aus, auch wenn du es gar nicht drauf anlegst.«
»Na, ich hoffe doch, dass ich ein bisschen besser rauskomme als gerade aus dem Bett gekrochen, wenn ich mir stundenlang Mühe gegeben habe«, meinte Julie und setzte dann hinzu: »Weißt du, Mum, ich glaube, du erinnerst dich an viel mehr, als du glaubst. Gran hat dir doch bestimmt jede Menge Geschichten über die alten Zeiten erzählt.«
»Ja, das hat sie. Ich kenne noch die kleinste Kleinigkeit aus ihrem Leben vor dem Krieg. Außerdem sind in diesem Schuhkarton Briefe an ihre Eltern, in denen sie ihr Leben als Ehefrau in Malaya schildert.«
»Also dann! Du könntest diesem Anthropologen eine Menge erzählen«, schlug Julie vor.
»Aber das sind doch ganz persönliche Sachen, so was interessiert ihn bestimmt nicht.«
»Wie kommt es eigentlich, dass du gar nichts über Großtante Bette und ihr Leben im Dschungel weißt?«
»Mmmm. Das Buch ist entstanden, lange nachdem Mutter und ich aus Malaya fort waren. Und, wie gesagt, konnte Mutter ihre Schwester nie erwähnen, ohne sie gleichzeitig herunterzumachen. Immer hieß es nur: ›Dieses grässliche Weib, das Schande über die Familie gebracht hat‹, und so weiter.«
»War das nicht ein komisches Familienleben, du und deine Mutter hier in Brisbane und dein Vater und dein Bruder in Malaya?«, fragte Julie.
»So haben wir das nicht gesehen. Als Mutter zurück nach Brisbane wollte, war Philip in England im Internat – er war zehn Jahre älter als ich –, also blieb er dort, und ich kam hierher. Und als er dann mit der Schule fertig war, wollte er bei Vater in Malaysia leben. Daher habe ich ihn nie richtig kennengelernt. Natürlich kenne ich nur Mutters Sicht der Dinge, wahrscheinlich fehlen mir ein paar Puzzleteile.«
»Glaubst du, dass der Krieg etwas mit eurer Familientrennung zu tun hatte?«
»Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, Vater hat die meiste Zeit des Krieges in Indien verbracht, und Mutter hat ihn in Brisbane durchgestanden. Aber danach sind beide zurück nach Malaysia, sonst wäre ich nicht auf der Welt. Das verrät uns aber noch nichts über Bette, oder?«
»Vielleicht weiß Dr. Cooper ja mehr. Ich meine, immerhin hat er von ihrem Buch erfahren.«
»Ich denke, er hat über die Eingeborenen in Borneo geforscht, nicht über unsere Familie!«
»Ja, schon klar. Aber es tut doch nicht weh, sich mal mit ihm zu unterhalten. Er hat versprochen, mir Bettes Buch zu leihen.«
Caroline zuckte die Schultern. »Na gut, dann lad ihn zum Tee ein. Vielleicht will er ja einen Blick auf die Fotos werfen. Jammerschade, dass Mutter nicht wenigstens die Namen hintendrauf geschrieben hat«, empörte sie sich. »Wer sind all diese Leute?«
Julie beobachtete, wie David Cooper aus seinem Wagen stieg, innehielt und das Haus ihrer Mutter betrachtete. Dann überquerte er den Rasen und sah zu den dicken Ästen des Flamboyantbaums hinauf, drehte sich um und bewunderte den Blick über die Moreton Bay. Er war etwa Ende dreißig, mittelgroß und hatte ziemlich langes Haar, das ihm bis zur Sonnenbrille in die Stirn hing. Seine Jeans waren gebügelt, das zitronengelbe Hemd hatte kurze Ärmel, und er trug ein Päckchen in der Hand. Als er zur Vordertreppe ging, trat Julie hinaus auf die Veranda, um ihn zu begrüßen.
»Hallo, ich bin Julie. Ihnen gefällt die Aussicht?«
»Was für ein hinreißendes altes Haus! Gut zu wissen, dass es noch ein paar gibt, die man nicht verfallen lässt, allerdings sind nur wenige so schön wie dieses. Hallo, ich bin David.« Er trat zu ihr auf die Terrasse, und Julie stellte fest, dass er größer war als gedacht. Sie nahm seine ausgestreckte Hand und schüttelte sie. Dann reichte er ihr das Päckchen.
»Das Buch. Wie versprochen.«
»Danke. Sie bekommen es zurück, sobald Mum und ich es gelesen haben.«
»Nein, behalten Sie es. Ich habe fotokopiert, was ich brauche, und finde, das Original gehört in Bettes Familie.«
»Oh, dann vielen Dank. Kommen Sie doch rein, meine Mutter hat Ihnen zu Ehren einen Kuchen gebacken.«
»Wie reizend. Ich bin beeindruckt.«
Lächelnd öffnete Julie die Eingangstür. »Mum ist nicht gerade berühmt für ihre Backkünste, es ist also nur ein schlichter Ananaskuchen.«
»Klingt großartig.«
Auf der hinteren Veranda stellte Caroline gerade einen Krug Wasser auf den Tisch. »Hallo, schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Caroline Reagan. Möchten Sie lieber Tee, Kaffee oder Eistee?«
»Eistee klingt wunderbar.« David Cooper musterte das zwanglose luftige Arrangement aus Rohrmöbeln, bunten Kissen und einer Kletterpflanze, die den Blick auf den üppig grünenden Garten verdeckte. »Das erinnert mich an die Kolonialhäuser der Pflanzer in den Tropen.«
»Reiner Zufall. Das Haus war schon in diesem Stil gehalten, bevor meine Mutter überhaupt wusste, wo Malaya liegt«, erwiderte Caroline. »Aber setzen Sie sich doch und erzählen uns etwas über sich.«
»Ich hole den Eistee«, erbot sich Julie und überließ David Cooper dem Verhör ihrer Mutter. Als sie zurückkam, waren beide in einer angeregten Unterhaltung begriffen. Julie stellte die Gläser mit den frischen Minzblättern hin und goss Eistee darauf. Ihre Mutter strahlte sie an.
»Wusstest du, dass Davids Familie aus Brisbane stammt? Es könnte gut sein, dass ich mit seiner Mutter Tennis gespielt habe, als ich noch zur Schule ging.«
»Ach ja? Und Sie sind auch hier aufgewachsen?«, erkundigte sich Julie.
»Ja. Aber meinen Abschluss hab ich an der National University gemacht. Allerdings hat mir die Kälte in Canberra ziemlich zugesetzt, weshalb ich heilfroh war, hier eine Stelle zu kriegen.« Er nahm das angebotene Glas Eistee. »Vermutlich ist das Klima ein weiterer Grund, dass es mir in Südostasien so gut gefällt.«
»Können Sie uns ein bisschen mehr über Ihr Projekt erzählen und wie Sie auf meine Tante gestoßen sind?«, fragte Caroline.
»Das war ein glücklicher Zufall. Ich wusste schon länger von ihrem Buch, weil es immer mal wieder in irgendwelchen Fußnoten erwähnt wurde, und war dann hocherfreut, in Kuching ein Exemplar in die Finger zu bekommen. Wie ich Julie schon erzählt habe, steht eine Widmung darin, die mich zu Ihrer Familienplantage Utopia geführt hat und damit zu Ihren Cousins Shane und Peter, die sehr gastfreundlich waren.«
»Darf ich mal?«, fragte Caroline, nahm das dünne Büchlein und fing an, es durchzublättern, wobei sie das eine und andere Foto näher in Augenschein nahm. »Das sieht wirklich interessant aus.«
»Ihre Tante scheint sich den Iban in Sarawak sehr verbunden gefühlt zu haben und zeigt viel Verständnis für sie. Die Schilderungen von im Ausland lebenden Landsleuten, auch wenn sie keine ausgebildeten Anthropologen sind, erzählen uns oft eine Menge über die Lebensverhältnisse und Gewohnheiten der dortigen Eingeborenen. Das bereichert meine Untersuchungen enorm. Und Bette war eine großartige Beobachterin.«
»Mum ist auf Utopia geboren worden«, sagte Julie, um eine Gesprächspause zu füllen, weil ihre Mutter tief in Gedanken versunken wirkte.
»Waren Sie mal dort?«, fragte David.
»Nein. Es ist mir eigentlich nie in den Sinn gekommen. Wie ist Malaysia denn so?«
»Sie sollten hinfahren und sich selbst ein Bild machen«, erwiderte David leise.
»Ja, vielleicht mache ich das mal«, sagte Julie leichthin und schien es nicht besonders ernst damit zu meinen. »Noch etwas Tee?«
»Nein, danke. Der Kuchen war übrigens köstlich, Mrs. Reagan, vielen Dank.«
»Gern geschehen. Und nennen Sie mich doch Caroline.« Inzwischen war David aufgestanden, und sie ergriff seine Hand. »Aber einen Augenblick noch, ich war mit den Gedanken ganz woanders. Hat Julie Ihnen erzählt, dass ich die Briefe und Fotos meiner Mutter durchgesehen habe und auch ein paar Bilder von Bette darunter sind, aus der Zeit vor dem Krieg? Vielleicht möchten Sie einen Blick darauf werfen?«
»Ich wüsste liebend gern, wie die Autorin dieses Buches ausgesehen hat.«
»Sei ein Schatz und räum die Gläser und den Kuchen weg, Jules«, bat Caroline ihre Tochter und führte David Cooper die Veranda entlang zu den Flügeltüren des Nähzimmers.
Julie war die nächsten beiden Wochen fast unentwegt in Victoria unterwegs, weil dort ein neuer Kunde sein Weingut zu einem großzügigen Gastbetrieb erweiterte. Zwar war es interessant gewesen, durch die Weinberge fahren, aber sie war doch froh, als sie wieder zu Hause im sonnigen Brisbane war. Auf dem Rückweg vom Flughafen verglich sie unwillkürlich die weite Landschaft von Victoria mit der Skyline aus dicht gedrängten Wohnhäusern rund um Brisbane.
Sie hatte in einem einstmals bescheidenen Vorort für Familien ein kleines altmodisches Haus gemietet, das in einem üppig wuchernden Garten versteckt lag. Zwar war das Haus ihrer Mutter viel größer und prächtiger, aber ihr luftiges weißes Queenslander Gebäude aus Holz wies einige Ähnlichkeiten mit Bayview auf.
Julie parkte in dem halbmorschen Unterstand unter dem großen Mangobaum. Oft malte sie sich aus, wie die früheren Bewohner auf der Vordertreppe gesessen und mit ihren Nachbarn, die in ähnlichen Häusern lebten, geplaudert hatten. Inzwischen wirkte ihr Holzhaus wie ein Anachronismus neben dem modernen Terrassengebäude aus Glas und Chrom auf der einen Seite und dem Haus mit den sechs Wohnungen auf der anderen, das ihr die Sonne nahm. Tagtäglich herrschte dichter Verkehr auf der Straße, die von parkenden Autos gesäumt war, obwohl man teuer dafür zahlen musste, denn es gab nicht genug Parkplätze für die vielen neu entstandenen Wohnungen und Büros. Sie wandte den Blick von den Neubauten ab und öffnete die Tür ihres kleinen Reichs.
Der Anrufbeantworter blinkte, und die Stimme ihrer Mutter hallte in Julies winziger heller Küche wider.
»Ich hoffe, dass bei deiner Reise alles gut gelaufen ist, Jules. Wenn du ein bisschen Zeit hast, komm doch rüber und iss mit uns zu Abend. Es gibt da etwas, worüber Dad und ich mit dir sprechen wollen. Keine Angst, uns geht’s gut, aber es gibt Ärger mit der Bezirksverwaltung. Bis dann, Schatz.«
Als Julie am nächsten Abend zu ihren Eltern kam, waren sie gerade bei den Essensvorbereitungen.
»Dad will grillen. Ach, wie ist das schön, dich zu sehen«, sagte Caroline und küsste Julie auf die Wange. »Schade, dass Adam nicht hier ist, aber vielleicht können wir später noch mit ihm sprechen.«
»Was ist los?«, fragte Julie.
»Es ist einfach unglaublich. Hier, lies den Brief von der Bezirksverwaltung.« Ihre Mutter schob ihr ein Kuvert hin, doch noch ehe Julie den Brief herausziehen konnte, platzte es aus Caroline heraus: »Sie wollen genau hier eine Umgehungsstraße bauen! Hat man so was Irrwitziges schon mal gehört? Man stelle sich nur vor: Schöne Häuser abzureißen für eine Straße!«
»Was meinst du mit ›abreißen‹? Doch nicht unser Haus? Das können sie nicht tun«, sagte Julie. »Lass mich mal lesen.«
»Es ist eindeutig, Paul, nicht wahr?«, sagte Caroline, als ihr Mann in die Küche kam.
Paul Reagan fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. »Ja, klingt ganz so, als ob sie das vorhätten. Wobei natürlich noch nichts feststeht.«
Julie überflog den Brief. »Das ist ungeheuerlich. Dem müssen wir sofort einen Riegel vorschieben. Offensichtlich haben diese sogenannten Planungsexperten noch nie einen Fuß in diese Straßen gesetzt und mal einen Blick auf die Häuser geworfen. Sonst kämen sie nicht auf die Idee, hier alles plattzuwalzen.«
»Als Gran noch lebte, war das ein wunderschöner Vorort. Und heute ist er fast noch schöner«, stellte ihre Mutter fest.
»Keiner baut heutzutage mehr solche Häuser, das ist sicher«, setzte ihr Vater hinzu.
»Hast du schon mit Adam gesprochen? Was meint er?«, fragte Julie.
»Nein, noch nicht. Du kennst doch deinen Bruder, er würde nur sagen, dass wir in Ruhe abwarten sollen, wie sich die Dinge entwickeln, vielleicht würde ja gar nichts draus«, seufzte Caroline.
»Ja, da hast du wohl recht«, nickte Julie. »Er ist nicht gerade der Mann für schnelle Entscheidungen. Aber das Risiko können wir nicht eingehen. Was sagen denn die Nachbarn dazu?«
»Sie sind auch nicht gerade glücklich darüber«, antwortete ihr Vater.
»Wir müssen alle zusammentrommeln und überlegen, wie sich das verhindern lässt«, entschied Julie. »Komm, Mum, lass uns Tee aufsetzen, und dann stecken wir die Köpfe zusammen und knobeln was aus.«
»Siehst du? Ich wusste, dass Julie etwas einfallen würde«, sagte Caroline und sah schon ein bisschen fröhlicher aus.
Am nächsten Tag rief David Cooper bei Julie an.
»Hallo. Wie hat Ihnen das Buch Ihrer Großtante gefallen?«
»Um ehrlich zu sein, bin ich noch nicht dazu gekommen, auch nur einen Blick reinzuwerfen. Ich habe so viel um die Ohren. Aber Mum hat es sich angeschaut.«
»Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten herausgefunden, die Sie und Ihre Mutter vielleicht interessieren könnten.«
»Mum würde bestimmt gern mehr erfahren, aber wir sind zurzeit mit dem Kopf ganz woanders. Die Bezirksverwaltung will unser Haus abreißen, und wir versuchen uns zu wehren.«
»Was? Das Haus Ihrer Großmutter? Aber das ist doch absurd! Weshalb denn um alles in der Welt?«
»Es war davor sogar das Haus meiner Urgroßmutter. Man will eine Umgehungsstraße bauen, damit der Verkehr flüssiger wird«, erklärte Julie. »Tja, verrückt. Mum gründet gerade eine Bürgerinitiative, um das zu verhindern.«
»Kann sie da Hilfe gebrauchen? Recherchieren ist mein Metier, und vielleicht finde ich ja genug über die Geschichte und den kulturellen Wert des Viertels heraus, um damit die Straße zu verhindern. Mir tut es immer in der Seele weh, wenn solche schönen Häuser oder gar Straßen und ganze Viertel geschändet werden«, sagte David.
»›Geschändet‹ ist das richtige Wort. Solche herrlichen alten Häuser niederzureißen ist ein barbarischer Akt. Und zu Ihrer Frage: Jede Hilfe ist willkommen. Vielleicht könnten Sie ja heute Abend an unserem Nachbarschaftstreffen teilnehmen? Von Mums Haus aus einfach ein Stück die Straße runter, um 19 Uhr?«
»Klar doch. Könnten wir uns bei Ihrer Mutter treffen, damit ich es auch finde?«
»Ja, natürlich. Und herzlichen Dank. Wir wissen Ihre Hilfe wirklich zu schätzen.«
Julie freute sich, David Cooper kennengelernt zu haben. »Danke, Großtante Bette«, murmelte sie.
Zwei Dutzend Familien hatten sich im Garten eines der bedrohten Häuser zusammengefunden, das ebenfalls schon seit Generationen derselben Familie gehörte. Die empörten Nachbarn wählten Caroline und einen anderen Anwohner zu ihren Sprechern. Außerdem war der Bezirksrat Fred Louden vorbeigekommen, um sich die Sorgen der Bürger in seinem Wahlkreis anzuhören. David Cooper saß mit einem Aufnahmegerät und einem Notizblock im Hintergrund, was Fred Louden zu der besorgten Frage veranlasste, ob er Journalist sei. Als David erwiderte, er sei ein Bekannter der Reagans, lächelte Louden leutselig und setzte sich auf seinen Platz.
Caroline las den Brief vor, den sie alle erhalten hatten, und fuhr in ruhigem Tonfall fort: »Wir alle verstehen, was uns dieses Schreiben sagen will: Die Bezirksverwaltung plant, einen Teil unseres Viertels wieder der öffentlichen Hand zuzuführen, um auf dem enteigneten Grund eine Umgehungsstraße zu bauen, um den Verkehrsfluss zu verbessern und den künftigen Aufbau einer Infrastruktur zu erleichtern.« Sie schwieg einen Augenblick, ehe sie fortfuhr: »Was auch immer das genau bedeuten mag. Aber da kann uns hoffentlich Mr. Louden aufklären.«
Doch der Bezirksrat sprach so vage und allgemein – über das Wachstum von Brisbane und dass die Einwohner Opfer bringen müssten und selbstverständlich angemessen entschädigt würden –, dass keiner der Anwesenden danach wirklich schlauer war, was die Bezirksverwaltung im Einzelnen plante. Als Caroline ihre Nachbarn danach aufforderte, sich dazu zu äußern und Fragen zu stellen, hagelte es Beschwerden. David Cooper kam beim Mitschreiben kaum mehr nach.
»Mr. Louden, hat sich irgendwer in der Bezirksverwaltung oder im Straßenbauamt mal die Mühe gemacht hierherzukommen und sich anzuschauen, wo diese angedachte Straße verlaufen soll?«, wollte eine Frau wissen. »Haben sie gesehen, was für wunderschöne Häuser und Gärten dieser Planung zum Opfer fallen?«
»Natürlich nicht«, rief ein anderer Anwohner. »Die haben nur auf die Karte geguckt und gesehen, wie nahe wir an der Stadt sind. Und weil unsere Häuser schon vor über hundert Jahren gebaut worden sind, haben sie gedacht, dass alles hier baufällig ist. Was aber nicht stimmt! Diese Häuser sind bewohnt, und wir sind stolz auf sie.«
»Was ist mit den Geschäften und der Schule und der Bücherei?«, fragte jemand. »Unsere Kinder müssten eine verdammte mehrspurige Schnellstraße überqueren, nur um zur Schule zu kommen – wie soll das gehen?«
»Werden die Schule und die Bücherei auch umgesiedelt?«
Fred Louden hielt den Kopf gesenkt und machte sich augenscheinlich Notizen, aber seine Antworten waren nichtssagend und beschwichtigend.
David warf Julie einen Blick zu. Sie ging nach hinten und setzte sich neben ihn.
»Es wäre interessant, welche Untersuchungen und Berichte den Plänen zugrunde liegen beziehungsweise was die Behörden in dieser Hinsicht noch vorhaben«, warf er ein. »Umweltverträglichkeitsstudien, Lärmgutachten, Landschaftsschutzmaßnahmen und dergleichen.«
»Das gehört alles zur Machbarkeitsstudie«, erwiderte Fred Louden aalglatt und schlug sein Notizbuch zu. »Ganz offensichtlich muss noch eine Menge abgearbeitet werden, ehe eine endgültige Entscheidung fällt. Unter anderem ist die Bezirksverwaltung zu einer Anwohneranhörung verpflichtet. Danke für die Einladung zu Ihrem Treffen. Ich muss noch zu einem anderen Termin, und sicher haben Sie einiges unter sich zu bereden.«
Nachdem Louden gegangen war, wurde es unruhig.
»Und was schließen wir nun daraus?«, fragte Caroline.
»Viel Neues hat er ja nicht erzählt«, meinte Julie. »Wir sollten uns eine gemeinsame Strategie überlegen.«
»Wie wär’s, wenn wir uns an unsere Eingangstore ketten, mit Plakaten, auf denen ›Wir gehen nirgendwohin!‹ steht, und die Medien informieren?«, lautete ein Vorschlag.
»Was ist mit dem National Trust? Könnten die Häuser nicht als kulturelles Erbe unter Denkmalschutz gestellt werden, so dass sich niemand daran vergreifen darf?«, fragte jemand.
Caroline sah ihren Mann an. »Wir hatten das mal überlegt, aber da gab es zu viele Bestimmungen, welche Modernisierungen und Veränderungen einem dann noch erlaubt sind.«
»Nicht dass wir je in die Gebäudestruktur eingegriffen hätten, das hatten wir nie vor. Keiner will ein historisches Gebäude von Grund auf ummodeln«, ergänzte Paul.
»Ich glaube auch, dass wir irgendwann unbedingt die Medien einschalten sollten«, sagte Julie, »Aber vorher sollten wir einen umfassenderen Verteidigungsplan schmieden. Sonst klingt es noch, als ob da ein elitärer Haufen nur seine hübschen Häuser retten will. Aber es geht ja nicht bloß um unsere Queenslander Gebäude und die Gärten und Bäume, es ist doch auch fragwürdig, was stattdessen hier entstehen soll. Ist eine Umgehungsstraße in diesem Gebiet wirklich nötig?«
»Wahrscheinlich sollten Sie professionellen Rat von Ingenieuren, Ökologen und Spezialisten für Lärmbelästigung und Landschaftsverschandelung einholen und sich über mögliche Gesundheitsrisiken und Beeinträchtigungen Ihres Alltags kundig machen, falls diese Umgehungsstraße realisiert wird«, riet David. »Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass die Kostenschätzungen der Bezirksverwaltung zu niedrig sind. Sie müssten also herausfinden, was ein realistischer Kostenrahmen für so ein Projekt ist und was da letztlich auf den Steuerzahler zukommt. Das sollte uns genügend Munition geben.«
»So etwas zu recherchieren ist eine kostspielige Sache«, meinte Caroline. »Wir brauchen eine Kriegskasse.« Dies stieß auf allgemeine Zustimmung.
»Danke für Ihre Vorschläge, David«, sagte Julie.
»Es ist ebenso meine Heimatstadt«, erwiderte David. »Auch wenn ich in einem anderen Viertel wohne, finde ich die Vorstellung schrecklich, dass hier eine Betonschneise geschlagen werden soll. Zudem habe ich Zweifel an dem Sinn des Projekts. Es ist eine komische Stelle für eine Umgehung. Vielleicht sollte sich auch jemand mit den Verkehrsprognosen befassen. Ich kann Ihnen da ein paar Kontakte vermitteln. Wir können per E-Mail in Verbindung bleiben.«
»Phantastisch. Ich fürchte nämlich, dass viele hier glauben, wir müssten nur ein bisschen vor den Fernsehkameras herumhüpfen und die Lokalzeitung auf unsere Seite ziehen, und schon würde die Bezirksverwaltung klein beigeben. Aber so einfach wird es nicht werden«, meinte Julie. »Wir brauchen auch ein paar gute Argumente.«
»Unterschätzen Sie die Macht des Volkes nicht. Öffentliche Aufmerksamkeit ist eine prima Sache. Aber Sie haben recht, auf lange Sicht reicht das nicht, da müssen Sie schon mehr aufbieten«, stimmte David zu. »Vielleicht kommt es ja sogar zu einer Klage. Zum Glück leben wir in einer Demokratie. In manchen Ländern hätten wir gar nichts mitzureden, da würde die Regierung einfach Bulldozer und Bagger anrücken lassen.«
Nach dem Treffen entschwanden die Anwohner in die Nacht, noch immer empört über die geplante Zerstörung ihrer Häuser, aber zumindest ein bisschen optimistischer, sie vielleicht doch verhindern zu können.
Es war so spät geworden, dass Julie beschloss, bei ihren Eltern zu übernachten. Sie schlief liebend gern in ihrem früheren Zimmer im Turm, wo in den Regalen noch immer ihre Kinderbücher und ihr Spielzeug standen. Nachdem sie gute Nacht gewünscht hatte und die enge Stiege hinaufgeklettert war, trat sie ans Mansardenfenster und schaute hinunter auf den im Mondlicht liegenden schlafenden Vorort. Es herrschte völlige Stille, nur hin und wieder hörte man einen Flughund im Sturzflug durchs Geäst rauschen. Weit hinten schimmerte die Moreton Bay, wo ihr Vater ihr auf einer Flying Ant das Jollensegeln beigebracht hatte.
Ihr Blick fiel auf den Vorgarten. Die Baumkrone des Flamboyant war fast so hoch wie das Dach, der Rasen darunter lag in tiefem Dunkel. Sie erinnerte sich an die alte Schaukel, die früher dort gehangen hatte. Zwar hatte man die Seile erneuert, als Julie klein war, aber sie wusste noch, wie sich der feste, glatte Holzsitz angefühlt hatte, den ihr Großvater oder vielleicht sogar ihr Urgroßvater gemacht hatte. Dieses Haus und dieser Garten riefen nostalgische Gefühle in ihr wach, waren Schauplatz ihrer frühesten Erinnerungen, und ihrer Mutter und ihrer Großmutter war es wohl ähnlich ergangen.
Julie schloss die Augen. Während die milde, warme Nachtluft über ihre Wangen strich, versuchte sie den Klang von Kinderlachen und das leise Plaudern von Erwachsenen heraufzubeschwören, die im Garten Tee oder einen Aperitif tranken, den lauten Hall entschlossener Schritte auf der breiten Veranda, das Knirschen des Schotters in der Auffahrt, wo Autos und früher vielleicht Pferdekarren und Kutschen eingetroffen waren. Die hohen Hecken und tropischen Sträucher schirmten das Haus von den Nachbarn ab, die sich ebenfalls mit üppig grünenden Oasen umgeben hatten.
Als sie die Augen öffnete, fühlte sie sich entschlossener denn je. Nein, sie würde nicht zulassen, dass sich stählerne Klauen und Zähne von Maschinen in die Häuser dieser Straße gruben und, ihrem Verlauf folgend, im weiten Bogen den Hügel hinauffraßen. Gerade als sie sich umdrehen und ins Bett gehen wollte, erregte etwas Fahles, Huschendes ihre Aufmerksamkeit. Sie lehnte sich aus dem Fenster und kniff die Augen zusammen.
Was war das gewesen? Eine weiße Katze? Nein, zu groß dafür.
Ihre Phantasie spielte ihr einen Streich. Sie hatte wohl zu viel über die Vergangenheit nachgedacht. Nun kam es ihr vor, als ob im Schatten unter dem Flamboyantbaum eine weibliche Gestalt ruhte. Eine innere Stimme riet ihr, sich ganz still zu verhalten und sich die Szene einzuprägen. Die Sepiafotografien in den Alben der Mutter kamen ihr in den Sinn. Der helle Fleck sah aus wie eine Frau aus der Ära weicher wehender Musselinstoffe, hochgesteckter Haare, weißer Schnallenschuhe und Sonnenschirmchen. Fast, als wäre ihre Urgroßmutter in den von ihr angelegten und heiß geliebten Garten zurückgekehrt.
Plötzlich kam Wind auf, die Zweige schwankten, und der Schemen verflüchtigte sich. Unter dem Baum war wieder alles dunkel und leer.
Julie zog die Vorhänge vor das kleine Fenster und legte sich ins Bett. Sie würde für dieses Haus kämpfen – nicht allein für sich, auch für diese Menschen einer anderen Zeit.
»Ich habe gestern Nacht von Urgroßmutter geträumt« erzählte Julie, als ihre Mutter am nächsten Morgen den Toast butterte. »Sie lag unter dem Flamboyantbaum auf dem Rasen. Wenn wir uns wirklich anstrengen, können wir das Haus bestimmt retten.«
»Das glaube ich auch, mein Schatz. David hat uns ein paar gute Ratschläge gegeben.« Caroline legte die Toastscheiben neben Julies gekochtes Ei.
Julie tunkte ein Stück Toast in das weiche Eigelb. »Mir ist durch den Kopf gegangen, wie viele Erinnerungen sich für uns mit diesem Haus verbinden … und dass es für Urgroßmutter und Großmutter ebenso war. An was erinnerst du dich besonders?«
»Ach, du liebe Güte.« Caroline zuckte die Schultern. »Ich weiß noch, wie sich meine Großeltern gefreut haben, als Mutter und ich hierher zurückgekommen sind, nachdem sich meine Eltern getrennt hatten. Wobei ich nicht glaube, dass Mutter allzu glücklich darüber war.«
»Meinst du nicht? Gran hat das Haus doch so sehr geliebt.«
»Ja, das hat sie. Und sie war auch sehr stolz auf den Garten. Aber seltsamerweise hat sie hin und wieder erwähnt, am glücklichsten sei sie vor dem Krieg als junge Ehefrau in Malaya gewesen.«
»Warum hat sie dann in Brisbane gelebt?«, fragte Julie.
»Ich weiß nicht genau. Manchmal hatte ich den Eindruck, es lag mindestens ebenso sehr an Bette wie an Vater, dass sie Malaya verlassen hat.«
Julie durchzuckte ein Verdacht, und ihre Augen weiteten sich. »Mum! Dein Vater hatte doch nicht etwa eine Affäre mit Bette, oder?«
Entschieden schüttelte Caroline den Kopf. »Nein, natürlich nicht.«
»Warum also ist Gran nach Australien zurückgekehrt?«, ließ Julie nicht locker.
»Ich weiß es wirklich nicht. Darüber wurde nicht geredet, das war tabu. Aber ich habe einiges von Mutters Geschichte aufgeschnappt. Als ich ungefähr fünfzehn war, hat sie mir doch tatsächlich erzählt, wie sie meinen Vater kennengelernt hat und wie die ersten Jahre mit ihm zusammen waren. Es ist zwar lange her, aber ich versuche mich nach bestem Wissen und Gewissen daran zu erinnern, wenn du es hören willst?«
»Ja, unbedingt«, sagte Julie, nahm sich noch mehr Toast und spitzte die Ohren.
Kapitel 2
Mittelmeer, 1937
Die junge Frau hielt ihren großen, kreisrunden Strohhut fest, während die salzige Brise den leichten Stoff ihres Kleides um ihre Beine spielen ließ, so dass ihre sportliche Figur zu erkennen war. Neben ihr ging eine ältere Frau mit Baumwollrock und korkbesohlten Schuhen; ihren Hut hatte sie mit einem Band unter dem Kinn festgebunden.
Sie wies auf einige im Windschatten aufgestellte Liegestühle. »Warum setzen wir uns nicht dorthin? Jetzt laufen wir schon zum dritten Mal ums Deck.«
Die junge Frau blickte sich um. »Ich hatte gehofft, wir würden diesen netten Mr. Elliott wiedersehen. Ich habe gehört, sein Vater besitzt Plantagen in Malaya. Das klingt doch interessant und romantisch.«
»Margaret Oldham, du bist unmöglich. Ich bin mir sicher, du siehst ihn heute Abend, wenn wir am Tisch des Kapitäns eingeladen sind, das ist er nämlich auch, glaube ich. Und wir sind noch wochenlang auf See, bis wir in Brisbane ankommen. Du wirst bestimmt noch viele nette, junge Männer kennenlernen.«
Adelaide Monkton setzte sich auf einen freien Liegestuhl, legte eine leichte Decke über ihren Rock und schlug den kleinen Gedichtband auf, den sie bei sich trug. Die letzten Monate war sie auf einer höchst interessanten Rundreise durch Europa und England gewesen, aber die Gesellschaft der sehr viel jüngeren Miss Oldham konnte ziemlich anstrengend sein.
Die einundzwanzigjährige Margaret strotzte vor Energie, und an der Gesellschaft junger Männer hatte sie weit regeres Interesse als an der Kultur der Alten Welt. Obwohl sie eine wohlerzogene junge Dame war und eine der angesehensten Schulen Brisbanes besucht hatte, nahm Adelaide auch einen rebellischen Zug an ihrem Schützling wahr. Während Margarets Freundinnen und Altersgenossinnen sich eher zurückhaltend gaben, konnte sie recht unverblümt sein. Und es lag wohl nicht nur an ihrer aufrechten Körperhaltung, die sie gewiss ihren Lehrern verdankte, dass Margaret für eine Einundzwanzigjährige mitunter ein wenig herrisch wirkte.
Rührte ihre Art vielleicht von diesem subtilen Standesdünkel her, den Familien aus besseren Kreisen ihren Töchtern einimpfen?, überlegte Adelaide. Ja, als Margaret in die Gesellschaft von London eingeführt worden war, schien sie völlig unbeeindruckt und bewegte sich wie unter ihresgleichen. Margaret wurde dort als »lustiges australisches Mädel« aufgenommen, mit dem man Pferde stehlen konnte. Adelaide war auch aufgefallen, dass sich Margaret einen ziemlich geschniegelt klingenden britischen Akzent zugelegt hatte.
Keine Frage, Adelaide würde heilfroh sein, wenn sie Margaret wieder in die Obhut ihrer Eltern geben und geruhsameren Aktivitäten nachgehen konnte.
Margaret legte sich in ihren Liegestuhl, schloss die Augen und genoss die Wärme der Sonne, nicht ahnend, dass ihre Reisegefährtin sie gerade eingehend analysierte. Doch nach wenigen Minuten sprang sie ungeduldig wieder auf. »Ich glaube, ich mach mich fürs Mittagessen fertig. Sehen wir uns in der Kajüte?«
»Ja, ich komme gleich runter. Es ist gerade so angenehm hier.« Adelaide faltete die Hände, mit einem Finger die Seite in ihrem Buch einmerkend, und schloss die Augen.
Margaret nahm einen Umweg zur Kajüte, die sie sich mit ihrer Anstandsdame teilte. Weil Winifred, Margarets Mutter, nicht besonders reiselustig war, hatte sie ihre älteste Tochter nicht nach England begleiten wollen. Außerdem war ihre jüngere Tochter Bette in ihrem letzten Schuljahr, und so vertraute sie ihre Älteste einer alten Freundin der Familie an. Die beiden waren schon über neun Monate unterwegs und befanden sich jetzt auf der letzten Etappe der Heimreise.
Margaret ging in die Erste-Klasse-Lounge auf dem A-Deck, dann durch den Musikraum und spähte durch die Glastür ins Raucherzimmer, die perfekte Nachbildung einer Halle eines alten Herrenhauses, mit einem imposanten offenen Kamin und einem Wappen darüber. Neben der Feuerstelle prangte eine Rüstung, und man konnte eine kleine Ausstellung mit Medaillons und Artefakten von Bonnie Prince Charlie in Augenschein nehmen. Dann stieg sie die mit rotem Teppich ausgelegte Art-déco-Wendeltreppe hinunter und hielt kurz am Gitter des im französischen Stil erbauten Lifts inne. Er führte hinab zum Hallenbad, das die Designerin Miss Elsie Mackay mit Marmorsäulen und kunstvollen Mosaiken den römischen Bädern nachempfunden hatte. Adelaide hatte Margaret erlaubt, dort zu den für Damen reservierten Zeiten zu schwimmen. Das fand die ältere Dame diskreter als die ausgelassenen Poolspiele und das gesellige Treiben am Außenpool auf dem B-Deck.
Wieder draußen auf dem B-Deck, nahm Margaret den Hut ab und lehnte sich an die Reling, um das schäumende blaue Kielwasser hinter dem weißen Schiffsrumpf zu beobachten. Der Wind trug Gelächter zu ihr herüber, und so umrundete sie ein Rettungsboot und stieß dahinter auf das Spieldeck. Dort war ein lebhaftes Wurfringspiel im Gange, und unter der Gruppe jüngerer Männer erkannte sie auch die hochgewachsene Gestalt von Roland Elliott. Sie blieb stehen, um zuzuschauen, und klatschte, als das Spiel zu Ende war.
Roland Elliott, gekleidet in tropisches Weiß, trat auf sie zu. Er war erhitzt, schien aber zufrieden über den Sieg seines Teams. »Hallo, Miss Oldham, wie frisch Sie aussehen! Wir sind hier ganz schön ins Schwitzen gekommen.« An seinem Akzent ließ sich unschwer erkennen, dass er eine englische Privatschule besucht hatte.
»Es scheint aber großen Spaß zu machen. Sie spielen außerordentlich gut«, sagte Margaret.
»Hätten Sie Lust, nach dem Essen bei einer zweiten Runde mitzumachen?«, fragte er. »Nur so zum Spaß, nichts Ernstes.«
»Sie machen allerdings den Eindruck, als würden Sie das durchaus ernst nehmen«, erwiderte Margaret.
Er zuckte mit den Achseln. »Mein Vater sagt immer, wenn du etwas tust, dann tu es, so gut du kannst.«
»Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, aber ich würde es gerne mal probieren«, sagte Margaret, die es nicht für sonderlich schwer hielt, einen Tauring über einen Nagel zu werfen.
»Ausgezeichnet. Dann treffen wir uns doch hier am späteren Nachmittag, wenn die Sonne nicht mehr aufs Deck scheint. Sagen wir gegen vier?«
»Wunderbar. Bis dann.«
»Decksport? Das klingt anstrengend«, meinte Adelaide. »Ich komme mit und schaue zu.«
»Das brauchst du nicht, wenn du nicht möchtest. Da ist eine Gruppe netter junger Leute. Mir wird schon nichts passieren.«
Adelaide Monkton zögerte. »Na, wenn du meinst. Heute Abend könnte es spät werden. Wir essen in der zweiten Schicht. Da würde ich gerne noch ein längeres Nickerchen machen.«
Margaret überlegte, was sie zum Wurfringspiel auf dem Deck anziehen sollte. Zwar war sie keine klassische Schönheit, aber sie war hübsch und machte das Beste aus ihrer vornehmen Erscheinung, denn sie wusste, welche Kleidung ihrer hochgewachsenen Figur schmeichelte. Schließlich entschied sie sich für locker sitzende weit geschnittene Hosen, ein weiß-blau gestreiftes, trikotartiges Top, Strandschuhe und die flotte weiße Schirmmütze, die sie auch beim Tennis trug.
Auf dem Deck angekommen, sah sie zwei andere Mädchen in kurzen Hosen und ein drittes mit langem Rock und einem Nackenträgertop. Schon jetzt war ihre helle Haut rötlich verfärbt, und nach einigen weiteren Wochen auf See würden sie sicher Probleme mit Sonnenbrand haben, dachte Margaret.
»Ich komme aus Queensland, ich bin an Sonne gewöhnt«, sagte sie zu einem der Mädchen.
»Sie haben so ein Glück. Einerseits fürchte ich die australische Sonne, aber es ist schön, mal aus dem Regen rauszukommen. Wir hatten dieses Jahr einen so fürchterlichen Winter.«
»Kennen Sie sich alle schon länger, oder haben Sie sich erst an Bord kennengelernt?«, fragte Margaret, die sich wunderte, wie zwanglos die jungen Leute miteinander umgingen.
»Unsere Familien sind befreundet, und diese beiden Burschen kennen sich aus der Schule«, antwortete eine der rosigen Engländerinnen.
Das Spiel begann, und Margaret freute sich, in Roland Elliotts Mannschaft zu sein. Er war groß, braungebrannt und gutaussehend und hatte einen bleistiftdünnen Schnurrbart, genau wie Ronald Coleman. Außerdem war er älter und kultivierter als die reichen Schnösel, die sie in England getroffen hatte. Er strahlte eine natürliche Autorität aus, was sie ziemlich attraktiv fand. Ihr Team gewann jedes der drei Spiele.
Er schüttelte ihr die Hand. »Gut gemacht, Partner. Sie haben ein paar ganz schöne Würfe gemacht.«
»Ach, das war nur Glück«, sagte Margaret leichthin, und er lachte.
Als sie zu einem Tisch auf der Terrasse gingen, auf dem Krüge mit eisgekühltem Wasser standen und kalte Handtücher bereitlagen, dachte Margaret, dass sie ein hübsches Paar abgeben würden. Beide waren sie groß, sportlich, braungebrannt und hatten das gleiche feine, helle Haar.
»Hört mal, kommt ihr heute Abend alle zum Stengah? Wir können uns an der Bar neben dem Musikraum treffen«, schlug Roland vor, als die Gruppe sich anschickte, das Deck zu verlassen.
»Das klingt reizvoll. Aber was genau ist ein Stengah?«, fragte Margaret.
»Ihr Australier! Das ist Whisky mit Sodawasser. Aber Sie können natürlich auch etwas anderes trinken. Einen G und T oder einen BGA, einen Gimlet oder so was«, sagte Roland. Und fügte erklärend hinzu: »Gin und Tonic, Brandy mit Ginger-Ale, Gin und Limettensaft.«
»Oh, natürlich, das wäre großartig. Und ich glaube, wir sitzen beim Essen zusammen.«
»Sie haben sich wacker geschlagen. Bis später dann.« Er ging mit großen Schritten davon.
An diesem Abend beobachtete Adelaide, wie Margaret sich die Haare zurechtmachte und ihr schräggeschnittenes Satinabendkleid mit dem rüschenverzierten Schnürleibchen glatt strich. Zwei paillettenbesetzte Schnallen hielten die Träger auf ihren Schultern. Dazu gab ihr Adelaide noch ein fein besticktes Schultertuch, das gleichzeitig wärmte und für etwas mehr Schicklichkeit sorgte.
»Hier, das wirst du brauchen. Ich bin froh, dass du ein paar umgängliche junge Leute kennengelernt hast.«
»So jung sind sie gar nicht, Adelaide. Und alles sehr gebildete Herrschaften, hauptsächlich Engländer und Schotten. Mr. Elliott ist mindestens zweiunddreißig.«
»Wir treffen uns dann im Speisesaal der ersten Klasse, wenn der Gong zum Essen ruft«, konnte Adelaide Margaret nur noch hinterherrufen, weil diese schon aus dem Zimmer gerauscht war.
An der Bar hatte sich dieselbe Gruppe versammelt wie vorhin beim Wurfringspiel, zudem noch einige Paare, die Margaret schon am Pool gesehen hatte. Alle waren elegant gekleidet. Margaret fand, dass sie aussahen wie aus einer Reklame für teure Zigaretten oder Wermut, bei der die Herren in Jacketts und die Damen in engen Abendkleidern mit elfenbeinernen Zigarettenspitzen rauchten und aus Martinigläsern tranken.
Roland trug einen perfekt sitzenden Smoking. Als er sie sah, nahm er ein Glas Champagner von einem Tablett, das der Kellner anbot, und reichte es Margaret. Er selbst genehmigte sich einen Whisky. »Wollen wir uns setzen?« Er wies auf einen gemütlich aussehenden Tisch aus Bambusrohr und einige Stühle, die unter einer bunten Lichterkette standen.
Sie bemerkte, wie vorsichtig er sich setzte, um seine Hose nicht zu verknittern.
Dann erhob er sein Glas. »Zum Wohl, Margaret.« Er nippte an seinem Getränk, zog dann ein Silberetui aus seiner Jackentasche, nahm sich eine Zigarette und klopfte sie leicht auf den Deckel, bevor er ein dazu passendes Feuerzeug aufschnappen ließ. »Oh, Entschuldigung. Möchten Sie auch eine?« Er hielt ihr das Etui hin.
»Nein, danke«, sagte Margaret. »Obwohl ich mir gelegentlich eine gönne.« Das stimmte sogar, auch wenn sie nur rauchte, um ihre Mutter und Adelaide zu ärgern, denn eigentlich mochte sie den Geschmack von Zigaretten nicht besonders.
»Reisen Sie viel?«, erkundigte sich Margaret.
»Kommt darauf an. Meine Großeltern sind schon recht betagt, und Mutter lebt bei ihnen in Kent, um nach ihnen zu sehen. Ich war nur dort, um die drei zu besuchen.«
»Werden Sie länger in Malaya bleiben?«
Er zog eine Augenbraue hoch. »Allerdings. Mein Vater besitzt dort eine Kautschukplantage, sie heißt Utopia. Das ist mein Zuhause. Ich bin dort geboren, und abgesehen vom Internat und von Cambridge, habe ich mein ganzes Leben dort verbracht.« Er blies eine dünne Spirale aus Rauch in die Luft. »Aber Sie haben recht, ich habe die Reise nach England und zurück schon einige Male gemacht.«
»Haben Sie viele Freunde in England?«, fragte Margaret, die versuchte, sich so ein Leben, zerrissen zwischen zwei Ländern, vorzustellen.
»Oh, aber natürlich. Ich habe Freunde, die in Singapur, da und dort in Malaya und in ganz Indien verstreut leben, aber das bringt das Empire nun mal so mit sich. Manche sind im Staatsdienst, andere arbeiten als Plantagenverwalter und so weiter. Doch das ist sicherlich nicht besonders interessant für Sie.« Er sprach sanft, doch sein Blick war forschend.
Margaret interessierte sich indes für alles, was Roland sagte. »Aber gewiss doch! Das klingt so faszinierend. So abenteuerlich und, na ja, nach einem spannenden Leben. Nicht wie mein langweiliger Alltagstrott in Brisbane.«
Ein leises Lächeln spielte um seine Lippen. »Langweilig ist es nicht in Malaya. Oft ist es sogar recht abenteuerlich, wie Sie sagen, aber Abenteuer sind nicht immer angenehm. Das Leben ist das, was man daraus macht, n’est-ce pas?« Er drückte seine Zigarette aus. »Noch einen Champagner?«
»Warum nicht? Danke schön.« Margaret ließ die Stola von ihren nackten Schultern gleiten und lehnte sich zurück. »Es wird mir schwerfallen, mich nach dieser Tour wieder zu Hause einzugewöhnen. Ich habe meine Leidenschaft fürs Reisen entdeckt. Man bekommt so viele Anregungen. Auch wenn es etwas lästig war, immer Miss Monkton als Anstandsdame dabeizuhaben, aber meine Eltern haben es so gewollt.«
»Vielleicht könnten Sie ja noch einen Abstecher einplanen. Wenn wir in Port Said einlaufen zum Beispiel, das finden Sie sicher sehr interessant. Und Colombo kenne ich wie meine Westentasche, vielleicht darf ich es Ihnen zeigen? Mit Miss Monkton natürlich. Ich gehe dort von Bord, aber wir könnten uns die Stadt ansehen, bevor das Schiff nach Singapur weiterfährt. Vielleicht könnten wir etwas organisieren.«
»Oh, Sie gehen in Colombo von Bord. Ich will Ihnen nicht die Zeit stehlen …«
Er machte eine lässige Bewegung mit seiner Zigarette. »Es würde mich wirklich freuen. Viel Zeit haben wir dort zwar nicht, aber wir könnten das Beste daraus machen.«
Margaret war enttäuscht, dass er nicht bis nach Australien mitreiste, bedachte ihn aber mit einem umwerfenden Lächeln und nahm sich vor, wirklich das Beste aus der verbleibenden Zeit zu machen.
»Das wäre wundervoll. Adelaide hat zwar Bedenken, in bestimmten Gegenden an Land zu gehen, aber ich bin mir sicher, Sie kennen die schönsten Sehenswürdigkeiten.« Sie lachte und hoffte, er würde sie allein mitnehmen, nicht zusammen mit seinen Freunden.
»Es läutet zum Essen.« Roland erhob sich und bot ihr den Arm.
»Danke für den Champagner.«
»Es war mir ein Vergnügen.« Er nickte ihr mit einem warmen Lächeln zu, dann gingen sie zusammen in den Speisesaal.
Die Dekoration im großen Speisesaal fanden Adelaide und Margaret sehr beeindruckend. Kerzen leuchteten über Tafelaufsätzen, in denen frische Rosen aus dem Kühlraum steckten. Überall funkelte Kristallglas, und auf dem goldgeränderten Tafelservice prangte das Wappen der Schifffahrtsgesellschaft. In der Mitte des Raumes ragten, von Gazetuch und Blattwerk umrankt, Säulen empor, auf denen ein mit aufwendigem Stuck verziertes Oberlicht ruhte.
Roland führte Margaret zum Tisch des Kapitäns, während Adelaide dort am Arm eines förmlich gekleideten Schiffsoffiziers erschien. Die Männer am Tisch erhoben sich, während die Damen Platz nahmen. Sie hatten den Kapitän schon beim Cocktailempfang kennengelernt.