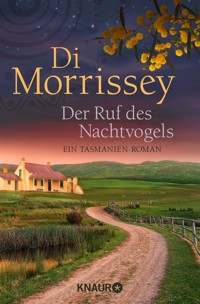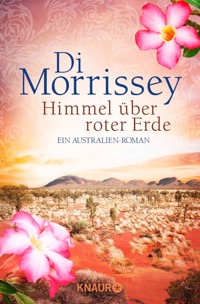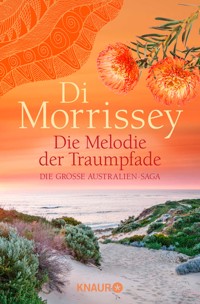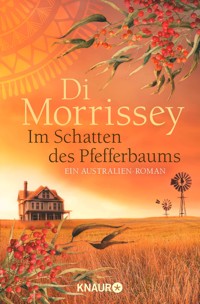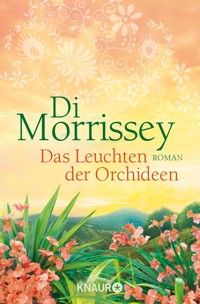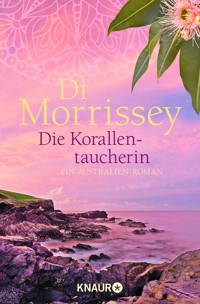
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Ökologin Jennifer Towse folgt ihrem ehrgeizigen Mann Blair widerwillig auf eine kleine Urlaubsinsel am Great Barrier Reef, wo dieser die Leitung eines Hotels übernehmen soll. Jennifer fürchtet das Meer, denn als kleines Mädchen musste sie miterleben, wie ihr Vater und ihr Bruder ertrunken sind. Bald nach ihrer Ankunft zeigt sich, dass Blair in üble Machenschaften um das Hotelmanagement verstrickt ist. Noch schwieriger wird die Situation, nachdem Jennifer feststellt, dass sie ein Kind erwartet und Blair eine Affäre mit einer Kollegin hat … Sie steht vor der schwersten Krise ihres Lebens, als sie sich beherzt einer Gruppe von Meeresforschern anschließt, die Umweltsündern auf der Spur ist. Nach und nach findet Jennifer den Mut, sich von Blair zu trennen. Die Korallentaucherin von Di Morrissey: im eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 732
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Di Morrissey
Die Korallentaucherin
Roman
Aus dem Englischen von Elisabeth Hartmann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als kleines Mädchen muss die Farmerstochter Jennifer miterleben, wie ihr kleiner Bruder und ihr Vater ums Leben kommen. Daraufhin verkauft die Mutter die kleine Farm und zieht mit der Tochter in die Stadt, wo sich Jennifer nie wirklich heimisch fühlt. Der Roman schildert die Entwicklung Jennifers zu einer selbstbewussten jungen Frau, die ihr Kindheitstrauma bewältigt und sich gegen ihren untreuen Ehemann und ihre manipulative Mutter behauptet.
Inhaltsübersicht
All denen gewidmet,
Kapitel eins
Country Victoria, 1980
Kapitel zwei
Country Victoria, 1992
Kapitel drei
Sydney, 1997
Kapitel vier
Sydney, 2004
Kapitel fünf
Branch Island, 2004
Kapitel sechs
Der Strandräuber
Kapitel sieben
Mondaufgang
Kapitel acht
Fremde an der Küste
Kapitel neun
Wassertreten
Kapitel zehn
Seeschlange
Kapitel elf
Unter Wasser
Kapitel zwölf
Riff-Wanderung
Kapitel dreizehn
Jenseits des Riffs
Kapitel vierzehn
Ebbe und Flut
Kapitel fünfzehn
Unter dem Wasserspiegel
Kapitel sechzehn
Meer und Symbiose
Kapitel siebzehn
Die Wellen teilen sich
Kapitel achtzehn
Das dunkle Meer
Kapitel neunzehn
Ebbe
Kapitel zwanzig
Sturm auf See
Kapitel einundzwanzig
Stille Wasser
Epilog
Branch Island, fünf Monate später
Danksagung
All denen gewidmet,
die an der Rettung der Meere arbeiten.
Kapitel eins
Country Victoria, 1980
Die siebte Welle
Jennifer sah zu, wie ihre Mutter alles, was sie für den Urlaub benötigten, in dem kleinen Caravan verstaute, und achtete darauf, dass ihre Lieblingspuppe, ihr Malbuch und ihre Stifte mitsamt der Angelrute, den Büchern und Schnipp-Schnapp-Karten ihres Bruders in die Kiste wanderten.
Christina Campbell schob alles unter die Sitzbank neben dem Klapptisch. »So, jetzt weißt du, wo Teddys und deine Sachen sind.«
»Kann ich Daisy jetzt zurückhaben? Da drinnen ist es dunkel.«
Christina lächelte ihre besorgte fünfjährige Tochter an. »Ihr geht’s gut, sie schläft. Daddy will, dass wir alles, was wir mitnehmen wollen, bis heute Abend in den Caravan geladen haben. Du willst Daisy doch nicht zu Hause lassen, oder?«
»Wo sind mein Eimer und meine Schaufel?«
»Schon eingepackt, Schätzchen, wir werden bestimmt nichts vergessen.« Christina konnte nur hoffen, dass sie recht hatte. Der Caravan, zwar alt und reisemüde, war eine Neuanschaffung der Familie, und sie standen vor ihrem ersten richtigen Camping-Urlaub. Und das Beste war: Sie reisten ans Meer. Zum ersten Mal. Das würde eine willkommene Abwechslung von der täglichen Plackerei auf der Farm sein, vom Kampf gegen die Dürre und sinkende Aktienkurse, ständig den Bankdirektor im Nacken. Christina erinnerte sich, wie ihr Mann Roger sie mit dem Caravan überrascht hatte.
Er hatte ihn eines Nachmittags, nachdem er zwei Tage fort gewesen war, um den Bankdirektor zu beschwichtigen, zum Viehmarkt zu gehen und mit anderen Farmern zu reden, die im selben Boot saßen wie er, mitgebracht. Sie hatte sich geärgert, weil er Geld für etwas so Überflüssiges wie einen Caravan ausgegeben hatte, und nicht im Traum daran gedacht, dass sie jemals wirklich damit in Urlaub fahren würden. Doch Roger hatte zum ersten Mal seit vielen Monaten vergnügt ausgesehen.
»Rolly Blake wollte ihn quasi verschenken. Da seine Frau tot ist und die Kinder verkaufen wollen, meinte er, ihn nicht mehr brauchen zu können. Und weißt du was, Liebes, alles könnte noch verdammt viel schlimmer werden, als es schon ist, nach dem, was ich in der Stadt so gehört habe. Da dachte ich, wir sollten den Kindern, uns allen, mal etwas gönnen. Gott weiß, wann wir je wieder die Möglichkeit dazu haben.«
Oder wann wir sie je hatten, dachte Christina, doch sie öffnete die Tür, um zu sehen, wie der Wohnwagen von innen aussah. Die Kinder kamen herbeigelaufen und hüpften begeistert um das Häuschen auf Rädern herum. Und Christina musste zugeben, dass der Caravan recht praktisch war, wirklich gut eingerichtet. Im Inneren hatte eine Frau gewirkt, das war nicht zu übersehen. Sie sah sich nach ihrem strahlenden Mann um. »Er ist wohl brauchbar. Wohin könnten wir damit fahren? Doch bestimmt nicht weit?«
»Ich habe mir was überlegt. Bernie Allen von nebenan würde sich um die Farm kümmern, und ich denke, wenn wir den alten Bullen verkaufen, haben wir genug Geld, um bis an die Küste zu fahren.«
Ihr siebenjähriger Sohn Teddy jauchzte, als er das hörte. »Meinst du, ans Meer, Dad? Dann können wir angeln gehen!«
»Na klar. Das ist was anderes als die Sonnenbarsche in unserem Stausee. Am Meer holen wir die richtig großen Fische raus!«
Die Fahrt an die Küste war ein Abenteuer, denn sie mussten zwei Nächte im Caravan verbringen. Die Kinder wollten auch während der Fahrt im Wohnwagen sitzen, mussten sich jedoch damit abfinden, nur auf dem Rücksitz herumhopsen zu können. Sie löcherten ihren Vater mit Fragen:
»Sind wir bald da?«
»Wie lange dauert’s noch?«
»Ich will meinen Eimer und die Schaufel!«
Der Campingplatz lag im Schatten von Keulenbäumen direkt am Strand. Die Landzunge im Süden ragte ins Meer, gischtgekrönte Wellen brachen sich an den Felsen. Ein schmucker Leuchtturm erhob sich auf dem höchsten Punkt. Am nördlichen Ende des Strandes waren bei Ebbe flache Felsen zu sehen, durchsetzt von Gezeitentümpeln und kleinen Prielen. Die Wellen leckten an den Steinen, und hinter dem Sandstrand erhoben sich hohe Dünen.
Die Familie Campbell wurde in der eingeschworenen Camper-Gemeinschaft freundlich aufgenommen. Die meisten waren alte Hasen, die jedes Jahr kamen, und die Familie wurde bereitwillig in die Sitten und Gebräuche des Campens eingeführt. Die Kinder hatten Spielkameraden, die Männer tranken Bier und palaverten, während die Frauen sich über Schnellverfahren bei der Zubereitung der Mahlzeiten und der täglichen Routine austauschten. Christina, »Sagt Tina zu mir, so wie Roger«, war zu Anfang schüchtern. Die meisten Frauen auf dem Campingplatz lebten in Vororten oder Kleinstädten, nicht auf einer abgelegenen Farm. Christina wurde bewusst, wie ausgehungert nach weiblicher Gesellschaft sie war.
Die Familie blieb während des größten Teils des Tags unter sich und kam zum Mittagessen zurück zum Caravan mit der Markise über dem Essplatz. Christina gönnte sich das seltene Vergnügen eines Mittagschläfchens, während Roger mehrere Stunden mit den Kindern am Strand verbrachte. Die Abende wurden gesellig mit den Nachbarn bei Spielen und gelegentlich gemeinsamen Essen verbracht.
Teddy und Jennifer liebten den Strand, wenngleich sie sich nicht ins Meer wagten. Jennifer konnte überhaupt nicht schwimmen, und Teddy hatte nur ein paar Unterrichtsstunden im Schwimmbad in der Stadt gehabt, denn die Stadt war zu weit entfernt für regelmäßigen Schwimmunterricht.
Auf dem Grundstück des Motels neben dem Campingplatz befand sich ein kleiner Pool, und einer der benachbarten Camper bot an, Teddy in null Komma nichts das Schwimmen beizubringen.
Teddy wollte einen großen Fisch angeln. Sein Vater hatte eine neue Rolle an seiner alten Rute angebracht und wusste inzwischen, welcher Köder am besten geeignet war. Einige Männer hatten tatsächlich Fische nach Hause gebracht, die sie vom Strand aus gefangen hatten, woraufhin ein großes Grillfest organisiert wurde. Teddy wollte, dass er und sein Vater einen noch größeren Fisch fingen, vielleicht sogar einen Dorsch, und Roger hatte ihm versprochen, am nächsten Tag bei Ebbe mit ihm von der Felsbank aus zu angeln.
»Kommst du mit, Schatz? Unterm Sonnenschirm zusehen, wie wir einen dicken Fisch fürs Abendessen rausholen?«
Christina schüttelte den Kopf. Sie freute sich darauf, den Nachmittag mit einem Deadwood-Dick-Taschenbuch genüsslich auf der Plastikliege zu verbringen, während Roger die Kinder beschäftigte. »Jenny … setz deinen Sonnenhut auf. Du auch, Teddy.«
»Och, Mum, ich habe doch Zinksalbe auf der Nase. Das reicht. Der Hut weht mir nur vom Kopf oder so.«
»Schon gut. Also, Jennifer, hast du Eimer und Schaufel? Hast du den Köder, Teddy? Dann kann’s ja losgehen. Bis später, Tina.«
»Viel Spaß. Sei schön artig, Jennifer. Lauf nicht so weit weg. Gib acht auf sie, Roger.«
»Tina, sie ist restlos zufrieden, wenn sie Sandburgen bauen und Wasser aus den Tümpeln in ihren Eimer schöpfen kann. Ruh du dich schön aus.«
»Es stört dich wirklich nicht?«, fragte Christina. Roger hatte ihr angeboten, die Sonnenliege und den Schirm hinunter an den Strand zu tragen, doch Christina war die Sonne zu heiß und grell. Sie genoss die Zeit für sich allein vor dem Caravan, wo sie sich jederzeit etwas Kaltes zu trinken oder eine Tasse Tee holen konnte. Manchmal trank sie Tee und rauchte eine Zigarette mit der Frau aus dem benachbarten Caravan. In der Nachmittagshitze herrschte Ruhe auf dem Campingplatz, und Christina liebte es, ausnahmsweise mal Zeit für sich allein zu haben, ohne dringende Arbeiten im Haus oder auf der Farm, ohne die Kinder, die nach Aufmerksamkeit verlangten. Sie wollte das Beste aus dieser zweiwöchigen Verschnaufpause machen, bevor sie zurückfahren musste zu … Sie mochte nicht daran denken.
Sie seufzte, ließ das Buch auf den Schoß sinken und schloss die Augen. Warum war ihr Leben so verdammt schwer? Sie war noch so naiv gewesen, als sie geheiratet hatte. Gott, wenn sie gewusst hätte, dass ihr Leben so aussehen würde … Ihre Mutter, mit geschürzten Lippen und missbilligender Miene, erschien vor ihrem inneren Auge. Roger Campbell war ihr nicht gut genug gewesen. Aber wer war ihre Mutter schon, dass sie sich solche Allüren erlaubte? Christinas Vater war ein hart arbeitender, exzessiv trinkender Kraftfahrzeugmechaniker gewesen, dessen Lohn kaum ausreichte, um die Grundbedürfnisse seiner Familie zu befriedigen.
Christina wollte keinen Sohn von Freunden ihres Vaters oder einen Jungen aus ihrem engen sozialen Umfeld heiraten. Eine zufällige Begegnung mit einem Jungen aus dem Busch erschien ihr wie ein Fluchtweg. Wenn sie gewusst hätte … Wie auch immer, irgendwann hatten sie und Roger genug Geld zusammengekratzt, um sich ein kleines Anwesen zu kaufen.
Sie würde, verdammt noch mal, dafür sorgen, dass es ihrer Tochter mal besserging als ihr. Sie wollte, dass Jennifer einen richtigen Beruf erlernte, einen, der sie im Notfall auch ernähren konnte. Vielleicht Lehrerin, Krankenschwester, Bankangestellte. Christina traute Männern nicht sonderlich, mochte sie auch nicht wirklich. Man konnte sich nicht darauf verlassen, dass sie ihre Versprechungen einhielten. Sie hatte zugesehen, wie ihr Vater ihre Mutter fertiggemacht hatte, und viele Freundinnen hatten ihr von den Enttäuschungen in ihren Ehen erzählt, und Roger hatte sich auch nicht als der erfolgreiche Mann erwiesen, den sie sich erhoffte. Vielleicht verlangte sie zu viel. Roger warf ihr vor, dass sie nie zufrieden wäre. Wenn sie einen Beruf hätte, irgendeine Arbeit, dann wäre vielleicht alles anders. Aber was sollte sie tun? Sie hatte zwei kleine Kinder und war die Frau eines Farmers auf einer dem Untergang geweihten Farm.
Tina drückte ihre Zigarette aus. Nun, zunächst einmal musste sie das Beste aus ihrer Situation machen. Wenn die Kinder erst älter waren und die Farm hoffentlich wieder schwarze Zahlen schrieb, dann würde ihr Leben sich vielleicht zum Besseren verändern.
Für Roger war die Küste eine Welt ohne Kummer und Sorgen. Er war frei von der endlosen Reihe von Pflichten, dem herzzerreißenden Anblick des mageren Viehs, des spärlichen Futters und der beinahe leeren Stauseen. Frei von der ständigen Erschöpfung und Depression, während er seinen fröhlichen, lebhaften Kindern ein heiteres Gesicht zeigte und Christina eine verschlossene, unzufriedene Miene zur Schau trug.
Hier fühlte er sich wieder wie ein Kind. Er und Teddy redeten ausführlich über die Montage ihrer Angeln, übers Auswerfen und darüber, wie sie ihren großen Fang an Land drillen würden. Immer wieder schaute er sich nach Jennifer um, die hingebungsvoll im knöcheltiefen Wasser watete, die Gezeitentümpel inspizierte und kleine Muscheln, Algen und hübsche Steine in ihrem Eimer sammelte. Sie ist so ein selbständiges kleines Mädchen, dachte er liebevoll. Sie würde in dieser Welt schon zurechtkommen. Er konnte nur hoffen, dass Tina nicht ihren geballten Ehrgeiz auf Jennifer übertrug und versuchte, das Leben, das sie nie hatte, durch ihre Tochter zu finden.
Ihm war bewusst, dass sie finanziell schwere Zeiten durchmachten, und dadurch waren ihre Gefühle zueinander erkaltet. Sie lebten ihre tägliche Routine, doch die Nähe, die Zuneigung, die Freundschaft fehlten. Hatte es sie je gegeben, fragte er sich in plötzlicher Erkenntnis. Er wusste, was Tina dachte, und dadurch fühlte er sich noch unzulänglicher und trauriger. Sie hatte gewusst, was er war, was er vorhatte – eine eigene Farm besitzen und bewirtschaften –, und das hatte er getan. Seine Mutter hatte ihm geraten, ein Mädchen vom Land zu heiraten, das wusste, worauf es sich einließ. Ein Mädchen aus den Vororten einer Großstadt würde nicht durchhalten, wenn die unvermeidlichen schweren Zeiten kamen, die Teil des Landlebens waren. Nun ja, zumindest blieb Tina bei ihm.
Er bemühte sich, die nörgelnde Stimme in einem Winkel seines Bewusstseins zu überhören, die in Frage stellte, ob sie zusammenblieben. Vielleicht wäre es besser für sie, ihre eigenen Wege zu gehen. Aber nicht für die Kinder. Sie waren der Leim, der sie zusammenhielt. Und Roger liebte seine Kinder – der Gedanke, sie nicht jeden Tag um sich zu haben, war für ihn tabu. Wie seine Mutter sagte: in guten wie in schlechten Zeiten, wie man sich bettet, so liegt man.
Seine Grübeleien hatten ihn abgelenkt, und er sah sich nach seinem Sohn um, der konzentriert an seiner Rolle bastelte. Dann suchte sein Blick Jennifer. Sie war nicht da.
Es schnürte ihm die Kehle zu, er trat einen Schritt zurück, und da entdeckte er ihre kleine Gestalt. Der Sonnenhut war ihr, gehalten von einem Gummiband, auf den Hinterkopf gerutscht. Sie hockte vor einem Tümpel am Rand des Felsens. Anscheinend war sie dem kleinen Priel bis an den Rand des Wassers gefolgt, fasziniert von dem Leben in der Unterwasserwelt. Doch sie befand sich zu nahe an der Stelle, wo die Wellen auf den Felsvorsprung schlugen.
Er wandte sich um und rief an Teddy vorbei: »Jennifer! Jennifer … komm zurück an den Strand! Das ist viel zu gefährlich da …«
Teddy drehte sich um und blickte zu der Stelle hinüber, wo Jennifer hockte. Beide sahen nicht die große drohende Welle.
Man sagt, es sei jede siebte Welle. Aber wer zählt schon mit? Diese schwellende Wasserwand musste gewartet und das Volumen des Ozeans in ihrer Brust aufgenommen haben, bis sie voll, massiv und zerstörerisch war. Wild bäumte sie sich auf und warf sich mit schäumender Macht, die alles mitriss, über die Felsen. Sie fiel Roger an, der rückwärts taumelte und hilflos die Arme nach der sich entfernenden Gestalt seines Sohnes ausstreckte, nach ihm griff, sich nach ihm streckte. Beide wurden unter das wirbelnde weiße Wasser gesogen und von dem Felsvorsprung gerissen.
Auch Jennifer hatte die Welle nicht kommen sehen. Sie hatte aufgeblickt, als sie die Stimme ihres Vaters hörte, und dann stand ihre Welt plötzlich kopf. Sie begriff nicht, was geschehen war. Sie schloss vor Schreck die Augen und spürte, wie ihr die Beine unter dem Leib weggerissen wurden. Etwas Hartes stieß gegen ihr Bein, es dröhnte in ihren Ohren.
Schwebte sie? Flog sie? Sie öffnete die Augen. Um sie herum war alles still und ruhig. Sie hing in einer blauen Leere. War das da oben Sonnenlicht? Eine kleine, leuchtend rot und grün gefärbte Gestalt huschte an ihr vorbei. Sie drehte den Kopf. Es war ein wunderschöner kleiner Fisch. Ein sehr emsiger Fisch, der nach unten schoss, wo ein rosa und violett gefärbter Teppich ausgebreitet lag. Allmählich sah sie noch mehr Bewegung, sanftes Wiegen eines langen Colliers aus grünem Seetang, den pulsierenden Tanz einer Gruppe durchscheinender lavendelfarbener Anemonen, die einen still schwebenden, winzigen, orange-schwarzen Fisch bargen.
Ich bin unter Wasser, dachte Jennifer. Ich bin in der Stadt unter dem Meeresspiegel! Sie hatte sich den Priel auf dem Felssprung als verkehrsreiche Straße vorgestellt, die an einen verzauberten Ort führte – und hier lag er vor ihr. Sie hob einen Arm, trat mit dem Bein aus und stellte fest, dass sie sich in dieser merkwürdigen Welt mühelos bewegen konnte. Sie streckte die Arme aus und spürte, wie sie emporgetragen wurde. In dem Blau schimmerten goldene Bögen wie Weizenfelder.
Doch dann schoss eine große schwarze Gestalt auf sie zu und griff in einem Schwall von gurgelnden Blasen nach ihr. Sie spürte, wie sie gepackt und nach oben auf das Licht zu gezerrt wurde. In Panik versuchte sie, sich gegen das, was sie da festhielt, zu wehren, doch plötzlich wurde sie aus der wunderschönen Welt herausgestoßen und durchbrach die Wasseroberfläche des Meeres. Sie sah wässrig verschwommen etwas auf dem Felsvorsprung, einen Mann, der winkte und etwas rief. War es Dad?
Sie wandte sich um und sah, dass sie von einem fremden Mann, der von Kopf bis zu den großen Schwimmflossen in schwarzes Gummi gekleidet war, durchs Wasser geschleift wurde. Nur sein erschrockenes weißes Gesicht war zu sehen. Er sagte irgendetwas. Alles, was sie hörte, war das brausende Meeresbranden an den Felsen. Dann zogen Hände sie aus dem Wasser auf die Felsen, und der fremde Wassermann kletterte hinter ihr hinaus und stolperte über seine großen Schwimmflossenfüße.
»Wir haben sie!« Sie wurde hochgehoben, und der Mann, der auf dem Felsen gestanden hatte, trug sie eilig, immer wieder stolpernd und ausgleitend, zum Strand zurück.
Jennifer wehrte sich. Das ganze Ausmaß des gerade Geschehenen dämmerte ihr allmählich. »Wo ist mein Daddy? Wo ist Teddy? Teddy soll kommen!«
Am Strand wimmelte es von Leuten, doch der Mann ließ sie nicht los, sondern drückte ihr Gesicht an seine Brust und rief zum Strand hinüber: »Ist er okay? Wo ist der Junge?« Und dann lag ihr Vater da im Sand, nass und ohne Hut und Sandalen. Doch er wandte sich um und richtete sich auf, hustete und rieb sich das Gesicht. Der Fremde ließ Jennifer zu Boden gleiten, und sie rannte zu ihrem Vater.
»Daddy …«
Er drückte sie an sich und gab merkwürdige Geräusche von sich, fast wie Weinen, was Jennifer noch nie bei ihm erlebt hatte.
Sie strich ihm mit der Hand über das nasse Haar. »Nicht weinen, Daddy.« Er hielt sie fest, umklammerte sie, und um sie herum standen Leute und starrten sie an. Verlegen drehte sie sich um und rief: »Teddy … Teddy … Wo ist Teddy?«
Wieder griffen Leute nach ihr, zerrten sie weg von ihrem Vater, halfen ihm auf die Beine und führten ihn vom Strand fort. Jennifer riss sich von der Hand des Fremden los, rannte zurück auf den Felsvorsprung und rief: »Teddy … Wo bist du, Teddy?«
Sie fingen sie ein und trugen sie fort. Sie trat um sich und begann zu brüllen: »Teddy soll kommen!«
»Das ist ihr Bruder«, hörte sie jemanden sagen.
Und dann ertönte Sirenengeheul, und noch mehr Menschen waren da, und sie wurde in einen Wagen gesetzt.
Sie waren in einer Arztpraxis. Jennifer saß auf der Kante eines flachen harten Betts, und eine Dame betupfte die Kratzer an ihren Beinen. Tränen liefen ihr über die Wangen, und Jennifer fragte sich, warum sie weinte. Schließlich waren es doch ihre Beine, die so brannten.
Sie wurde nach draußen geführt und erschrak, als sie ihre Mutter zusammengesunken in einem Sessel sitzen sah. Sie umschlang ihren Oberkörper mit den Armen, hielt den Kopf gesenkt, und ihre Schultern zuckten von dem Schluchzen, das ihren ganzen Körper erschütterte. Ihr Vater stand neben ihr, eine Wolldecke über die nassen Schultern gelegt. Sein Gesicht wirkte grau und krank. Jennifer lief zu ihm, doch er schob sie von sich. »Geh zu deiner Mutter.«
Jennifer hatte Angst, als sie ihre Mutter so sah. »Ist Mummy krank?«
Ihre Mutter griff mit geschlossenen Augen nach ihr, ein Arm ruderte blindlings in der Luft, als wollte er die Stunde zurückholen, als ihre Familie noch vollständig war. »Jennifer …« Ihre Stimme war rauh und heiser, und Jennifer wich einen Schritt zurück, aus Angst, etwas Böses getan zu haben.
»Die Mutter hat eine Spritze bekommen; dem Vater geben Sie am besten ein Beruhigungsmittel. Die Leute von nebenan haben angeboten, Jennifer zu sich zu nehmen, bis … sie ihn gefunden haben«, sagte jemand.
Ein heftiger Schmerz durchzuckte Jennifer, brannte unter ihren Fußsohlen und schoss lodernd durch ihren kleinen Körper bis in ihren Kopf, und wieder hörte sie das wütende Brüllen des Ozeans an den Felsen. Sie wusste, dass Teddy noch da draußen war, ihr entrissen. »Teddy!«, schrie sie.
Sie hielten ihre rudernden Arme und Beine fest, und sie versuchte wild, sich zu befreien. »Ich will weg … ich will bei Teddy sein.« Die Vorstellung, dass er sich in jener wunderschönen blauen Welt unter dem Meeresspiegel befand, brach ihr das Herz. Sie hatten doch immer alles gemeinsam unternommen.
Die Krankenschwester kniete sich neben sie. »Dein Bruder, Teddy, er ist im Himmel, Schätzchen. Er ist bei den Engeln …«, sagte sie, und ihr Gesicht war noch nass vom Weinen.
Jennifer starrte die Frau an, ihr Schreien ließ nach und machte einer verächtlichen Miene Platz. »Teddy ist nicht bei den Engeln. Er ist bei den Fischen.«
Sie wurde eilig weggebracht. Sie fuhren nach Hause. Die Tage vergingen in einem trüben Dunst. Ihre Mutter blieb im Bett, und wenn sie wach war, weinte sie oder lag nur da und starrte an die Wand, ohne etwas zu sagen. Ihr Vater war wie ein Schatten.
Tante Vi, Christinas Schwägerin, die aus Sydney gekommen war, kochte und putzte, und Fremde kamen und gingen. Ihr Vater blieb von Tagesanbruch bis in die Dunkelheit draußen auf der Farm. Er aß und schlief auf der Veranda. Doch Jennifer wusste, dass er auf der Farm nicht arbeitete. Sie sah ihn ziellos umherwandern oder einfach nur dasitzen oder an einem Zaun lehnen.
Irgendwann kam auch Tante Vis Mann Don, Christinas Bruder, und sprach mit ihrem Vater.
Dann waren sie allein. Nur zu dritt. Ihre Mutter tat in Haus und Garten das, was sie schon immer getan hatte. Doch ihr Schritt war langsam, ihre Bewegungen lethargisch, ihr Gesicht hager und traurig. Sie blickte selten jemandem in die Augen, vermied jeden Kontakt. Besonders mit Jennifers Vater. Sie bürstete Jennifers Haar, stellte die Mahlzeiten auf den Tisch und wusch Wäsche, aber sie las ihr keine Geschichten vor und brachte sie nicht zu Bett. Jennifer schlüpfte still unter die Decke, drückte Teddys geliebte Strick-Schildkröte an sich und vergrub das Gesicht in den Kissen, damit niemand ihr einsames Weinen hörte.
Eines Nachmittags kam sie unverhofft in die Küche und fand ihren Vater vor, der beim Herd stand. Sein Hut lag auf dem Boden, seine Arme hingen schlaff herab, den Kopf hatte er in den Nacken gelegt, die Augen geschlossen. Ihre Mutter boxte auf ihn ein, hieb ihm mit zu Fäusten geballten Händen auf die Brust, und er stand da und machte keinerlei Anstalten, dem wilden Angriff auszuweichen. Sein Gesicht war schmerzlich verzogen, jedoch nicht wegen der Schläge seiner verzweifelten Frau.
Christina schrie: »Zur Hölle mit dir! Du hast ihn umgebracht! Du hast ihn umgebracht! Du hast mir meinen Jungen genommen. Ich hasse dich, hasse dich, hasse dich …«
Jennifer wollte ihre Mutter daran hindern, ihren Vater so zu schlagen, doch sie drehte sich um und rannte und rannte, bis ihre Beine sie nicht mehr trugen. Da warf sie sich auf den Boden und hieb auf die Erde, wie ihre Mutter auf ihren Vater eingedroschen hatte. Sie wollte ihren Bruder Teddy zurück. Sie wollte, dass alles wieder so war wie früher.
An diesem Abend kam ihr Vater zu ihr und setzte sich im Dunkeln auf die Bettkante. Er strich ihr Haar zurück und fuhr mit seiner Hand zärtlich über ihre Wange. »Nicht weinen, Jen … Wenn ich etwas ändern könnte, würde ich es tun. Ich werde mir nie verzeihen. Aber du darfst nicht so traurig sein. Du wirst zu einer wunderschönen Prinzessin heranwachsen und in einem Schloss leben und glücklich sein.«
»Mit Teddy?«, schluchzte sie.
»Nein, Jennifer, Teddy wirst du sehr lange nicht sehen.«
»Und du und Mommy, kommt ihr in mein Schloss?«
»Nein. Ich gehe fort, Jen … Ich werde dich vielleicht sehr lange nicht wiedersehen. Du musst ein braves Mädchen sein …« Seine Stimme machte ein seltsames Geräusch in seiner Kehle, und er hörte auf zu reden.
Ein paar Minuten lang schwiegen beide in der Dunkelheit. »Gehst du zu Teddy?«, flüsterte Jennifer. Sie wusste, dass dieses Gespräch ein Geheimnis enthielt, etwas, was sie vor ihrer Mutter verbergen musste.
Ihr Vater drückte ihr die Hand, strich ihr sanft übers Haar, beugte sich dann hinab und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Träum was Schönes, kleine Prinzessin.«
Sie sah ihren Vater nie wieder. Sie erfuhr nie genau, was passiert war. Als Teenager fand sie einen klein zusammengefalteten Zeitungsartikel im Fotoalbum ihrer Mutter, das diese in einer Schublade in ihrem Schlafzimmer aufbewahrte. Es war kein umfangreicher Artikel, doch er zählte trocken und unpersönlich Tatsachen auf. Ein kleines Aluminiumboot war unbemannt in Strandnähe gefunden worden. Ein Fischer wurde vermisst. Das Meer war in jener Nacht ruhig gewesen. Die Polizei ermittelte, denn am Ufer hatte man säuberlich zusammengelegte Männerkleidung gefunden. Nichts wies auf ein Verbrechen hin. Achtzehn Monate zuvor war der Sohn des betreffenden Mannes am selben Strand ertrunken.
Sie legte den Zeitungsausschnitt zurück und wusste instinktiv, dass sie mit ihrer Mutter nicht darüber sprechen konnte. Christina weigerte sich, über ihren Mann oder ihren Sohn zu reden. Wenn Jennifer sie erwähnte, verschloss sich das Gesicht ihrer Mutter vor Schmerz, und sie wandte sich ab. Doch Jennifer sehnte sich danach, über ihren Bruder und ihren Vater reden zu können. Dann waren sie ihr nahe, denn sie hatte Angst, sie zu vergessen, wenn sie nie von ihnen sprach. Deshalb plauderte sie mit ihrem Bruder, als wäre er bei ihr und spielte an ihrer Seite, und schloss ihren Vater an erster Stelle in ihre Gebete ein.
Nach dem »Unfall«, wie der Tod ihres Mannes allgemein bezeichnet wurde, hatte Christina sich wegen des Verkaufs der Farm gequält, doch nachdem sie sich ein Jahr lang mit Hilfe von Nachbarn mit der Bewirtschaftung abgemüht hatte, sah sie ein, dass dies vom finanziellen Standpunkt aus kein gangbarer Weg war. Die Farm war abgelegen und voller Erinnerungen. Christina hatte nur Jennifer als Gesellschaft. Die Männer aus der Nachbarschaft, die ihr halfen, waren müde, sorgten sich um Traktorpannen, Mangel an Regen und Viehfutter. Ihre Frauen führten ein ausgefülltes, arbeitsreiches Leben. Christina konnte nicht Auto fahren, und ein Ausflug in die Stadt per Bus oder mit einem Nachbarn war ein seltenes Vergnügen. Gespräche mit ihrer Tochter drehten sich um Jennifers Interessen. Tagsüber führten Radiosendungen Christina vor Augen, wie isoliert sie war. Die Abende verstrichen vor dem Fernseher mit amerikanischen Sitcoms.
Jennifer erinnerte sich später stets an die Freiheit, die sie während dieses Jahrs auf der Farm genoss. Ihre Mutter sagte ihr, sie müsse sich selbst beschäftigen. So vergrößerte sich die Welt des kleinen Mädchens, was zur Entdeckung ihrer selbst und zu Abenteuern führte. Kein Daddy oder Bruder waren da, um sie zu beschützen, andererseits gab es auch niemanden, der ihre Aufmerksamkeit auf Dinge lenkte, die sie seines Erachtens hätte tun müssen. Stattdessen entdeckten ihre Augen und ihr Forscherdrang allerlei Faszinierendes: Pflanzen, kleine Lebewesen, Vögel und den unbekannten Busch da draußen. So konnte sie, zum Beispiel, stundenlang, alles um sich herum und auch die Zeit vergessend, auf dem Boden hocken und eine Prozession von Ameisen beobachten, die ihre Last zum Bau trugen, oder eine Raupe, die mit unhörbaren Bissen an einem Blatt fraß, oder einen Vogel, der seine Jungen fütterte.
Es war eine Zeit, die ihr die Augen öffnete für eine andere Welt. Eine Welt, die innerhalb der ihren existierte und doch von ihr abgetrennt war. Die Welt der Natur, der Pflanzen und Tiere, ihrer Abhängigkeit von der Umwelt, ihrer Überlebensstrategien, ihrer Hingabe an den Schutz und den Erhalt ihrer Spezies. Neben dem Vieh, den Hunden, den großen Weiden und dem fernen Stausee gab es jenseits ihrer Hintertür eine andere Welt, die von Leben wimmelte.
Auf einer dieser Expeditionen, auf denen sie im Gehen oder Sitzen den Blick auf den Boden zu richten pflegte, fand sie die Muschel. Ein Beuteldachs hatte an den Wurzeln eines Baums ein Loch gegraben, und dort entdeckte Jennifer etwas Helles im aufgeworfenen Erdreich. Sie hob den vermeintlichen Stein auf, und als sie ihn in den Händen drehte, bemerkte sie die unverkennbare Form einer Muschel. Sie war so in den Stein eingebettet, dass sie ein Teil von ihm zu sein schien. Mit der Fingerspitze zeichnete sie den Rand der Muschel nach, und dort, in der Hitze auf der Weide, unter einem Gummibaum, in dem eine Elster keckerte, hörte sie, zuerst nur schwach, dann in einer alles verschlingenden Woge, das Rauschen des Meeres. Sie schloss die Augen, schloss die Faust um das Fossil und erinnerte sich an den Geruch der salzigen Luft, an die frische Brise auf ihren Wangen, und der Rhythmus des Ozeans erfasste sie wieder. Sie nahm die Muschel mit nach Hause, wusch sie ab und legte sie in den Schuhkarton, in dem sie ihre besonderen Schätze aufbewahrte.
Wenn Jennifer das Haus verließ und für Stunden verschwunden war, dachte ihre Mutter, sie würde ihre Zeit vergeuden und sich vor Arbeit und Schulaufgaben drücken. Wenn sie zurückkam und gefragt wurde, was sie getrieben habe, antwortete sie wenig aufschlussreich: »Nix.«
Es war ihr verboten, zum Stausee zu gehen, obwohl er seicht und schlammig war und das Wasser ihr nicht einmal bis an die Schultern reichte. In der Stimme ihrer Mutter hörte, in ihren Augen erkannte sie eine unausgesprochene Angst vor Gefahren, die von jeglichen Gewässern ausgingen.
Und dann eines Abends, als Jennifer an der Spüle stand und den Abwasch erledigte, kam ihre Mutter hinzu, griff nach einem Küchentuch und begann, das Geschirr abzutrocknen, das gewöhnlich zum Abtropfen stehengelassen wurde.
»Ich muss dir etwas sagen.« Sie schob einen zerknüllten Zipfel des Tuchs in ein Glas und drehte ihn. »Seit … dem Unfall … fällt es mir sehr schwer, die Farm allein zu bewirtschaften.«
»Ich helfe dir! Und Mr.Allen von nebenan kommt auch, um dir Arbeit abzunehmen, Mum.«
»Ich weiß. Aber es reicht nicht. Ich muss an die Zukunft denken. Also, Jennifer, ich habe die Farm verkauft …«
»Aber es ist unsere Farm. Unser Zuhause …« Tränen traten ihr in die Augen, und sie wandte ihr erschrockenes Gesicht ihrer Mutter zu, die Hände im Seifenwasser um einen Teller gekrallt.
Ihre Mutter hielt den Blick gesenkt und konzentrierte sich auf das Polieren des Glases. »Es ist zu unserem Besten«, sagte sie ergeben. Sie hatte gewusst, dass ihre Tochter schockiert sein würde. Sie kannte ja nichts anderes als die Farm.
»Wo sollen wir wohnen?« Jennifer brach in Tränen aus.
Ihre Mutter legte Glas und Geschirrtuch aus der Hand und strich ihrer Tochter eine hellblonde Haarsträhne von der tränennassen Wange. »Komm, setz dich zu mir. Ich hole dir ein Glas Milch. Wir ziehen in die Stadt. Es wird dir gefallen. Dort hast du dann Freunde ganz in deiner Nähe, kannst ins Kino gehen, zu Fuß zur Schule gehen.«
»Ich will hier nicht weg.«
»Tja, wir ziehen aber fort, und damit basta.«
Christina fiel die ganze Angelegenheit schwer genug, und sie hatte gehofft, Jennifer würde den Umzug als großes Abenteuer betrachten. »Ich muss an unsere Zukunft denken. Dein Vater hat uns ohne irgendwelche Rücklagen verlassen, die Farm wirft nicht genug ab …«
»Dad hat unsere Farm geliebt. Er würde mich nie von hier wegnehmen.«
»Aber er ist nicht hier, oder?« Ihrer Mutter riss der Geduldsfaden. »Ich muss mir Arbeit suchen, um Himmels willen. Arbeit, die Geld einbringt. Weiß der Himmel, was. Wahrscheinlich ende ich als Putzfrau für irgendwelche Leute oder als Verkäuferin in einem Laden. Nur, damit du zur Schule gehen kannst.«
»Ich will nicht zur Schule gehen. Ich will hierbleiben!« Jennifer lief in ihr Zimmer und schlug die Tür zu.
»Mach es doch nicht noch schwieriger, als es schon ist«, rief Christina ihr nach.
Das Thema wurde nicht noch einmal angesprochen. Wie betäubt sah Jennifer ihrer Mutter zu, als sie ihre Habseligkeiten einpackte und den Auktionator herumführte, der Gegenstände verkaufte, die nicht zusammen mit der Farm veräußert wurden. Sie blieb in sich gekehrt und traurig, auch als die Umzugsvorbereitungen hektischer wurden. Erst als Mr.Allen mit seinem Lieferwagen auftauchte und die Hunde ihres Vaters darin festband, stieß Jennifer einen jämmerlichen Schrei aus, lief zu ihm, zerrte ihn am Ärmel und versuchte, zu den Hunden auf die Ladefläche zu springen.
»Nein, Mr.Allen. Bluey und Charlie müssen bei uns bleiben. Sie gehören Daddy.«
»Jenny, Schätzchen, du kannst die Hunde nicht in die Stadt mitnehmen. Nicht dahin, wo deine Mum hinzieht. Außerdem sind sie Hütehunde. Sie brauchen viel Auslauf. Mrs.Allen und ich werden schon gut für sie sorgen.« Jennifers Blick schweifte wild über die Stapel von Kisten voller Kleidung und Küchengeräte, über den leeren Schuppen, die landwirtschaftlichen Geräte und Haushaltsgegenstände, die versteigert werden sollten. Dem kleinen Mädchen war zumute, als würde ihr ganzes Leben verpackt, fortgeschafft, verschenkt und verkauft.
Der alte Farmer beugte sich zu ihr herab und tätschelte ihren Kopf. »Sie werden es gut haben, Kleine. Du kannst sie ja mal besuchen. Mich und Mrs.Allen auch.«
Sie blickte in sein unglückliches Gesicht und wusste, dass das nie geschehen würde. Sie konnte die Hunde nicht einmal ansehen, die ihrem Vater überallhin gefolgt waren, mit ihm auf seinem alten Motorrad, einer vorn, einer hinten, gefahren waren. Sie nickte und ging, ohne sich noch einmal umzusehen, zum Haus. Bernie Allen stand da, stülpte sich den Hut auf den Kopf und dachte, es sei doch eine verdammte Schande, dass es so weit kommen musste. Roger war ein Idiot gewesen, als er zum Brandungsangeln ging, obwohl er nicht die geringste Ahnung vom Meer, vom Angeln und vom Schwimmen hatte. Christina Campbell war hart im Nehmen, doch sie würde niemals darüber hinwegkommen, und ihr kleines Mädchen tat ihm leid.
Christina und Jennifer zogen in ein kleines Haus am Stadtrand. Jennifers Welt wurde enger. Fort waren der Garten, die Tiere rund um den Holzstoß, die Hühner und Enten in ihren Gehegen, die Kühe auf den Weiden hinter dem Haus, der kleine Bach jenseits des Zauns. Fort waren die kleinen und großen Lebewesen, die Pflanzen, die bewusste Nähe zur Natur, die ihr Umfeld gewesen war. Jetzt lebte sie in einer ländlichen Kleinstadt, die versuchte, mit dem Fortschritt der Großstädte mitzuhalten, und sie musste ihre Beobachtungen entsprechend umstellen.
Jennifer hatte es schwer in ihrer neuen Schule. Um sie herum waren so viele andere Kinder. Sie waren lebhaft und laut, rannten auf dem asphaltierten Schulhof herum und spielten alberne Spiele. Nach drei Jahren versuchte Jennifer, sich zu erinnern, wie es zu Hause gewesen war. Die Weiden, die Bäume und die sanften Kühe. Die frische Luft. Die friedliche Stille. Ihr Vater, der einen Zaun reparierte, die Ärmel des blauen Hemds hochgekrempelt, den Buschhut tief in die Stirn gezogen. Der Duft aus der Küche, wenn ihre Mutter backte. Flatternde Wäsche auf der von einer Forke hochgehaltenen Leine. Teddy fehlte ihr.
Ihre Mutter ging jetzt arbeiten. Sie hatte eine Stelle in der Bibliothek gefunden. »Jemand muss auf dich aufpassen«, sagte sie seufzend zu Jennifer. »Du bist alles, was ich habe auf der Welt.«
Jennifer biss sich auf die Unterlippe. »Ich passe auf dich auf, Mum. Wenn ich groß bin, habe ich einen richtig guten Beruf, und du kannst zu Hause bleiben.«
Ihre Mutter zuckte mit den Schultern, wandte den Blick ab und gab ihre stereotype Antwort: »Wir werden sehen.«
Christina musste das System der Bücherei erlernen. Sie schob den vollgeladenen Wagen durch die Gänge und ordnete die Bücher in die Regale ein. Um zusätzlich Geld zu verdienen, putzte sie nach Feierabend in der Bibliothek. Nach achtzehn Monaten fragte sie nach, ob man ihr auch noch weitere Betätigungsfelder überlassen könnte.
Die Leiterin der Bibliothek blieb fest. »Nur, wenn Sie tippen lernen.« Christina beklagte sich bei Jennifer, die Bibliotheksleiterin sei ein Drachen und würde sie ständig herunterputzen, weil sie keine »Büroausbildung« habe.
Jennifer schlug ihr vor, in einem TAFE-Institut Maschineschreiben und die Grundlagen der Büroarbeit zu erlernen. Anfangs weigerte ihre Mutter sich, und Jennifer vermutete, dass die Tatsache, dass ihre Tochter mehr als sie selbst über Fortbildungsmöglichkeiten wusste, Christina in Verlegenheit brachte, wenn nicht gar erbitterte. Als Christina etwas darüber äußerte, dass sie sich eine bessere Stelle suchen wolle, vielleicht in einem Lokal, ging Jennifer das Problem von einer anderen Seite an.
»Mum, ich kenne mich eigentlich nur mit den Grundlagen aus, ich bin sicher, du lernst es viel schneller als ich. Dann kannst du dir die Feinheiten aneignen und mir alles beibringen.«
Jennifer war sich ihrer Verantwortung für ihre Mutter bewusst. Sie musste die Lücke füllen, die ihr Vater und ihr Bruder hinterlassen hatten. Sie ging nicht gern in die Schule, ahnte aber, dass harte Arbeit in allen Fächern ihr eine Art Fluchtweg öffnete. Die Lehrer vermittelten ihr die Vorstellung, dass das Lernen nur einem Ziel diente: einen Beruf zu finden. Die Freude am Lernen und am Recherchieren in bestimmten Fächern wurden als sinnloses Vergnügen abgetan. Jennifer wurde sich eines unausgesprochenen, subtilen Drucks bewusst, der sie in akzeptable Berufe wie den der Lehrerin, der Krankenschwester oder der Buchhalterin drängen sollte. Andere Mädchen wünschten sich Tätigkeiten, bei denen sie Freunde finden und Geld sparen konnten, bis zu dem Zeitpunkt, da sie eine Familie gründeten.
Der einzige Ausweg aus der profanen Welt kleinstädtischer Eifersüchteleien und begrenzter Zukunftsaussichten bot sich Jennifer in Nächten, wenn der Traum kam. Dann schwebte sie wieder in der fremdartig schönen, von unvorstellbaren Lebewesen bevölkerten Welt. Diese lebten in einer kunstvollen Architektur aus bunten Felsen und phantastischen Gärten. Und um sie herum breitete sich die große Bläue des unsichtbaren Meeres aus.
Kapitel zwei
Country Victoria, 1992
Wellen und Whirlpools
Christina und Jennifer verbrachten diese heißen Weihnachtsferien so, wie es inzwischen zur Norm geworden war: Sie schwitzten in ihrem Häuschen und hörten die Nachbarn in ihrem Plastikpool planschen oder Kinder auf der anderen Straßenseite auf dem braunen Rasen im Vorgarten unter dem Wasserstrahl kreischen. Am Abendbrottisch saß wieder einmal ein fremder Mann neben ihrer Mutter, doch Jennifer hatte es mittlerweile aufgegeben, nett zu solchem Herrenbesuch zu sein. Sie war höflich, ohne ermutigend zu sein. Und bald gaben die Besucher es auf, mit dem in sich gekehrten siebzehnjährigen Mädchen plaudern zu wollen.
Jennifer hatte ihre Lektion ein paar Jahre zuvor gelernt, als zu ihrer Verwunderung ein Mann auf eine Tasse Tee hereinschaute. Ein paar Tage später brachte er Christina nach der Arbeit in seinem Wagen nach Hause. Jennifer, vierzehn Jahre alt, fand die Vorstellung, dass ihre Mutter einen Freund hatte, aufregend. Als er das nächste Mal kam, um Christina zum Abendessen im Bowling Club abzuholen, hatte Jennifer sich hübsch angezogen, das Haar gebürstet, hellrosa Lippenstift und etwas Rouge aufgelegt und ihre Nägel im gleichen Pinkton lackiert. Sie plauderte angeregt mit Mr.Teddich.
Christina war nicht erfreut; ihr Gesicht war vielmehr angespannt, gerötet und böse. »Du gehst nicht mit uns aus«, zischte sie Jennifer in der Küche zu.
»Ich weiß. Ich muss noch Hausaufgaben machen, und du hast mir mein Abendessen schon bereitgestellt«, sagte sie erstaunt.
Ihre Mutter deutete auf Jennifers geblümtes, bestes Kleid. »Und das da kannst du beruhigt wieder ausziehen, und zwar sofort. Ich weiß, was du im Sinn hast. Geh in dein Zimmer, zieh dich um und wasch dir die Farbe vom Gesicht. Und du kommst erst wieder nach unten, wenn wir weg sind.«
»Aber ich muss Mr.Teddich doch auf Wiedersehen sagen.«
»Du hast weiß Gott genug gesagt, mein Fräulein.« Ihre Mutter rauschte aus der Küche und schloss mit Nachdruck die Tür hinter sich.
Jennifer war gekränkt und ließ die Unterhaltung mit dem Freund ihrer Mutter immer und immer wieder Revue passieren, versuchte zu ergründen, was, um alles in der Welt, es war, das ihre Mutter so verärgert hatte. Das Thema wurde nie wieder angesprochen, und Mr.Teddich ließ sich nie wieder blicken. Allerdings war er Vertreter und vielleicht nur auf der Durchreise gewesen. Jennifer war traurig und beschloss, das nächste Mal, wenn ihre Mutter einen Freund mitbrachte, noch netter und viel vorsichtiger zu sein.
Kurze Zeit später hörte Jennifer Christina mit Tante Vi telefonieren. Sie sagte, sie würde nie wieder heiraten. Kein Mann wäre es wert, um seinetwillen ihr Leben zu ändern. »Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott«, erklärte Christina ihrer Schwägerin. Der Sinn lag auf der Hand: Man dürfe sich nicht auf andere verlassen, schon gar nicht auf Männer.
Jennifer wünschte sich einen Vater. Sie beneidete ihre Schulfreundinnen, die Väter hatten, mit denen sie Ausflüge unternahmen oder die eben einfach nur da waren. Erinnerungen an ihren eigenen Vater wurden wach und brachten sie zum Weinen. Je länger sie über die Ablehnung ihrer Mutter von männlichen Gefährten nachdachte, desto größer wurde ihre Angst, es könnte ihre Schuld sein. Dann kam ihr ein erschreckender, furchtbarer Gedanke. Konnte es sein, dass Mr.Teddich, weil sie versucht hatte, hübsch auszusehen und nett zu sein, glaubte, sie wollte mit ihm flirten? Dass sie frühreif und aufreizend wäre? Bestimmt nicht. Aber es war durchaus möglich, dass ihre Mutter ihr Verhalten so auslegte. Jennifer schämte sich bei dem Gedanken und fühlte sich schuldig daran, die Heiratschancen ihrer Mutter verdorben zu haben.
Christina musste Jennifer nicht drängen, nach der Schule einen Job anzunehmen. Sie war sich der angespannten Finanzlage deutlich bewusst, und deshalb nahm sie einen Gelegenheitsjob als Bürokraft für den Nationalpark an. Sie unterstützte zudem die beiden Ranger beim Zusammenstellen von Statistikmaterial, Fragebögen und Berichten. Sie fand die Informationen spannend und lernte nach und nach bedeutend mehr über ihre Heimatstadt, die Funktionen der umgebenden Parklandschaft und die Konflikte mit den Farmern, Baugesellschaften und Personen, die sich um das Wohl der Tiere und die Erhaltung des Buschlands bemühten.
Christina zeigte wenig Interesse für die Geschichten, die Jennifer von dem schweigsamen Ranger erfuhr, und drängte ihre Tochter immer wieder, sich der kommunalen Theatergruppe anzuschließen. »Du könntest hinter den Kulissen arbeiten, wie ich es tue. Ich weiß wohl, dass du nicht der Typ bist, der vor Publikum auf die Bühne tritt, aber du musst lernen, unter Menschen zu gehen, Jennifer. Du bist so ein Mauerblümchen.«
»Schon gut, Mum, du bist der Star in unserer Familie.«
Christina entging die Ironie in Jennifers Stimme. »Bei der Arbeit hat neulich jemand gesagt, ich sollte Schauspielerin werden.« Sie lächelte. »In dieser Welt musst du den Mund aufmachen, Jennifer. Das Rad, das quietscht, kriegt das Öl. Niemand hilft dir. Ich möchte nicht, dass du für andere der Fußabtreter bist.«
»Ich komme schon zurecht, Mum. Die Leute sind mir gegenüber immer freundlich und hilfsbereit.«
»Das liegt daran, dass du noch so jung und unschuldig bist. Du bist so weich. Du musst härter werden, wenn du mal vor einer Klasse voll lauter, ungezogener Gören stehen willst.«
Jennifer seufzte und wandte sich ab. Ihre Mutter hatte sich in den Kopf gesetzt, dass Jennifer Grundschullehrerin werden sollte. Darüber wurde nie diskutiert. Ihre Mutter hatte die Vorstellung, dass es ein Beruf mit guten Aussichten wäre. Sie sprach ausführlich über das, was sie von einer der Lehrerinnen gehört hatte, die häufig die Bibliothek besuchten, und war zu der Überzeugung gekommen, dass es Jennifers Berufung wäre. Ihre Tochter wurde nicht gefragt. Jennifers Berufsberater in der Schule waren ebenfalls der Meinung, dass der Beruf des Lehrers das Richtige für sie wäre. Also suchte Jennifer ihren Mentor auf und erkundigte sich nach Universitätsabschlüssen in Pädagogik. Nach einem Blick auf Jennifers gute Noten und im Wissen über die finanzielle Situation ihrer Mutter half er ihr beim Ausfüllen einer Bewerbung für ein Stipendium.
Erst als Jennifer und ihre Mutter nach der Schulabschlussfeier, auf der Christina sich im Erfolg ihrer Tochter gesonnt hatte, nach Hause gingen, verkündete Jennifer, dass sie sich an der Universität von Sydney bewerben wollte.
Ihre Mutter schüttelte in trauriger Resignation den Kopf. »Das ist ja alles gut und schön, aber ich kann es mir absolut nicht leisten, dir das Studium zu finanzieren. Und wozu die Mühe? Du kannst auch an der hiesigen Universität auf Lehramt studieren.«
»Dank meiner guten Noten bekomme ich ein Stipendium, Mum. Das und der Zuschuss vom Staat reichen für die Unterbringung und einige Extras. Und wenn ich dann noch einen Teilzeitjob annehme, kann ich billig auf dem Campus wohnen und meinen Unterhalt bestreiten. Mit einem Hochschulabschluss habe ich Aussicht auf eine besser bezahlte Stelle.« Sie holte tief Luft, um ihre nächste Ankündigung so beiläufig wie möglich vorzubringen. »Ich habe meine Möglichkeiten geprüft, und was mich wirklich interessiert, ist die Natur, das Land … Und in Sydney kann ich Umweltwissenschaften studieren.«
Ihre Mutter starrte ihre große, hübsche Tochter an, als sähe sie sie seit Jahren zum ersten Mal, und verzog das Gesicht, als hätte sie etwas Schlechtes gegessen. »Und wozu soll das gut sein? Was für einen Beruf willst du dann ergreifen?«, fragte sie.
Jennifer war ein wenig verblüfft über die Reaktion ihrer Mutter. »Einen wirklich interessanten. Ich könnte auch in einer Wohngemeinschaft außerhalb des Campus wohnen, denke aber, es wäre einfacher, in der Nähe der Bibliothek, der Seminarräume und der Cafeteria unterzukommen.«
»Du würdest zu Hause ausziehen?« Jennifer antwortete nicht. »Du hast dich erkundigt und deinen Entschluss gefasst, ohne mich zu fragen?«, fragte ihre Mutter gedehnt und mit einer Stimme, die Ärger verkündete.
Mit sinkendem Mut erklärte Jennifer: »Ich wollte mich nur gründlich informieren.«
»Nun, das war Zeitverschwendung. Es kommt nicht in Frage.« Ihre Mutter presste die Lippen zusammen.
»Mum, willst du mal das Programm sehen, das Handbuch, die Seminare, die ich belegen könnte?«
Ihre Mutter ging schneller. »Nein, will ich nicht. Für wen hältst du dich eigentlich? An die Universität! Das ist nur eine Ausrede, um von zu Hause wegzukommen und dich aufzuspielen.«
»Vielleicht könnten Tante Vi und Onkel Don mich ein bisschen unterstützen. Sie haben keine Kinder. Und sie haben schon immer gesagt, ich wäre wie eine Tochter für sie …«
Ihre Mutter blieb stehen, baute sich vor Jennifer auf und flüsterte mit zusammengebissenen Zähnen, um in der Öffentlichkeit keine Szene zu machen: »Das reicht. Was haben die jemals für uns getan? Für dich? Sie würden denken, wir wollten sie ausnutzen. Ich könnte ihnen nicht mehr in die Augen sehen.«
»Mum! Sie haben mich so oft eingeladen, die Ferien bei ihnen in Sydney zu verbringen. Oder angeboten, mit mir irgendwohin zu fahren. Du hast es nie erlaubt!« Ein tiefsitzender, lange unterdrückter Zorn brach sich Bahn. Jennifer spürte eine Enge in der Brust, bekam kaum noch Luft. »Wir sind nie irgendwohin gefahren! Seit zehn Jahren hocken wir in dieser Stadt. Ich hasse sie!«
»Ich arbeite hart. Ich hatte nie das Geld, dir einen Urlaub zu finanzieren. Ich hatte auch nie Urlaub!«, fauchte Christina zurück.
»Du hättest mich mit meinen Freundinnen fahren lassen können. Deren Eltern sagten, es würde überhaupt nichts kosten, wenn ich mit ihnen zum Camping fahren würde. Onkel Don hatte angeboten, mir das Geld für die Zugfahrt zu schicken.«
»Ich will nicht, dass du hinter meinem Rücken Pläne schmiedest, und ich will niemandem verpflichtet sein. In dieser Welt gibt es nur eine Möglichkeit, voranzukommen, und die besteht darin, für sich selbst aufzukommen.«
»Warum traust du keinem Menschen, Mum?«, fragte Jennifer leise. »Du denkst, die ganze Welt wäre gegen dich. Alle haben es darauf abgesehen, dich fertigzumachen.« Jennifers Zorn war verraucht; sie wirkte eher bestürzt als wütend.
Ihre Mutter ging weiter. »Du wirst es noch lernen. Auf die harte Tour. Und eines Tages wirst du mir dankbar sein. Glaubst du denn, es hilft dir, wenn du lieb und nett bist und den Leuten schöntust? Sie benutzen dich, Jennifer. Männern kann man nicht trauen, und Frauen sind immer neidisch. Stell dich auf deine eigenen Füße und verlass dich nur auf dich selbst.«
Jennifer beschleunigte ihren Schritt, um zu ihrer Mutter aufzuholen. Es machte sie traurig, dass ihre Mutter so dachte. Sie selbst betrachtete die Welt und die Menschen anders. Und hinter der hitzigen Wut ihrer Mutter erkannte sie eine ängstliche, unsichere Frau, die sich mit gespielter Selbstsicherheit durchs Leben schlug. Jennifer hatte hinter geschlossenen Türen erlebt, wie ihre Mutter wirklich war, und das war völlig anders. Den Rest des Heimwegs legten sie schweigend zurück, ohne Lösungen gefunden oder geklärt zu haben, was sie empfanden und wirklich meinten.
Jennifers Freude und Stolz über ihren glorreichen Schulabschluss war verflogen. Sie hatte ihre Mutter wieder enttäuscht. Und sie hatte sich während der Highschool-Zeit so angestrengt. Aber eines wusste sie: Sie wollte unbedingt fort aus dieser Stadt. Und von ihrer Mutter. Und Christina wusste es jetzt auch.
Wenig später war es dann der Besuch des Schuldirektors, der Christina so erschreckte, dass sie ihr Einverständnis zu Jennifers Bewerbung an der Universität in Sydney gab.
Christina war in erster Linie verärgert, weil, wie sie es ausdrückte: »… dieser Mann unangekündigt auftauchen musste, als ich noch nicht aufgeräumt und den Tisch abgedeckt hatte. Ich kam mir vor wie eine Idiotin, die von nichts eine Ahnung hat. Als ob deine Zukunft mir egal wäre … obwohl ich doch alles für dich geopfert habe.«
»Mum, bitte. Sie wollen nur helfen. Das Beste für mich herausschlagen. Dir helfen …«
»Ich brauche keine Hilfe. Du hast die Angelegenheiten ja anscheinend selbst in die Hand genommen und badest es selbst aus, Jennifer. Du weißt, dass ich es mir nicht leisten kann, dich aus irgendwelchen Schwierigkeiten freizukaufen.«
»Was für Schwierigkeiten, Mum? Ich lasse mich auf nichts ein, was ich nicht bewältigen kann. Ich muss nur mein Geld zusammenhalten und darf nicht übermütig werden. Wenn ich mich eingelebt habe und weiß, wie viel Zeit ich für die Arbeit brauche, kann ich mir vielleicht einen Job suchen und zusätzlich etwas Geld verdienen.«
»Du hast dir alles schon genau überlegt, wie?« Sie hielt inne. »Und falls, wirklich nur falls, du tatsächlich auf diese tolle Uni in Sydney gehst, hast du sicher vor, Vi und Don zu besuchen? Stecken sie mit dir unter einer Decke?«
»Mum, da gibt es keinerlei Geheimnisse. Ich habe noch nicht mit ihnen darüber gesprochen. Für den Fall, dass es nicht klappt.« Jennifer wandte den Blick ab, verärgert über den flüchtigen Ausdruck von Befriedigung auf dem Gesicht ihrer Mutter.
»Nun, dann brüten wir lieber nicht über ungelegte Eier.«
Ihre Mutter setzte sich an den Küchentisch und sah zu, wie Jennifer eine kleine Schachtel Eiskrem aus dem Gefrierfach nahm. Christina zündete sich eine Zigarette an und blies den Rauch langsam zur Decke hinauf. Als Jennifer hohe Gläser mit schäumendem Milchshake auf den Tisch stellte, strich Christina über ihre Hand. »Strebe nicht zu hoch hinaus und erhoffe dir nicht Dinge, die unsereinem nicht zustehen, Jennifer. Hier in der Umgebung hast du so viele Möglichkeiten.«
Jennifer antwortete nicht. Doch innerlich schrie sie: Warum stehen uns die guten Dinge des Lebens nicht zu? Warum soll ich mir meine Ziele nicht so hochstecken, wie ich nur kann?
Ihre Mutter war wieder heiter und überlegen. Jennifers Verirrung in die Vorstellung, in Sydney die Universität zu besuchen, würde sich von selbst erledigen.
Jennifer wusch die Gläser ab und ging in ihr Zimmer. Wenn sie doch jemanden hätte, dem sie sich anvertrauen, den sie um Rat fragen könnte, jemanden, der keine anderen Absichten hegte, als sie auf den richtigen Weg zu führen. Sie zog ihre Schuluniform aus. Vielleicht hatte ihre Mutter recht, und man war auf der Welt tatsächlich völlig auf sich allein gestellt und musste sein Leben selbst in die Hand nehmen. Sie musterte sich im Spiegel und sah ein junges Mädchen auf der Schwelle zur Frau: zarte helle Haut, Rundungen, die noch voller werden mussten, glänzendes goldblondes Haar, das sie selbst schnitt, klare blaue Augen und einen Mund, der weich und traurig wirkte. Ich will nicht allein sein, dachte sie.
Wie ihr der Vater und der große Bruder fehlten. Im ganzen Haus gab es keine Fotos von ihnen, doch sie wusste von dem Fotoalbum ihrer Mutter, ganz zuunterst in einer Schublade in ihrem Schlafzimmer. Jennifer schloss die Augen und dachte an einen lachenden Jungen, der ihre Hand hielt, ihr das Haar zerzauste und ihr im Flüsterton Geschichten erzählte, wenn sie sich zu ihm ins Bett schlich.
Manchmal zuckten Szenen von jenem Tag am Strand, von ihrer Mutter in der Küche, wie sie auf ihren Vater eindrosch, in ihrem Bewusstsein auf, doch sie verdrängte sie. Es hatte eine Weile gedauert, doch schließlich hatte sie gelernt, ihr Bewusstsein zu verschließen, wenn diese unerwünschten Bilder vor ihrem inneren Auge auftauchten. Dann stellte sie sich rasch einen schwarzen Nachthimmel vor. Blieben immer noch kleine Erinnerungsfetzen, so ersetzte sie diese durch Momentaufnahmen, die sie glücklich machten – bunte Fische in rosafarbenem Seetang, die weiche silbrige Haut eines Gummibaums unter der sich schälenden Rinde, ein Schmetterling auf einem Blatt, im Begriff, ins Sonnenlicht davonzuflattern. Dann öffnete sie die Augen wieder und kehrte seufzend in die Realität zurück.
Jennifer saß auf einer warmen Holzbank am Rand des Innenhofs der Universität und schaute den Studenten zu, die auf dem Rasen umherschlenderten oder saßen. Träge fragte sie sich, wer außer ihr wohl schon auf dieser alten Bank gesessen und die steinernen Bogengänge und die im Sonnenlicht blitzenden Fenster betrachtet hatte. Sosehr sie ihre Seminare an der Universität und die Freiheit, sich selbst überlassen zu sein, auch liebte, hatte sie nach ihrem ersten halben Jahr an der Universität von Sydney doch noch immer das Gefühl, nicht dazuzugehören.
Die Überzeugung ihrer Mutter, dass sie ihre Grenzen übertreten hätte, hatte irgendwo tief in ihrem Inneren Wurzeln geschlagen. Das wirkte sich auf alles aus, was sie in diesem neuen Leben angriff. Nie hatte sie das Gefühl, richtig gekleidet zu sein, kannte nicht dieselben Örtlichkeiten und Leute und Modetrends wie die anderen Studenten. Sie glaubte, ihr Bestes geben und gute Noten erzielen zu müssen, etwas beweisen zu müssen, und zwar nicht nur sich selbst, sondern auch ihrer Mutter. Das schlechte Gewissen, weil ihre Mutter allein in einer Kleinstadt in Victoria lebte, war ihr ständiger Begleiter, obwohl sie wusste, das Freunde und Nachbarn sie besuchten und Christina einluden, sowohl um Jennifers als auch um Christinas willen.
Jennifers gesellschaftliches Leben verlief ereignislos. Manchmal schloss sie sich einer Gruppe von Freunden von der Uni an, die Cafés und Bars in der Nähe besuchten. Jeden zweiten Sonntag war sie zum Mittagessen bei Onkel Don und Tante Vi eingeladen, und sie genoss die Besuche bei ihnen. Manchmal unternahmen sie nachmittags einen Ausflug oder gingen ins Kino. Dann verbrachte sie die Nacht in dem Gästezimmer im Erdgeschoss, das groß und gemütlich war. Eine Schiebetür führte auf eine kleine Terrasse und in den schmucken Garten, in dem Onkel Don Vögel züchtete.
Das kompakte Backsteinhaus war fast identisch mit dem benachbarten, und wenn der vorstädtische Lebensstil auch recht angenehm war, konnte er Jennifer doch nicht interessieren. Wenn sie schon das weite offene Land nicht haben konnte, dann zog sie das sprühende Leben in der Innenstadt vor. Besonders wegen der tatkräftigen Studenten und interessanten Gestalten, die das Universitätsgelände bevölkerten.
Von Vis und Dons Haus bis zu ihrer Unterkunft auf dem Campus musste sie mit dem Zug fahren und dann ein Stück zu Fuß gehen oder eine lange Busfahrt auf sich nehmen. Deshalb beschloss Jennifer, am Montagmorgen früh aufzustehen und abzureisen, statt bei Nacht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ihre Tante und ihr Onkel wollten, dass sie das Gästezimmer als ihr eigenes betrachtete und einen Teil ihrer Habseligkeiten dort aufbewahrte, doch das widerstrebte ihr. Sie genoss den Kontakt zu den Verwandten und wusste, dass ihre Besuche, die angefüllt waren mit Geschichten über ihr Leben an der Uni, ihnen große Freude bereiteten. Allerdings stellte Jennifer fest, dass sie die Besuche herunterspielen musste, wenn sie mit ihrer Mutter sprach. Christinas Abneigung – oder war es schlicht Neid? – knisterte in der Telefonleitung.
»Und worüber habt ihr geredet? Muss schön für sie sein, all die kleinen Details zu hören, die mir zu erzählen du nicht die Zeit hast. Immerhin bekommst du eine gute Mahlzeit, wenn du sie besuchst. Vermutlich macht Vi immer noch den großen Sonntagsbraten. Du liebe Zeit, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Lamm gegessen habe.« Und so weiter.
Jennifer brachte es nicht über sich, ihr zu sagen, dass Vi nur gelegentlich eine traditionelle Mahlzeit zubereitete. Sie experimentierte mit exotischen Gerichten, und einmal im Monat besuchten sie eines der Restaurants in Sydney: griechische, vietnamesische, libanesische oder chinesische Küche. Sie wusste, dass ihre Mutter nichts von ausländischem Essen hielt. Aber schlimmer noch war in den Augen ihrer Mutter die Tatsache, dass Jennifer Spaß mit Vi und Don hatte.
Jennifers Lieblingslokal in Uni-Nähe war ein kleines Café mit Namen »Crush«, das sich auf innovative Naturkost und -säfte spezialisiert hatte. Draußen standen Tische mit Sonnenschirmen, drinnen säumten lange Tresen mit Barhockern die Wände, und ein großer Holztisch dominierte den Raum. An diesem saßen viele Leute, und so konnte man gut Bekanntschaften schließen. Eine Auswahl an Zeitungen stand zur Verfügung, ein Schwarzes Brett war gespickt voll mit Ankündigungen von Events, An- und Verkaufsmeldungen, der Suche nach Mitfahrgelegenheiten aus der Stadt und so ziemlich allem, was für die Studentenschaft von Interesse ist.
Jennifer saß gern draußen und gönnte sich einen Milchshake oder einen Salat, während sie inmitten des Geplauders und Gelächters anderer Studenten ihre Aufzeichnungen oder ein Buch las. Dort drängte niemand zur Eile, und sie mochte das freundliche junge Personal. Sie erwog, sich nach einem Job zu erkundigen, ließ sich jedoch ein wenig einschüchtern von all den Öko-Nahrungsmitteln, von denen sie manche noch nie gesehen hatte, zum Beispiel Queckensaft, Granatäpfel und eine Reihe asiatischer Gemüse. Stattdessen arbeitete sie in der Universitätsbibliothek – sehr zur Freude ihrer Mutter –, hoffte jedoch, bald einen anderen Teilzeitjob zu finden.
Ein Salat mit gebratener roter Bete, gefüllt mit Bocconcini und bestreut mit gerösteten Pinienkernen und frischem Koriander wurde ihr serviert. Es überraschte sie, dass einer der Köche selbst bediente.
»Ist das eine von deinen Spezialitäten?«
»Ganz und gar mein eigenes Werk. Ich hoffe, es schmeckt dir.«
»Wie kommt’s, dass du kochst und zusätzlich bedienst?«
»Eines der Mädchen kommt später, musste zu ihrem Tutor. Ich habe ihr angeboten, für sie einzuspringen.«
»Das ist nett von dir. Gehst du auch an die Uni?«
»Nein. Ich habe gerade einen Kurs zum Restaurantfachwirt bei TAFE abgeschlossen. Hier sammle ich Erfahrungen und kann mir Geld zusammensparen. Ich will in einem großen Hotel in Übersee arbeiten.«
Er war mittelgroß, durchschnittlich gebaut und hatte ein nettes Gesicht und ungebärdiges lockiges dunkles Haar. Jennifer fand, dass er sympathisch aussah. »Um als Koch zu arbeiten?«
»Eigentlich nicht. Hotelmanagement interessiert mich schon eher. Ich habe überall ein bisschen reingeschnuppert. Ups, ich muss los, der andere Typ in der Küche hat bestimmt schon die nächste Bestellung fertig.«
Er kam noch ein paarmal an ihren Tisch, um ihr Wasser nachzuschenken, ihren Teller abzuräumen und sie zu einem Flan mit Früchten zu überreden. Als sie aufbrach, winkte er ihr. »Hat’s geschmeckt?«
»Und wie. Und der Service war große Klasse.«
Jennifer suchte das Café jetzt häufiger auf, und sie und Blair – so hieß der junge Koch, wie sie inzwischen erfahren hatte – plauderten freundlich und streuten vorsichtig Informationen ein, die Aufschluss über ihre Familien, ihre Zukunftspläne und ihre Vorlieben gaben.
Eine Woche später trafen sie sich zufällig auf dem sonntäglichen Bauernmarkt und schlenderten gemeinsam an den Ständen entlang, wo Blair Obst und Gemüse einkaufte. Jennifer kaufte einen Armvoll Blumen, Chutney und Marmelade, beides hausgemacht, und zwei reife Mangos, eine Frucht, die sie gerade erst entdeckt hatte.
»Kaufst du fürs Café oder für dich selbst ein?«, fragte sie.
»Heute für mich selbst. Ich bin es leid, im Restaurant zu essen oder Reste mit nach Hause zu nehmen. Ich wollte mir mal eine anständige Mahlzeit kochen.« Er sah in ihr hübsches, dezent geschminktes Gesicht, betrachtete ihr hellgoldenes Haar, das frisch gewaschen und luftgetrocknet aussah. Es umspielte ihr Gesicht und fiel bis auf die Schultern. Die exotischen farbenprächtigen Blumen in ihrem Arm bildeten einen hübschen Kontrast zu ihren blauen Augen und dem hellen Teint ihrer insgesamt hellen Erscheinung. Ein schwacher süßer Duft, entweder von den Blumen oder von ihrem Haar, umgab sie, und plötzlich verspürte er den Wunsch, sich zu ihr vorzubeugen und den Duft einzuatmen. Er bemerkte, dass er sie schon zu lange ansah. »Sag mal, hast du Lust, mit zu mir zu kommen und mit mir zu essen? Ich wohne in Glebe, das ist nicht weit. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir zwei gute Bekannte sind.«
»Ich auch.« Sie fand es albern, dass sie sich so freute.
Das Mittagessen war köstlich. Sein kleines Reihenhaus gefiel ihr, und es gefiel ihr, wie er ihr mit schöner Selbstverständlichkeit ein Glas Wein einschenkte, als sie auf einem Hocker saß und zusah, wie er lässig eine schlichte Mahlzeit zusammenbrutzelte, die sie von großen, bunten, eckigen Tellern auf seiner winzigen Terrasse verzehrten. Sie fühlte sich sehr weltgewandt und bemühte sich, nicht zu zeigen, wie beeindruckt sie war. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass irgendeiner von den Jungen, die sie zu Hause kannte, oder von den Freunden ihrer Mutter sie so bewirtete. Sie bestand darauf, ihm beim Abwaschen zu helfen, und als dann der träge, leere Nachmittag drohte, bekam sie es mit der Angst zu tun und erklärte, gehen zu müssen, weil sie ihre Tante und ihren Onkel besuchen wolle.