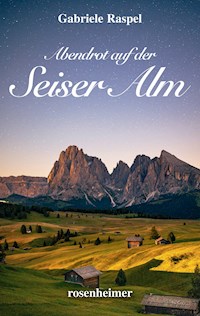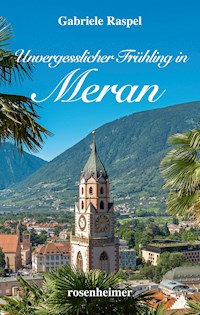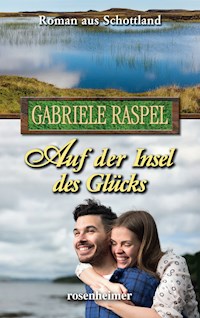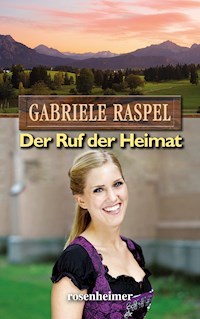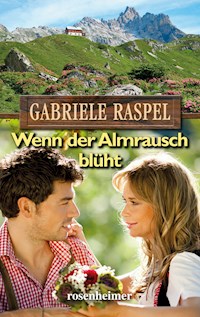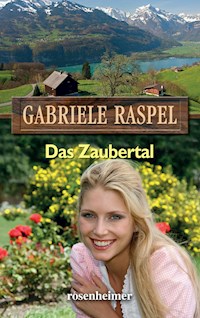
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Toni Angerer hat mit einem Schlag alles verloren: Ehemann, Wohnung und Arbeitsstelle. Sie möchte völlig neu beginnen und bewirbt sich als Hauswirtschafterin auf einem Bauernhof im idyllischen "Zaubertal". Während Bauer Kurt begeistert von ihrer direkten und herzlichen Art ist, hat sein erwachsener Sohn Ferdinand Bedenken. Ob diese Städterin zum Landleben taugt? Es folgt eine Bewährungszeit für Toni, in der sich die beiden jungen Leute näher kommen. Doch schon bald steht die Liebe der beiden auf dem Prüfstand, denn in einem "Zaubertal" geschehen nun einmal seltsame Dinge …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LESEPROBE zuVollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2011
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim www.rosenheimer.com
Titelfoto: Evgeny Murtola – istockphoto.com (oben)und Studio von Sarosdy, Düsseldorf (unten)Lektorat und Satz: BuchBetrieb Peggy Stelling, Leipzig
eISBN 978-3-475-54392-0 (epub)
Worum geht es im Buch?
Gabriele Raspel
Das Zaubertal
Toni Angerer hat mit einem Schlag alles verloren: Ehemann, Wohnung und Arbeitsstelle. Sie möchte völlig neu beginnen und bewirbt sich als Hauswirtschafterin auf einem Bauernhof im idyllischen »Zaubertal«. Während Bauer Kurt begeistert von ihrer direkten und herzlichen Art ist, hat sein erwachsener Sohn Ferdinand Bedenken. Ob diese Städterin zum Landleben taugt? Es folgt eine Bewährungszeit für Toni, in der sich die beiden jungen Leute näher kommen. Doch schon bald steht die Liebe der beiden auf dem Prüfstand, denn in einem »Zaubertal« geschehen nun einmal seltsame Dinge …
Kurt
Kurt schaute bedrückt aus dem verwitterten Holzfenster des großen Bauernhauses, an dem die Tropfen wie Perlen hingen. Der Regen prasselte auf die moosigen Granitplatten im Hof, schnurgerade und in einer Gleichförmigkeit, als wäre am Himmel eine überdimensionierte Dusche installiert worden. Wenn er dem Alkohol nicht komplett abgeschworen hätte, dann wäre spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem er sich den ersten Roten eingegossen hätte.
Bereits der Frühling war eher die Verlängerung des Winters gewesen, dem ein verregneter Sommer gefolgt war, wie er ihn in seinen zweiundfünfzig Jahren selten erlebt hatte. Das triste Wetter erinnerte mehr an November, eine Zeit, in der es seiner Eva stets jämmerlich ergangen war. Jetzt konnte er nachvollziehen, wie trübsinnig es einen machen konnte, im Gegensatz zu früher. Mittlerweile gab es tatsächlich kaum einen Tag, an dem sich das dunkle Grau auflöste und die schwarzen Wolken den Blick auf die Berge freigaben.
Er stand auf und öffnete die Ofentür. Der Duft nach Holz und Rauch zog durch den Raum, als er ein neues Holzscheit einlegte. Stöhnend richtete er sich auf und schleppte sich zurück zum Sessel am Fenster. Kein Wunder, dass einem dabei die Knochen einrosteten. Wenn er seine Werkstatt nicht hätte, in der er sich beim Holzbearbeiten austoben könnte, würde er sich wie ein Greis fühlen.
Sein Blick wanderte zum Herrgottswinkel, neben dem das Hochzeitsfoto von ihm und seiner Frau hing. Dieses Jahr wäre es das neunte Weihnachtsfest ohne sie. Gegen ihre Melancholie, die sie in der lichtarmen Zeit überfallen hatte, hatten nur Spaziergänge oder Ausritte geholfen. Diese vermaledeiten Pferde, wie sehr sie sie geliebt hatte, mit denen er selbst hingegen nie warm geworden war. Und hatten sie nicht auch das Unglück über dieses Haus gebracht? Doch, das hatten sie! Und da mochte Hermann, sein Nachbar und ehemaliger Freund, noch so sehr widersprechen. Schließlich war er es gewesen, der seiner Eva diesen wilden Gaul zum Reiten angedreht hatte. Drei Monate nach der Geburt von Marie! Nein, das konnte und das wollte er ihm niemals verzeihen. Schlimm war nur, dass ihm seither nicht nur die Frau fehlte, sondern auch sein bester Freund. Und dass er den trotz allem vermisste.
»Papa, Peter mag ein Madl aus der Stadt, die wo weiße Wadln hat«, schallte es jetzt mit heller Stimme durchs Haus.
Kurt musste schmunzeln. Da gab es ja doch etwas, was einen vor dem Wahnsinn bewahrte: seine Kinder.
»Stimmt ja net, du bist dumm«, kam die Antwort. Dann folgte ein munteres Fußgetrappel und ein Mädchen und ein Bube stürmten in die Küche.
»Des hab’ i nur g’sungen«, protestierte Peter, der neunjährige Bruder von Marie. Beide waren mittelblond und stämmig. Auch die hellen, wachen Augen ließen erkennen, dass sie Geschwister waren.
»Aber Ferdl mag die Madln aus der Stadt, gell, Ferdl?«
»Jetzt nimmer«, kicherte Marie, seine achtjährige Schwester.
»Nein, jetzt nimmer«, antwortete Ferdinand grimmig, der stumm in der Ecke gesessen hatte und die Einkaufsliste für den folgenden Tag durchgegangen war.
Er riss die Liste aus dem Block und ergriff erneut den Kugelschreiber.
»Und jetzt setzt euch hin und passt auf, wir wollen endlich die Anzeige für die Zeitung aufgeben.«
»Au ja, wir krieg’n a echte Köchin«, krähte Peter.
»Die kann wenigstens g’scheit kochen und net so a G’lump z’sammhauen als wie der Ferdl.«
»Das heißt nicht als wie, sondern wie. Und i geb’ dir gleich G’lump«, sagte Ferdinand.
Kurt schmunzelte. Kochen lag seinem Ältesten tatsächlich nicht, obwohl er es seit acht Jahren fast täglich für die Familie tat. Genau seit dem Tag, als die Mutter starb und der damals Zwanzigjährige allein mit seinem Vater vor der Aufgabe stand, einen Haushalt mit anfangs sieben Personen zu schmeißen. Einen Haushalt, in dem die Großeltern zu versorgen waren, die beide schon damals nicht gesund gewesen waren, Gäste zu beköstigen, Kühe zu füttern und all die unzähligen Aufgaben zu bewältigen waren, die auf einem Bauernhof so anfielen. Das Ganze neben seinem Informatik-Studium an der Technischen Universität in München, wofür er täglich fast zweihundert Kilometer zurückgelegt hatte. Denn dass Ferdinand den Bauernhof am See in dem idyllischen Tal verließ, um sich in der Stadt ein Zimmer zu suchen, verbot sich aus den verschiedensten Gründen.
Allen voran war es die Tatsache, dass er, Kurt, damals, als ihm die Sorgen schier die Luft zum Atmen nahmen, regelmäßig enormen Alkoholabstürzen verfallen war, die ihn für Tage völlig außer Gefecht setzten, sodass sein Ältester praktisch allein für den Hof, ihn, seine Eltern und die drei kleinen Geschwister Sorge getragen hatte. Außerdem war Geld für ein Zimmer in der Stadt ebenfalls nicht vorhanden gewesen. Weder damals noch heute.
Das Tal mit seinem See am Talschluss, der wohl zu den schönsten in Bayern gehörte, mit seinem Halbrund aus steilen Felsen, dessen Steine die schönsten Moose und Flechten aufwiesen und dessen Hänge im unteren Teil mit Arven und Lärchen bewachsen waren, wurde das »Zaubertal« genannt. Die Leute der Gegend nannten es so, weil häufig Dinge eintraten, die man sich nicht erklären konnte. Kurt hielt dies für Humbug, er fand, dass es einfach nur ein besonders schönes Tal war. Doch wenn das Wort »Zauber« die Gäste der Magie wegen anzog, sollte es ihm recht sein. Außerdem wurden die Einwohner des Tals häufig erheblich älter als der Durchschnitt. Mehr als anderswo gab es hier Menschen, die leicht das neunzigste oder gar das hundertste Lebensjahr erreichten.
Das hatte leider nicht für seine Eltern gegolten. Seinen Vater hatten sie fünf Jahre nach der Diagnose »Alzheimer« schließlich zuerst in die Tagespflege und später schweren Herzens vollends in ein Altersheim geben müssen, weil sie nachts allesamt keinen Schlaf mehr finden konnten. Er wusste noch genau, wie er am Abend des Abschiednehmens im Bett gelegen und geheult hatte, nachdem sie sich zu diesem schweren Schritt entschlossen hatten. Das Heim war gut gewesen, jeder hatte sich Mühe gegeben, seinem Vater das Leben dort so angenehm wie möglich zu gestalten, doch lange hatte er mit dem Gefühl von Schuld zu kämpfen gehabt, vor allem, nachdem sein Vater dort ein halbes Jahr später, erst achtundsechzigjährig, starb. Er entsann sich noch genau, wie schwer es ihnen gefallen war. Doch bei aller Liebe hatten sie nicht mehr für ihn sorgen können. Regelmäßig in der Nacht war er aufgestanden und hatte unbemerkt das Haus verlassen, sodass sie sich morgens besorgt auf die Suche gemacht hatten. Nachdem er im Winter beinahe erfroren wäre, hatten sie sich schließlich zu diesem Schritt entschieden. Seine Mutter verstarb bereits mit fünfundsechzig an einem Schlaganfall, zum Glück noch bevor die Krankheit des Vaters nicht mehr zu übersehen war und sie ihn ins Heim geben mussten.
Jetzt beschlich ihn zum ersten Mal nach vielen Jahren die Hoffnung, dass es aufwärts ging. Und auch das lag wieder einmal an Ferdinand, der eine gut dotierte Stelle als Informatiker in einer jungen, aufstrebenden Software-Firma im Gewerbegebiet, nur eine Viertelstunde mit dem Auto vom Hof entfernt, ergattert hatte.
»Also, Ferdinand, schreib auf«, befahl Kurt, »fähige Köchin für einen Bauernhaushalt gesucht.«
»Sie muss gut Nudeln kochen können«, sagte Marie, »und Pudding.«
»Und sie sollte net allzu jung sein«, sagte Ferdinand ernst.
Kurt warf ihm in liebevollem Spott einen raschen Seitenblick zu.
»Was hast du gegen Junge? In deinem Alter wär’ mir eine Junge allemal lieber g’wesen als eine Alte.«
Ferdinand schüttelte den Kopf und erwiderte ernsthaft: »Die Jungen sind unzuverlässig.«
»Gut, einigen wir uns auf die Mitte«, entgegnete Kurt gutmütig.
»Und Köchin reicht auch net. Wir brauchen eine g’standene Haushaltshilfe, die praktisch ein Mädchen für alles ist. Des sie daneben natürlich auch noch kochen kann, versteht sich von selbst.«
»Ganz deiner Meinung«, nickte Kurt.
»Also: Hauswirtschafterin mit guten Kochkenntnissen mittleren Alters gegen Kost, Logis und Taschengeld ab sofort gesucht. Vorstellung Samstag ab neun Uhr.«
»Warum soll sie sich erst Samstag vorstellen?«, fragte Kurt neugierig.
»Damit i dabei bin, wenn sie kommen.«
»Wenn sie kommen«, brummte Kurt. »Wie hoch, sagtest du noch mal gleich, soll das Taschengeld ausfallen?«
»Weiß i net, darüber muss i erst noch nachdenken. Die Hauptsache ist, des sie sofort anfängt, denn wenn i am Mittwoch meine neue Arbeit beginn’, möcht’ i dich und die Kleinen versorgt wissen.«
»Zur Not kann ja auch dein alter Vater ein Ei in die Pfann’ hauen«, sagte Kurt mit zusammengezogenen Brauen.
»Und i bin net klein, i kann scho’ Nudeln kochen«, meldete sich Marie.
»Und i Tomatensoß’«, fügte Peter hinzu.
»Kannst du gar net«, sagte Sonja, die Elfjährige, die soeben in die Küche gestürmt kam.
Kurt betrachtete sie liebevoll. Sie war die schwierigste der Kleinen, ein wenig rebellisch, wilder und resoluter als Peter und Marie. Sie hatte die langen blonden Haare zu einem nachlässigen Pferdeschwanz gebunden, doch hatten sich aus dem Wust etliche Strähnen gelöst, die ihr längliches, ein wenig knochiges Gesicht umwehten. Sie kam wie ihre kleineren Geschwister nach ihm. Mit seinen zweiundfünfzig Jahren konnte er heute noch einen prächtigen Schopf weizenblonden Haares mit dichten Locken vorweisen, in dem die wenigen silbrigen Strähnen kaum auffielen, während Ferdinand mit seinem braunen, glatten Haar, der hohen Stirn, den tief liegenden braunen Augen und seiner Liebe zu Musik und Mathematik ganz die Mutter war. Nicht zu vergessen sein Interesse an all dem esoterischen asiatischen Quatsch, wie es bereits Eva an den Tag gelegt hatte; sie, die so gern Lehrerin geworden wäre und die es so schlecht vertragen hatte, wenn er, Kurt, sie wegen ihrer Yoga- und Meditationsübungen manchmal aufgezogen hatte. Außerdem neigte Ferdinand nicht zum Dickwerden, wie es den Geschwistern zu seinem Leidwesen in die Wiege gelegt worden war.
»Du weißt, was i mein’, Vater.«
Kurt schwieg. Manchmal war sein Ältester wirklich zu gesetzt und ernsthaft für sein Alter. Aber das lag nicht allein an seinem sensiblen Wesen. Dabei spielten sicher der Tod seiner Frau und die frühe Verantwortung gegenüber der Familie eine große Rolle.
Er schluckte trocken. Ja doch, heute plagte ihn das schlechte Gewissen, aber er war nun einmal kein Mann großer Worte. Warum fiel es ihm denn nur so schwer, Ferdinand einfach in den Arm zu nehmen, sich bei ihm zu entschuldigen oder schlicht zu bedanken, für das, was er für die ganze Familie geleistet hatte?
Nun, irgendwann fand sich vielleicht tatsächlich einmal die Gelegenheit dazu. Jetzt würde er wenigstens dafür sorgen, dass sich der häusliche Arbeitsanfall für seinen Ältesten verringerte. Wenn die Haushälterin da wäre, hatte man Luft und Ferdinand könnte wenigstens an den Wochenenden ausgehen und feiern, wie die anderen jungen Leute in seinem Alter.
»War eine gute Idee, des mit der Haushälterin«, unternahm er einen schwachen Versuch, seinem Sohn ein Kompliment zu machen.
»Danke«, sagte Ferdinand ernst.
Kurt seufzte unhörbar. Das Unglück von Monika vor einem Jahr, als sie bei einem Spaziergang ums Leben gekommen war, war ein erneuter Tiefschlag gewesen. Obwohl er bemerkt zu haben meinte, dass es mit den beiden schon wieder aus war, nachdem sie höchstens ein Vierteljahr zusammen gewesen waren. Das hatte sicher nicht nur daran gelegen, dass Monika nicht für einen Bauernhaushalt geeignet gewesen war. Aber in sie war Ferdinand wenigstens verliebt gewesen – nach einem kurzen Ausrutscher mit einem Gast, Corinne Morgenroth. Aber die war nun wirklich die Falsche gewesen. Und Ferdl hatte es rasch eingesehen. Wenn auch Corinne sich noch heute Hoffnung auf ihn machte. Aber das war zum Glück ihr Problem. Ferdinand hatte ihr deutlich genug erklärt, dass es mit ihnen beiden keinen Sinn hatte.
Jetzt war er wieder allein, und so sehr er sich auch bemühte, die Traurigkeit über diesen Zustand konnte er kaum verbergen. Eine Schande war das. Ja, er würde sich endgültig am Riemen reißen, sodass Ferdinand sich nicht weiter sorgen musste, wie sie die Arbeit schaffen sollten. Jetzt, wenn Ferdinand einer geregelten Tätigkeit nachging, hatte er tatsächlich keine Zeit mehr auch noch stundenlang auf dem Hof zu schuften.
Kurt ballte die Hand zur Faust. Ja, er würde sich wirklich alle Mühe geben, dass er nie wieder so abstürzte wie in vergangenen Jahren. Und die Depressionen, in die er auch heute noch manchmal verfiel, sollte ihn nicht wieder vom Arbeiten abhalten, das schwor er sich. Jetzt sollte ein neuer Anfang gemacht werden. Das war er seiner Familie schuldig.
Wenn die Frau nur mit dem Gehalt, genauer dem Taschengeld, zufrieden war. Insgeheim zweifelte er daran. Doch er wollte Ferdinand nicht gleich zu Beginn die Hoffnung nehmen.
»I find’, wir brauchen keine Frau im Haus«, sagte Sonja, während sie die vertrockneten Blätter von den Geranien abzupfte, die auf der Fensterbank standen.
Sie liebte Blumen und Tiere und Menschen, und legte bereits jetzt eine erstaunliche Beharrlichkeit an den Tag, die, die sie liebte, zu manipulieren und sie nach ihrer Fasson zurechtzustutzen.
»Wir können uns doch selbst helfen, so wie bisher. Eine Frau stört nur, die meckert, wenn wir die Sachen auf den Boden werfen, und die will immer, des wir alles sofort spülen.«
»Was ja auch richtig ist«, sagte Ferdinand. »Also, Papa, du weißt, wenn eine anklingelt, dann rufst mich, damit i auf jeden Fall bei der Vorstellung dabei bin.«
»Wird gemacht, mein Sohn«, sagte Kurt.
Wie nett, dass sein Junge wieder Papa zu ihm sagte, statt das ernste Vater zu benutzen, wie er es sich im Laufe der letzten Jahre angewöhnt hatte.
Ja, es wurde wirklich Zeit, dass ein Ruck durch diesen Haushalt ging, und er, Kurt, würde alles daran setzen, dass dieser Neuanfang zur Zufriedenheit aller bewerkstelligt wurde.
»Und jetzt schnappt sich jeder einen Besen oder Staubsauger und es wird sauberg’macht«, sagte er und klatschte in die Hände. Auf einmal war seine Melancholie wie weggeblasen.
»I putz’ die Treppe«, rief Sonja sofort.
»I will saugen«, sagte Peter.
»Du musst aber erst aufräumen, ehe du Staubsaugen kannst«, wies Sonja ihn an.
»Weiß i doch.«
Kurt betrachtete mit liebevollem Stolz die Seinen. Er war froh, dass er nach dem Tod der Eltern die Zweiteilung des Hauses in Privat- und Gästetrakt vorgenommen hatte. Dadurch hatten sie hier etwas weniger Platz, doch der war völlig ausreichend. Die Kinder besaßen jeder ein Zimmer für sich, Sonja und Marie schliefen zwar in einem gemeinsam, doch sie vertrugen sich gut, während Peter mit der kleinen ehemaligen Abstellkammer zufrieden war. Ferdinand hatte, als er mit dem Studium begonnen hatte, das Elternschlafzimmer erhalten, wenn auch unter Protest. Doch Kurt hatte darauf bestanden und war in das kleinere Zimmer am Ende des Korridors gezogen. Schließlich musste Ferdinand seit Beginn des Studiums ausreichend Raum für einen Schreibtisch, seinen Computer und die zahllosen Bücher und CDs haben, die er benötigte und liebte.
»Und du, Sonja, machst bitte net nur die Treppe, sondern auch des Bad«, befahl Ferdinand mit ruhiger Stimme.
»Immer i«, maulte Sonja.
»Marie, du übernimmst die Spülmaschine, während der Papa und i uns ums Holz kümmern. Alles klar?«
»Alles klar«, sagte Marie.
Sonja seufzte laut. »Aber die Treppe wird heute nur trocken g’reinigt. G’putzt hab’ i die scho’ letzte Woch’.«
»Von mir aus, Hauptsache, sie ist sauber«, entgegnete Kurt.
So sehr sie die Gäste brauchten, so froh war er doch, dass sie zur Zeit fehlten. Diese Schonzeit genoss er, so lange sie dauerte, denn sich um die Gäste zu kümmern – Ausflugsvorschläge zu machen, sich dann und wann nach dem Befinden zu erkundigen, eventuell ein Glas Wein miteinander zu trinken –, dies lag ab jetzt allein in seinen Händen. Auch die wöchentliche Einladung an die Gäste zum Kesselgulasch auf dem Hof würde er ab jetzt allein bewerkstelligen und nicht immer Ferdinand vorschicken. Und später, sinnierte er zufrieden, würde die Kocherei und einiges mehr in den Händen der neuen Haushälterin liegen.
Das schlechte Wetter hatte die Leute abgehalten zu buchen. Und die, die gebucht hatten, sagten einige Tage vor ihrer Ankunft unter fadenscheinigen Gründen wieder ab. Diese kurzfristigen Absagen schmerzten am meisten, doch was sollte er sich mit den Leuten streiten.
»Also dann, packen wir’s an.«
Mehr oder weniger munter machten sich alle ans Werk.
Toni
Toni verließ gemeinsam mit ihrer Freundin Petra erschöpft das Gerichtsgebäude. Geschafft! Ab jetzt würde sie zwar nicht mehr so in Saus und Braus Geld ausgeben können wie im letzten Jahr, doch sie war frei und vor allem rehabilitiert. Freigesprochen von Schuld, und das zu Recht. Im Gegensatz zu ihrem Mann, der mitsamt dem Firmenvermögen und seinem nicht unerheblichen Privatvermögen in die Karibik, nach Bali oder sonst wohin untergetaucht war. Den Mercedes hatten sie am Münchener Flughafen gefunden, was möglicherweise eine Finte war. Vielleicht trieb er sich im hintersten Bayerischen Wald herum. Was sie wiederum nicht glauben konnte. Natur hatte ihn bisher immer kalt gelassen. Der Mercedes war in die Konkursmasse eingeflossen. Von Michael jedoch gab es keine Spur.
Anfangs hätte sie vor Wut am liebsten ihre Zähne in ein Beißholz gerammt. Doch dann kam die bittere Zeit der Firmenauflösung und gleichzeitig die Anzeige wegen betrügerischen Konkurses. Wie sie die letzten Monate überstanden hatte, wusste sie nicht. Sie wusste nur, dass sie von jetzt auf gleich aus ihrem alten, bequemen Leben gerissen worden war. Und dass sie die Gastfreundschaft ihrer Freundin nicht länger in Anspruch nehmen wollte.
»Aber du kannst doch so lange du willst bei mir wohnen bleiben«, hatte Petra auf sie eingeredet.
Toni schüttelte den Kopf. »Du kommst selbst gerade so über die Runden, du darfst dir nicht auch noch mich aufhalsen«, sagte sie bestimmt.
Sie dachte an ihre Mutter, die sie angefleht hatte nach Hause zu kommen, damit sie wenigstens ein Dach über dem Kopf hätte. Doch sie hatte eben ihren Stolz. Ins Elternhaus zurückzukehren, das kam gar nicht infrage. Ohnehin hatte ihre Mutter ihr altes Zimmer mit dem Bad und dem gemütlichen Dachgeschoss gerade an eine junge Studentin vermietet. Ihr Vater, der sich von ihrer Mutter vor über zehn Jahren getrennt hatte, arbeitete als Tiefbauingenieur in der mittlerweile fünften Straßenbaufirma, nachdem eine nach der anderen Konkurs hatte anmelden müssen. Ihre Mutter war Physiotherapeutin. Zur Zeit war auch sie arbeitslos. Sie konnte das bisschen Miete also gut gebrauchen.
»Bei Eigenbedarf wäre eine Kündigung sicher möglich«, versuchte ihre Mutter ihre Bedenken über Bord zu werfen.
Doch Toni blieb hart. Sie war schlicht glücklich, dass sie so glimpflich aus der Geschichte herausgekommen war. Michael war der Gauner. Wenn sie ihn in die Hände bekäme, würde sie ihm den Hals umdrehen. Doch das war wohl kaum der Fall. Er war über alle Berge verschwunden und würde sicherlich nicht mehr freiwillig auftauchen. Die Sache mit ihrer Mutter würde in Ordnung gehen, wenn sie zur Zeit auch beleidigt war, nachdem sie es abgelehnt hatte, ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie verstand einfach nicht, dass es für ihr Selbstbewusstsein wichtig war, wieder allein auf die Füße zu kommen. Doch im Grunde liebten sie sich, und irgendwann würde sich alles wieder zum Guten wenden, da war sie ganz sicher.
»Aber jetzt feiern wir erst einmal, dass man dich nicht eingekerkert hat.«
»Jo, des moch’n mir«, sagte Toni lachend.
»Und lass um Himmelswillen deinen schrecklichen Versuch unseren Dialekt nachzuahmen, den du bis heute nicht verstehst, obwohl du ansonsten drei Sprachen sprichst, du preußische Stadtpflanze, du«, grinste Petra.
Toni hob die Hände. »Schulkenntnisse, und die auch nur leidlich«, bekannte sie.
In Krefeld hatte sie Englisch und Französisch in der Schule gelernt, die sie mit der mittleren Reife verlassen hatte. Außerdem hatte sie früh bemerkt, dass ihre Eltern jeden Cent zweimal herumdrehten, um die Hypothek aufbringen zu können. Sie hatte sich einfach nicht vorstellen können, wie sie ein Studium hätten finanzieren sollen.
Was war die Folge?
Sie hatte in einer der letzten Tuchfabriken Krefelds an einer Maschine gestanden und so ihr Brot verdient. Bis diese Tuchfabrik die Tore schloss und sie, wie alle, auf der Straße stand. Dann hatte sie auf die Annonce ihres zukünftigen Mannes geantwortet, der hier in Bayern eine kleine Tuchmacherei besaß. Sie hatte die Berge immer geliebt, und so hatte sie die Koffer gepackt und war in die hübsche bayerische Kleinstadt gedüst. Keine vier Wochen später waren Michael und sie ein Paar, und ein Jahr darauf war er verschwunden und hatte eine Fabrik und neunzig Arbeiter einschließlich sie hinterlassen. Und einen Haufen Schulden.
Nie würde sie die ehrlichen Gesichter der Arbeiter vergessen, die Wut, Verzweiflung und schlicht Trauer zeigten, nun da sie arbeitslos geworden waren. Sie hatte sich geschämt, obwohl sie doch eigentlich schuldlos gewesen war. Oder nicht? Hätte sie sich mehr informieren müssen? Sie hatte im Empfang der Firma gearbeitet, sich jedoch nie um das Geschäftliche gekümmert. Es hatte schlicht ihren Horizont überstiegen. Und außerdem hatte es dafür Frau Heidtmeier gegeben, die Sekretärin von Michael. Die zur gleichen Zeit wie Michael verschwunden war.
»Ich bin froh, dass du hier geblieben bist, du eigenwillige Person.«
Sie setzten sich in Petras Fiat. Toni besaß keinen Wagen mehr. Der Mercedes war futsch und ihr kleiner Sportwagen ebenso. Da hatte sie sich auf ihr wunderschönes neues Fahrrad besonnen, das für Ausflüge mit Michael gedacht gewesen war, zu denen es jedoch nie gekommen war, und nutzte es jetzt für ihre Erledigungen – mit fröhlicher Energie, wohingegen sie früher selbst zum Brotholen das Auto genommen hatte. Doch die Fahrt vom Gericht nach Hause sollte sie nicht mit dem Fahrrad machen, darauf hatte Petra bestanden und sie abgeholt.
»Bevor wir feiern, müssen wir erst was essen.«
»Gute Idee«, erwiderte Toni. »Aber hast du vielleicht noch eine von den Kopfschmerztabletten?«
»Oh, du Ärmste. Ist es wieder so weit? Das kommt sicher von der Aufregung im Gericht.«
Petra warf ihre Jacke an den übervollen Kleiderhaken hinter der Tür, nachdem sie die Wohnung betreten hatten, eine großzügig Dreizimmer-Wohnung genannte Behausung, die einer Puppenstube glich. Sie war gemütlich unterm Dach gelegen, doch Toni würde so schnell wie möglich ausziehen, schließlich wollte sie Petras »begehbaren Kleiderschrank«, wie diese die Wohnung scherzhaft nannte, nicht länger mit dem Klappbett okkupieren.
Das allerdings war genau der Punkt, der ihr Sorge bereitete. Sie brauchte dringend eine Arbeit, damit sie sich diese eigene Wohnung leisten konnte. Aber der Gedanke daran bereitete ihr mittlerweile nicht nur Unbehagen, sondern weitete sich zur Panik aus.
Ohne dass sie Petra davon erzählte, hatte sie bereits zwei Firmen aufgesucht, die eine Bürokraft für leichte Tätigkeiten am PC, den sie dank einiger Abendkurse leidlich beherrschte, suchten.
Im ersten Fall war sie sich ihrer Sache so sicher gewesen, dass sie Petra nichts vom Besuch erzählte, damit sie am Abend die Überraschung platzen und die Flasche Sekt öffnen könnte, um ihre neue Stelle zu feiern. Bis sie zu ihrem Entsetzen feststellte, dass sie es nicht einmal schaffte die Büroräume zu betreten, geschweige denn, sich dem Gespräch zu stellen.
Den zweiten Besuch verschwieg sie, weil sie bereits eine weitere Blamage fürchtete und sich nicht den neugierigen Fragen Petras stellen wollte.
Dabei hatte sie keinerlei Vorbehalte gehabt, die Arbeit schaffen zu können. Früher jedenfalls. Doch nach dem Konkurs und die auf sie einstürzenden Beschuldigungen schien sie jegliches Selbstvertrauen in sich verloren zu haben. Zum Glück hatte sie ihrer Mutter nichts davon erzählt, sie hätte sie an den Haaren hinauf nach Krefeld in das bescheidene Reihenhaus gezogen, da war sie sich sicher.
Sie hatte schlicht Panik vor den neuen Aufgaben, den neuen Kollegen, Angst davor zu versagen.
Doch beim zweiten Mal hatte sie sich nicht nur in die Büroräume getraut, sondern sogar am gleichen Tag noch einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Aber dann, keine halbe Stunde später, angerufen und die Stelle wieder abgesagt, indem sie einen Ehemann vorgeschoben hatte, der ihr das Arbeiten verboten hätte. Natürlich hatte man ihr nicht geglaubt, und sie hatte mit hochrotem Kopf und schweißnassen Händen den Hörer einfach auf die Gabel geworfen, weil ihr keine Argumente, die diesen Schwachsinn erklärten, eingefallen waren. Noch jetzt schämte sie sich bei dem Gedanken an dieses Desaster.
Sie litt unter rasender Angst. Das war das Problem. Kein Wunder, dass sie tagtäglich Kopfschmerzen hatte. Selbst Petra wusste ihr nicht zu helfen. Aber ihr hatte sie ja auch nicht die ganze Problematik verraten. Sie konnte sie sich ja kaum selbst erklären.
Wo war ihre frühere Sorglosigkeit geblieben?
Hatte sie sich je Gedanken über die Zukunft gemacht? Nie!
Die ersten beiden Bewerbungen ihres Lebens, jene in Krefeld und die in Michaels Firma, hatte sie wie nebenbei erledigt und die Jobs sogleich erhalten. Kein Problem.
Doch heute fühlte sie sich unsicherer als eine Frau, die nach zwanzig Jahren das erste Mal wieder eine Tätigkeit außerhalb ihrer vier Wände ausüben wollte.
»Mir fällt da nur der Pizzaservice ein«, durchdrang Petras klare Stimme Tonis Wust aus Angst und Verzweiflung.
Sie zwang sich ihre Zukunftssorgen für heute zu vergessen. Heute hatten sie endlich einen guten Grund zum Feiern. Sie war vom Vorwurf freigesprochen worden, mit ihrem Ehemann gemeinsame Sache gemacht zu haben. Vielmehr hatte man die Sekretärin im Verdacht. Ein Anfang war getan. Den Rest würde – musste – sie schon irgendwie hinkriegen.
»Warum denn das?«, zwang sie sich zu einer Antwort. »Immer dieses Fast-Food. Ich kann uns doch schnell etwas zubereiten.«
»Nein, heute bist du mein Gast. Und dieses Fast-Food ist allemal besser als das, was ich so in der Regel hinkriege. Und du, mit Verlaub, ebenfalls.«
»Jeder kann kochen, wenn er nur will.«
»Aber ich will nicht!«, erwiderte Petra kategorisch. »Und wenn ich danach ginge, muss ich sagen, dass du es auch nie aus tiefster Seele gewollt hast, jedenfalls hätte es dann besser schmecken müssen.«
»Ich könnte schon, wenn ich müsste. Aber früher hat meine Mutter mich verwöhnt und später Michaels Köchin.«
»Langer Rede, kurzer Sinn: Was soll es sein? Pizza, Hühnchen oder Chinesisch? Oder etwa Sushi? Du magst ja das Zeug. Obwohl da Fisch drin ist, du Vegetarierin!«
Toni lachte. »Fisch esse ich. Und manchmal auch Fleisch, wie du weißt. So wie heute. Wir nehmen Chinesisch. Ich will doch nicht, dass sich dir der Magen umdreht.«
Sie bestellten Frühlingsrollen, gebratene Nudeln mit Ente und Reis mit Hühnchen. Dann nahm Toni eine Kopfschmerztablette.
Petra kochte Tee, während Toni es sich auf ihren Befehl hin auf dem Sofa mit der Zeitung gemütlich machte.
Plötzlich hallte ein Schrei durch das Wohnzimmer.
Petra erschien in der Tür. »Jemand verletzt?«
»Nein«, lachte Toni, »ich habe nur gerade eine Stelle für mich entdeckt. Hör zu: ›Hauswirtschafterin mittleren Alters gegen Kost, Logis und Taschengeld ab sofort gesucht. Vorstellung Samstag ab neun Uhr‹. Na, was sagst du dazu? Angegeben ist eine Adresse in einem wunderhübschen Tal. An das entsinne ich mich noch von einem Besuch mit Michael, damals, als wir uns gerade erst kennengelernt hatten.«
»Sagtest du wirklich Taschengeld?«, vergewisserte sich Petra und trat näher, um einen Blick in die Zeitung zu werfen. »Wissen die nicht, dass Hauswirtschafterinnen Perlen sind, die mit Gold nicht aufzuwiegen sind? Und da kommen die mit Taschengeld? Ich glaub’s nicht! Die Leute werden immer dreister.«
»Warum nicht? Ein Taschengeld würde mir doch reichen. Oh, Mann, da fahre ich gleich morgen früh hin.«
Toni hatte ganz rote Wangen bekommen. Sie glühte förmlich vor Begeisterung. Ein Bauernhof war etwas Bodenständiges. Hier gab es Nestwärme inmitten bunter Wiesen, ländliche Ruhe, untermalt nur vom Gebimmel der Kuhglocken. Hier gab es eine Arbeit, die jeder, selbst sie, bewältigen konnte. Hier war alles, was sie momentan brauchte wie die Luft zum Atmen: Geborgenheit! Sicherheit! Frieden!
»Geborgenheit, Sicherheit, Frieden«, kreischte Petra, und Toni merkte verlegen, dass sie laut gesprochen hatte.
»Wo lebst du denn? Hast du nie gute Bücher gelesen, die, die sämtliche Literaturwettbewerbe gewinnen? Auf Bauernhöfen herrscht das Gesetz des Stärkeren. Dort lebt das Grauen. Da geht die Post ab, da gibt es Gemetzel. Da herrscht Krieg!«
Toni kicherte. »Komm runter, du Landei!«
Petra hob theatralisch die Hände. »Gut, das mit dem Grauen nehme ich zurück«, sagte sie. »Aber auf einem Bauernhof arbeitet man sich dumm und dusslig, glaub mir. Und dass du auf so eine Schwachsinns-Anzeige von Halsabschneidern hereinfällst, die noch damit werben, dass sie dir lediglich ein Taschengeld für deine Arbeit zukommen lassen wollen, kann ich nur damit erklären, dass dir die vergangenen Wochen auf dein Gehirn geschlagen haben. Und dann noch Hauswirtschafterin! Du!«
Petra kicherte und tippte sich an die Stirn.
»Ich könnte bei ihnen kostenlos wohnen. Müsste nichts fürs Essen ausgeben. Und auf einem Bauernhof zu arbeiten finde ich irgendwie … äh … prickelnd.«
Was schlichtweg gelogen war. Prickelnd fand sie die Sache überhaupt nicht. Im Gegenteil: Der Gedanke daran hatte etwas tröstlich Beruhigendes.
»Prickelnd? Ich glaub’, ich spinne. Anstrengende Arbeit ist das! Und wenn ich dich so anschaue … da ich weiß nicht, ob du die Richtige für dieses Ambiente bist. Schließlich gehören deine Kleider eher in ein … ich weiß nicht … Anwaltsbüro oder so, so teuer wie die Klamotten waren.«
»Mit meinen Kleidern müssten sie natürlich leben. Und was das Ambiente anbelangt, so wäre ein Bauernhof eine ganz neue Erfahrung«, sagte Toni spitzbübisch.
Tatsächlich hatte sie mit Freuden das Geld, das Michael ihr neben ihrem Gehalt großzügigerweise geschenkt hatte, stets in die hübschesten Kleider investiert, Kleider von so erlesener Qualität, wie sie sich die in ihrem früheren Leben nie hätte leisten können.
»Was trägt wohl eine gesetzte Haushälterin mittleren Alters? Schwarze Strümpfe, graues Kleid, grauer Haarknoten?«
»Mit sechsundzwanzig gehörst du noch nicht zum Mittelalter, also musst du dich älter machen. Das bedeutet: kniebedeckender Rock, flache Schuhe, kein Make-up«, sagte Petra stirnrunzelnd. »Und die Haare gehören hochgesteckt.« Sie zupfte an ihren überdimensionalen Ohrringen aus lila Plastik, die ihr wie alles, was sie trug, hervorragend standen und blickte skeptisch auf ihre Freundin hinunter.
»Sieh mich nicht so an. Das wird schon«, sagte Toni optimistisch. Und optimistisch fühlte sie sich wirklich. Zum ersten Mal seit Michaels Abschied, der gar keiner gewesen war, wenn man es recht bedachte.
»Außerdem hätte ich nicht weit bis zu dir. Kennst du das Zaubertal?«
»Habe davon gehört, bin aber nie da gewesen. Du weißt doch, dass ich das Wandern hasse.«
»Es ist wirklich wunderschön. Keine zwanzig Kilometer von hier. Es gibt sogar einen Bus, der dorthin fährt. Und am Ende hat es einen kleinen See, den kaum jemand kennt. Ja, ich werde alles tun, damit ich diese Stelle bekomme.«
»Na, dann ist dir nicht zu helfen. Viel Glück«, seufzte Petra und schlang den Arm um die Freundin.
»Darf ich dich wenigstens zu deinem Vorstellungstermin fahren, damit ich sehe, wo du landest?«
Toni tippte sich mit dem Kuli, mit dem sie die Anzeige umrandet hatte, an die Unterlippe.
»Ich will morgen früh um neun da sein, das könnte knapp für dich werden, wenn du um zehn in der Touristen-Information sein musst.«
Das stimmte, doch ganz im Hinterkopf war auch immer noch die Furcht, sie könnte in letzter Sekunde einen Rückzieher machen.
»Ich habe so viele Überstunden abzufeiern, ich nehme morgen einfach den ganzen Tag frei. Ich werde gleich Herrn Schaller anrufen und ihm Bescheid geben. Zum Glück ist er ja eine Seele von Mensch und wird mir sicher keine Probleme bereiten«, sagte Petra gut gelaunt. »Und ich sehe auf diese Art und Weise wenigstens, ob diesen Bauersleuten zu trauen ist.«
»Wenn ich dort lande«, warf Toni ein und freute sich nun doch, dass Petra mitkam. Sie würde im Notfall Schützenhilfe leisten können.
»Das schaffst du schon. Niemand sonst wird für ein Taschengeld ans Ende der Welt ziehen«, sagte Petra.
»Wie du sprichst. Ich wage zu behaupten, du bist noch mehr eine Stadtpflanze als ich«, protestierte Toni.
»Das ist mal sicher.«
»Also abgemacht. Nimmst du mich auch wieder mit zurück?«
Petra wuschelte Tonis Haare, die ihr wild über die Schultern fielen.
»Natürlich, du Schaf. Wenn sie dich nicht gleich einkassieren. Aber willst du nicht wenigstens vorher bei den feinen Leuten anrufen, ehe du sie so überfällst?«
»Wo denkst du hin, ich bin doch nicht blöd. Der ganze Überraschungseffekt ist dann hin«, grinste Toni.
»Und wenn schlicht niemand zu Hause ist?«
»Auf einem Bauernhof ist immer jemand da.«
»Na gut. Also morgen früh.«
Petra rief Herrn Schaller an und bekam den Tag Urlaub, und kurz darauf klingelte es an der Wohnung und das Essen wurde geliefert. Hungrig fielen sie darüber her, wobei sie Tonis Garderobe durchgingen, damit sie seriös und mittelalt aussah.
»Und setz deine schwarze Brille auf. Die gibt dir was Gediegenes.«
»Die ist nur für die Ferne. Außerdem macht mich das schwarze Gestell intellektuell. Das fände ich unpassend, irgendwie«, murmelte Toni zwischen zwei Bissen.
»Du begehst einen Fehler, wenn du die Landbevölkerung unterschätzt«, dozierte Petra mit erhobenem Zeigefinger. »Auf den heutigen Bauernhöfen geht es modern zu, mit High-Tech und allem Schnickschnack. Die haben das Gärtnern und Umgraben auf der Hochschule gelernt. Da muht keine Kuh, ohne dass es in einem Computer festgehalten wird. Die leben beileibe nicht hinterm Mond. Die Frauen jedenfalls sind echte Power-Weiber.«
»Ja, ja, du Bauerntochter. Du musst dich ja auskennen.«
»Tu ich auch. Ich habe eine Freundin, deren Schwester hat einen Landwirt geheiratet. Was die alles an einem Tag auf die Beine stellt – da bekomme ich direkt Komplexe. Außerdem lese ich schließlich Zeitung. Die Bauernhöfe sind heute modernste Betriebe mit Computertechnologie und Unmengen Hektar Grund.«
»Ich glaube, ein Hof, der eine Hauswirtschafterin mit einem Taschengeld zufriedenstellen will, klingt mehr nach Nebenerwerbsbetrieb.«
Petra zog die Stirn kraus und stopfte sich ein Stück vom Hühnchen in den Mund. »Da magst du Recht haben«, mümmelte sie. »Aber man wird sehen. Ich geb dir keinen Monat, dann bist du wieder bei Muttern, ich meine bei mir. Ich bin ja schon so gespannt.«
»Ich erst«, sagte Toni mit belegter Stimme. »Aber Bangemachen gilt nicht. Ich werde das schon schaffen!«
In der Nacht schlief sie unruhig. Sie hatte sich ihre Sachen zurechtgelegt und war in Gedanken die Worte durchgegangen, mit denen sie sich positiv präsentieren wollte. Dennoch war sie natürlich aufgeregt. Brachte man eigentlich Zeugnisse mit, wenn man sich auf eine solche Stelle bewarb? Sie hatte in der Realschule ein Jahr Kochunterricht erhalten und darin sogar eine Eins bekommen. Vielleicht reichte das ja aus. Und ihre Kochkünste bei Petra waren auch recht ordentlich, so, wie Petra jedes Mal die Teller leer aß.
Außerdem war sie nicht auf den Mund gefallen und würde die Bauersleute schon irgendwie überzeugen, wenn sie sich zusammennahm, da war sie ganz sicher. Jedoch stammte sie unzweifelhaft nicht aus Bayern. Ein Manko? Viel hatte sie eben leider nicht zu bieten. Da half möglicherweise alles nichts außer ihrem Charme. Ob sie den in ihrer Aufgeregtheit zustande brachte? Nun, das hatte früher doch auch manchmal geklappt und sollte eine zu bewältigende Übung sein, machte sie sich Mut und schlief mit einem zuversichtlichen Lächeln endlich ein.
Am folgenden Morgen zog sie einen Tweedrock an, der ihre Knie bedeckte, dazu einen Schuh mit einem halbhohen Absatz. Jeans und Turnschuhe erschienen ihr für ein Vorstellungsgespräch zu leger, selbst wenn es sich um einen Bauernhof handelte. Der rote Pullover war hochgeschlossen. Von dem Tragen eines Dirndls hatte Petra ihr dringend abgeraten, dabei hätte sie so gern eins angezogen. Seltsamerweise hatte auch ihr Mann Michael immer gesagt, dass ein Dirndl nicht zu ihr als Frau aus dem Norden passe. Nun, Michaels Meinung zählte nicht mehr. Doch in diesem Fall wollte sie sich auf Petra verlassen.
Ihre dunklen Haare schlang sie zu einer Banane, wobei sich einige Strähnen ihrer feinen Haare selbstständig machten und ihr dreieckiges Gesicht kitzelten. Da würde eine Dose Haarspray nötig sein, um ihnen beizukommen, verlorene Liebesmüh.
Den Rock musste sie mit einer Sicherheitsnadel an der Taille verengen. Sie hatte gewaltig abgenommen in den letzten Monaten. Ansonsten nahm sie nur ein wenig Wimperntusche und einen natürlich aussehenden Lippenstift. Sie war, fand sie, sicher keine Schönheit mit ihrer blassen Haut, den dunklen Augen und Haaren, doch sie verstand es sich nett zurecht zu machen. In Sack und Asche musste man auch auf einem Bauernhof nicht erscheinen, dachte sie und legte entschlossen ein wenig Rouge auf die blassen Wangen. Es wurde Zeit, dass sie an die frische Luft kam, von der es auf einem Hof genug gab.
Als sie Petra sah, stockte ihr der Atem. Hoffentlich hielt sie sich wirklich nur im Auto auf. Ihre grell-bunte Kleidung passte zwar zu ihrem Temperament, doch wirkte sie wie ein zwanzigjähriges Hippie-Mädchen und Toni wollte doch seriös erscheinen. Mit Petra an ihrer Seite ging jede Seriosität auf der Stelle flöten.
Aufgekratzt und herumalbernd setzten sie sich in Petras Fiat und fuhren los.
Das Zaubertal war ausgeschildert und leicht zu finden.
»Solltest du weiterhin jedes Mal, wenn du einen Baum siehst, an meinem Arm zerren, werden wir deinen Bauernhof nie lebend erreichen«, rügte Petra Toni, die ihre Freundin alle zwei Minuten auf die Natur in ihren überbordenden Farben, den Lärchen im frühen beginnenden Gelb und den Mischwald, dessen Laub sich bereits an einigen Stellen bunt zu färben begann, aufmerksam machte. Zum Glück hatte der Regen aufgehört, und die Landschaft im frühherbstlichem Nebel glich an diesem Morgen einem zarten Aquarell. Toni begeisterte sich mehr und mehr, mit jedem Meter, den sie durch das Tal zurücklegten.
Schließlich bogen sie von der Bundesstraße ab, passierten mehrere stattliche Höfe, die, sauber und aufgeräumt, in ihrer behäbigen Schönheit und Blumenpracht von der Liebe ihrer Bewohner zu ihrer Heimat zeugten.
Kurz bevor die kleine Straße schließlich in einen unbefestigten Weg einmündete, drängten sich um einen kleinen Dorfplatz einige Häuser mit hübscher Lüftlmalerei sowie ein Lebensmittelgeschäft, ein Hotel und eine Gaststätte.
Sie bogen in die schmale Straße, die sie an Pensionen und einem großen Pferdegestüt vorbeiführte und fuhren zehn Minuten in langsamem Tempo, wobei sie nur Wiesen und dann ein steiles Kiefern-Waldstück passierten, in dem rechts an einigen Stellen Fichten wie Mikadostäbe herumlagen.
Sie mussten bald da sein. Tonis Erregung steigerte sich unangenehm.
Und dann, als sie meinten sich verfahren zu haben, ganz am Ende des Tals, ging die Unordnung das zerstörten Steilhanges in einen ordentlich aufgeforsteten Wald über. Die steilen Berge verliefen in sanftere Hänge und die Sicht wurde frei, auf ein romantisches Hofensemble, das sich unter einen berauschend schönen Talabschluss schmiegte, dessen Steilhänge den Hof friedvoll umschlossen.
Toni seufzte unbewusst. Dies würde ihr neues Domizil für die nächsten Jahre werden. Lange war sie sich ihrer Sache nicht so sicher gewesen.
Doch sogleich wurden ihre Höhenflüge von Petra unterbrochen.
»Also von Reichtum kann hier keine Rede sein«, stellte diese trocken fest. »Die Fassade hat seit Jahren keinen Anstrich erfahren. Die Fensterrahmen sehen rissig aus wie die Haut der Leute, die sich ein Leben lang unter den Asi-Toaster legen. Und das Dach ist so löchrig wie mein Gedächtnis, darauf könnte ich wetten.«
»Aber es sieht trotzdem nicht heruntergekommen, sondern sehr ordentlich aus. Und so romantisch. Sieh doch nur den Torbogen und schau in den Innenhof. Das ist Idylle pur«, sagte Toni mit glänzenden Augen. »Schau den Holunder. Ich liebe Holunder, daraus mach ich dir die schönsten Säfte – jedenfalls wenn man mir sagt, wie. Und die Vogelbeerbäume und die Schlehenhecke. Oh, Mann, Petra, da bekomme ich beinahe Lust zu malen.«
»Komm du nur wieder runter und krieg dich ein. Als Hauswirtschafterin wirst du zum Malen kaum Zeit finden«, erwiderte die Freundin düster. »Hast du überhaupt je einen Pinsel geschwungen?«
»Die Note besagt gar nichts«, sagte Toni, die in Zeichnen eine vier gehabt hatte. »Das ist wie beim Kochen. Man muss nur Lust dazu haben.«
»Ich habe auch immer Lust. Aber meine Lust bezieht sich auf Handfesteres«, seufzte Petra, die seit einem halben Jahr Single war. Wieder einmal. »Ich habe nur die Befürchtung, dass du die ganze Angelegenheit viel zu sehr romantisierst.«
»Ach, Petra«, sagte Toni nur. Sie war viel zu begeistert, als dass sie Petras Einwände bekümmerten. Sie war so begeistert, dass sich sogar ihre Angst ein wenig legte.
»Setz die Brille auf und schau streng, damit man dich für mittelalt hält und dir nicht ansieht, dass du vorgestern erst sechsundzwanzig Jahre alt geworden bist. Und reiß ansonsten die Äugelein auf, damit du vor lauter Idylle nicht deinen Verstand verlierst und auf jedes noch so schwachsinnige Angebot eingehst.«
»Die Brille kann ich nicht aufsetzen, wie ich dir schon sagte. Da sehe ich nur die Ferne scharf. Und keine Sorge, ich werde den Bauersleuten schon scharf in die Augen sehen. Bei aller Liebe zu diesem Gemäuer …«
»Gemäuer ist hier der richtige Ausdruck«, kam es frech von Petra.
»… will ich hier nicht nur für sieben Tage schuften, sondern viele Jahre überstehen. Drück mir bitte die Daumen«, sagte Toni. Sie atmete tief ein und aus.
»Toi, toi, toi.«
Toni stieg aus dem Auto und ging, den tiefen Pfützen mit ihren hellgrauen Schuhen aus Wildleder ausweichend, durch den mit wildem Wein und Efeu überwucherten Torbogen in den Innenhof.
Einen Moment blieb sie überwältigt stehen. Es handelte sich um ein komplettes Hofensemble mit geräumigen Stallungen zur Rechten und Linken. Eine Linde in der Mitte überschattete einen Brunnen, und die sauber gekehrten Granitsteine vor dem Eingang verstärkten den blitzblanken Eindruck, den der Hof trotz der sichtlichen Bescheidenheit machte.
Die Blumen in den Granitkästen und Tontöpfen blühten recht brav, trotz der fehlenden Sonne in den letzten Wochen und waren ebenfalls gepflegt. Vor den Haustüren, aus Eiche, wie Toni vermutete, die erfreulich stabil und sicher aussahen, und von denen es je links und rechts eine gab, standen jeweils ein großer Tisch mit zwei Bänken. Ein Hofhund schien zu fehlen und wenn es ihn gab, dann war es sicher ein friedlicher. So wie alles Frieden und Ruhe atmete. Dies war der Platz, wo sie leben konnte.
Sie genoss die Brise, die, wie es ihr schien, erfüllt war von den köstlichsten Gerüchen, nicht gerade nach Vieh und Dung, sondern nach Kräutern und einem undefinierbaren Etwas, das sie nicht einordnen konnte. Ehrlicherweise hatte sie keine Ahnung, wie ein Bauernhof in der Regel roch, sie hatte nie einen besucht. Nicht einmal Ferien hatte sie auf einem solchen gemacht, wie ihre Freundinnen es so liebten. Ihre Eltern hatten Hunger nach Sonne und Meer und sich meistens für den Süden entschieden. Sie war ihnen gern gefolgt und hatte Ferien auf dem Bauernhof nie vermisst. Heute würde sie ihr Bestes geben und alles tun, dass man in ihr nicht nur den Stadtmenschen erkannte.
Sie entschied sich für die linke Tür, an der sie einen altmodischen Klopfer betätigte. Niemand erschien. Zu schüchtern, um die Türklinke herunterzudrücken, blickte sie ein wenig unsicher an der Fassade hoch, dann wandte sie sich dem Gebäude aus Holz zu, das sich links daneben anschloss und in dem sie den Stall vermutete. Sie trat auf das Tor zu, das halb offen stand und steckte den Kopf hinein. Und in der Tat befanden sich darin ein Maschinenpark und eine Vielzahl von Geräten, die sie nicht kannte, jedoch keine Tiere, wie sie erwartet hatte.
»Hallo, ist hier jemand?«
»Grüß Gott, was gibt’s?«, erklang eine Stimme aus dem Hintergrund, und ein muskulöser Mann um die Fünfzig mit hellem Haar und eisblauen Augen trat um den urtümlichen Traktor herum, an dem er anscheinend gearbeitet hatte.
»Grüß Gott, ich bin Antonie Angerer. Ich bin gekommen, um mich für die Stelle als Haushälterin zu bewerben.«
»Was wollen S’?«, fragte der Mann mit tiefer Stimme und trat auf sie zu. Er überragte sie um einen ganzen Kopf.
Toni schluckte trocken. »Mich für die Stelle bewerben.«
»Aber des ist jetzt ganz schlecht. Sie sollten doch erst am Samstag kommen.« Der Mann schien alles andere als begeistert.
»Ja, ich weiß«, erwiderte Toni hastig. Jetzt bloß die Nerven behalten. »Aber ich dachte … ich könnte mich vielleicht schon heute bewerben, weil Sie doch so dringend jemanden suchen.«
»Wer sagt des?«
»Nun, in Ihrer Stellenanzeige stand für sofort. Und da dachte ich …«
»Jetzt kommen S’ erst mal hinein in die gute Stube«, befahl der Mann, von dem Toni annahm, dass es sich um den Bauern handelte. Er stellte den Hammer, den er in der Hand trug, neben die Tür und wies auf das Haus, vor dem Toni gestanden hatte.
Schweigend folgte sie ihm. Ebenso schweigend öffnete der Mann die Haustür auf der linken Seite das Hauses und zog sich wiederum schweigend die Schuhe im geräumigen Flur aus. Dann ging er in grauen Pantoffeln zur Tür, die links in die Küche führte. Toni folgte ihm.
»Oh, schön warm«, entfuhr es ihr.
»Ja, bei den Temperaturen kann man morgens ein wenig Wärme vertragen.«
»Sie heizen mit Holz?«, fragte Toni und blickte sich interessiert in dem aufgeräumten Raum um.
»Ja, wir haben einen eigenen Wald und nutzen ihn. Aber bitte setzen S’ sich doch.«
Er ging zu einem tiefen Waschbecken in der Ecke der Küche und wusch sich die Hände.
Toni setzte sich in den Sessel, den er ihr zugewiesen hatte. Er stand neben einem kleinen runden Tisch mit einer Leselampe unter dem Fenster, von dem aus man durch dichte Büsche das Glitzern des Sees wahrnehmen konnte. Daneben gab es einen zweiten der zierlichen Cocktailsessel in kräftigem Rot, die Toni als Zeugen der fünfziger Jahre aus dem letzten Jahrhundert einordnete. Sie waren sehr bequem, obwohl sie so klein aussahen.
Toni stellte mit einem raschen Blick fest, dass auf den mindestens sechs weiteren Fenstern an der Längsseite das Raumes, die zum Hof wiesen, überall blühende Blumen standen, die einen würzigen Duft verströmten. Auf der gegenüberliegenden Längsseite stahl ein Ofen mit einem mächtigen Ofenrohr neben einem sorgfältig aufgeschichteten Holzstapel einem winzigen Elektroherd mit zwei Platten die Schau. Die Schränke aus hellem Holz schienen vom Tischler angefertigt und wirkten in ihrer Einfachheit schön und praktisch. Ein großes Spülbecken lud ein, Gemüse- und Obstberge zu bewältigen. Oberhalb zogen sich über die gesamte Länge tiefe Regale, in denen sich nicht nur Kochbücher stapelten, wie sie zu ihrer Erleichterung sah, sondern in denen auch bunte Schalen und Schüsseln aus Keramik und Holz nebeneinander standen.
»Oder wollen S’ sich vielleicht Ihre Jacke ausziehen?«, fragte der Mann sie zögernd.
Toni verneinte. Die Jacke passte perfekt zum Tweed-Rock und stand ihr gut. Vor allem machte sie sie seriös.
»Tja dann …« Der Mann kratzte sich am Kopf.
Toni bemerkte, dass er ebenfalls verlegen schien.
»Wo Sie scho’ mal da sind … mögen S’ vielleicht eine Tasse Kaffee? I hätt’ noch eine. Er ist noch ganz frisch.«
»Sehr gern«, nickte sie lächelnd.
Er ging hinüber zum Ofen und goss zwei Becher voll. »Milch, Zucker?«
»Beides gern.«
Er nahm den Zuckertopf und Milch aus dem Kühlschrank. Dann stellte er eine Packung Butterkekse auf den Tisch vor Toni. »Bitt’ schön, was anderes ist leider net im Haus.«
»Danke, das reicht völlig.«
»Als dann legen S’ los.«
»Äh … ja.« Toni holte tief Luft. »Ich bin …« Sie hatte sagen wollen, dass sie eine Köchin war, aber das stimmte ja gar nicht, durchzuckte es sie im letzten Moment. Sie nahm einen neuerlichen Anlauf. »Also ich denke, dass ich für diese Stelle wie geschaffen bin. Ich kann kochen, ich kann einen Haushalt führen und ich bin sauber. Ich kann gut mit Geld wirtschaften und ich liebe Kinder. Und Tiere.«
Nun überfiel sie ein Anflug von schlechtem Gewissen. Doch in der Not waren vielleicht kleine Flunkereien erlaubt. Alles, was sie von sich gab, war aus der Luft gegriffen. Sie hatte nie einen Haushalt führen müssen, das hatte im letzten Jahr die nette Frau Friedl für sie besorgt. Auf Geld hatte sie im letzten Jahr nicht achten müssen, abgesehen in den letzten Wochen. Als sie noch zu Hause gewohnt hatte, hatte sie einen Teil ihres Lohns den Eltern gegeben, ansonsten hatte sie immer völlig sorglos bei ihnen wohnen und essen dürfen. Und was Kinder anbelangte, so hatten diese ebenso wie Tiere nie einen sonderlichen Stellenwert in ihrem Leben eingenommen, sie war einfach selten mit ihnen zusammengetroffen.
»Wir sind fünf Mann, i, mein erwachsener Sohn und drei kleine Kinder. Marie ist acht, Peter neun und Sonja elf.«
Toni nickte.
Einen Moment sah der Bauer sie völlig ratlos an. »Haben S’ Referenzen oder so was in der Art? Zeugnisse?«
Sie schüttelte den Kopf. »Leider kaum etwas, was Ihnen helfen könnte. Ich habe in einer Stofffabrik in Krefeld gearbeitet. Und im letzten Jahr in der hiesigen Stoffmanufaktur, der Firma Angerer, wenn Ihnen das etwas sagt?«
»Die, die vor fünf Monaten in Konkurs g’gangen sind?«
»Ja, genau. Das war die Firma meines Mannes.«
»Der sich verdünnisiert hat.«
»Korrekt. Mein Mann hat das Geld aus allen zur Verfügung stehenden Kassen genommen und hat die Firma sich selbst überlassen. Leider ist er unauffindbar – einschließlich der Sekretärin. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Die Firma ging in Konkurs. Ich sehe das als Chance etwas völlig Neues zu wagen. Daher kommt mir Ihre Stelle gerade recht. Ich meine … ich habe keine Wohnung mehr. Zur Zeit wohne ich noch bei einer Freundin. Aber ich bin eine Göttin im Kochen. Ich glaube, so haben wir beide einen guten Fang getan. Oder hätten es zumindest, wenn Sie sich für mich entscheiden würden.«
Er betrachtete sie stumm und Toni hatte das Bedürfnis, sich die Hände trocken zu wischen.
»Tja, da gibt’s nur eine Möglichkeit.«
»Ja?«
»I muss Sie testen.«
»Aber gern«, sagte sie in einer Mischung aus Freude und Sorge. Jetzt hing alles von ihrem Können und ihrer Intuition ab.
Er stand auf. »Als dann – los geht’s.« Er öffnete die Kühlschranktür. »Des steht Ihnen zur Verfügung. Sie dürfen alles verkochen.«
»Sind Sie Vegetarier, Veganer, Rohköstler?«
Er blickte sie verdutzt an, dann brach er in schallendes Gelächter aus.
Toni lächelte. »Also ganz normaler Esser. Wunderbar, das vereinfacht die Sache.« Dass sie Vegetarierin war, brauchte er als Bauer nicht zu wissen.
»Ganz recht. I und meine ganze Familie, wir essen alles«, sagte er immer noch mit Lachfältchen um die Augen.
»Wo ist Ihre Mikrowelle?« Sein Blick sprach Bände. Eins zu Null gegen mich, dachte sie und fügte hastig hinzu: »Nicht, dass ich eine bräuchte.«
»Eine Mikrowelle haben wir net. Aber wir haben eine G’friertruhe.«
Er ging in einen Nebenraum, den Toni als Speise- und Rumpelkammer klassifizierte. Er knipste an einem Schalter und eine Funzel erhellte nur unzureichend den vollgestellten Raum, in dem sich nicht nur Lebensmittel, sondern auch Putzmittel befanden – ein Umstand, den sie zu ändern gedachte, wenn man sie ließe. Dann entdeckte sie in der hintersten Ecke eine Gefriertruhe, die zehn Schweinen und fünf Kühen Platz geboten hätte, in zerlegten Stücken. Mindestens.
Toni hob fragend den Kopf, nachdem sie den Inhalt kurz überflogen hatte.
»Soll ich das gefrorene Gemüse verwenden? Denn für das Fleisch fürchte ich, reicht die Zeit nicht, wir wollen es doch nicht mit kochendem Wasser auftauen, das wäre dem Geschmack extrem abträglich.«
»Schauen S’ erst, was wir an frischem Grünzeug haben. Wenn S’ dann noch net reicht, gehen S’ ans Eing’machte.«
Toni reckte sich gerade. »Muss ich Allergien beachten? Oder leidet jemand unter Diabetes?«
»Nein, wir sind alle g’sund.«
»Haben Sie eine Schürze?«
Er kratzte sich am Kopf. »I fürcht’, die ist Ihnen net sauber g’nug.«
»Macht nichts.«
Sie gingen gemeinsam in die Küche. »Wo sind die Küchenhandtücher?«
Er zeigte es ihr. Sie nahm eines aus dem Buffet heraus und band es um ihren Rock. Dann machte sie sich ans Werk.
Eineinhalb Stunden später vernahmen sie wie die Haustür geöffnet wurde.
»Hallo, ist hier jemand?«, erklang eine energische Stimme.
»Oh je, meine Freundin, die hab ich ganz vergessen«, sagte Toni mit roten Wangen.
Im gleichen Moment wurde die Küchentür aufgerissen.
»Hallo?« Petra steckte den Kopf durch die Tür. »Na Gottseidank, du lebst. Ich hatte schon Sorge, dir könnte was passiert sein«, sagte sie atemlos.
»Kommen S’ nur herein. Ihre Freundin ist gerade fertig geworden und wir können mit dem Essen beginnen«, sagte Kurt gut gelaunt, »denn i fürcht’, für zwei Mann ist des alles ein bisschen viel.«
»Dann brauche ich den wohl nicht.«
Kurt und Toni schauten zu Petra, die verstohlen den handfesten Knüppel auf den Fußboden legte.
Sie lachten alle, und dann kam Petra der Aufforderung nach und trat zu dem Bauern. »Ich bin Petra Maurer, die Freundin von Frau Angerer.«
»Und i bin Kurt Beiler. Nett, des Sie Ihre Freundin begleiten. Sie ist auch scho’ fertig. Sie sollte nur eine Kostprobe ihres Könnens abliefern. Sie sind herzlich eing’laden, bitte nehmen S’ Platz.«
Toni stellte drei Teller auf den Tisch. »Entschuldige, Petra, aber ich hab dich völlig vergessen.«
»Macht ja nix. Jetzt krieg ich dafür ein Gratisessen, zubereitet von der besten Köchin der Welt.«
»Was es zu beweisen gilt«, sagte Kurt, doch man sah ihm an, dass Toni bei ihm bereits gewonnen hatte. Schließlich hatten sie genügend Zeit gehabt zu naschen. Und sich zu unterhalten. Was zur Folge hatte, dass Toni Bescheid wusste: über Kurt, angefangen von der Jugend auf dem Hof, über die Kriegszeiten bis zum Tod seiner Frau und dem Einsatz von Ferdinand, seiner größten Hilfe. Und Kurt hatte das Wichtigste der letzten Jahre über Toni erfahren.
Toni hatte sich selbst überboten und in der Tat fast die gesamten Vorräte, die nicht eingefroren waren, verarbeitet. Es gab süße Pfannkuchen und Pfannkuchen mit Speck, köstliche Tellerlinsen mit Möhren, Zwiebeln, Knoblauch, Zimt, Curry und getrockneten Aprikosen, ein Rezept, das ihr aus einer Illustrierten in Erinnerung geblieben war, da sie es nachkochen wollte. Dann kosteten sie von der bunten Gemüsesuppe, den Nudeln mit Krevetten, die aufgetaut im Kühlschrank lagerten und nach Kurts Beschwörung erst am gestrigen Abend aus der Truhe geholt worden waren. Dazu arrangierte sie einen grünen Salat, dem sie dank das Geheimrezepts ihrer Großmutter in kürzester Zeit zu frischerem Leben verholfen hatte. Als Nachtisch hatte Toni Kirschauflauf gezaubert und einen Apfelstrudel, um die letzten verschrumpelten Äpfel zu verwerten, den sie mit köstlicher Vanillesoße servieren würde.
Alles wurde auf dem riesigen Küchentisch aufgebaut. »Bitte greift zu«, sagte sie mit Stolz in der Stimme.
Das taten sie dann auch. Es roch paradiesisch und Toni war sicher, sich selbst übertrumpft zu haben.
»Was übrig bleibt, können Sie morgen aufbrauchen, außer den Nudeln mit den Krevetten, die müssten heute gegessen werden«, sagte sie beim abschließenden Kaffee.
»Und i hatt’ scho’ Sorge, Sie essen wie ein Spatz, so dürr wie Sie sind«, sagte Kurt Beiler.
»In meiner Familie werden die Frauen erst ab vierzig dick. Davor können wir essen so viel wir wollen. Zum Glück«, lachte Toni. »Und? Hat’s Ihnen geschmeckt?« Diese Frage war angesichts von Kurts Appetit überflüssig, doch schließlich musste man zum Ende kommen. Für Tonis Geschmack hatte sich bestätigt, dass sie gut gewesen war, doch nun musste das finale Lob vom Hausherrn gesprochen werden.
»Sagten Sie, dass Sie eine gute Köchin sind?«
»Ich sagte, dass ich eine gute Köchin bin und dass ich wie eine Göttin koche. Beides stimmt«, erklärte Toni selbstbewusst und wie sich zu ihrem Erstaunen tatsächlich herausgestellt hatte.
»Sie sind sicher net für Ihre Bescheidenheit bekannt, aber Sie kochen tatsächlich recht gut. Auch wenn S’ meine Familie erst noch davon überzeugen müssen, des Linsen und Aprikosen tatsächlich zusammenpassen. Und wenn S’ dann und wann ein wenig mehr Salz und Pfeffer nehmen, sind Sie unser Mann.«
»Ihre Hauswirtschafterin.«
»Sag’ i doch.«
»Muss ich auch putzen?«
Er runzelte die Stirn. »Tja, logisch. I mein’ … wir helfen natürlich alle mit, denn eine eigene Putzfrau haben wir net. Aber wenn Gäste da sind, müssten die zwei Ferienwohnungen natürlich später g’putzt werden.«
Toni nickte. Langeweile, das stand fest, würde in den nächsten Jahren nicht anstehen. Es war gut, dass sie körperlich in bester Verfassung war.
»Dann bin ich Ihre Frau. Wann soll ich anfangen?«
»Wie wär’s mit morgen?«
»Perfekt«, strahlte sie, streckte die Hand aus und Kurt nahm sie. Sie nickten sich voll gegenseitiger Begeisterung zu. »Morgen um zehn stehe ich bei Ihnen auf der Matte. Ist das in Ordnung?«
»Wär’ gut.«
Sie stand auf. »So, jetzt werde ich die Köstlichkeiten in den Kühlschrank packen und rasch spülen, dann verabschiede ich mich von Ihnen. Ich hoffe nur, Ihrer Familie wird es genauso gut schmecken wie uns.«
Und außerdem hoffte sie, dass sie bei der Familie genau so viel Zustimmung fand wie beim Bauern. Aber er war zumindest ein guter Anfang. Das mit dem Würzen würde sie schon hinkriegen. Sie hatte lieber zu wenig Salz genommen als zu viel, und dass im Rotkohl ein wenig zu viel Marmelade drin war, um den leicht angebrannten Geschmack zu übertünchen, schien er gar nicht bemerkt zu haben.
»Da können S’ sicher sein.«
Petra half ihr bei der Arbeit und wenige Minuten später sah alles blitz-blank aus, so wie sie die Küche vorgefunden hatte.
»Ich danke Ihnen, dass Sie mich eingestellt haben und freue mich auf morgen früh«, sagte Toni lächelnd zu dem Bauern.
»I mich ebenfalls. Ach herrjeh«, er fuhr sich mit der Hand an den Kopf, »des hätt’ i beinahe vergessen. I sollt’ Ihnen natürlich noch rasch Ihr Zimmer und den Hof und alles zeigen. Also … wir haben zwei Ferienwohnungen, eine für sechs und eine für fünf Personen, des war die Wohnung meiner Eltern, bevor sie starben. Sie liegen alle drüben im Gästeflügel, wo wir immer unsere Pensionsgäste unterbringen.«
Toni nickte stumm.
»Unterm Dach steht ein Zimmer mit Bad für Sie bereit. Und des hier ist unsere gute Stube.«
Toni folgte ihm durch die Tür, die rechts von der Küche in einen kleinen Raum führte, in dem sich zwei Sofas befanden, die über Eck um einen runden Tisch standen und zwei ausladende Sessel beinahe das einzige Inventar bildeten, neben einer altertümlichen Musiktruhe und einem Fernsehgerät, das daneben auf einem niedrigen Schrank stand. Den Rest das Raumes nahm an der Längsseite ein prall gefülltes Bücherregal ein. Der Raum war klein aber sehr gemütlich, und der Blick aus den Fenstern auf den See und die Berge war überwältigend.
»Ein sehr gemütlicher Raum«, sagte Toni.
»Ja, des ist er. Aber wir sitzen zumeist in der Küche und gehen hier nur zum fernsehen hinein, es sei denn, wir kriegen Besuch.«
Sie verließen den Raum und Toni folgte Kurt Beiler den langen Flur entlang in den rechten Flügel das Hauses.
Tja, Toni, dachte sie, wollen wir mal hoffen, dass du das tatsächlich alles gebacken kriegst. So viel Arbeit wäre in der Tat eine neue Herausforderung.
»Die Gäste haben einen eigenen Eingang, damit wir uns net stören. Unten ist ein G’meinschaftsraum, in dem nochmals ein Fernseher und Bücher stehen, sodass man sich hier zum gemütlichen Beisammensein treffen kann, falls mal befreundete Familien anreisen.«
»Gute Idee, finde ich«, bestätigte Toni.
»Ja, des war die Idee vom Ferdinand. Ach, und den Garten hab i Ihnen auch noch net g’zeigt.«
»Und die Tiere.«
»Natürlich. Wir haben vierzehn Milchkühe. Die sind zur Zeit oben auf der Alm. Dazu besitzen wir zwanzig Hektar Wald, von dem wir jährlich fünfzehn Ster an die Säge verkaufen. Wie i ja scho’ sagte, wird der Hof mit dem Holz beheizt.«
»Verstehe«, erwiderte Toni, die keine Ahnung hatte, wie viel ein Ster war. Aber das würde sie ja alles in Zukunft noch lernen. Hauptsache, sie musste nicht zu all der Arbeit im Haus auch noch das Holz spalten. Und bloß keine Kühe melken.
Die Stufen knarrten leise, als sie ihm die Treppe hinauf folgte. Er öffnete die Tür zur ersten Wohnung, die für fünf Personen vorgesehen war.
»Oh ja«, brachte Toni erschrocken hervor. So etwas Schreckliches hatte sie lange nicht gesehen.
Die Sofas waren von abstoßendem grau-braunem Mustermix, über die fein säuberlich eine bunte Tagesdecke gelegt worden war, wahrscheinlich damit man die Flecken darauf auch nach zwanzig Jahren nicht wahrnehmen konnte, weil sie bereits zu Beginn verfleckt wirkten, dachte sie entsetzt. Die Farben an den lackierten Holzmöbeln waren abgeschabt. Aber das, durchzuckte es sie, galt heute ja bei einigen Menschen als modern. In der Küche gab es einen Resopaltisch mit den dazu passenden Stühlen, wie ihre Eltern sie besessen hatten, als sie sieben oder acht Jahre alt gewesen war. Doch ihre Essecke war inzwischen längst modernisiert worden. Das Bad in tristem Braun-Grün und die Schimmelfugen in den Duschen ließen sie erschauern, die Handtücher darin waren so hauchdünn, dass man durch sie die Zeitung lesen konnte. Von den Gardinen ganz zu schweigen. Die Plastikvorhänge würde sie mit Gummihandschuhen abnehmen und als erstes waschen. Allein bei dem Gedanken zog sie einen imaginären Mundschutz hervor. Als sie jedoch den Versuch einer Verschönerung in Form von Plastikblumen auf den Nachttischen und den liebevoll mit Obst und Süßigkeiten bestückten Teller sah, wurde sie von Rührung übermannt.
»Hoppla, an des Obst hab’ i net mehr g’dacht«, sagte Kurt Beiler verlegen, als er sah, dass die Trauben und Birnen, die er für die Gäste auf dem Wohnzimmertisch bereitgelegt hatte, braune Stellen aufwiesen und bereits zahlreiche Obstfliegen angezogen hatten. »Die Leut’ haben gestern erst abg’sagt.«
»Das kann doch schon mal vorkommen. Dafür haben Sie ja jetzt mich«, sagte Toni rasch. »Wunderschön ist dieser Blick auf den Garten und den See.«