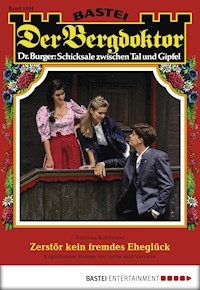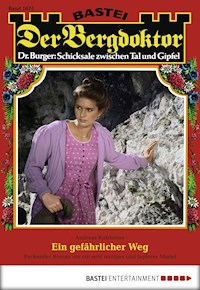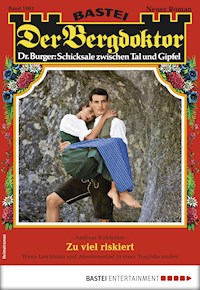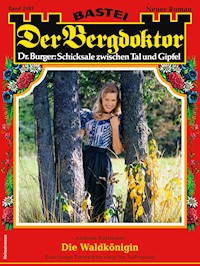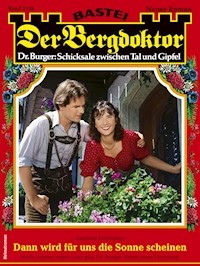1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Bergdoktor
- Sprache: Deutsch
Im Doktorhaus von St. Christoph freut man sich auf das Wochenende und auf den Gast Hans Limbach, einen ehemaligen Kollegen aus Dr. Burgers Münchner Zeit.
Dr. Limbach, inzwischen ein erfolgreicher Augenarzt, und Martin Burger waren vor vielen Jahren zur gleichen Zeit in der Münchner Uniklinik tätig. Obwohl sie sich danach nur noch selten getroffen haben, war es ihnen wichtig, den Kontakt nicht zu verlieren.
So weit, so gut. Doch Dr. Limbach kommt mit großen Sorgen im Gepäck und bittet Martin Burger eindringlich um Hilfe. Der wäre nicht der Mann, wie wir ihn kennen, wenn er seine Unterstützung nicht spontan zusagen würde. Allerdings ahnt er nicht, was nun auf ihn zukommen wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Frei für dich
Vorschau
Impressum
Frei für dich
Wie der Bergdoktor einem Paar in schweren Zeiten zur Seite stand
Von Andreas Kufsteiner
Die folgende Geschichte zeigt, dass man zuweilen wirklich nicht an Zufälle glauben kann, sondern dass es wohl doch das Schicksal ist, das die Karten mischt:
Liebe Leserinnen und Leser, machen wir uns auf den Weg nach St. Christoph. Unser Besuch im Zillertal, der eine ganze Weile dauern wird, beginnt an einem sonnigen Tag im Hochsommer. Und schon sind wir mittendrin im Geschehen, auch wenn es anfangs vielleicht nicht so scheint. Viele Ereignisse, die das ganze Leben verändern, beginnen zunächst mit kleinen Schritten ...
Im Doktorhaus von St. Christoph freut man sich auf das Wochenende und auf den Gast Hans Limbach, einen ehemaligen Kollegen aus Dr. Burgers Münchner Zeit.
Dr. Limbach, inzwischen ein erfolgreicher Augenarzt, und Martin Burger waren vor vielen Jahren zur gleichen Zeit in der Münchner Uniklinik tätig. Obwohl sie sich danach nur noch selten getroffen haben, war es ihnen wichtig, den Kontakt nicht zu verlieren.
So weit, so gut. Doch Dr. Limbach kommt mit großen Sorgen im Gepäck und bittet Martin Burger eindringlich um Hilfe. Der wäre nicht der Mann, als den wir ihn kennen, wenn er seine Unterstützung nicht spontan zusagen würde. Allerdings ahnt er nicht, was nun auf ihn zukommen wird ...
Es war ein heißer Tag in St. Christoph. So heiß, dass sogar der Bergwind, von dem man sich im Zillertal auch bei Temperaturen von dreißig Grad ein angenehm kühles Lüftchen erwarten konnte, nichts mehr ausrichten konnte.
Hin und wieder wehte er an diesem Sonnabend zögerlich über die Gipfel, machte dann kurz an den Almen halt und versuchte, im Wald ein bisschen Frische einzusammeln. Das gelang ihm zwar, doch auf dem Weg hinunter ins Dorf ging das Lüfterl wieder verloren.
Die Sonne war in Hochform und dachte gar nicht daran, das Zepter aus ihren sommerlich heißen Händen zu geben. Wolken jeder Art, auch nicht die kleinen, wattweichen Schäfchenwolken, hatten ebenfalls keine Chance. Der Himmel war so blau, dass er endlos wirkte: Ein unfassbar großes, strahlend blaues Gewölbe, das anscheinend bis ans Ende der Welt und noch weiter reichte – bis hinauf zu den Sternen.
Wenn es dunkel wurde, kamen in den traumhaft schönen Sommernächten die Sterne so hell hervor, dass man das prachtvolle Flimmern und Glitzern gar nicht genug bewundern konnte. Man hatte den Eindruck, dass sie ganz nah waren und nicht Lichtjahre entfernt.
Kaum zu glauben, dass der Himmel auch irgendwann wieder einmal verhangen oder trüb sein würde, dass – so stand es in den Sagenbüchern – die Nebelfrauen auf den stillen, feuchten Wiesen schweben und die goldenen Tage des Sommers nur noch Erinnerung sein würden.
Aber daran musste noch niemand denken, denn nach dem Sommer hatte auch der Herbst im Zillertal noch viel Schönes zu bieten. Manche Leute fanden es sogar angenehmer, wenn die Hitze nachließ und die Sonne eher unterging, als es derzeit der Fall war.
Im Garten der Familie Burger herrschte schon früh am Morgen gute Laune. Sommerzeit war Ferienzeit, jedenfalls für Tessa, acht Jahre alt, und ihren drei Jahre jüngeren Bruder Filli, der zwar noch in den Kindergarten ging, aber – bitte jetzt Obacht geben! – offiziell ein Vorschulkind war.
Sätze wie »Das kannst du noch net!« oder »Du weißt das eh net, also sei still!« waren tunlichst zu unterlassen. Filli reagierte darauf sehr empfindlich.
Vorschulkind Filli wusste nämlich schon eine ganze Menge und konnte, zum Beispiel, ganz allein einkaufen gehen, etwa bei der Jeggl-Alma nebenan oder in der Apotheke gegenüber. Apotheker Steghofer passte außerdem immer genau auf, er wusste über alle Medikamente Bescheid und lieferte bestimmte Dinge persönlich aus. Es konnte also gar nichts schiefgehen.
Wer immer Ferien hatte, war Klein-Laura, zwei Jahre und ein paar Monate alt. Das heißt, so ganz stimmte das nicht mit den Dauerferien. Denn das Nesthäkchen wollte sich natürlich den beiden »Großen« anpassen. Mit anderen Worten, wenn Tessa in der Schule und Filli im Kindergarten – Verzeihung, in der Vorschule – waren, hatte das Mauserl daheim eine Menge zu tun.
Bis die Geschwister wiederkamen, kümmerte sich die Kleine um ihre Stofftiere, die ja auch etwas lernen mussten. Besonders Fröschli wurde von Laura sehr streng unterrichtet. Und da grüne Plüschtiere mit Schlenkerbeinen und treuherzigen Frosch-Äuglein meistens keine Lust zum Lernen hatten, musste die kleine Lehrerin manchmal ernsthaft durchgreifen und Fröschli ausschimpfen.
Aber lange konnte sie ihrem grünen Freund nicht böse sein, denn er war immer bei ihr und tröstete sie sogar nachts, wenn sie mal wieder vom Rumpelgeist auf dem Dachboden geträumt hatte. Fröschli flüsterte ihr dann zu, dass der Rumpelgeist eigentlich nur ein Zwergerl war, das bei der Nacht große Angst hatte und sich deshalb auf dem Dachboden versteckte. Das sagte Papa auch immer. Und wenn Papa etwas sagte, dann stimmte es auf den Punkt.
Klein-Laura half übrigens auch der Bachhuber-Zenzi, die seit vierzig Jahren im Doktorhaus werkelte und zur Familie gehörte. Zum Beispiel machte es Spaß, die Blumen zu gießen und Kräuter für den Salat zu pflücken.
Laura sah jeden Tag im Garten nach den »Krabbelis« und nach den Schmetterlingen, damit ihnen nichts passierte. Sie bürstete sogar Dackel Poldis Fell, aber nur ganz vorsichtig, damit es nicht ziepte.
Und natürlich half sie auch der Mama, die immer so viel zu organisieren hatte und manchmal ganz schnell zu Papa in die Praxis eilte, weil jemand ganz schrecklich krank geworden war und vielleicht sogar operiert werden musste.
Mama war nämlich auch Ärztin. Wenn Papa einen Patienten operierte, dann gab Mama dem Kranken vorher eine Spritze, damit er einschlief und nichts merkte. Das nannte man dann Narkose. Oder Anästhesie. Aber so ein schwieriges Wort konnte sich ein kleines Mauserl wie Laura natürlich noch nicht merken.
Wer noch ab und zu Klein-Lauras Hilfe in Anspruch nahm, war natürlich Opa.
Er war auch Arzt. Eigentlich waren ja alle Ärzte, aber Opa meinte immer, dass er im Ruhestand sei. Allerdings nur halb, weil er sich auf keinen Fall den ganzen Tag lang aufs Ohr legen wollte.
Der Großpapa war meistens sehr lustig. Er hatte tolle Ideen und war immer sehr beschäftigt, zum Beispiel mit seiner Zillertaler Chronik, die er ständig ergänzte und erweiterte. Niemand konnte so gut Geschichten erzählen wie er.
Klein-Laura half ihm in seinem »Kabinettl« beim Aufräumen, sie brachte ihm manchmal ein paar Kekse und seine Lieblingsschokolade. Dann setzten sie sich zusammen auf das Kanapee und ließen es sich schmecken. Aber nur immer ein einziges Kekserl und ein Stück Schokolade, damit man kein Bauchweh bekam.
Opa meinte auch, dass er bei den Süßigkeiten ein bisserl »auf die Bremse« treten musste, weil ihm sonst der Gürtel zu eng wurde. Er machte kein Geheimnis daraus, dass er ein Feinschmecker war und gerne auch mal ein bisschen mehr aß, als es seinem Gewicht gut tat.
»Was soll's«, scherzte er dann. »Ich bin kein junger Hirsch von zwanzig mehr, sondern siebenundsiebzig, und eine olympische Medaille im Weitsprung will ich mir auch nicht mehr holen!«
***
Die Tage im Doktorhaus vergingen wie im Flug. Es würde auch heute nicht anders sein. Das Frühstück war noch nicht vorbei, aber schon überlegten die Zenzi und Sabine Burger, was mittags auf dem Tisch stehen sollte.
»Wann kommt denn unser Gast?«, fragte Sabine, während ihr Mann bedauernd feststellte, dass sich in der Kaffeekanne nur noch ein kläglicher Rest befand.
»So gegen elf Uhr, denke ich«, antwortete Martin. »Hans war ein paar Tage in Graz. Ein Seminar über Sehstörungen im Alter. Ja, die Augenärzte wollen immer den Durchblick behalten.«
Sabine lachte. »Und die Chirurgen und Internisten? Was wollen die? Ich schätze, ein gutes Skalpell und die beste Diagnose.«
»Richtig, Schatz«, erwiderte der Doktor. »Wobei ich soeben darüber nachdenke, was Anästhesisten sich am meisten wünschen. Ich nehme an, sie freuen sich über einen Patienten im absoluten Tiefschlaf, der nach dem Aufwachen erzählt, dass er etwas Wunderbares geträumt hat.«
»Gelegentlich kann so etwas sogar vorkommen, Martin.«
»Ich hatte mal einen Patienten, der eine ganze Weile bewusstlos war«, schaltete sich der Senior in das Gespräch ein. »Ihm war beim Arbeiten am Hausdach eine Dachrinne auf den Kopf gefallen. Zum Glück hatte das außer einer mäßigen Gehirnerschütterung, ein paar Hämatomen und einer ausgerenkten Schulter keine Folgen – es war wirklich erstaunlich. Als er wieder bei sich war, fragte er ständig, wo denn die liebenswürdige, freundliche Frau im weißen Kleid sei, die ihn zu mir gebracht hatte. Diese Frau gab es aber gar nicht. Sein Sohn, der Peter, hat ihn zu mir in die Praxis gebracht. Er hatte seinen Vater auf dem Boden liegend gefunden. Der Patient beharrte aber auch später noch darauf, dass es eine schöne junge Frau gewesen sei, die sich um ihn gekümmert und ihm versichert hatte, dass er bald wieder auf den Beinen sein würde. Das behauptet er übrigens steif und fest bis heute. Und er erzählt es immer noch allen Leuten. Deshalb kann ich euch ja auch sagen, dass es sich um den Altbauern vom Achleitner-Hof handelt. Inzwischen hat er seinen achtzigsten Geburtstag hinter sich und erinnert sich glasklar an die Vergangenheit. Vor allem auch an die Frau, die sich angeblich um ihn gekümmert hat.«
»Wenn man bewusstlos ist, dann heißt das ja nicht, dass das Gehirn seine Tätigkeit einstellt«, gab Sabine zu bedenken. »Man kann in diesem Ausnahmezustand Dinge sehen, die man später als völlig real empfindet. Und wer weiß schon so genau, wo man ist, wenn man das Bewusstsein verloren hat?«
»Darüber streiten sich die Wissenschaftler«, warf Dr. Burger ein.
»Man kann während einer Narkose den Patienten komplett überwachen, die medizinischen Geräte zeigen die kleinste Schwankung an. Aber was in ihm vorgeht, welche Bilder er sieht, das weiß man nicht«, meinte Sabine nachdenklich. »Die meisten Patienten erinnern sich nicht. Aber es gibt es auch solche, die Erstaunliches berichten. Vor allem dann, wenn ihr Zustand lebensbedrohlich war. Wenn sie beispielsweise eine schwere Operation überstanden haben – auch schwierige Eingriffe am Gehirn – und schließlich schrittweise aus der Narkose geholt werden, berichten sie, was sich in der Zwischenzeit abgespielt hat. Sie waren zum Beispiel in einer schönen Gegend, haben Menschen getroffen, die ihnen lieb und teuer waren und fühlten sich so glücklich wie nie zuvor.«
Dr. Burger nickte. »Das sind typische Nahtod-Erlebnisse. Zum Teil sind sie auf die Endorphine zurückzuführen, körpereigene morphinähnliche Substanzen, die in bedrohlichen Situationen verstärkt vom Nervensystem und der Hypophyse ausgeschüttet werden. Endorphine haben auch eine starke analgetische Wirkung. Das erklärt, warum sehr schwer Verletzte in Lebensgefahr sogar heftige Schmerzen kaum bemerken. Das alles ist ein Schutz, um etwas Unerträgliches eben doch auszuhalten. Vielleicht ist man dem Tod nahe, aber anstatt in Panik auszubrechen, sieht man wunderbare Bilder und hat das Gefühl, zu schweben oder liebevoll umsorgt zu werden.«
»Martin, nur zum Teil sind, deiner Meinung nach, diese Erlebnisse im Koma oder in einer tiefen Narkose auf die Endorphin-Ausschüttung zurückzuführen«, unterbrach Sabine ihren Mann. »Was ist dann mit der zweiten Hälfte?
»Wir wissen es bis heute nicht«, erwiderte Martin Burger. »Handelt es sich um Träume oder Erinnerungen? Aber wie kann es sein, dass der Patient dann sehr genau sagen kann, was im Koma oder in der Narkose mit ihm geschehen ist, was gesprochen wurde und welche Augenfarbe der Operateur hatte? Das und Ähnliches ist übrigens mehrfach belegt worden. Namhafte Mediziner haben Bücher darüber geschrieben. Es ist ein sehr kompliziertes Thema, in dem nicht nur die Wissenschaft zu Wort kommt. Einiges lässt sich eben nicht erklären, auch wenn man sich noch so sehr bemüht.«
Auch der Senior hatte dazu noch etwas zu sagen.
»In welcher Grauzone wir uns bewegen, wenn wir zwischen Leben und Tod schweben, bleibt letztlich ein Rätsel. Ist es so, dass wir dann einen Blick nach drüben werfen können, wie viele annehmen? Wartet wirklich in einer anderen Welt das ewige Licht und eine unendliche Liebe auf uns? Von den Nahtod-Patienten hört man das jedenfalls immer wieder. Sie möchten dorthin zurück, wo sie im Zustand vor ihrem Erwachen gewesen sind.«
Sabine nickte. »Ja, das stimmt. Es ist ja nicht so, dass jeder Schwerkranke ein Nahtod-Erlebnis hat. Viele sind sehr froh, wenn sie aufwachen und erfahren, dass es für sie weitergeht. Aber diejenigen, die in eine andere Welt eintauchen, vergessen es nie mehr. Was sie erlebt haben, ist für sie völlig real – keineswegs wie ein Traum. Es ist mindestens genauso klar wie dieser Morgen für uns. Wir sitzen am Frühstückstisch und schauen den Kindern zu, die draußen im Garten mit Poldi spielen. Alles deutlich und ohne jeden Zweifel ganz logisch. So ist das auch für diejenigen, die eine Nahtod-Erfahrung gemacht haben.«
Die Zenzi hatte bis jetzt zugehört, ohne ein Wort zu sagen. Das kam bei ihr nur selten vor. Eigentlich fast nie.
»Das klingt alles wie im Märchen«, meinte sie, »für einige vielleicht sogar ein bisserl gruselig. Ist es aber net. Im Gegenteil. Es ist doch schön, wenn man weiß, dass man auch dann net allein ist, wenn das Leben zu Ende geht. Jemand ist da. Man wird aufgefangen. Nach der letzten Chorprobe haben wir mit dem Herrn Staudacher darüber gesprochen, und Pfarrer Roseder kam zufällig auch dazu. Wir hatten nämlich ein Lied für die Beerdigung unserer guten, alten Steiner-Rosa eingeübt, die ja so lange bei uns als Dorfhelferin gearbeitet hat.«
»Ach ja, die Rosa.« Dr. Burger nickte. »Immer bescheiden und mit einem Glauben, der durch nichts zu erschüttern war. Sie ist am Ende ihres langen Lebens friedlich eingeschlafen.«
»Sie wollte, das man bei ihrem Begräbnis etwas Schönes singt. Nix Trauriges. Der Herr Pfarrer meinte, dass die Rosa genau wusste, wo sie hingehen würde«, berichtete die Zenzi. »Zu ihrem Mann wollte sie, der ja schon vor ein paar Jahren verstorben ist. ›Ich seh meinen Kilian‹, hat sie gesagt, ›er ist schon da und wartet an der Tür auf mich. Wir haben ja abgemacht, dass er mich abholt. Wir werden beim Herrgott ein warmes Platzl für uns beide bekommen.‹«
Nun hatte die Zenzi vor Rührung ein Tränchen im Augen, denn obwohl die Rosa ein langes und erfülltes Leben gehabt hatte, hätte man sie gern noch weiterhin in ihrem Garten beobachtet, in dem sie Gemüse angebaut und mit ihren beiden schneeweißen Hausenten geredet hatte.
Die Enten sollte Chorleiter Staudacher zu sich nehmen, das hatte Rosa so bestimmt: »Weil ich doch so gern dem Chor zugehört hab. Ohne ihn wären die Lieder net so schön gewesen.«