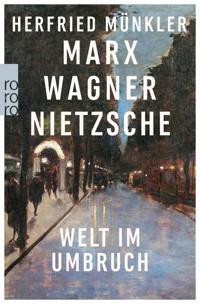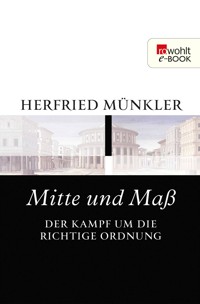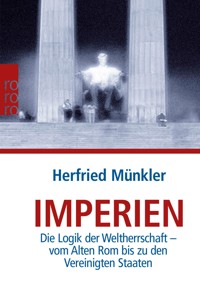16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Noch heute gilt «Dreißigjähriger Krieg» als Metapher für die Schrecken des Krieges schlechthin, dauerte es doch Jahrzehnte, bis die Verwüstungen überwunden waren, die der längste Krieg auf deutschem Boden angerichtet hatte. Dabei war, als am 23. Mai 1618 protestantische Adelige die Statthalter des römisch-deutschen Kaisers Ferdinand II. aus den Fenstern der Prager Burg stürzten, kaum abzusehen, was folgen sollte: ein Flächenbrand, der erste im vollen Sinne «europäische Krieg». Fesselnd erzählt Herfried Münkler vom Schwedenkönig Gustav Adolf und dem Feldherrn Wallenstein, von Kardinälen und Kurfürsten, von den Landsknechten und den durch Krieg und Krankheiten – ein Viertel der Bevölkerung fand den Tod – verheerten Landschaften Deutschlands. Auch die europäische Staatenordnung lag in Trümmern – und doch entstand auf diesen Trümmern eine wegweisende Friedensordnung, mit der eine neue Epoche ihren Ausgang nahm. Herfried Münkler führt den Krieg in all seinen Aspekten vor Augen, behält dabei aber auch unsere Gegenwart im Blick: Der Dreißigjährige Krieg kann uns, wie er zeigt, besser als alle späteren Konflikte die Kriege der Gegenwart verstehen lassen. Eine packende Gesamtdarstellung, die historische Erzählung und politische Analyse vereint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1539
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Herfried Münkler
Der Dreißigjährige Krieg
Europäische Katastrophe, deutsches Trauma 1618–1648
Über dieses Buch
Vor 400 Jahren begann der Dreißigjährige Krieg: Herfried Münklers grandiose Gesamtschau
Noch heute gilt «Dreißigjähriger Krieg» als Metapher für die Schrecken des Krieges schlechthin, dauerte es doch Jahrzehnte, bis sich Deutschland von den Verwüstungen erholte, die der längste und blutigste Religionskrieg der Geschichte angerichtet hatte. Dabei war, als am 23. Mai 1618 protestantische Adelige die Statthalter des römisch-deutschen Kaisers Ferdinand II. aus den Fenstern der Prager Burg stürzten, kaum abzusehen, was folgen sollte: ein Flächenbrand, der erste im vollen Sinne «europäische Krieg». Fesselnd erzählt Herfried Münkler vom Schwedenkönig Gustav Adolf und dem Feldherrn Wallenstein, von Kardinälen und Kurfürsten, von den Landsknechten und den durch Krieg und Krankheiten – ein Drittel der Bevölkerung fand den Tod – verheerten Landschaften Deutschlands. Auch die europäische Staatenordnung lag in Trümmern – und doch entstand auf diesen Trümmern eine wegweisende Friedensordnung, mit der eine neue Epoche ihren Ausgang nahm.
Herfried Münkler führt den Krieg in all seinen Aspekten vor Augen, behält dabei aber immer unsere Gegenwart im Blick: Der Dreißigjährige Krieg kann uns, wie er zeigt, besser als alle späteren Konflikte die heutigen Kriege verstehen lassen. – Eine packende Gesamtdarstellung, die große Geschichtsschreibung und politische Analyse vereint.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, November 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
Umschlagabbildung Radierung (17. Jh.) von Jan Martszen d. J./bpk
ISBN 978-3-644-12071-6
Hinweis: Seitenverweise beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Marina
EinleitungDeutsche Erinnerung und deutsches Trauma
Die Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg war das große Trauma der Deutschen, bis dieses Trauma durch die kollektive Erinnerung an die Gewalt und Zerstörung abgelöst wurde, die mit den beiden Weltkriegen einhergingen. Die Verwüstung der Städte, die Verheerung des Landes und das massenhafte Sterben der Menschen in den Jahren von 1618 bis 1648 standen beispielhaft für die Schrecken des Krieges,[1] doch diente der Dreißigjährige Krieg darüber hinaus als Erklärung dafür, warum die deutsche Geschichte, so die Annahme, seit dem 17. Jahrhundert ganz anders verlaufen sei als die der meisten europäischen Nationen: Während diese politisch handlungsfähige Staaten gebildet und ihre jeweiligen Interessen in gegenseitiger Konkurrenz zur Geltung gebracht hätten, sei Deutschland zum Tummelplatz für die Heere ebenjener Mächte geworden und habe erst mit großer Verspätung einen eigenen Nationalstaat bilden können. Dass die Deutschen unter den Europäern zur «verspäteten Nation» wurden, wie die von dem Soziologen Helmuth Plessner geprägte Formel lautet,[2] hat dieser Erinnerung zufolge ihre Ursache im Dreißigjährigen Krieg, der seinerseits wiederum auf die konfessionelle Spaltung des Landes zurückzuführen sei.
Gemäß dieser Beschreibung ist Deutschland einen «Sonderweg» gegangen: Während sich bei den mächtigen Akteuren der europäischen Politik, bei Frankreich und England, Spanien und Schweden, eine verbindliche Konfession durchsetzte, blieb Deutschland konfessionell gespalten, und im Westfälischen Frieden wurde dies festgeschrieben. Die Spaltung, so die geschichtspolitische Meistererzählung weiter, habe sich im 18. Jahrhundert zum machtpolitischen Gegensatz zwischen dem protestantischen Preußen und dem katholischen Österreich, zwischen der Herrscherfamilie der Hohenzollern und dem Hause Habsburg zugespitzt, der bald zwei Jahrhunderte lang einer deutschen Nationalstaatsgründung entgegenstand. Folgt man dieser Sichtweise, so ist der im Dreißigjährigen Krieg ausgetragene Konflikt erst 1866 in der Schlacht bei Königgrätz (beziehungsweise Sadowa, wie man in Österreich sagt) zugunsten des protestantischen Nordens entschieden worden – geographisch nicht zufällig in Böhmen, also dort, wo der Dreißigjährige Krieg seinen Anfang genommen hat. Der Krieg habe Deutschland gegenüber seinen Nachbarn um zwei Jahrhunderte zurückgeworfen, und deswegen müssten die Deutschen in Jahrzehnten nachholen, wozu andere Jahrhunderte Zeit gehabt hätten. Die Trauma-Erzählung wurde damit zum Beschleunigungsimperativ der Politik.
Als Spätankömmling, so die politische Pointe der Erzählung, habe Deutschland sich seinen Platz unter den europäischen Großmächten nachträglich erobern müssen, und dabei sei es vor allem mit jenen Mächten in Konflikt geraten, die sich im Dreißigjährigen Krieg Einfluss auf die deutsche Politik verschafft und diesen Einfluss im Westfälischen Frieden auf Dauer gefestigt hätten. Die drei Einigungskriege, die Preußen zwischen 1864 und 1870 geführt hat, konnten demnach als Revision der Ergebnisse des Dreißigjährigen Krieges angesehen werden, und die den Deutschen angetane Gewalt wurde zur Rechtfertigung für die nunmehr von den Deutschen den anderen zugefügte Gewalt. Wer sich als Opfer begreift, hat oft keine Probleme damit, andere zum Opfer zu machen. Noch bei Beginn des Ersten Weltkriegs gehörte es zu den gängigen Begründungen für das militärisch offensive Vorgehen der Deutschen, man dürfe nicht zulassen, dass dem neuen Reich dasselbe Schicksal widerfahre wie dem alten Reich im Dreißigjährigen Krieg. Das im kollektiven Gedächtnis der Nation verankerte Trauma wurde zur Rechtfertigung eines aggressiven Auftretens und zum Imperativ, die Wiederholung eines solchen Krieges auf deutschem Territorium unter allen Umständen zu verhindern. Das Mittel, das die Geschichtserzählung nahelegte, war eine Außenpolitik, die vor einem Präventivkrieg nicht zurückschreckte. Dies wiederum, so die Anschlusserzählung von einem zweiten Trauma, habe dazu beigetragen, dass es in Europa im 20. Jahrhundert zu einem weiteren «Dreißigjährigen Krieg» gekommen sei, wie die beiden zu einem Geschehen zusammengefügten Weltkriege bezeichnet worden sind[3] – eine überaus bittere Pointe, wenn vom «Lernen aus der Geschichte» die Rede ist.
Lange Zeit stand neben dem traumagespeisten Imperativ aggressiver Machtpolitik die ebenfalls durch den Rückbezug auf den Dreißigjährigen Krieg gestützte Überzeugung, einen derart langen und gesellschaftlich verheerenden Krieg nicht noch einmal zulassen zu dürfen. Es war der greise Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke, der legendäre Sieger von Königgrätz und Sedan, der am 14. Mai 1890 in einer Reichstagsrede vor einem neuen großen Krieg in Europa warnte, einem Krieg, der nicht «in einem oder in zwei Feldzügen» erledigt sein werde; «es kann ein siebenjähriger, es kann ein dreißigjähriger Krieg werden, – und wehe dem, der Europa in Brand steckt, der zuerst die Lunte in das Pulverfaß schleudert!»[4]
Nahm man diese Warnung ernst, so lief sie darauf hinaus, die Entstehung von politischen Konstellationen zu verhindern, die denen vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges ähnelten. Das konnte zu einer klug angelegten Entspannungspolitik führen, ebenso aber zur Planung kurzer Kriege, die in schnellen Feldzügen entschieden werden sollten. In diesem Fall wirkte das Geschichtsnarrativ des Dreißigjährigen Krieges wie eine Aufforderung, Kriege nach der zügig gesuchten Entscheidungsschlacht umgehend wieder zu beenden. Das Problem der deutschen Politik vor 1914 war, dass sie zwischen beiden Optionen, der Kriegsverhinderung auf der einen und der schnellen Niederwerfung des Gegners auf der anderen Seite, hin und her schwankte. Die Trauma-Erzählung ließ keine eindeutige Entscheidung und Festlegung zu.
Als Helmuth von Moltke vor einem neuen Dreißigjährigen Krieg warnte, äußerte er sich nicht nur als professioneller Militär, sondern brachte auch die Vorstellungswelt des deutschen Bürgertums zum Ausdruck, die durch die Schilderungen des Dreißigjährigen Kriegs in Gustav Freytags weitverbreitetem Werk Bilder aus der deutschen Vergangenheit – erschienen in mehreren Bänden zwischen 1859 und 1867 – geprägt war. «Wie der Kampf», so resümiert Freytag die Situation nach Ende des Krieges, «waren auch die Zustände, welche nach dem Kriege eintraten, außer allem Vergleich mit anderen Niederlagen kultivierter Völker. Gewiß sind in einzelnen Zeiträumen der Völkerwanderung große Landschaften Europas noch mehr verödet worden, zuweilen hat im Mittelalter eine Pest die Bewohner großer Städte ebensosehr dezimiert; aber solches Unglück war entweder lokal oder wurde leicht durch den Überschuß von Menschenkraft geheilt, der aus der Umgegend auf dem geleerten Grund zusammenströmte, oder es fiel in eine Zeit, wo die Völker nicht fester auf dem Boden standen als lockere Sanddünen am Strand, welche leicht von einer Stelle zur andern geweht werden.»[5]
Freytag ging es darum, das Exzeptionelle dieses Krieges herauszustellen, seine Einmaligkeit und Unvergleichbarkeit vor allem im Hinblick auf das Unglück und Elend, das den Deutschen widerfahren sei: «Hier aber wird eine große Nation mit alter Kultur, mit vielen hundert festgemauerten Städten, vielen tausend Dorffluren, mit Acker- und Weideland, das durch mehr als dreißig Generationen desselben Stammes bebaut war, so verwüstet, daß überall leere Räume entstehen, in denen die wilde Natur, die so lange im Dienste des Menschen gebändigt war, wieder die alten Feinde des Menschen aus dem Boden erzeugt, wucherndes Gestrüpp und wilde Tiere. Wenn ein solches Unglück plötzlich über eine Nation hereinbräche, es würde ohne Zweifel auch eine kleine Zahl der Überlebenden unfähig machen ein Volk zu bilden, ja schon das Entsetzen würde sie vernichten; hier aber hat das allmähliche Eintreten der Verringerung den Überlebenden das Schreckliche zur Gewohnheit gemacht. Eine ganze Generation war aufgewachsen innerhalb der Zeit der Zerstörung. Die gesamte Jugend kannte keinen anderen Zustand als den der Gewalttat, der Flucht, der allmählichen Verkleinerung von Stadt und Dorf, des Wechsels der Konfession.»[6] Gustav Freytags Zeilen können als Kurzfassung der deutschen Trauma-Erzählung gelten.
Das von ihm prominent entfaltete Opfernarrativ hatte eine ambivalente Wirkung:[7] Auf der einen Seite fügte es sich in einen Zustand der Trauer, des melancholischen Erinnerns und der politischen Zurückhaltung; auf der anderen Seite verschaffte es denen, die als Opfer der Geschichte und der geopolitischen Konstellationen vorgestellt wurden, ein gutes Gewissen, wenn es darum ging, die eigenen Ansprüche durchzusetzen: Man war ja Opfer und hatte in der Vergangenheit gelitten, weswegen Gegenwart und Zukunft dafür entschädigen mussten. Je eindringlicher das Opfernarrativ, desto größer der Anspruch auf Ausgleich. Das lässt sich an der Haltung des deutschen Bürgertums beobachten, dem die meisten Leser Gustav Freytags entstammten und von dem er, ein politisch Liberaler, erwartete, dass es im neugeschaffenen Deutschen Reich eine führende Rolle spielen werde.[8] Es war vor allem das Bildungsbürgertum, das die Opfererzählung des Dreißigjährigen Krieges aufsaugte und daraus schlussfolgerte, man dürfe unter keinen Umständen noch einmal in diese Rolle hineingedrängt werden. Man verstand Machtpolitik darum nicht als ein Projekt, dessen Chancen und Risiken, Erträge und Kosten kühl kalkuliert werden mussten, sondern glaubte, ein Recht auf die Umkehrung der früheren Konstellationen zu haben. Sobald moralische Ansprüche ins Spiel kommen, erscheinen Risikokalkulationen und Kosten-Nutzen-Erwägungen als kleinliches Denken gegenüber dem, was als historische Gerechtigkeit verstanden wird. Hierin lag die politische Wirkung der Opfererzählung und der traumatischen Fixierung auf den Dreißigjährigen Krieg in der kollektiven Erinnerung der Deutschen.
Historische Zäsuren und antiquarisches Interesse
Aber ist die Darstellung der Kriegsfolgen bei Gustav Freytag überhaupt zutreffend? Oder hatte er maßlos übertrieben? Hatte sich das deutsche Bürgertum im 19. Jahrhundert womöglich in ein Trauma «hineinerzählen» lassen, für das es keine Grundlage gab? Diente der Dreißigjährige Krieg nur als Pauschalentschuldigung für alles, was in der deutschen Geschichte schiefgelaufen war, und als Generalerklärung für alle Unterschiede etwa zur Entwicklung Frankreichs, das man sich ebenso zum Vorbild nahm, wie man zu ihm auf eine ressentimentgeladene Distanz ging? Musste man den Deutschen vielleicht das Narrativ ihrer Selbsttraumatisierung nehmen, um ihnen die Chance zu eröffnen, einen normalen Platz in der europäischen Völkerfamilie zu finden?
Zwei ihrer Herkunft nach deutsche Autoren haben in englischsprachigen Arbeiten diesen Weg beschritten und die These verfochten, der Dreißigjährige Krieg habe keineswegs so tief in die deutsche Geschichte eingegriffen, wie dies von vielen Historikern behauptet worden sei. In seinem 1956 erschienenen Buch The Myth of the All-Destructive Fury of the Thirty Years War hat Robert Ergang die Zahl der Kriegstoten heruntergerechnet, indem er nur die in Schlachten und Gefechten zu Tode Gekommenen als solche gelten ließ und die Opfer von Hunger und Seuchen, beides unmittelbare Folgen des Krieges, kurzerhand herausnahm[1] – ein Verfahren, das der sonst üblichen Berechnung von Menschenverlusten entgegenstand und das gerade in diesem Krieg, in dem die Verwüstung des Landes eine bewusst eingesetzte Strategie war, in die Irre führen musste.[2] Der Dreißigjährige Krieg wird bei Ergang zur Sammelbezeichnung für einige Schlachten, die sich von denen der Kriege davor und danach eigentlich nicht unterscheiden.
Zu einer größeren Debatte führte dann das zehn Jahre darauf erschienene Buch The Thirty Years War and the Conflict for European Hegemony von Sigfried H. Steinberg, in dem dieser die Folgen des Krieges für Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland als vernachlässigbar darstellte und die These vertrat, die Bevölkerung in den Kriegsjahren sei insgesamt sogar leicht gewachsen.[3] «An die Stelle der Fabel von der allgemeinen Verwüstung und dem Massenelend», so Steinberg, «ist daher die weniger sensationelle Erkenntnis zu setzen, daß zwischen 1600 und 1650 in Deutschland eine Umschichtung der Bevölkerungen und des Besitzes stattfand, die einigen Gegenden, Ortschaften und Personen zum Vorteil und anderen zum Schaden gereichte. […] Im Jahre 1648 war Deutschland weder besser noch schlechter daran als im Jahre 1609: es war lediglich anders, als es ein halbes Jahrhundert zuvor gewesen war.»[4] Dass Hunderte Dörfer und Tausende Gehöfte verschwanden, wird von Steinberg dementsprechend eher auf das Wirken feudaler Großgrundbesitzer zurückgeführt denn als Folge des Dreißigjährigen Krieges begriffen.[5]
Wissenschaftlich sind Steinbergs Thesen längst widerlegt; hier geht es um ihre geschichtspolitische Funktion, den Deutschen das Narrativ von den verheerenden Wirkungen des Dreißigjährigen Krieges als rechtfertigende Erklärung für den Verlauf ihrer Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert zu entwinden: Während Ergang und Steinberg in der englischsprachigen Historiographie eher geringe Spuren hinterlassen haben,[6] fanden sie hierzulande über Hans-Ulrich Wehlers Deutsche Gesellschaftsgeschichte Eingang in die Forschung und das Bild der Kriegsfolgen. «Unstreitig», schreibt Wehler, «hat jedoch auch der Mythos des großen Brennens und Mordens die realhistorische Wirkung der Feldzüge und Epidemien übermäßig dramatisiert. Das muß zurechtgerückt werden.»[7] Wehler verweist auf den wirtschaftlichen Abschwung, der sich seit dem Ende der 1630er Jahre überall in Europa bemerkbar gemacht habe, «so daß es sich bei der ökonomischen Stockung keineswegs um eine deutsche Besonderheit handelte».[8] Die Folgen des Krieges als «ökonomische Stockung» zu bezeichnen, ist freilich mindestens ein Euphemismus, eine Beschönigung und Verharmlosung der Kriegsfolgen. Sofern diese Wertung nicht aus einer unkritischen Übernahme der Thesen Ergangs und Steinbergs resultiert,[9] ist sie nur aus dem geschichtspolitischen Motiv heraus zu verstehen, dem deutschen Selbstverständigungsdiskurs den Verweis auf den Dreißigjährigen Krieg als allgemeine Erklärung und Entschuldigung für den weiteren Verlauf der Geschichte zu entreißen. Diese Revision einer geschichtspolitischen Betrachtung des Krieges läuft darauf hinaus, ihn als historische Zäsur in Frage zu stellen und eher als einen Verstärker der großen Krisen zu begreifen, von denen die gesellschaftliche Entwicklung Europas in der frühen Neuzeit geprägt worden ist. Wichtiger als der Krieg waren demnach die sozioökonomischen Krisen, mit denen man sich stattdessen beschäftigen solle. Das ist in zugespitzter Form die Sicht der Gesellschaftsgeschichte, die in kritischer Absetzung von der herkömmlichen Politikgeschichte entworfen wurde.
Es hätte dieser Perspektivenkontroverse in der Geschichtswissenschaft indes nicht bedurft, um die Bedeutung des Dreißigjährigen Krieges für das Selbstverständnis der Deutschen zu relativieren: Die beiden Weltkriege haben den Dreißigjährigen Krieg geschichtspolitisch längst in den Hintergrund gedrängt. Er ist wohl nicht aus der historischen Erinnerung der Deutschen verschwunden, dient aber nicht mehr als Erklärungsmuster: Wenn gegenwärtige Entwicklungen in Deutschland oder besondere Mentalitäten der Deutschen erklärt werden sollen, dann findet sich so gut wie keine Bezugnahme mehr auf den Dreißigjährigen Krieg. Der zeitliche Abstand ist zu groß geworden, als dass sich noch plausible Kontinuitätslinien bis zur Gegenwart ziehen ließen. Das zeigt sich auch im historischen Wissen über einzelne Städte und Regionen: Die Erinnerung an Belagerungen und Durchzüge von «Kriegsvölkern» in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges sind zu einer Angelegenheit der Lokalhistoriker geworden, und das Wissen um verwüstete und aufgegebene Ortschaften ist nur noch in Gemarkungsnamen präsent. Dass der Zweite Weltkrieg im historischen Gedächtnis der Deutschen inzwischen die Stelle des Dreißigjährigen Krieges einnimmt, dürfte auch damit zu tun haben, dass er, ebenso wie der Dreißigjährige Krieg, nicht auf das Kampfgeschehen im engeren Sinn beschränkt blieb; als Vernichtungskrieg in Osteuropa und dann auch als Bombenkrieg richtete er sich vor allem gegen die Zivilbevölkerung und ließ einen völlig verwüsteten Raum zurück. Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs haben im Geschichtsbewusstsein der Deutschen, wie eingangs erwähnt, die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges überlagert und verdrängt.
Geschichtspolitisch hat der Zweite Weltkrieg jedoch eine ganz andere Funktion als der Dreißigjährige Krieg: Stand in dessen Zentrum die große Erzählung von den Deutschen als Opfer – Opfer ihrer konfessionellen Zerrissenheit, Opfer der geopolitischen Konstellationen, Opfer des Machtwillens der Nachbarstaaten –, so steht bei der Beschäftigung mit dem Zweiten Weltkrieg seit den 1980er Jahren die deutsche Täterrolle im Mittelpunkt. Lief das Geschichtsnarrativ des Dreißigjährigen Krieges immer auch auf eine Anklage der anderen hinaus – in der katholischen Historiographie erschien der Schwedenkönig Gustav Adolf als Aggressor und Eroberer, während in der protestantischen Historiographie der imperialen Politik Spaniens und des Kaisers eine vergleichbare Rolle zukam –, so wurde die Beschäftigung mit dem Zweiten Weltkrieg zur Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld und Verantwortung, von der Erpressungs- und Annexionspolitik Hitlers vor Kriegsbeginn bis zum millionenfachen Mord an den europäischen Juden. Aus dem Trauma der Opferrolle ist das Trauma der Schuld an furchtbaren Verbrechen geworden.[10] Die Vorstellung von der großen Zäsur in der deutschen Geschichte hat sich verschoben: Nicht mehr 1618 bis 1648, sondern 1933 bis 1945 war der tiefe Zivilisationsbruch.
Inzwischen freilich ist auch das tiefsitzende Bedürfnis zu beobachten, die erinnerungspolitisch komfortable Position des Opfers zurückzuerlangen. Seit einiger Zeit bemüht man sich etwa, den Zweiten Weltkrieg umzuerzählen oder einzelne Etappen herauszugreifen: Die Konzentration auf den Bombenkrieg zwischen 1943 und 1945, als Deutschland verstärkt zum Ziel alliierter Bomberflotten wurde, ist ein solches Verfahren der Umerzählung.[11] Damit ist die Grundkonstellation der Erzählung vom Dreißigjährigen Krieg wiederhergestellt – und schon begegnen wir auch wieder vergleichbaren Folgen. Die Warn- und Verbotsschilder, die vordem zu Vorsicht und Zurückhaltung im politischen Reden und Handeln aufgefordert haben, sind umgestellt worden oder verschwunden, und es macht sich, wo die Umerzählung vorherrscht, eine Stimmung des Trotzes und der Revision breit. Dazu gehört die Obsession, von den «Anderen» bedroht zu sein, die schnell in Aggression umschlagen kann: Man sei der Welt nichts schuldig und habe auf nichts und niemand Rücksicht zu nehmen. Das ist eine Mentalität, wie sie durch das Trauma- und Opfernarrativ des Dreißigjährigen Krieges befördert wurde, und insofern ist nachzuvollziehen, warum einige Historiker dieses Narrativ destruieren wollten. Sie wollten korrigieren, was sie als Folge einer bestimmten Geschichtspolitik ausgemacht hatten.
Die Kontroversen über die Folgen des Dreißigjährigen Krieges für die deutsche Geschichte gehören inzwischen der Vergangenheit an. Das Opfernarrativ lässt sich nicht nur wegen der zeitlichen Distanz und der beiden Weltkriege nicht mehr reaktivieren; es ist auch das Unverständnis für die konfessionellen Konflikte hinzugekommen. Dass man ein Land verheert und verwüstet, Menschen massenhaft tötet oder deren Lebensgrundlagen auf Jahre hinaus zerstört, weil man unterschiedliche Gottesvorstellungen hat und einen anderen Umgang mit dem Sakralen pflegt, ist für uns nicht mehr nachvollziehbar. Die große Distanz zum Dreißigjährigen Krieg als politisch-kulturellem Identitätsmarker der Deutschen resultiert nicht zuletzt daraus, dass wir gegenüber religiösen Kontroversen gleichgültig geworden sind. Wo man Derartiges beobachtet, wie in den Kriegen, Bürgerkriegen und terroristischen Attacken der islamischen Welt, reagiert man mit Abscheu und Unverständnis – um anschließend mit Erstaunen zur Kenntnis zu nehmen, dass es solche Kriege auch in unserer eigenen Geschichte gegeben hat. Geographischer Abstand im einen und historischer Abstand im anderen Fall sorgen jedoch dafür, dass diese Konflikte als etwas zutiefst Fremdes begriffen werden.[12]
Friedrich Nietzsche hat die überhandnehmende Vergangenheitsorientierung ohne Bezug zur Gegenwart und ohne Nutzen für das Begreifen ihrer Herausforderungen als «antiquarisch» bezeichnet. Ein antiquarisches Interesse an der Geschichte sei vorherrschend, «wenn die Historie dem vergangenen Leben so dient, daß sie das Weiterleben und gerade das höhere Leben untergräbt, wenn der historische Sinn das Leben nicht mehr konserviert, sondern mumisiert […]. Die antiquarische Historie entartet selbst in dem Augenblicke, in dem das frische Leben der Gegenwart sie nicht mehr beseelt und begeistert. Jetzt dorrt die Pietät ab, die gelehrtenhafte Gewöhnung besteht ohne sie fort und dreht sich egoistisch-selbstgefällig um ihren eigenen Mittelpunkt. Dann erblickt man […] das widrige Schauspiel einer blinden Sammelwut, eines rastlosen Zusammenscharrens alles einmal Dagewesenen. Der Mensch hüllt sich in Moderduft; es gelingt ihm, selbst eine bedeutendere Anlage, ein edleres Bedürfnis durch die antiquarische Manier zu unersättlicher Neugier, richtiger Alt- und Allbegier herabzustimmen; oftmals sinkt er so tief, daß er zuletzt mit jeder Kost zufrieden ist und mit Lust selbst den Staub bibliographischer Quisquilien frisst.»[13]
Wer die in den letzten zwei, drei Jahrzehnten entstandene Literatur zum Dreißigjährigen Krieg durchstöbert, stößt immer wieder auf ein solches antiquarisches Interesse; die Ereignisse von 1618 bis 1648 sind von den Historikern im buchstäblichen Sinn historisiert worden. Der Krieg gehört, liest man die einschlägigen Arbeiten, einer Vergangenheit an, die definitiv vergangen ist – im Unterschied zu den Vergangenheiten, von denen formelhaft gesagt wird, dass sie «nicht vergehen wollen». Kaum etwas ist so kennzeichnend für die Abgeschlossenheit eines Geschichtsabschnitts wie die Art seiner Darstellung: Wenn die Aufsätze zu Einzelaspekten des Geschehens überhandnehmen und so gut wie keine großen Gesamtdarstellungen mehr verfasst werden, dann zeigt das, dass der fragliche Geschichtsabschnitt tatsächlich nur noch von antiquarischem Interesse ist, Gegenstand eines Gesprächs von Fachgelehrten, die sich gegenseitig darauf hinweisen, welche speziellen Aspekte des Krieges und seiner Folgen trotz aller bisherigen Bemühungen noch genauer untersucht werden müssen, aber mit keinem Wort darauf eingehen, welchen Erkenntniswert die weitere Erforschung dieser Spezialaspekte für uns heute haben könnte.
Das ist kein Einwand gegen den Wert solcher Forschungen; außerdem ist die Eigenlogik der Wissenschaft selbstreferenziell, und die Frage nach dem Ertrag oder – mit Nietzsche – «Nutzen» der Forschung wird an eine wissenschaftliche Disziplin zumeist von außen herangetragen. Wo die Wissenschaft, zumal die Geistes- und Sozialwissenschaften, sich von vornherein unter den Imperativ gesellschaftlicher und politischer Nützlichkeit stellen soll, wird sie schnell zur bestellten Expertise, deren Wert und Bedeutung an die Interessen des Bestellers gebunden sind, was dem Selbstverständnis von Wissenschaft zuwiderläuft. Im Schatten der politischen und gesellschaftlichen Aufmerksamkeit lässt sich sehr viel ruhiger und gelassener forschen, als wenn jedes Ergebnis, und sei es noch so vorläufig und fragil, sogleich im Fokus des allgemeinen Interesses steht. Das alles ist wahr. Und doch ist es für die Beschäftigung mit einem historischen Thema wichtig, dass sie irgendwann auf ein Interesse stößt, das über die freundliche Aufmerksamkeit der Fachkollegen hinausgeht. Dafür muss es freilich Gründe geben, die in der Sache selbst liegen. Die hier vorgelegte Darstellung des Dreißigjährigen Krieges geht davon aus, dass es seit geraumer Zeit solche Gründe gibt.
Nietzsches Beschreibung des antiquarischen Interesses soll ihr als Warnschild dienen: Es gibt keine unmittelbaren Verbindungslinien zwischen uns und der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, und dass dieser sich auf einem Territorium abgespielt hat, das im Wesentlichen mit dem heutigen Deutschland identisch ist, berührt uns wenig – solange man nicht bei Grabungen auf Skelette von Getöteten einer großen Schlacht dieses Krieges stößt, wie vor geraumer Zeit nahe Wittstock an der Dosse. Wenn so etwas geschieht, lässt sich mit Hilfe moderner Untersuchungsmethoden ein genaueres Bild von der Ernährung und den Krankheiten der Bestatteten gewinnen.[14] Das Urteil über den Krieg selbst revidieren solche Funde und ihre Auswertung indes nicht: Sie sind ein Fall fürs Museum, und wenn sie entsprechende Aufmerksamkeit erregen, vergrößern sie die Zahl der Besucher oder werden unter Umständen gar zum Publikumsmagneten, der sich touristisch bewirtschaften lässt. Unser geneigtes Interesse wird befriedigt, unser Wissen vermehrt, aber unser politisches Selbstbild ändert sich dadurch nicht. Ganz anders ist das, sobald wir uns mit den jüngsten Kriegen an der europäischen Peripherie beziehungsweise der Peripherie der globalen Wohlstandszonen beschäftigen und mit Erstaunen feststellen, dass es strukturelle Ähnlichkeiten zwischen ihnen und dem Dreißigjährigen Krieg gibt. Ist dieser Krieg, den wir eben noch als ein überwundenes Trauma der Deutschen betrachtet haben, womöglich so etwas wie eine Blaupause für die Kriege des 21. Jahrhunderts? Das ist das nichtantiquarische Interesse, das im Hintergrund dieser Darstellung steht.[15]
Die Westfälische Ordnung, der Aufstieg des Staates und die Verstaatlichung des Krieges
Dass uns der Dreißigjährige Krieg inzwischen so fernliegt und fremd geworden ist, hat auch mit dem Westfälischen Frieden zu tun, der ihn beendete, vor allem aber mit der in Münster und Osnabrück ausgehandelten Ordnung, die von der amerikanischen Politikwissenschaft als «Westfälisches System» oder «Westfälische Ordnung» bezeichnet worden ist.[1] Wenngleich man diese Bezeichnungen des Friedensschlusses als Westfälische Ordnung wiederholt kritisiert hat,[2] bringen sie doch eine grundlegende Veränderung im Verhältnis der Mächte zum Ausdruck. Der Westfälische Frieden hat, auch wenn er mit dem Anspruch formuliert wurde, ein «immerwährender», ein «ewiger» Friede zu sein,[3] die Praxis des Kriegführens zur Durchsetzung politischer Ziele keineswegs beendet, und eigentlich war das auch nicht beabsichtigt. Er hat vielmehr den Krieg reguliert, ihn als das Recht eines jeden Souveräns festgeschrieben (ius ad bellum) und dadurch die Kriegführung einer Reihe von auf Symmetrie ausgelegten Regeln (ius in bello) unterworfen. Die Äquivalenz der Souveräne trat an die Stelle der Hierarchie, an deren Spitze der Kaiser als Garant der Friedensordnung stand. Die Anwendung von Gewalt, um einen politischen Willen durchzusetzen, war aus seiner Sicht, zumindest innerhalb des Reichs, Rebellion und Aufstand gewesen. Solange das so war, blieb die Beachtung des Kriegsrechts prekär. Es kommt nicht von ungefähr, dass nur wenige der am Dreißigjährigen Krieg beteiligten Mächte sich offiziell den Krieg erklärt hatten. In der Westfälischen Ordnung dagegen war (und ist nach wie vor) der souveräne Staat verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Regeln des Krieges beachtet und befolgt werden, und das beginnt mit dem Akt der Kriegserklärung. Die Westfälische Ordnung war so angelegt, dass die Durchsetzung der Regeln im Interesse der Staaten lag und es dafür keiner übergeordneten Instanz bedurfte.[4] Sie war und ist eine «Ordnung ohne Hüter».
Dem Grundsatz nach wurde die Entscheidung über Krieg und Frieden in der Westfälischen Ordnung gemäß den Interessen der Staaten und nicht unter Bezug auf Wertbindungen oder religiöse Verpflichtungen getroffen.[5] Das hat den Krieg nicht aus der Welt geschafft, ihn aber sehr viel stärker einem rationalen Kalkül unterstellt, was nicht bedeutet, dass sich ein solches Kalkül immer durchsetzen konnte oder Fehlkalkulationen vermieden worden wären. Kalkülrational geführte Kriege sind jedenfalls in der Regel schneller und leichter zu beenden als Kriege, in denen Identität und Werte, Ambitionen und Verpflichtungen, Machtgier und religiöse Solidarität ineinander verschränkt sind wie im Dreißigjährigen Krieg. Wo es in erster Linie um Macht und Interessen geht, sind Kompromisse sehr viel leichter zu finden, und jeder Beteiligte verfügt über einen prinzipiellen Maßstab, an dem sich ablesen lässt, ob die Fortführung des Krieges den eigenen Interessen noch entspricht oder nicht mehr; dazu müssen nur die wahrscheinlichen Kosten mit dem möglichen Nutzen ins Verhältnis gesetzt werden. Hätte man das im Dreißigjährigen Krieg getan – er hätte keine dreißig Jahre gedauert.
Die entscheidende Veränderung, die mit der Westfälischen Ordnung gegenüber der vorherigen Ordnung des Politischen eintrat, war die Separierung der Kriegstypen und die Entflechtung der Konfliktebenen. Die lange Dauer des Krieges resultierte nämlich auch daraus, dass in ihm unterschiedliche Kriegstypen und unterschiedliche Konfliktebenen ineinander verschränkt und miteinander verflochten waren. Alle den westfälischen Verhandlungen vorangegangenen Versuche, den Krieg zu beenden, sind an dieser Komplexität gescheitert. Sie vermochten sie nicht aufzulösen. Der Westfälische Frieden schuf die Grundlagen dafür, dass die Komplexität eines Krieges in die Ordnung des Friedens überführt werden konnte. Unter dem Eindruck der beiden Weltkriege ist das in Vergessenheit geraten. Die jüngsten Kriege im Nahen Osten, in der Maghrebregion und in der Sahelzone erinnern uns wieder daran.
Hierarchie und Gleichgewicht
Der amerikanische Politikwissenschaftler Kenneth Waltz hat die These vertreten, internationale Konstellationen seien entweder nach dem Prinzip der Hierarchie oder dem der Anarchie strukturiert.[1] Das ist angesichts der Fülle möglicher Ordnungsbildungen zu schematisch. So lässt sich als Variante dessen, was Waltz als Anarchie bezeichnet, durchaus ein sich selbst regulierendes Gleichgewicht vorstellen, ebenso eines, das keinen hegemonialen, sondern einen bloß balancierenden Ordnungshüter hat – eine Rolle, die Großbritannien im 18. und 19. Jahrhundert häufig zugeschrieben wurde.[2] Beides ist kaum angemessen als Anarchie zu beschreiben, ebenso wenig aber kann die Rolle des Hegemons in einem System sich prinzipiell als gleich anerkennender Staaten als Hierarchie bezeichnet werden. Eher kann man diese Konstellation als eine Zwischenform, als Hybridbildung von Hierarchie und Anarchie begreifen, wenn man denn auf das Oppositionspaar als heuristisches Hilfsmittel nicht verzichten will.[3] Für eine analytische Beschreibung des Dreißigjährigen Krieges ist das insofern relevant, weil dieser sich nicht zuletzt um die Frage des politischen Ordnungsideals gedreht hat: Sollte Europa künftig nach den Vorgaben einer Hierarchie geordnet sein oder nach denen eines Systems gleichberechtigter Akteure, deren Interessen durch einen Hegemon in gewisser Weise gelenkt würden?[4] Dabei spielten von vornherein die konkreten Interessen der großen Mächte eine Rolle, schließlich war zu entscheiden, wer am Ende davon profitieren würde, wenn eine hierarchische Ordnung durch eine des potenziellen Gleichgewichts abgelöst wurde. Insofern war dieser Krieg ein «Welt»-Ordnungskrieg, der als Hegemonialkrieg geführt wurde.
Der Kaiser im «Heiligen Römischen Reich deutscher Nation», wie die offizielle Bezeichnung lautete, war der erste Aspirant auf die Position an der Spitze der europäischen Hierarchie; um diese aber wirklich einnehmen zu können, mangelte es ihm seit dem 13. Jahrhundert an den erforderlichen Ressourcen. Das Reich war der Verfassung nach ein Wahlkaisertum, und sobald der Kaiser die Mittel des Reichs in Anspruch nehmen wollte, war er auf die Zustimmung der Reichsstände angewiesen, die ihm häufig versagt blieb oder nur unter stark einschränkenden Bedingungen bewilligt wurde. Möglicherweise wäre im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges Wallenstein der Mann gewesen, das zu ändern, doch gerade weil sie das befürchteten, zwangen die Kurfürsten den Kaiser im Jahre 1630 zur Entlassung seines Generalissimus.
Im Unterschied zum Wiener Zweig des Hauses Habsburg verfügte dessen Madrider Linie über wirkliche Macht, und spätestens Philipp II. herrschte über ein Reich, in dem, wie sein Vater Karl V. es einmal formuliert haben soll, «die Sonne nie unterging». Die Grundlage der spanischen Macht waren die Silbervorkommen der Neuen Welt und eine; – wesentlich aus diesem Silber finanzierte – Infanterie, die bis in den Dreißigjährigen Krieg hinein als das militärisch Beste galt, was es in Europa gab.[5] König Philipp III. sowie sein Sohn Philipp IV. und deren leitender Minister Olivares verfolgten vor und während des Krieges eine Politik, die im Bündnis mit der Wiener Linie der Casa d’Austria an einer imperialen Ordnung mit den Habsburgern an der Spitze ausgerichtet war.[6] Hätten sie sich durchgesetzt, so wäre dies wohl auf eine Erneuerung des hierarchischen Modells der politischen Ordnung in Europa hinausgelaufen. Aber die spanische Macht war nach demographischen und fiskalischen Krisen im Kernland verwundbar, und ihre legendäre Infanterie stieß im Unabhängigkeitskrieg der Niederlande an die Grenzen ihrer Möglichkeiten.[7] Die Niederländer hatten sich neue Formen militärischer Disziplin und taktischen Agierens angeeignet, die sich denen der Spanier nach einiger Zeit als ebenbürtig erwiesen.[8] Im Kriegsverlauf wurde die Kluft zwischen dem imperialen Anspruch und der schwindenden Macht Spaniens immer deutlicher. Die politische Ordnung in Europa wechselte auch deshalb, weil es niemanden mehr gab, der die erforderlichen Ressourcen für die Rolle des Hierarchen hatte. Der Krieg war gewissermaßen ein sich hinziehender Test auf kontinuierliche Ressourcenverfügbarkeit.
Ein weiterer Aspirant auf den Platz an der Spitze der europäischen Hierarchie war die Römische Kurie, deren Einfluss in großen Teilen Europas mit Ausbreitung der Reformation jedoch deutlich abgenommen hatte. Zwar war die Papstkirche mit dem Konzil von Trient und dem Beginn der Gegenreformation beziehungsweise der katholischen Reform[9] wieder in die Offensive gekommen; es stand aber außer Zweifel, dass der Protestantismus nur in einem großen Krieg umfassend zurückgedrängt werden konnte. Unter diesen Umständen wäre eigentlich zu erwarten gewesen, dass der Papst eifrig den Kaiser und Spanien unterstützte, denn diese hatten sich den Kampf für den katholischen Glauben auf die Fahnen geschrieben. Seit Errichtung des Kirchenstaates war der Papst jedoch auch ein italienischer Regionalfürst, und als solcher stimmte seine Machträson mit den Imperativen der Universalkirche nicht überein. Die spanische Macht in Italien schränkte die Handlungsfähigkeit der dortigen Fürsten ein, weshalb Urban VIII. ein starkes Interesse daran hatte, Spanien zu schwächen und ein Gleichgewicht mit Frankreich herzustellen. Es kam also nicht zu einem Dreibund zwischen Kurie, Kaiser und Spanien, stattdessen unterstützte Urban VIII. die antihabsburgische Politik Kardinal Richelieus.[10] Die konfessionellen Fronten des Dreißigjährigen Kriegs waren keineswegs so eindeutig, wie die Bezeichnung als Konfessionskrieg es nahelegt; immer wieder kam es zu Koalitionsbildungen über die Glaubensbekenntnisse hinweg. Schon das macht es schwer, den Konflikt wesentlich als Religionskrieg zu sehen.[11] Er war das zweifellos, aber zugleich war er noch viel mehr.
Die französische Politik war in ihrer Opposition zur imperialen Stellung des Hauses Habsburg keineswegs von Anfang an darauf ausgerichtet, ein System gleichberechtigter Staaten mit Frankreich als Schiedsrichter zu schaffen. Der sogenannte Große Plan Heinrichs IV., den der Herzog von Sully ausgearbeitet hat, drehte sich ebenfalls um die Oberhoheit über Europa – in diesem Fall freilich die Frankreichs. In dem von Ludwig XIII. und Ludwig XIV. zeitweilig verfolgten Projekt, sich zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs wählen zu lassen, ist ein Nachklang dessen zu finden. Während des Dreißigjährigen Krieges stellte Richelieu derart weitgesteckte Ziele in den Hintergrund und beschränkte sich darauf, eine habsburgische Universalmonarchie, wie die zeitgenössische Bezeichnung für ein gesamteuropäisches Imperium lautete, zu verhindern.[12] Das hatte auch damit zu tun, dass Frankreich im konfessionellen Bürgerkrieg eine relative Schwächung erfuhr und der hugenottische Widerstand periodisch wieder auflebte.[13] Selbst der schwedische König Gustav II. Adolf scheint nach seinem Sieg bei Breitenfeld im Jahr 1631 mit der Vorstellung geliebäugelt zu haben, sich zum deutschen Kaiser wählen zu lassen, womit das Übergewicht der Katholiken im Reich durch das der Evangelischen abgelöst worden wäre. Inwieweit damit die schwedische Ostseehegemonie hätte flankiert werden sollen oder ob sich die Herrschaft Gustav Adolfs von Schweden nach Deutschland, von Stockholm nach Frankfurt oder Nürnberg verlagert hätte, mag hier dahingestellt bleiben.[14] Bedeutsam für die Beschreibung des Krieges als Hybrid zwischen Imperial- und Hegemonialkrieg ist, dass selbst der «Löwe aus dem Norden», der in seinen offiziellen Proklamationen das schwedische Eingreifen mit der Verteidigung des evangelischen Glaubens begründete, sich den imperialen Suggestionen nicht entziehen konnte, nachdem er zu einem maßgeblichen Kriegsakteur geworden war.[15] Sobald eine Großmacht militärisch die Oberhand bekam, stand sie vor der Frage, ob sie das in einer imperialen oder hegemonialen Ordnung politisch festschreiben wollte.
Der ständige Wechsel des Kriegsglücks führte jedoch dazu, dass die imperialen Projekte schnell zurückgestutzt wurden. Das Ergebnis des Krieges war die Aufteilung Europas in Hegemonialsphären, die zur Grundlage der europäischen Pentarchie wurden, der Ordnung der fünf großen Mächte. Sie bestand im 17. Jahrhundert aus Spanien, Frankreich, England, dem Kaiserhaus in Wien und Schweden. Mit dem Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert schieden Spanien sowie Schweden aus und wurden schrittweise durch Preußen und Russland ersetzt. Die Aufteilung der Hegemonialzonen, von denen die normative Ordnung der souveränen Staaten machtpolitisch überlagert wurde, ist im Verlauf des Dreißigjährigen Kriegs ausgefochten worden. Diese Zonen waren so etwas wie ein realpolitischer Kompromiss zwischen den imperialen Ambitionen der Großmächte und dem System souveräner Staaten, als das die Westfälische Ordnung in den Völkerrechtstexten beschrieben wird. Die Bildung eines solchen souveränen Staates fand in Deutschland jedoch nicht statt; das Heilige Römische Reich deutscher Nation blieb als Überrest der imperialen Ordnung bestehen.
Die geopolitische Mitte des europäischen Raumes, also Deutschland, wurde auch deshalb zum Kriegsschauplatz der alten imperialen Mächte und der neuen Hegemonialaspiranten, weil am Reichsgedanken die Legitimität der alten Ordnung hing.[16] Nach dem Westfälischen Frieden geriet das Reich in die ökonomischen und politischen Einflusssphären der europäischen Pentarchie, die Zugriff auf die Verhältnisse in seinem Innern hatte: Schweden, insofern es mit dem Friedensvertrag zum Reichsstand wurde; Frankreich, dem das zuvor habsburgische Elsass zufiel, indem es eine bis zum Rhein und mitunter darüber hinaus reichende Einflusszone in Südwestdeutschland errichtete; die Habsburger in Wien durch ihre Stellung als Kaiser des Reichs; schließlich England, das den Handel in der Nordsee schrittweise unter seine Kontrolle brachte und dadurch die norddeutsche Wirtschaft kontrollierte. Allein Spanien hatte durch die in Münster festgeschriebene Trennung der Wiener von der Madrider Linie der Habsburger seinen Einfluss auf das Reich verloren, und nach einiger Zeit schied es ganz aus der europäischen Pentarchie aus und zog sich auf die außereuropäischen Territorien zurück.
Die der Westfälischen Ordnung zugrundeliegenden Normen gleichberechtigter souveräner Staaten entsprachen also ebenso wenig der machtpolitischen Realität Europas, wie das zuvor die hierarchische Ordnungsvorstellung des Mittelalters getan hatte. Insofern ist es ratsam, die Normstruktur des Völkerrechts nicht mit den realen Machtkonstellationen zu verwechseln. Dennoch wirkten die neuen Normen auf die tatsächlichen Machtverhältnisse ein und veränderten sie dahingehend, dass die Vorstellung von einer christlichen Einheit mit hierarchischer Spitze zunehmend obsolet wurde. Die großen Kriege wurden nunmehr um die Reichweite der Hegemonialzonen geführt. Bis ins 20. Jahrhundert hinein ging es in Europa nicht mehr um prinzipiell andere Ordnungsmodelle.
Die Vielfalt der Kriegstypen
Mit der Charakterisierung des Krieges als Ständeaufstand, Staatenkrieg, Konfessionskrieg sowie Imperial- und Hegemonialkrieg ist die Fülle der zwischen 1618 und 1648 ineinander verschränkten Kriegstypen noch immer nicht erschöpft. Der Dreißigjährige Krieg enthielt obendrein Elemente eines genuinen Bürgerkriegs, insofern es in seinem Verlauf zu Bauernaufständen kam, die vom Militär niedergeschlagen wurden.[1] Es gab diese Bauernaufstände in vielen Gebieten des Reichs, auch wenn sie nirgendwo die Ausdehnung und Intensität des oberösterreichischen Aufstandes annahmen. Andernorts mündeten sie in einen Kleinkrieg gegen einzelne Soldatentrupps, die von den Bauern überfallen und niedergemacht wurden. Das waren Racheakte für die Gewalt, die marodierende Söldner wie reguläre Einheiten den Bauern auf der Suche nach Geld und Gut angetan hatten.[2] Dabei entstammten die meisten Söldner selbst der Bauernschaft und waren Soldaten geworden, um der Drangsalierung durch das Militär zu entgehen. Das berühmteste Beispiel für einen solchen Wechsel ist Grimmelshausens mit autobiographischen Zügen ausgestattete Romanfigur Simplicius Simplicissimus: Simplicissimus wird nach einem Überfall schwedischer Soldaten auf den elterlichen Bauernhof nach einiger Zeit selbst Soldat und verübt Überfälle auf Bauern und Reisende, bis er sich schließlich wieder in einen Bauern zurückverwandelt.[3] So entwickelte sich neben den anderen Kriegstypen ein «Krieg im Kriege», der durchaus Züge eines Bürgerkrieges trug.
Dieser «kleine Krieg» wurde im Verlauf der 1620er Jahre zum ständigen Begleiter des «großen Krieges». Es gehört zu den folgenreichen Leistungen der Westfälischen Ordnung, den «großen Krieg» reguliert und den «kleinen Krieg» auf die bewaffnete Macht des Gegners gerichtet zu haben.[4] Für mehrere Jahrhunderte wurde der kleine Krieg zu einer auf die Logistik der gegnerischen Armeen zielenden Strategie. Erst im antinapoleonischen Partisanenkrieg der Spanier ist er als «Volkskrieg» in die europäische Kriegführung zurückgekehrt, und prompt stellten sich erneut die Grausamkeiten gegen die ländliche Bevölkerung ein, wie sie für den Dreißigjährigen Krieg typisch waren. Francisco de Goya hat in seinen an die Arbeiten Hans Ulrich Francks erinnernden Desastres de la Guerra diese Grausamkeiten festgehalten. Davor und auch wieder danach gelang es im Rahmen der Westfälischen Ordnung, die völkerrechtliche Trennung von Kombattanten und Nonkombattanten bis in die Kleinkriegführung durchzusetzen. Sieht man von Entwicklungen an der europäischen Peripherie ab, in Spanien, auf dem Balkan und im Kaukasus, so hatte sie bis ins 20. Jahrhundert Bestand.[5]
Um dieser Trennung zwischen Kombattanten und Nonkombattanten als Kernbestand regulierter Kriegführung Geltung zu verschaffen, bedurfte es nach dem Dreißigjährigen Krieg einer grundlegenden Veränderung des Militärwesens. Diese lässt sich unter der Überschrift «Verstaatlichung» zusammenfassen: An die Stelle der Söldnerverbände, die von Kriegsunternehmern aufgestellt worden waren, traten nun Armeen, die «des Königs Rock» trugen, also aus staatlichen Magazinen uniformiert und bewaffnet und aus Staatsmitteln versorgt und besoldet wurden. Vorläufer und erste Ansätze lassen sich bereits während des Dreißigjährigen Krieges beobachten;[6] die Geschichte des Krieges ist ein ständiges Hin und Her zwischen Verstaatlichung und Entstaatlichung. In der Westfälischen Ordnung mussten die Truppen im Kriegsfall nicht erst angeworben werden, sondern standen in den Garnisons- und Festungsstädten zum Einsatz bereit. Sie mussten lediglich, wie es zeitgenössisch hieß, vom «Friedens- auf den Kriegsfuß» versetzt werden, was bedeutet, dass die für landwirtschaftliche Arbeiten abgestellten Soldaten zu ihren Einheiten zurückbeordert wurden. Die Unterhaltskosten des stehenden Heeres waren im Frieden niedriger als im Krieg, doch war der Unterschied nicht mehr so groß wie zuvor, als Frieden hieß, dass sämtliche Truppen abgedankt wurden.[7] Obendrein wurden jetzt systematisch und von langer Hand Magazine zur Versorgung des Militärs errichtet, und es wurde ein Staatsschatz gebildet, durch den die Kosten eines Krieges für einige Zeit gedeckt waren. So wurde zum Ausnahmefall, was im Dreißigjährigen Krieg noch die Regel war: dass die angeworbenen Verbände keinen regelmäßigen Sold erhielten und, da sie nicht anderweitig versorgt wurden, raubten und plünderten. Dass der Dreißigjährige Krieg zum Trauma der Deutschen wurde, lag mehr am «kleinen» als am «großen Krieg».
Die Vermischung der unterschiedlichen Kriegstypen war es, die es so ungemein schwierig gemacht hat, den Krieg zu beenden. Wäre es nur darum gegangen, mit Waffengewalt die Frage zu klären, ob ein bestimmter Landstreifen oder eine Region zu diesem oder jenem Herrscher gehörten, so hätte sich das in einer Entscheidungsschlacht der beiden Konkurrenten schnell klären lassen. Da aber im Dreißigjährigen Krieg die Probleme der unterschiedlichen Kriegstypen noch hinzukamen, war keine Schlacht ausreichend, um von den kriegführenden Parteien als Entscheidung anerkannt zu werden. Es waren zu viele Fragen, die gleichzeitig beantwortet werden mussten. Erst in der Westfälischen Ordnung wurde der Krieg als praktikable Entscheidungsinstanz politischer Konflikte wiederhergestellt.
Ressourcenverbrauch, Kriegsfinanzierung und Heeresversorgung
Jeder Krieg ist eine Form erhöhten und letztlich unproduktiven Ressourcenverbrauchs. Aber die Kriege unterscheiden sich durch das Maß, in dem ihr Ressourcenverbrauch den in Friedenszeiten übertrifft. Ebenso unterscheiden sie sich durch die Folgen, die sich bei ihrem Ende aus dem zeitweilig erhöhten Ressourcenverbrauch ergeben. Die oben diskutierten Thesen Ergangs, Steinbergs und Wehlers, denen zufolge die Verwüstungen und Menschenverluste im Dreißigjährigen Krieg lange Zeit überschätzt worden seien, beruhen auf der Annahme, dass für den erhöhten Ressourcenverbrauch im Krieg ausschließlich die Waffentechnik verantwortlich sei. Insbesondere Steinberg hat seine Thesen daher mit dem Verweis auf die sehr viel größere Zerstörungskraft der Waffen begründet, die in den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts eingesetzt wurden.[1] Dabei wird der Einfluss der Militärorganisation auf den Ressourcenverbrauch übersehen, und dieser Einfluss dürfte mindestens ebenso groß gewesen sein wie die der Waffentechnik geschuldeten Effekte.
Die Beschäftigung mit dem Niveau des Ressourcenverbrauchs im Krieg ermöglicht einen neuen Blick auf die traumatischen Folgen des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland. Die Westfälische Ordnung hat Krieg unter anderem dadurch wieder führbar gemacht, dass sie die ineinander verschränkten Kriegstypen voneinander getrennt und den Krieg einer an den Staatsinteressen ausgerichteten Kalkülrationalität unterworfen hat. Zugleich hat sie den Ressourcenverbrauch im Krieg so weit gesenkt, dass dieser wieder als ein Mittel der Politik, «ein wahres politisches Instrument», wie es bei Clausewitz heißt, gelten konnte.[2] Allgemein formuliert bedeutet das: Das Militär wurde so reorganisiert, dass der Ressourcenverbrauch in Friedenszeiten erhöht und die Ressourcenvernichtung in Kriegszeiten begrenzt wurde. Die Folge war, dass die Differenz zwischen Krieg und Frieden nicht mehr als so dramatisch erfahren wurde, wie das im Dreißigjährigen Krieg der Fall war.
Diese eher abstrakte Überlegung zum Verhältnis von Militärwesen und Kriegführung lässt sich an einigen Beobachtungen zur Heeresversorgung im Dreißigjährigen Krieg konkretisieren. Dabei sind vier Versorgungstypen zu unterscheiden. Da ist zunächst das System der Kontributionen, das Wallenstein während seines ersten Generalats von 1625 bis 1630 perfektionierte.[3] Dieses System beruhte darauf, dass die Truppen über einen größeren Landstrich verteilt und «einquartiert» wurden, was heißt, dass diese Gebiete nicht nur Unterkünfte und Lebensmittel für die Soldaten bereitstellen, sondern auch noch für ihre Besoldung aufkommen mussten. Zumeist erfolgten solche Einquartierungen in «Feindesland». Sie waren der Preis, den eine Bevölkerung zu zahlen hatte, wenn ihr Landesherr Krieg führte, aber sein Territorium nicht vor gegnerischen Truppen schützen konnte. Einquartierung bedeutete, dass das Mehrprodukt des Landes, sein Überschuss an Gütern, von den Besatzungstruppen verzehrt wurde. Das traf zunächst den Landesherrn, denn eigentlich war er es ja, der sich dieses Mehrprodukt in Form von Abgaben aneignete, um seine Hofhaltung, seine Repräsentationsprojekte, sein Heer und anderes mehr damit zu finanzieren. Einquartierungen verwehrten einem Landesherrn also den Zugriff auf das Mehrprodukt seines Landes. Solange es dabei blieb, waren die Folgen begrenzt. Sobald aber die für die einquartierten Truppen aufzubringenden Leistungen höher waren als das, was der Landesherr in Friedenszeiten abschöpfte, hatte die gesamte Bevölkerung schwer zu leiden. Das Besondere an der von Wallenstein praktizierten Methode der Einquartierung bestand darin, dass er sie nicht auf gegnerisches Gebiet beschränkte, sondern auch auf eigene Territorien ausdehnte, was im Ergebnis auf die Eintreibung einer Steuer zur Finanzierung der Armee hinauslief. Wallenstein scheint eine sehr genaue Vorstellung davon gehabt zu haben, dass ein stehendes Heer einen effektiven Steuerstaat zur Voraussetzung hatte.[4]
Im Prinzip war dieses System eine Land und Leute belastende, aber relativ erträgliche Form der Kriegsfinanzierung. Da Nachhaltigkeit belohnt wurde und die Soldaten selbst davon profitierten, wenn sie Menschen, Vieh und Gebäude schonend behandelten, kam es in der Regel nicht zu sinnlosen Zerstörungen. Außerdem ließ sich die Disziplin des für längere Zeit einquartierten Militärs leidlich aufrechterhalten. Das war anders beim zweiten Versorgungstyp, der dadurch gekennzeichnet war, dass die Truppen in Bewegung waren und das Interesse der Soldaten am schonenden Umgang mit Land und Leuten schwand. Man hat das Heer auf dem Marsch als «wandernde Stadt» bezeichnet,[5] weil eigentlich alles mitgeführt wurde, was zum täglichen Leben erforderlich war. Wenn aber die mitgeführten Vorräte zur Neige gingen und es für die Soldaten zu einer Frage des Überlebens wurde, wo und wie sie an Nahrungsmittel kamen, verwandelte sich das Heer in eine große Zerstörungsmaschine. Mochten die Ersten, die ein Dorf plünderten, noch allerhand Brauchbares zurücklassen, so fand doch jede Gruppe, die danach kam, immer weniger vor, und wenn auch mit Gewalt und Folter bei den Bauern nichts mehr zu holen war, nahm die Wut überhand. Die Bauern, ihre Frauen, Kinder und Knechte wurden erschlagen, ihre Höfe in Brand gesetzt. Dass die Soldaten damit sich selbst schadeten, wenn sie einige Wochen später erneut durch die verwüstete Gegend marschierten, spielte dabei keine Rolle.
Was bei der Armee auf dem Marsch immer wieder vorkam, war bei Söldnerverbänden wie denen Ernst von Mansfelds die Regel; sie stehen für den dritten Versorgungstyp. Da diese Söldner ständig den Auftraggeber wechselten, gab es für sie keinen wirklichen Unterschied zwischen Feindes- und Freundesland. Längere Einquartierungen kamen nicht vor, da sie nur für den Einsatz und nicht für die Präsenz in einem bestimmten Raum besoldet wurden. Es gab für die Söldner also keinen Grund, die Bevölkerung zu schonen. Ihre Art der Kriegführung folgte den Grundsätzen der Verwüstungsstrategie, selbst wenn dabei keine strategische Devise zugrunde lag.[6] Während der ersten Phase des Krieges gehörten die Mansfeld’schen Reiter zu den am meisten gefürchteten Söldnern. Wo sie auftauchten, verbreiteten sie Angst und Schrecken. Sie hinterließen eine Spur der Verwüstung, und dies hatte nicht einmal den Zweck, dem Gegner einen politischen Willen aufzuzwingen, sondern war schlichtweg das typische Verhalten dieser Söldner. Es gab aber auch Heerführer, von denen die Verwüstung eines Landes in strategischer Absicht eingesetzt wurde, beispielsweise Gustav Adolf, der das bis dahin vom Krieg noch kaum berührte Bayern systematisch verwüsten ließ[7] – sei es aus Rache für die vorherige Plünderung der protestantischen Gebiete, sei es, weil der Schwedenkönig damit Kurfürst Maximilian in die Knie zwingen wollte. War Maximilian erst einmal ausgeschaltet, glaubte Gustav Adolf mit dem Kaiser leichtes Spiel zu haben – was sich als Fehlrechnung erweisen sollte.
Die schlimmsten Folgen hatte aber die Bildung von Marodeurshaufen, die plündernd und sengend durchs Land zogen. Das war der vierte Versorgungstyp. Die Marodeure glichen mehr großen Räuberbanden als einem Truppenverband. Grimmelshausen berichtet in dem Kapitel «Von dem Orden der Merode-Brüder» seines Simplicissimus: «Wenn ein Reiter sein Pferd oder ein Musketier seine Gesundheit verliert oder wenn ihm seine Frau oder sein Kind krank wird und zurückbleiben will, so hat man schon anderthalb Merode-Brüder – ein Völkchen, das sich am ehesten mit den Zigeunern vergleichen lässt, weil es nach eigenem Belieben vor oder hinter oder neben der Armee oder mittendrin herumstreicht, und das diesen auch in Sitten und Gebräuchen ähnelt.»[8] Grimmelshausen wollte die Marodeure gegen die Soldaten absetzen, aber er wusste durchaus, dass auch sie ein Produkt des Krieges waren: «Denn sie gleichen den Drohnen in den Bienenkörben, die, wenn sie ihren Stachel verloren haben, nicht mehr arbeiten und keinen Honig mehr machen, sondern nur noch fressen können.»[9] Diese als «Marode-Brüder» oder «Schnapp-Hahnen» bezeichneten Banden trugen die Verheerungen des Krieges in alle Gebiete Deutschlands und beschränkten sich im Unterschied zu den Streifscharen, die den Durchzug eines Heeres begleiteten, nicht auf einen spezifischen Kriegsschauplatz.
Das hatte Folgen für den Grad der Verwüstungen, die der Krieg hinterließ: Wo die Schröpfung der Landbevölkerung auf das Gebiet begrenzt blieb, in dem für einen Sommer und Herbst «das Kriegstheater aufgeschlagen» worden war, bot sich die Möglichkeit zur Erholung der bäuerlichen Wirtschaft im darauffolgenden Jahr – wenn denn der Krieg nicht erneut in diesem Gebiet stattfand. Die Bauern hatten nämlich die Gewohnheit, ihr Vieh in die Wälder zu treiben und auch Frauen und Kinder dort zu verstecken, sobald sich die Nachricht von heranziehenden Soldatentrupps verbreitete. Das im Wald verborgene Vieh war nach Abzug der Soldaten die Grundlage für die Wiederaufnahme der bäuerlichen Wirtschaft.
Mit den Marodeursbanden entwickelte sich der bereits erwähnte Kleinkrieg zwischen Soldateska und Landbevölkerung. Nachdem die großen Schlachten in der Mitte des Krieges keine Entscheidung gebracht hatten und das Kriegsgeschehen mehr und mehr zerfaserte, griff das Marodeurswesen um sich. Die intensive Kriegsgewalt, wie sie bei Belagerungen und Feldschlachten anzutreffen war, verschwand zwar nicht völlig aus dem Kriegsgeschehen, aber sie wurde durch eine diffuse Gewalt überlagert, die dem Krieg seine desaströse Wirkung verlieh. Wer nur die von der Waffentechnik abhängige Intensität der Kriegsgewalt im Auge hat, wie Ergang, Steinberg und Wehler, um auf dieser Grundlage die mittel- und langfristigen Folgen des Krieges abzuschätzen, hat das für den Dreißigjährigen Krieg Typische übersehen: die lange Dauer der diffusen Gewalt. Viel stärker als die großen Schlachten, die keine Entscheidung im Ringen um Macht und Einfluss gebracht haben, hat sie den Krieg in das kollektive Gedächtnis der Deutschen eingeschrieben.
Das ist im Übrigen einer der Aspekte, die den Dreißigjährigen Krieg im Europa des 17. Jahrhunderts mit einigen Kriegen unserer Gegenwart an der Peripherie Europas verbinden. Diese Kriege werden nicht nach den Vorgaben der von Clausewitz so bezeichneten «Niederwerfungsstrategie»[10] geführt und kulminieren demzufolge auch nicht in großen Entscheidungsschlachten, die auf den Abschluss eines Friedensvertrags hoffen lassen. Eher folgten sie einer «Ermattungsstrategie», selbst wenn sie vermutlich nicht so geplant worden sind.[11] Diese Ermattungsstrategie ist häufig mit einer Verwüstungsstrategie gepaart. Die Ermattung der Kriegsparteien ist das, worauf der Krieg hinausläuft, wenn keine Seite die Fähigkeit besitzt, den Gegner niederzuwerfen und ihm den eigenen Willen aufzuzwingen. Wenn die Kriegsparteien es in einer solchen Situation nicht schaffen, den Krieg zu beenden, dauert er an, bis alle Beteiligten so entkräftet sind, dass der Krieg aus purer Erschöpfung, gleichsam «von selbst», zu Ende geht. In mancher Hinsicht war das auch 1648 der Fall.
Der Dreißigjährige Krieg und wir
Der Dreißigjährige Krieg war das große Trauma der Deutschen, aber er ist es nicht mehr. Das mag auch der Grund dafür sein, dass in den letzten Jahrzehnten keine umfassende Darstellung dieses Krieges mehr geschrieben worden ist. Zugespitzt kann man sagen, dass die letzte große Darstellung die von Cicely Veronica Wedgwood ist, und sie stammt aus dem Jahre 1938. Was zumal nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland veröffentlicht wurde, waren entweder Analysen des Krieges, die voraussetzten, dass man mit seinem Verlauf gut vertraut war, oder aber Einzelstudien zu speziellen Fragen und Aspekten. Der Dreißigjährige Krieg ist zu einem Thema im Normalbetrieb der Wissenschaft geworden. Das kann als ein zuverlässiger Indikator für die Enttraumatisierung eines Themas beziehungsweise Abschnitts der Geschichte angesehen werden. Andererseits zeigt das Fehlen von Gesamtdarstellungen oder auch das Ausweichen auf Biographien prägender Gestalten wie Wallenstein oder Gustav Adolf, dass eine ausgeprägte Zurückhaltung besteht, sich auf dieses Terrain zu begeben. Symptomatisch dafür könnte sein, dass der Verfasser dieses Buches von seiner akademischen Profession her Politikwissenschaftler ist – und eben nicht Historiker.
Es gibt zwei Gründe, warum der Dreißigjährige Krieg gerade aus politikwissenschaftlicher Perspektive ein wichtiger und für gegenwärtige Fragen hochgradig aufschlussreicher Abschnitt der deutschen und europäischen Geschichte ist, und zumindest einer dieser Gründe hat nichts mit der vordem so dominanten Traumabearbeitung zu tun: Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit der Dreißigjährige Krieg als Paradigma und Analysefolie für einige Kriege der Gegenwart und vor allem die der Zukunft dienen kann. Diese Frage geht aus von der These, dass die Ära der klassischen Staatenkriege, der «Westfälischen Kriege», definitiv zu Ende gegangen ist, dass damit entgegen einer zumal in Deutschland verbreiteten Vorstellung der Krieg jedoch nicht verschwunden, sondern in veränderter Gestalt wiederaufgetaucht ist. Aber welche Gestalt ist das, und wie lassen sich diese Kriege analytisch fassen, um der Politik Handreichungen für deren Vermeidung oder Beendigung zu geben? Die Vermutung, die neuen Kriege besäßen strukturelle Ähnlichkeiten mit dem Dreißigjährigen Krieg, also dem großen Krieg vor Installierung der Westfälischen Ordnung, ist in jüngster Zeit immer wieder geäußert worden, aber um darauf eine Antwort geben zu können, muss dieser Krieg zunächst einmal sorgfältig beschrieben werden: im Hinblick auf die Motivlagen der beteiligten Mächte, auf seine strukturellen Faktoren, seinen Verlauf, den Kriegseintritt immer neuer Mächte, die den Krieg nicht «ausbrennen» ließen, und schließlich die Faktoren seiner Beendigung. Das ist eine komplexe Aufgabe, die nur in einer umfangreichen Darstellung zu bewältigen ist. Diese Darstellung, in der erzählende und analytische Teile einander abwechseln, ist die Grundlage für das Schlusskapitel des Buches, das die Frage behandelt, ob und inwiefern wir aus der Beschäftigung mit dem Dreißigjährigen Krieg lernen können, um die politischen Herausforderungen unserer Gegenwart besser zu bewältigen.
Der zweite Grund, weshalb der Dreißigjährige Krieg gerade aus politiktheoretischer Perspektive interessant ist, besteht in dem gravierenden Defizit an strategischem Denken in der politisch interessierten deutschen Öffentlichkeit. Stark vereinfacht kann man vielleicht sagen, dass die vorherrschende Reaktion auf politikstrategische Herausforderungen hierzulande der Verweis auf juridische Regelungen ist, zumeist solche des Völkerrechts, wobei generell unterstellt wird, dass die Rahmenbedingungen nicht nur für die Geltung, sondern auch für das Geltendmachen des Rechts selbstverständlich gegeben seien und die Rechtsdurchsetzung mit der Bewältigung der Herausforderung identisch sei. Die Auseinandersetzung mit dem Dreißigjährigen Krieg ist eine vorzügliche Übung zur Desillusionierung solcher Erwartungen. In der Anfangsphase des Krieges nämlich sind alle Parteien in der festen Überzeugung in den Konflikt hineingegangen, das Recht auf ihrer Seite zu haben, und dementsprechend haben sie den eigenen Gewaltgebrauch als einen Akt der Rechtswahrung und Rechtsdurchsetzung legitimiert. Das wird nachfolgend im Einzelnen dargestellt. Die ersten Kriegsjahre zumindest veranschaulichen auf erschreckende Weise die römische Formel summum ius, summa iniuria, die den Umschlag von Rechtsinsistenz in eine Anhäufung von Unrechtsakten auf den Begriff bringt. Wer die Vorgeschichte und die ersten Jahre des Krieges studiert, wird gegenüber der Fixierung auf das Recht als Bewältigungsform politischer Herausforderungen skeptisch werden und darüber nachdenken, ob nicht strategische Kompromissbildung sinnvoller ist als das dogmatische Insistieren auf rechtlichen Bestimmungen. Diese Fragen werden implizit im ersten und zweiten Kapitel des Buches behandelt.
Neben dem Reaktionsmodell des Rechtlichen steht hierzulande das des Moralischen. Die Erörterung politischer Herausforderungen im Horizont moralischer Normen und Imperative ist vielfach an die Stelle strategischen Denkens getreten. Das kann man sich leisten, solange nicht die Gefahr droht, die aufgezeigten Werte und die aus ihnen resultierenden Verpflichtungen durchsetzen zu müssen, jedenfalls nicht außerhalb des eigenen Staatsgebiets. Sobald die Moralkommunikation jedoch folgenreich wird, gerät sie unter die Vorgaben strategischer Überlegungen, bei denen die Kosten der Wertdurchsetzung gegen deren Risiken abgewogen werden, und auch dieses Abwägen erweist sich als ein weiterer Prozess der Desillusionierung. Über die verhängnisvollen Folgen unbedingter Wertbindung lässt sich anhand des Dreißigjährigen Krieges sehr viel lernen – unter anderem auch, dass es ohne eine Abkehr davon zu keinem Friedensschluss gekommen wäre. Die auf ihren Werten insistierende Römische Kurie hat deswegen dem auf Kompromissen beruhenden Friedensschluss von 1648 nicht zugestimmt, sondern ihn verurteilt. Die Paradoxien unbedingter Wertbindung lassen sich am Beispiel des Dreißigjährigen Krieges sehr genau studieren.
Aber strategisches Denken lässt sich nicht dekretieren, sondern will geübt sein. Ein Krieg, der sich über einen Zeitraum von dreißig Jahren erstreckt hat, ist ein vorzüglicher Übungsplatz für strategisches Denken. Das ist der Grund, warum sich die nachfolgende Darstellung immer wieder auf strategische Entscheidungen einlässt, indem sie sowohl die Motive und Zielsetzungen als auch deren unbeabsichtigte Effekte beschreibt – von Fragen der Fortsetzung oder Beendigung der Krieges über solche der Eröffnung neuer Kriegsschauplätze beziehungsweise Schließung bestehender und der Planung von Feldzügen, insbesondere zur Zeit Tillys, Wallensteins und Gustav Adolfs, mit der Alternative einer «Verselbständigung» des Krieges, bei der jegliche Strategie von den Erfordernissen der Logistik aufgezehrt wird, bis hin zu den taktischen Dispositionen bei der Führung von Schlachten. Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Kapitel zwei bis sieben. Sie sind – auch – eine Übung in strategischem Denken und eine Betrachtung von Erfolg und Scheitern.
1. Kapitel«Ihr kennt nicht die Folgen eures Tuns»: Anfänge und Vorgeschichten
Fenstersturz in Prag
Am Vormittag des 23. Mai 1618 drängte eine beständig wachsende Men schenmenge durch das Zentrum von Prag; sie zog vom Karolinum, wo sich die Vertreter der Stände versammelt hatten, zum Hradschin, zur Burg, wo die Statthalter des Kaisers residierten. Die kaiserlichen Beamten sollten zur Rede gestellt und gefragt werden, weshalb sie die Ständeversammlung des böhmischen Adels und der Städte nun schon zum zweiten Mal hatten verbieten lassen und wer für den, wie die Ständevertreter meinten, rüden Ton des kaiserlichen Verbotsschreibens verantwortlich sei.[1] Manche der in Richtung Burg Drängenden meinten, das Schreiben sei überhaupt nicht in Wien, sondern in Prag verfasst worden, und man glaubte aus ihm die Auffassung einiger Standesgenossen herauszuhören, die der katholischen Gegenreformation eng verbunden waren, vor allem die des Jaroslaw von Martinitz und des Wilhelm Slawata. Auch machten in der Menge Gerüchte die Runde, denen zufolge die kaiserlichen Statthalter einen Anschlag auf die Ständeversammlung planten, um ein «absolutes Dominat» der Habsburger in Böhmen durchzusetzen. Dagegen wollte man sich wehren.
An der Spitze des Zuges marschierten Joachim Andreas von Schlick, der Führer des böhmischen Adels, ein Lutheraner, der bislang eher auf eine zurückhaltende und vorsichtige Politik gegenüber dem habsburgischen Kaiserhaus gesetzt hatte, und Heinrich Matthias von Thurn, ein Calvinist, der seit langem für entschiedenen Widerstand gegen die Eingriffe der kaiserlichen Beamten in die Rechte des böhmischen Adels eintrat. Die unterschiedlichen Einstellungen der beiden protestantischen Konfessionen, der Lutheraner und der Calvinisten, gegenüber dem Landesherrn spielten auch in Böhmen eine Rolle. Nun allerdings marschierten die beiden gemeinsam. Die kaiserlichen Beamten hatten es zu weit getrieben. Das einte Lutheraner und Reformierte und verband selbst so gegensätzliche Charaktere wie den gemäßigten Schlick und den Heißsporn Thurn.[2]
Der Konflikt, der an diesem Vormittag offen ausbrach, betraf die ständischen Rechte. Es handelte sich um einen Verfassungskonflikt, der mit der unterschiedlichen Interpretation von Verträgen und Vereinbarungen zusammenhing. Gleichzeitig betraf er aber auch die freie Religionsausübung in Böhmen, also das Recht der Menschen, sich den eigenen Vorstellungen gemäß um ihr Seelenheil zu sorgen. Das Dokument, auf das sich die Stände als Hüter der Freiheit und Sicherheit Böhmens beriefen, war der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. aus dem Juli 1609. In ihm wurden die Protestanten – im Text als «Utraquisten» bezeichnet – den Katholiken gleichgestellt, was auf die organisatorische Eigenständigkeit ihrer Kirche hinauslief und bedeutete, dass sie ungehindert Kirchen- und Schulgebäude errichten durften. Zudem erlaubte ihnen der Majestätsbrief, aus ihrer Mitte «Defensoren» zu wählen, die als Verteidiger ihrer Rechte auftraten.[3] Matthias, seit 1611 Rudolfs Nachfolger als böhmischer König, hatte diese Privilegien bestätigt, und auch Erzherzog Ferdinand, der ein Jahr zuvor neu gewählte böhmische König, hatte ausdrücklich zugesagt, dass er die den Böhmen im Majestätsbrief zugesicherten religiösen Freiheiten uneingeschränkt anerkenne. Darauf hatte die dem neuen König huldigende Ständeversammlung – die Huldigung war «der herrschaftsstiftende Akt am Anfang einer Regierung»[4] – Wert gelegt.
Dafür gab es aus ihrer Sicht gute Gründe, und einer davon war, dass Ferdinand in der Steiermark eine rigorose Politik der Rekatholisierung betrieben hatte. Einige befürchteten, er werde auch in Böhmen auf diese Weise vorgehen. Dass es unter den Adligen des Landes eine kleine Gruppe gab, die nichts sehnsüchtiger erwartete, als gemeinsam mit dem Landesherrn der Gegenreformation zum Sieg zu verhelfen, war allgemein bekannt. Jaroslaw von Martinitz etwa, einer der Statthalter des Kaisers in Prag, spielte dabei eine wichtige Rolle. Der von ihm erteilte Erlass, wer von den Untertanen seiner Besitzungen nicht zur katholischen Beichte und Kommunion gehe, müsse 50 Taler Strafe zahlen, richtete sich eindeutig gegen die Protestanten und verletzte die im Majestätsbrief jedem Bürger und Bauern zugesicherte Religionsfreiheit.[5] Die allgemeine Unruhe wurde noch dadurch gesteigert, dass die weitgehend protestantische Altstadt von Prag einen Rat erhalten hatte, der zu mehr als der Hälfte aus Katholiken bestand.[6] Generell ließ sich beobachten, dass bei der Ämtervergabe in der landesherrschaftlichen Administration entschiedene Anhänger der Gegenreformation bevorzugt wurden. Das sich ausbreitende Misstrauen gegenüber dem Landesherrn und den von ihm eingesetzten Beamten kam also nicht von ungefähr. Aber es war bislang eher diffus geblieben. Am frühen Vormittag des 23. Mai 1618 wurde es zum Antrieb für eine politische Aktion.