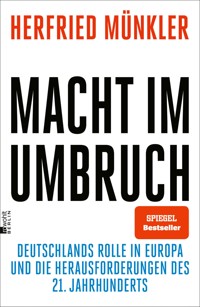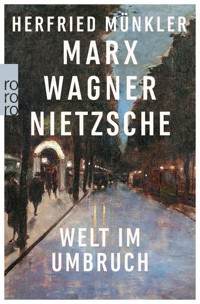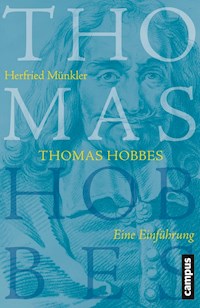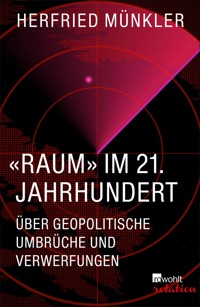9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Deutschland ist aus seiner Behaglichkeit gerissen worden. Die «Flüchtlingskrise» hat die Grundprobleme unserer Gesellschaft sichtbar gemacht und gezeigt, dass das alte Deutschland unwiderruflich vergangen ist. Herfried und Marina Münkler betten die aktuelle Situation ‒ jenseits der Aufgeregtheiten der Tagespolitik ‒ in den historischen Zusammenhang ein und weisen darauf hin, dass Wanderungs- und Fluchtbewegungen nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Deutschland hat sich immer wieder ‒ mit neuen Menschen ‒ neu aufgestellt. Das wird auch heute nicht ohne Brüche und Probleme abgehen: Mächtige, oft divergierende Kräfte werden in der deutschen Gesellschaft freigesetzt. Wie können sie beherrscht werden, was muss man tun, damit wir ihnen nicht wehrlos gegenüberstehen? Herfried und Marina Münkler benennen die Risiken und Gefahren präzise und realistisch; gleichzeitig zeigen sie aber auch die großen Chancen auf, die sich uns bieten. Die neuen Deutschen ‒ das sind wir. Nur wenn wir die Grundfragen klären, in welchem Land wir leben wollen, wie es sich verändern soll und wie nicht, kann dieser größte Umbruch seit der Wiedervereinigung gelingen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Herfried Münkler • Marina Münkler
Die neuen Deutschen
Ein Land vor seiner Zukunft
Über dieses Buch
«Viele glauben, dass sich nichts ändern muss, damit alles bleibt, wie es ist. Das ist ein Irrtum. Wir müssen uns jetzt überlegen, in welchem Land wir leben wollen.»
Deutschland ist aus seiner Behaglichkeit gerissen worden. Die «Flüchtlingskrise» hat die Grundprobleme unserer Gesellschaft sichtbar gemacht und gezeigt, dass das alte Deutschland unwiderruflich vergangen ist.
Herfried und Marina Münkler betten die aktuelle Situation – jenseits der Aufgeregtheiten der Tagespolitik – in den historischen Zusammenhang ein und weisen darauf hin, dass Wanderungs- und Fluchtbewegungen nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Deutschland hat sich immer wieder – mit neuen Menschen – neu aufgestellt. Das wird auch heute nicht ohne Brüche und Probleme abgehen: Mächtige, oft divergierende Kräfte werden in der deutschen Gesellschaft freigesetzt. Wie können sie beherrscht werden, was muss man tun, damit wir ihnen nicht wehrlos gegenübertreten? Herfried und Marina Münkler benennen die Risiken und Gefahren präzise und realistisch; gleichzeitig zeigen sie aber auch die großen Chancen auf, die sich uns bieten.
Die neuen Deutschen – das sind wir. Nur wenn wir die Grundfragen klären, in welchem Land wir leben wollen, wie es sich verändern soll und wie nicht, kann dieser größte Umbruch seit der Wiedervereinigung gelingen.
Vita
Herfried Münkler, geboren 1951, ist Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt- Universität und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Mehrere seiner Bücher gelten mittlerweile als Standardwerke, etwa «Die neuen Kriege» (2002), «Imperien» (2005), «Die Deutschen und ihre Mythen» (2009), das mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde, und «Der Große Krieg» (2013), das monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste stand.
Marina Münkler, geboren 1960, ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Sie hat zum Begriff des Fremden geforscht und zum Phänomen der Interkulturalität. 1998 erschien «Marco Polo»; 2000 «Erfahrung des Fremden» und «Lexikon der Renaissance»; 2003, herausgegeben mit Werner Röcke und Steffen Martus, «Schlachtfelder. Zur Codierung von Gewalt im medialen Wandel».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
ISBN 978-3-644-12441-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Einleitung: Pascals Wette
Der Flüchtling sei ein «Bote des Unglücks», heißt es bei Bertolt Brecht.[1] Das ist er zweifellos, und zwar nicht nur ein Bote seines eigenen Unglücks, sondern auch einer des Unglücks seines Landes, seiner Landsleute und der ganzen Region, aus der er geflohen ist. Denen, in deren Land er meist unerwartet kommt, ruft er das relative Glück ihres Lebens in Erinnerung: Was Frieden und Sicherheit, Ruhe und Wohlstand wert sind, wird uns häufig erst durch solche «Boten des Unglücks» wieder bewusst. Im Ankunftsland der Flüchtlinge löst das recht unterschiedliche Empfindungen und Reaktionen aus: Während die einen dankbar dafür sind, wie gut es ihnen geht, und diese Dankbarkeit in die Bereitschaft umwandeln, den Unglücklichen zu helfen, fühlen sich andere durch die ungebetenen Gäste gestört und hoffen, dass sie so schnell wie möglich wieder verschwinden. Für noch einmal andere sind die Flüchtlinge Eindringlinge, die man verjagen will, denen man gar Gewalt androht; als Zeichen, dass diese Drohung ernst gemeint ist, stecken sie die für sie vorgesehenen Unterkünfte in Brand.
So ist Deutschland seit dem Herbst 2015 zu einem gespaltenen Land geworden: Auf der einen Seite viele – und viel mehr, als man erwarten konnte –, die geholfen haben, wo und so gut sie konnten, und auf der anderen Seite eine mit dem anhaltenden Zustrom von Flüchtlingen wachsende Gruppe, die einfach die Grenzen schließen will und sich demonstrativ für unzuständig erklärt: Sollen, so ihre Forderung, die Flüchtlinge die Botschaft ihres Unglücks doch andernorts verkünden – hier wolle man sie nicht hören! Die gesellschaftliche Spaltung in der Flüchtlingsfrage hat inzwischen zu dramatischen Umbrüchen in der politischen Landschaft der Bundesrepublik Deutschland geführt; die Folgen werden für lange Zeit spürbar sein. Deutschland wird aus dieser Herausforderung als ein anderes Land hervorgehen. – Es steht vor seiner Zukunft und ringt mit der Frage, welche Zukunft es sein soll.
Wenn hier von den «neuen Deutschen» die Rede ist, so sind damit keineswegs nur die Neuankömmlinge gemeint, die sich irgendwie mit den Alteingesessenen arrangieren werden. Sicher, es geht zunächst um sie und um die Frage, wie sie sich erfolgreich integrieren können – wobei erfolgreich heißt, dass sowohl die Flüchtlinge als auch die bereits hier Lebenden davon profitieren. Doch es geht ebenso um die deutsche Gesellschaft, die sich angesichts des Umstands, dass sie sich seit längerem nicht mehr biologisch reproduziert, sondern auf Zuwanderung angewiesen ist, wenn sie ihre Bevölkerungszahl halten will, neu definieren und eine veränderte Identität entwickeln muss. Insofern gehören auch die alten Deutschen zu den «neuen Deutschen». In beiden Fällen ist die Frage offen, mit was für «neuen Deutschen» wir es in Zukunft zu tun haben werden: Bei den Neuankömmlingen geht es darum, ob sie sich in Deutschland einleben, hier Arbeit finden und die deutschen Grundwerte als die ihren annehmen werden – oder eben nicht, was hieße, dass sie sich in Parallelgesellschaften gegen die deutsche Mehrheitsgesellschaft abschotten würden. Das hätte dann zur Folge, dass sie mit Argwohn beobachtet würden und sie wiederum eine noch größere Distanz zur Bevölkerungsmehrheit suchten. Und bei den Alteingesessenen wird es darum gehen, ob sie die Flüchtlinge eher als Chance oder als eine Last und Bedrohung sehen und welche Schlussfolgerungen sie aus ihrer jeweiligen Sichtweise ziehen. Auf jeden Fall aber ist klar, dass sich die Integration, wenn sie erfolgreich verlaufen soll, über Jahre hinziehen wird und die mit ihr verbundenen Herausforderungen nicht mit ein paar Verwaltungsmaßnahmen zu bewältigen sind.
Die nachfolgenden Erkundungen sind von der Überzeugung getragen, dass die Neuankömmlinge eine Chance für unsere Gesellschaft darstellen; allerdings steht immer wieder die Beobachtung dagegen, dass die Migration kurzfristig eine enorme Belastung ist: für die Verwaltungen der Länder und Kommunen, die seit Monaten an der Grenze ihrer Belastbarkeit arbeiten; für den Staatshaushalt, aus dem die zusätzlichen Aufwendungen – inzwischen ist von bis zu 200 Milliarden Euro die Rede – finanziert werden müssen, die nötig sind, um die Menschen unterzubringen und zu versorgen, aber auch, um sie aus- und weiterzubilden. Diejenigen, die im Herbst und Winter 2015 nach Deutschland gekommen sind, waren nämlich nur in wenigen Fällen auf den deutschen Arbeitsmarkt vorbereitet. Also muss zunächst in ihre Befähigung investiert werden, und diese Investitionen, die sich im Übrigen nicht auf die Arbeitsqualifikation beschränken können, wenn eine nachhaltige Integration in die deutsche Gesellschaft stattfinden soll, werden sich über einen gewissen Zeitraum hinziehen. Es wird in einigen Fällen länger dauern, in anderen kürzer, und man muss davon ausgehen, dass sie mitunter auch erfolglos bleiben, weil die Voraussetzungen für eine Integration in den deutschen Arbeitsmarkt nachträglich nicht mehr herzustellen sind. Man sollte in dieser Frage nicht übertrieben optimistisch sein, sondern sich auch auf Enttäuschungen einstellen. Dennoch gibt es keinen Grund zu vorauseilendem Pessimismus. Ein solcher wäre nur gegeben, wenn man in den Neuankömmlingen ausschließlich eine Last und nicht die Spur einer Chance sehen würde.
Dafür, dass es in jedem Fall vernünftiger ist, die Flüchtlinge als Chance und nicht als Last zu betrachten und dementsprechend zu handeln, spricht ein einfaches Gedankenexperiment, das in der Philosophiegeschichte als «Pascalsche Wette» bekannt geworden ist. Der französische Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal hat diese Wette anhand des Problems entwickelt, dass die Existenz Gottes nicht zu beweisen ist: Wenn wir weder von der Existenz noch von der Nichtexistenz Gottes mit Sicherheit ausgehen können und die Wahrscheinlichkeit des einen wie des anderen als gleich groß zu veranschlagen ist – dann sind auch die Chancen, die Wette zu gewinnen, wenn man auf das eine oder andere setzt, exakt gleich. Was jedoch nicht gleich ist, so die Pointe von Pascals Überlegung, ist der jeweilige Einsatz: Wer gegen die Existenz Gottes wettet, gewinnt nichts, wenn er recht behält – verliert aber das ewige Leben, wenn er falschliegt. Während der, der auf die Existenz Gottes setzt, für den Fall, dass er die Wette verliert, nur nichts gewinnt – und alles gewinnt, wenn er richtigliegt.
Wenn wir das dieser Wette zugrundeliegende Kalkül auf die Frage nach dem Erfolg oder Scheitern der Flüchtlingsintegration übertragen, so ist es vernünftig, auf den Erfolg zu setzen, weil nur dieser einen gesellschaftlichen Ertrag hat – während der, der auf das Scheitern setzt, nichts gewinnt, sollte er recht behalten. In diesem Fall kommt noch hinzu, dass die Wettenden auf den Ausgang der Wette selbst Einfluss nehmen, denn selbstverständlich werden die, die auf Erfolg gesetzt haben, alles tun, um recht zu behalten, während die, die auf Misserfolg gesetzt haben, vernünftigerweise nichts für das Eintreten desselben tun werden, da die Kosten sie genauso treffen würden wie die, die auf das Gegenteil gewettet haben. Kurz: Wer auf das Scheitern der Integration setzt, verliert in jedem Fall, und nur wer auf den Erfolg setzt, hat eine Gewinnchance. In diesem Sinne hat die nachfolgende Argumentation ein durchgängiges Interesse am Erfolg, kann aber nicht grundsätzlich ausschließen, dass das Projekt scheitert.
Durch die Neuankömmlinge ist eine Situation entstanden, die, unabhängig von allem Abwägen, einen Gewinn für unsere Gesellschaft darstellt. Das ist schon aufgrund des Erfordernisses der Fall, über die eigene Kollektividentität neu nachzudenken und dabei zu klären, was für sie elementar und unverzichtbar ist und was eher einer vergangenen geschichtlichen Etappe angehört. Eine derartige kollektive Selbstreflexion hat, wenn sie nicht auf eine dauerhafte Spaltung der Gesellschaft hinausläuft, die Wirkung eines Jungbrunnens, in dem sich eine politische Ordnung ihrer selbst vergewissert und sich so erneuert. Solche Selbsterneuerungen sind sonst zumeist mit Krisen und Katastrophen verbunden, im deutschen Fall etwa mit verlorenen Kriegen. Es ist die Herausforderung durch das Fremde, die gegenwärtig an deren Stelle tritt, die Beschäftigung mit dem Anderen, aus der die Vergewisserung des Eigenen erwächst. Die Katastrophe der Anderen, von der die Flüchtlinge, die «Boten des Unglücks», künden, ersetzt die Erfahrung der eigenen Katastrophe – jedenfalls dann, wenn man der Botschaft der Flüchtlinge nicht mit mürrischer Gleichgültigkeit begegnet. Es wird deswegen nachfolgend immer auch das Fremde eine Rolle spielen: die Frage, wie mit ihm umzugehen ist, wie viel Fremdheit wir aushalten wollen und wo die Annährung der Fremden an unser Eigenes unverzichtbar ist. So hat die Debatte der zurückliegenden Monate etwa Klarheit über die individualistischen Grundlagen unseres Rechtsverständnisses geschaffen und gezeigt, dass dieses mit aller Entschiedenheit gegen gruppenbezogene Sonderrechte ethnischer oder religiöser Art verteidigt werden muss.
Es ist nicht so, dass die Flüchtlingskrise ein Land ereilt hat, das sich seiner selbst nicht sicher und von der Herausforderung restlos überfordert war. Die deutsche Gesellschaft hat den Stresstest vom Herbst 2015 durchaus bestanden. In jedem Fall hat sie das in einer für die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorbildlichen Form getan. Die Arbeit einiger Landesverwaltungen, die mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen deutlich überfordert waren, und einiger Landespolizeien, die nicht in der Lage waren, Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte zu verhindern oder zumindest zügig aufzuklären, überzeugt dagegen weniger. Immerhin wurde dadurch für die Politik erkennbar, wo Reformen vonnöten sind oder es gar dringenden Handlungsbedarf gibt. Die verschiedenen mit dem Zustrom der Flüchtlinge befassten Ämter und Behörden haben Erfahrungen gesammelt, die sich, wenn daraus die richtigen Schlüsse gezogen werden, bei nächster Gelegenheit als wertvoll erweisen könnten. Zunächst aber kommt es darauf an, bei der Integration der Neuankömmlinge einen langen Atem zu haben. Das wird, was die Mobilisierung von Hilfsbereitschaft und Engagement in der Bevölkerung anlangt, sehr viel schwieriger sein, als dies in der eigentlichen Situation der Ankunft war, wo es darum ging, die Menschen erst einmal unterzubringen und zu versorgen. Das härtere Stück Arbeit steht noch bevor.
Und immer, wenn auf die bevorstehenden Mühen und Lasten geblickt wird, taucht offen oder insgeheim die Frage auf, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, sich all das zu ersparen, indem man Anfang September die Grenzen geschlossen und dafür gesorgt hätte, dass die Flüchtlinge irgendwo auf der Balkanroute gestoppt oder am Übersetzen auf die griechischen Inseln gehindert worden wären. Abgesehen davon, dass dies zu einer humanitären Katastrophe geführt hätte, wären so mit Sicherheit alle Erfolge zunichtegemacht worden, die die Europäer im zurückliegenden Jahrzehnt bei der Befriedung des mittleren Balkans erzielt haben. Man hätte dann fragile Staaten mit mühsam stabilisierten Verhältnissen zwischen den ethnisch-religiösen Gruppen einer Belastungsprobe ausgesetzt, die sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bestanden hätten. Was aber, wenn die Unruhen und Bürgerkriege, die man dort notdürftig beendet hat, wieder aufgeflammt wären? – Insofern hat die Flüchtlingskrise auch die Frage aufgeworfen, wie eine gemeinsame Sicherheitsstrategie der EU für ihre «weiche Flanke» im Südosten aussehen kann.
Doch kommen wir auf Deutschland zurück, auf die neuen und die alten Deutschen und die Aufgabe, dass sie jetzt zusammenfinden müssen: Die alten Deutschen sind dabei jene, die an der ethnischen Geschlossenheit des Volkes hängen und sich nichts anderes für die Zukunft vorstellen können. Die neuen Deutschen sind in diesem Fall nicht die Neuankömmlinge, die sich ja überhaupt noch entscheiden müssen, ob sie überhaupt Deutsche werden wollen, sondern jene, die auf ein weltoffenes und nicht mehr ausschließlich ethnisch definiertes Deutschland setzen. Zwischen beiden Seiten hat sich in der Debatte der letzten Monate eine beachtliche Kluft aufgetan, die wieder geschlossen werden muss, wenn man die bevorstehenden Aufgaben bewältigen will. Eine Grundlage dafür könnte die Einsicht sein, dass Deutschland dauerhaft auf Zuwanderung angewiesen ist, wenn es das bleiben möchte, was es zurzeit noch ist – sowohl im Hinblick auf den materiellen Wohlstand des Landes als auch auf die Leistungsfähigkeit des Sozialstaats. Solch eine Zuwanderung muss freilich nicht in Form kaskadenförmiger Flüchtlingsströme auftreten – im Gegenteil: Eine geregelte Zuwanderung in einer der hiesigen Aufnahmefähigkeit angemessenen Dosierung, bei der deutsche Behörden Einfluss auf die Auswahl der Zuwandernden haben, würde sicherlich den deutschen Bedürfnissen sehr viel mehr entsprechen. Doch diese Politik ist in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten, seitdem sie angezeigt war, nicht betrieben worden.
Der Flüchtlingsstrom vom Herbst 2015 hat ein lange verdrängtes Problem auf die politische Tagesordnung gesetzt. Dieses Problem besteht darin, dass ein demographisches Schrumpfen ökologisch sinnvoll sein mag, aber auf soziale und wirtschaftliche Verwerfungen hinausläuft, die eine durchgeplante und durchorganisierte Gesellschaft wie die unsere mit ihren vergleichsweise hohen Wohlstandserwartungen nicht verkraften kann. Deswegen braucht eine solche Gesellschaft kontinuierlichen Zuzug. Kontinuierliche Zuwanderung als Ausgleich für eine defizitäre biologische Reproduktion ist nicht neu, sondern eine historische Regel: So haben sich die großen Städte seit ihrer Entstehung in Mesopotamien oder im Niltal mehr als ein Jahrtausend vor Christus bis weit ins 19. Jahrhundert hinein nie selbst, also durch ihre Geburtenrate, reproduzieren können; sie waren stets auf Zuzug aus dem sie umgebenden Land angewiesen. Blieb dieser Zuzug aus, schrumpften die Städte oder verfielen, wie das in Nordwesteuropa im Frühmittelalter der Fall war. Aber es war eher eine Ausnahme, dass der Zuzug ausblieb; das Leben in den Städten war attraktiv und bot deutlich größere Annehmlichkeiten und Aufstiegschancen als das Leben auf dem Lande.
Das ist heute ganz ähnlich, nur dass an die Stelle von Stadt und Land der reiche Norden und der arme Süden getreten sind, in globaler Hinsicht, aber auch in Großräumen wie der Europäischen Union. Der globale Norden ist nicht nur reicher als der globale Süden. Er verfügt auch, wenn man einmal vom Sonderfall Russland absieht, über politische Ordnungen mit einem hohen Grad an Freiheit und einer großen Rechtssicherheit, was in den meisten Ländern des Südens nicht der Fall ist. Sicherlich sollte man die Gegenüberstellung von reichem Norden und armem Süden nicht überzeichnen und immer im Auge behalten, dass eine historische Analogie eben nur eine Analogie ist und keine Blaupause. Aber die Ähnlichkeiten zwischen der Stadt-Land-Beziehung in West- und Mitteleuropa vom 11. bis zum 19. Jahrhundert und den heutigen Nord-Süd-Konstellationen sind augenfällig, und man kann, wenn man will, aus dem Vergleich einiges ziehen, um unsere Gegenwart und ihre Herausforderungen zu analysieren.
Freilich muss dafür zwischen einem Normalzustand und immer wieder auftretenden Not- und Ausnahmesituationen unterschieden werden. Hungersnöte infolge von Missernten sowie Kriege und Bürgerkriege haben auch in der Vergangenheit zum Anschwellen von Flüchtlingsbewegungen geführt, und daran hat sich bis heute nichts geändert. In solchen Konstellationen werden die normalen Migrationsbewegungen vom Land in die Stadt überlagert; in manchen Fällen haben sie sich intensiviert, während sie sich in anderen umgekehrt haben und von der Stadt aufs Land erfolgt sind. Bei Seuchen kam es vor, dass die Menschen aus der Stadt flüchteten, was auch bei einer absehbaren Belagerung so sein konnte; während es hinter den Mauern einer Stadt durchweg sicherer war, wenn marodierende Soldateska und Räuberbanden durchs Land streiften. Aber das waren, modelltheoretisch betrachtet, Sondersituationen. Die Grundkonstellation war eine kontinuierliche Bewegung vom Land in die Stadt, da diese sich mit ihrer Geburtenrate nicht zu reproduzieren vermochte. Auf dem Land herrschte dagegen, von Ausnahmesituationen abgesehen, ein Geburtenüberschuss, der, wenn er sich aufstaute, die sozialen Verhältnisse durcheinanderbrachte. Insofern war auch das Land auf einen kontinuierlichen Abfluss von Menschen angewiesen. Was wir in der Normalkonstellation beobachten, ist Arbeitsmigration, die durch Flüchtlingsbewegungen in Ausnahmesituationen überformt wird.
Das entspricht auch der heutigen Lage, und deswegen ist es sinnvoll, zwischen Arbeitsmigranten und Bürgerkriegs- beziehungsweise Katastrophenflüchtlingen zu unterscheiden. Auf Erstere ist der reiche Norden angewiesen, wobei sich der Arbeitskräftebedarf im letzten Jahrzehnt zunehmend von der Industrie in den Dienstleistungsbereich verschoben hat; Letztere hingegen sind ein periodisch auftretendes Problem, und weder die Zahl noch die Fähigkeiten der Flüchtlinge lassen sich ohne weiteres mit den Arbeitsmarktanforderungen in den aufnehmenden Ländern in Einklang bringen. Wenn es sich nicht um ein kurzzeitiges Exil handelt, sondern absehbar ist, dass die Flüchtlinge für längere Zeit, womöglich dauerhaft bleiben werden, kommt es also darauf an, beides miteinander kompatibel zu machen: die Neuankömmlinge mit dem Arbeitsmarkt und den Arbeitsmarkt mit den Neuankömmlingen. Modelltheoretisch betrachtet, stellen solche Sondersituationen eine Irritation der normalen Arbeitsmigration dar. Diese findet in der Regel eher stillschweigend statt, wird in Talkshows nicht diskutiert und schafft es allenfalls als statistische Größe einmal in die Nachrichten. Regelmäßige Arbeitsmigration und kaskadenförmige Fluchtbewegungen sind in der deutschen Debatte zuletzt durcheinandergeraten, und dazu hat nicht zuletzt die Diskussion über religiös-konfessionelle Prägungen, insbesondere den Islam, beigetragen, die zu einer Vermischung beider Bewegungen und der mit ihnen verbundenen Folgen für die deutsche Gesellschaft geführt hat. Um es kurz zu sagen: Die «Islamisierung» der Flüchtlings- und Zuwanderungsdebatte hat mehr Unklarheit als Klarheit geschaffen.
Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass es Fälle gibt, in denen sich der Islam bei der Integration in die europäischen Gesellschaften als Blockade erweist, und dass obendrein der islamistische Dschihadismus eine Bedrohung für das Sicherheitsempfinden der Menschen in West- und Mitteleuropa darstellt. Das zu bestreiten, wäre töricht, und tatsächlich hat sich beides nach den Anschlägen von Paris und Brüssel und den Übergriffen vornehmlich nordafrikanischer Flüchtlinge am Kölner Hauptbahnhof in der Silvesternacht 2015/16 mit der Debatte verbunden, wie die Aufnahme von Flüchtlingen und ihre Integration in die deutsche Gesellschaft vonstattengehen können. Aber damit ist mehr aufgeregte Emotionalität als analytische Rationalität in diese Debatte gekommen, und in der Folge dessen ist politisches Handeln schwieriger und nicht einfacher geworden. Das heißt, dass auch die Versuche erschwert wurden, Lösungen für das Problem zu finden. Die Aufgeregtheit mag verständlich sein, aber zielführend ist sie nicht. Politische Debatten sollten politisches Handeln vorbereiten und nur ausnahmsweise als eine Variante sozialpsychologischer Problembearbeitung dienen. In diesem Sinn wird nachfolgend versucht, die Herausforderungen überschaubar zu machen und mögliche Perspektiven aufzuzeigen, wie sie zu bewältigen sind.
Schon jetzt ist ein bestimmter Vorwurf absehbar, der unseren Überlegungen gemacht werden dürfte: dass sie das Problem nicht in seiner ganzen Komplexität und Vielschichtigkeit erfasst hätten, weil zu wenig von globaler Ausbeutung, insbesondere der des Südens durch den Norden, von den Folgen der kapitalistischen Produktionsweise, speziell des Finanzkapitalismus, und schließlich auch vom Klimawandel die Rede sei. Es ist richtig, dass diese Fragen eher gestreift oder beiläufig angesprochen werden und nicht im Zentrum des Buches stehen. Das hat wohlbedachte Gründe: Es gibt eine fatale Neigung, bei der Beschreibung von Problemen immer wieder auf Vorstellungen zurückzukommen, in denen alles mit allem in einer so komplexen Weise zusammenhängt, dass es kein politisches Handeln mehr geben kann und man eigentlich in melancholische Untätigkeit versinken müsste, wie Wagners Wotan am Ende des Rings, der nur noch auf das Ende der Welt wartet und darauf hofft, dass es möglichst bald eintritt. Die Beschreibung der bevorstehenden Katastrophe wird unter diesen Umständen zum ästhetischen Ereignis, aus dessen Antizipation so mancher noch einen moralischen Gewinn ziehen zu können meint. Ein solcher Leser wird in den nachfolgenden Kapiteln nicht auf seine Kosten kommen.
Unsere Überlegungen sind von dem theoretischen Impetus getragen, Komplexität zu reduzieren, um konkretes Handeln zu ermöglichen; und sie sind von dem praktischen Impetus angestoßen, Lösungen für Probleme zu finden. Wir haben deswegen ein politisches Buch geschrieben, kein erbauliches. Dabei sind wir von der Leitidee ausgegangen, dass die Integration der Neuankömmlinge in die deutsche Gesellschaft nicht durch einfache Inklusion erfolgen kann; dass es aber genauso wenig möglich ist, die hierher Geflüchteten wieder aus dieser Gesellschaft auszuschließen. Wer meint, das Problem der Integration allein durch rechtliche Inklusion lösen zu können, der irrt; wer meint, sich die Mühen der Integration durch rechtlich abgesichertes Ausschließen vom Hals schaffen zu können, der irrt nicht minder.
Viele glauben, dass sich nichts ändern muss, damit alles so bleibt, wie es ist. Das ist ein Irrtum: Wir müssen einiges ändern, um auch in Zukunft so leben zu können, wie wir uns dies in den letzten Jahrzehnten angewöhnt haben. Also müssen wir uns jetzt überlegen, wie das Land beschaffen sein muss, beschaffen sein soll, in dem wir auch weiterhin dieses gute Leben führen können. Es ist ein beschwerlicher Weg, der nun angetreten werden muss – aber wenn wir ihn gehen, dürfte es am Ende lohnend sein.
1. Grenzen, Ströme, Kreisläufe – wie ordnet sich eine Gesellschaft?
Eine Welt in Bewegung: die jüngsten Flüchtlingsströme
Unser Bild von einer guten Zukunft ist von zwei recht unterschiedlichen Vorstellungen geprägt: zunächst, dass wir einen Ort haben, an dem wir zu Hause sind, einen Raum, der Sicherheit bietet; dass wir uns also in einer sozialen Umgebung bewegen, die uns vertraut ist und auf die wir uns, falls erforderlich, verlassen können. Nennen wir das Heimat, und zwar in dem von dem Philosophen Ernst Bloch vorgeschlagenen Sinn: ein Raum, den wir als Ort einer geborgenen Kindheit erinnern und von dem wir gleichzeitig wissen, dass unsere Erinnerung mit Wünschen und Hoffnungen durchsetzt ist, die weit über das hinausgehen, was wir tatsächlich erfahren haben. Heimat ist erinnerte Zukunft, eine Vorstellung, in der Erfahrung und Phantasma ineinander übergehen. Das verleiht ihr einen ebenso appellativen wie melancholischen Charakter.
Zugleich stellen wir uns die gute Zukunft als ein Leben vor, bei dem wir an keinen Ort dauerhaft gebunden sind, also nach Belieben reisen und die Welt erkunden können, bei dem wir die Orte, an denen wir uns aufhalten, gemäß den jeweiligen Vorlieben wechseln können – sei es, weil wir uns der vermeintlichen Langeweile und Tristesse des Bleibens entziehen wollen, sei es, weil wir andernorts bessere Möglichkeiten beruflichen Fortkommens oder persönlichen Glücks zu finden glauben. Was früher das für Not- und Ausnahmefälle gedachte ius emigrandi, das Recht der Auswanderung, war, ist heute zu einer verbreiteten Praxis der Lebensgestaltung geworden. In der Vorstellung eines guten Lebens sind die Imaginationen von Sicherheit und Freiheit miteinander verbunden, und diese Verbindung ist für uns essenziell, denn ohne das Eine ist das Andere nichts oder doch sehr viel weniger wert.[1]
Für die meisten Menschen der nördlichen Hemisphäre ist ein Leben, das diese beiden scheinbar konträren Vorstellungen vereint, tendenziell möglich: Sie haben ein Haus oder eine Wohnung, machen regelmäßig Urlaub und nutzen dies, um «die Welt» zu sehen; sie können sich frei entscheiden, ob sie an einem vertrauten Ort auf Dauer bleiben oder räumlich mobil sein wollen. Sie leben in einer Welt, in der das Stationäre und das Mobile, das Feste und das Fluide so miteinander verbunden sind, dass sie Wahlmöglichkeit und Entscheidungsfreiheit haben. Zu dieser Freiheit gehört, dass man selbst festlegt, ob, wann und in welchem Umfang man von den Alternativen des Stationären und Mobilen Gebrauch macht und die erforderlichen Anstrengungen unternimmt. Auch wenn das nicht für alle Menschen des reichen Nordens in gleichem Maße gilt und das Ausmaß, in dem diese Freiheit in Anspruch genommen werden kann, zumeist von Einkommen und Vermögen abhängt, ist die Freiheit des individuell verfügbaren Arrangements von Ortsfestigkeit und Ortswechsel doch ein wesentliches Merkmal der offenen Gesellschaft. Eine offene Gesellschaft ist der Ermöglichungsrahmen eines guten Lebens.
Gleiches gilt für die meisten Menschen des globalen Südens nicht. Sie haben keine Perspektive einer beruflichen Karriere durch Ortswechsel, leben nicht selten unter Regimen, die sie mit Zwang in einem bestimmten Raum festhalten oder aber alles daransetzen, sie aus dem Raum, in dem sie bislang gelebt haben, zu vertreiben, wobei sie oft nicht mehr zu retten vermögen als das nackte Leben.[2] Lebenslange Ortsgebundenheit und massenhafte Flucht stehen in vielen Gesellschaften des globalen Südens unmittelbar nebeneinander. Freiheit ist hier – nicht überall, aber doch vielerorts – auf den individuellen Entschluss beschränkt zu migrieren.[3] Aber das ist kein Entschluss, der nach Belieben umkehrbar ist; diejenigen, die sich auf den Weg machen, tun dies in dem Bewusstsein, dass es für sie keine Rückkehr gibt beziehungsweise dass jede Form von Rückkehr auf das Eingeständnis eines Scheiterns hinausläuft, nachdem die Familie zuvor alle verfügbaren Ressourcen aufgebracht hat, um dem Betreffenden den Aufbruch in eine bessere Welt zu ermöglichen.
Das erklärt die große Risikobereitschaft der Migranten bei dem Versuch, nach Europa zu kommen. Oft erwächst Migration tatsächlich aus einer freien Entscheidung, als Einzelner oder in einer kleinen Gruppe ein besseres Leben zu suchen. In einer wachsenden Zahl von Fällen bleibt großen Bevölkerungsgruppen infolge von Hungerkatastrophen und Bürgerkriegen freilich gar nichts anderes übrig, als sich auf die Flucht zu begeben, wenn sie nicht sterben wollen – wohin auch immer, nur weg aus den Räumen, die im buchstäblichen Sinn zu Todeszonen geworden sind. Das ist zwar auch eine Entscheidung, sie lässt sich aber kaum als Entscheidung aus freien Stücken bezeichnen. Im ersten Fall dominieren die Pull-Faktoren, die Aussicht auf ein besseres Leben in Ländern, die man sich als Zielgebiet der Wanderung ausgesucht hat; in letzterem hingegen die Push-Faktoren, die Ursachen, die dazu nötigen, die angestammte Heimat zu verlassen. Sicher verbinden sich in jedem Entschluss zur Migration Push- und Pull-Faktoren miteinander, aber ihre Anteile sind so unterschiedlich gewichtet, dass man es mit zwei Gruppen von Migranten zu tun hat. Bevor man den Unterschied zwischen beiden Gruppen aber zu groß macht und essenzialisiert – etwa in der Gegenüberstellung von «Wirtschaftsmigranten» und «Bürgerkriegsflüchtlingen» –, sollte man im Auge behalten, dass es auch für die meist kein Zurück mehr gibt, die ihr Land aus freien Stücken verlassen haben. Je länger der Weg ist, den man hinter sich gebracht hat, desto schwerer fällt der Entschluss zurückzukehren. Das muss eine Politik bedenken, die Flüchtlingsrouten sperrt und mit Appellen versucht, die Flüchtlinge zur Umkehr zu bewegen.
Wer sich aus mehr oder weniger freien Stücken entschieden hat zu migrieren, sucht ein besseres Leben, und meistens ist das Ziel ein Land des reichen Nordens; im Fall der Afrikaner sind das West- und Nordeuropa, bei den Mittelamerikanern die USA oder Kanada.[4] Die Länder des Nordens jedoch sind angesichts ihrer Aufnahmekapazitäten und ihres tatsächlichen Arbeitsbedarfs bestrebt, die Armutsmigranten «draußen» zu halten, zumal diese in der Regel nicht die erforderliche Qualifikation mitbringen, um auf dem Arbeitsmarkt ihres Ziellandes reüssieren zu können; die Länder errichten zu diesem Zweck Grenzzäune und Sicherungssysteme, die dafür sorgen sollen, dass Migranten keinen Zugang zu den Räumen einer relativ freien Lebensgestaltung finden. Die Logik dahinter lautet: Um unsere Freiheit und den für deren Genuss erforderlichen Wohlstand zu bewahren, ist es erforderlich, dass der Zustrom von Menschen aus dem globalen Süden begrenzt bleibt, dass die Aufnahmeländer sich zumindest aussuchen können, wem sie Zutritt gewähren und wem nicht, und dabei die aus ihrer Sicht Bestgeeigneten auswählen. Auf diese Weise wollen die Länder des Nordens verhindern, dass ein Sogeffekt entsteht, der das für sie verkraftbare Hereintröpfeln von Migranten in einen breiten Zustrom verwandelt. Mehr noch: sie wollen das Hereintröpfeln durch ein Herauspicken ersetzen. Diese Politik folgt einer Logik der Individualisierung, die durchaus zu den Grundsätzen einer offenen Gesellschaft gehört; sie weist in normativer Hinsicht jedoch den Makel auf, dass sie Freiheit und Sicherheit in Gestalt eines individuellen Arrangements den Bewohnern des reichen Nordens vorbehält und die Menschen des globalen Südens von einer solchen Möglichkeit ausschließt. Für die Menschen des Nordens ist das, wenn überhaupt, ein moralisches Problem, das ihnen gelegentlich ein schlechtes Gewissen verursacht; für die Menschen des Südens ist es dagegen ein existenzielles Problem, bei dem es nicht selten um Leben und Tod geht.
Solche Systeme von Inklusion und Exklusion sind nicht neu, sondern folgen dem seit jeher genutzten Modell von «Drinnen» und «Draußen». Die Ordnung von Zugehörigkeit und Ausschluss ist indes zum Problem geworden, seit die Universalität von Normen zum Selbstverständnis der offenen Gesellschaften gehört, also, um einen Zeitraum zu nennen, seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, seit Verkündung der UN-Charta im Jahre 1945 und der Inkraftsetzung der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, und überhaupt seit der allmählichen Auflösung der Vorstellung, wonach die Verschiedenheit der «Rassen» oder Ethnien eine legitime Begründung für ein prinzipiell unterschiedliches Leben sei. Seitdem ist begründungsbedürftig, weshalb Freiheit und Wohlstand de facto Privilegien des weißen Mannes (und der weißen Frau) sein und die Menschen des globalen Südens in ihrer überwiegenden Mehrheit davon ausgeschlossen werden sollen. Über ein halbes Jahrhundert hat das entwicklungspolitische Versprechen des Nordens dazu gedient, dieses Problem zu entschärfen; es stellte Armut und Unterdrückung in der südlichen Hemisphäre als ein zeitlich begrenztes Problem dar, das durch die materielle Hilfe des Nordens Jahr für Jahr kleiner werde, um schließlich gänzlich zu verschwinden. Die Zeit sollte, so das sozioökonomische Entwicklungsparadigma, die Unterschiedlichkeit der Räume allmählich in eine Welt der gleichen Chancen überführen.
Wie begründet auch immer die damit verbundenen Hoffnungen und Erwartungen gewesen sein mögen – sie haben zunächst einmal das Normproblem relativiert, indem sie es als einen befristeten Entwicklungsabstand dargestellt haben. Gleichzeitig hat dieses Versprechen in der südlichen Hemisphäre die Vorstellung gestützt, es werde möglich sein, durch eine forcierte Entwicklung, bei der man sich bis 1989/90 entweder am kapitalistischen Westen oder am sozialistischen Osten orientierte, den Rückstand Schritt für Schritt zu verkleinern. Die Option, als Einzelner oder in kleinen Gruppen in den Norden zu wandern, wurde überwölbt von der Erwartung, der Süden könne es als Ganzes schaffen, auf das Niveau des Nordens zu kommen oder sich dem zumindest anzunähern. Diese Vorstellung hat, seitdem die ökologischen Grenzen des Wachstums Thema wurden, an Überzeugungskraft verloren. In den zur Jahrtausendwende formulierten Millenniumszielen der Vereinten Nationen ist sie noch einmal öffentlichkeitswirksam bekräftigt worden, hat aber seither immer mehr an Bindekraft eingebüßt; die wachsende Zahl derer, die sich in den letzten Jahren aus Afrika auf den Weg gemacht haben, um irgendwie nach Europa zu kommen, ist ein Indikator dafür, dass viele nicht mehr an das Entwicklungsversprechen glauben.
Die angestrebte Reduzierung der zuletzt immer stärker angewachsenen Flüchtlingsströme nach Europa setzt somit voraus, dass die Entwicklungsperspektiven der nordafrikanischen Länder – von Marokko über Algerien bis Tunesien – sowie der subsaharischen Länder – von den Krisenstaaten Westafrikas über Mali, Nigeria, Kamerun und Burkina Faso bis Somalia und Eritrea – deutlich verbessert werden, und zwar so weit, dass sich für die potenziellen Migranten beim Abwägen zwischen Gehen oder Bleiben die Gewichte wieder zugunsten des Bleibens verschieben. Auf diese Herausforderung müssen die Europäer eine überzeugende Antwort finden, wenn die Ströme der Armutsmigranten in den nächsten Jahren nicht auf dem aktuellen Niveau bleiben oder noch weiter anschwellen sollen. Doch selbst wenn das gelingt, wäre dies eher mittel- als kurzfristig wirksam.
Zur schwindenden Bindekraft des Entwicklungsversprechens kamen seit den 1990er Jahren noch die neuen Kommunikations- und Informationstechnologien hinzu, die das gute Leben im Norden – häufig in erheblich überzeichneter Form – sichtbar gemacht und das Problem der unterschiedlichen Lebensstandards in der nördlichen und der südlichen Hemisphäre erheblich zugespitzt haben. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Und ebenso wenig lässt sich rückgängig machen, dass die Flüchtlingsbewegungen durch den Gebrauch von Handys effektiv koordiniert und schnell dirigiert werden können.
Von den Migranten, die aufbrechen, um ein besseres Leben zu suchen, und im weiteren Sinn eine freie Entscheidung getroffen haben, sind die zu unterscheiden, die ihren Herkunftsort verlassen, weil Hungerkatastrophen ihnen kaum eine andere Wahl lassen oder Bürgerkriege und Gewaltstrukturen sie zur Flucht nötigen.[5] Auch sie haben eine Entscheidung getroffen, die in Anbetracht der Umstände aber nicht als frei bezeichnet werden kann, insofern es ihnen nicht um ein besseres Leben, sondern ums bloße Überleben geht. In der Regel versuchen die Flüchtenden zunächst nur, dem unmittelbaren Kriegsgebiet, der Kampfzone, zu entkommen, und dabei suchen sie Zuflucht in den Teilen ihres Landes, wo (noch) nicht gekämpft wird. Erst wenn das nicht mehr möglich ist, weil das gesamte Land zum Kriegsgebiet geworden oder die Versorgung der Flüchtlinge zusammengebrochen ist, verlassen sie ihr Land. Doch auch dann bleiben die meisten von ihnen in dessen unmittelbarer Umgebung und suchen Zuflucht in den von den Vereinten Nationen oder humanitären Hilfsorganisationen «heimatnah» betriebenen Flüchtlingslagern. Das «größte Flüchtlingslager der Welt», das zu einer Großstadt mit bald einer halben Million Bewohner angewachsene Lager Dadaab an der kenianischen Grenze zu Somalia, ist dafür ein Beispiel.[6] Dasselbe zeigt sich auch im syrischen Bürgerkrieg, wo die überwiegende Mehrheit der Menschen, die auf der Flucht sind, sich entweder noch im eigenen Land aufhält oder in einem der großen Flüchtlingslager in Jordanien, dem Libanon oder der Türkei untergekommen ist. Die Fliehenden tun das in der Erwartung, dass der Bürgerkrieg in absehbarer Zeit endet und sie dann wieder in ihre angestammten Wohnorte zurückkehren können. Erst wenn die Lage in den Flüchtlingslagern infolge einer sich verschlechternden Versorgung durch das Hilfswerk der Vereinten Nationen unerträglich wird oder die Aussicht auf Rückkehr von Monat zu Monat und schließlich Jahr zu Jahr immer weiter schwindet, entschließen sich die Menschen, den Weg nach West- und Nordeuropa zu wagen, um dort – womöglich – eine neue Heimat zu finden.
Die Stärke des Flüchtlingsstroms wächst in diesem Fall also mit der Perspektivlosigkeit in den Lagern und der Dauer des Bürgerkriegs. Wollen die Zielländer die auf diese Weise entstehenden Flüchtlingsströme begrenzen oder verkleinern, so müssen sie das Versorgungsniveau in den heimatnahen Flüchtlingslagern verbessern und sich um eine Beendigung des Bürgerkriegs bemühen. Im Unterschied zur Armutsmigration können politische Maßnahmen und wirtschaftliche Hilfsleistungen hier durchaus kurzfristige Wirkung zeitigen, und sie tun das umso mehr, je früher sie erfolgen und je konsequenter sie beibehalten werden. Hat hingegen eine kontinuierliche Verschlechterung der Lebensbedingungen in den Lagern erst einmal eingesetzt und sind die Flüchtlinge hinsichtlich der baldigen Rückkehr in ihre Heimat desillusioniert, ist es nur noch schwer möglich, diesen Prozess zu stoppen. Versäumnisse lassen sich dann nicht mehr nachholen und Fehler kaum noch ausbügeln.
Bei einer ersten, noch ganz vorläufigen Inaugenscheinnahme des Problems zeigt sich, dass die Länder des reichen Nordens erhebliche finanzielle Mittel aufwenden und große politische Anstrengungen unternehmen müssen, wenn sie die Flüchtlingsströme von Süden nach Norden begrenzen und wieder unter Kontrolle bringen wollen. Dafür werden verschärfte Grenzsicherungsanlagen nicht genügen, nicht in humanitärer, aber auch nicht in politisch-operativer Hinsicht: Grenzsicherung, in welcher Form auch immer, ist nämlich defensiv, und bloße Defensive wird nicht ausreichen, um die Herausforderung zu bewältigen. Das schließt deren Erfordernis nicht von vornherein aus. «Wenn Menschen mit einer liberalen Haltung», schreibt der niederländische Soziologe Paul Scheffer, «nicht über Grenzen nachdenken wollen, dann ziehen am Ende Menschen mit autoritären Einstellungen die Grenzen.»[7] Das ist sicherlich richtig. Aber letzten Endes wird alles davon abhängen, dass die Länder der südlichen Hemisphäre sozial und wirtschaftlich stabilisiert werden. Das wiederum wird auf einen kontinuierlichen Transfer von Finanzmitteln hinauslaufen. Das Problem dabei ist freilich, dass viele Transfers der Vergangenheit keineswegs die allgemeinen Lebensbedingungen in den Ländern des Südens verbessert haben, sondern in den Taschen der dortigen Eliten oder einzelner Bürgerkriegsparteien gelandet sind. Die Finanztransfers müssen also mit einer nachhaltigen Veränderung der politischen Konstellationen in den Empfängerländern verbunden sein, wenn sie die angestrebte Wirkung entfalten sollen. Das ist leicht gesagt, aber dafür, wie es erreicht werden kann, fehlt nach dem Scheitern des amerikanischen Transformationsprojekts im Irak und auch nach dem Fehlschlag des «arabischen Frühlings»[8] eigentlich jedes Konzept.
Wohlstandszentren, Arbeitskräftewanderung und Bevölkerungsentwicklung
Der Norden kann ohne eine kontinuierliche Zuwanderung von Arbeitskräften nicht auskommen. Die Untersuchungen der jüngeren Migrationsforschung zeigen, dass seit jeher Wanderungen stattgefunden haben: Größere und kleinere Menschenmengen zogen dahin, wo sie Arbeit und Unterhalt zu finden hofften. Das gilt für die Söldner des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, die sich regelmäßig dort versammelten, wo ein Krieg auszubrechen drohte oder ein Herrscher Truppen aufstellte;[1] das gilt ebenso für die Bauern, die die Donau entlang nach Siebenbürgen zogen, die dem Ruf einer russischen Zarin an die Wolga folgten oder, nachdem sie von «Pioniermigranten»[2] von den fruchtbaren Gebieten westlich des Mississippi erfahren hatten, über den Ozean in die Neue Welt auswanderten. Und es gilt für die Arbeiter, die innerhalb des preußischen Staates aus Schlesien ins Ruhrgebiet abwanderten, wo im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine Montanindustrie entstand, die immer mehr Arbeitskräfte brauchte.[3] «Migration ist eine zivilisatorische Unentbehrlichkeit» – so der französische Annales-Historiker Fernand Braudel.
Migration geht fast immer dorthin, wo die drei Produktionsfaktoren Boden, Kapital und Arbeit zusammengebracht werden. Boden ist immobil, und die meisten Rohstoffe, die aus ihm gefördert werden, Erze und Kohle im Fall der Montanindustrie, konnten im 19. Jahrhundert aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nur über begrenzte Entfernungen transportiert werden. Kapital hingegen ist hochgradig mobil; seit der Entstehung des Bankensystems im spätmittelalterlichen Europa lässt es sich zu relativ niedrigen Kosten von einem Ort zum andern transferieren. Der Produktionsfaktor Arbeit rangiert, was Mobilität anlangt, zwischen Boden und Kapital. Da ihr Transfer erheblich kostengünstiger ist als der von Bodenschätzen, kommt die Arbeit eher zu den Bodenschätzen als umgekehrt. Im Fall der bäuerlichen Bewirtschaftung des Bodens ist das ohnehin der Fall. Die Regel, dass Migration dorthin geht, wo Arbeitskraft gebraucht wird, ist erst mit der digitalen Revolution bis zu einem gewissen Grad außer Kraft gesetzt worden – das Internet hat das Erfordernis der Migration von Arbeitskräften in die Prosperitätszonen der Weltwirtschaft spürbar relativiert. Ohne das Internet würde noch viel mehr Arbeitsmigration stattfinden, und der Norden wäre noch stärker auf Zuwanderung angewiesen, um seinen Wohlstand zu wahren.
Die räumlich nicht kongruenten Dynamiken von Bevölkerungsentwicklung und Arbeitskräftenachfrage in den Zentren wirtschaftlichen Wohlstands haben seit jeher zu Migrationsbewegungen geführt; wenn man diese im Zeitraffer erfasst und in Form von Pfeilen und Linien in Karten einträgt, entsteht ein Bild von Strömen, die sich immer wieder verändern, neue Schwerpunkte bilden und alte Wirtschaftsräume entvölkern. Was wir dabei sehen, ist eine Wirtschaftsentwicklung, die häufig auf die politische und soziale Ordnung zerstörerisch einwirkt, indem sie überkommene Sozialordnungen austrocknet und ältere Machtstrukturen untergräbt. Gleichzeitig aber lässt sie neue Prosperitätsräume und Machtzentren entstehen. Diese Prozesse lassen sich mit dem von dem Wirtschaftswissenschaftler Joseph Schumpeter geprägten Begriff der «kreativen Zerstörung» kennzeichnen:[4] Die Entstehung des Neuen ist aufs engste mit dem Ruin der alten Ordnung verbunden, und fast jeder Zugewinn in dem einen Raum ist mit Verlusten in einem anderen verbunden. Die Träger der alten Ordnung wiederum wollen die von ihnen als bloß destruktiv wahrgenommene Entwicklung nicht hinnehmen und erwehren sich der durch Migration erfolgenden Macht- und Prosperitätsverlagerung, indem sie Wanderungsprozesse zu unterbinden suchen. Es sind nicht nur die Einwanderungsländer, wie man zurzeit meinen könnte, sondern auch die «abgebenden» Länder, die sich um eine Begrenzung, zumindest eine Kontrolle der Migration bemühen. Gegen die Veränderungsdynamik des Fluiden setzen sie die Ordnungsstrukturen des Stationären, und diese beginnen bei der Fesselung menschlicher Arbeitskraft an den Boden, etwa in Form der Leibeigenschaft als der nach der Sklavenwirtschaft radikalsten Blockierung der Exit-Option,[5] und reichen bis zu den Regimen politischer Grenzziehung, die bloß imaginierte Grenzen, aber auch Grenzen mit Mauern und Stacheldraht oder sogar den Schießbefehl umfassen. Je stärker durch diese Grenzregime Linien in physische Sperren verwandelt werden, desto intensiver ist damit die Erfahrung von «Drinnen» und «Draußen» verbunden, die in der Wahrnehmung der meisten Menschen immer noch die Schlüsselerfahrung der politischen Ordnung darstellt. Politische Ordnung beginnt mit der Unterteilung des Raums in Räume, und das erfolgt durch Grenzziehung. Ein Raum ohne Grenzen ist ein Raum ohne politische Ordnung.[6]
Was wir in der Geschichte beobachten, ist der Widerstreit zwischen einer vor allem ökonomischen Imperativen folgenden Dynamik mit immer neuen Formen der Schwerpunktbildung und einem gesellschaftspolitischen Ordnungsmodell, das auf Stabilität und Dauer abzielt. Der Gegensatz dieser beiden Ordnungsvorstellungen ist in der politischen Ideengeschichte vielfach ausformuliert worden, etwa in der Gegenüberstellung von Individuum und Gemeinschaft: Eine Gemeinschaft, die von einer starken Abwanderung betroffen ist, weil sich zahlreiche Mitglieder auf den Weg machen, um andernorts nach wirtschaftlich besseren oder politisch freieren Lebensbedingungen zu suchen, errichtet Barrieren, um die Abwanderung physisch zu blockieren, oder sie entwickelt Ideologien, in denen die Bindungen an Boden, Familie und Vaterland herausgestellt und auf diese Weise Verpflichtungen konstruiert werden, denen man sich nicht entziehen kann, ohne als Verräter diffamiert zu werden. Die Abwanderungswilligen stellen dem die verschiedenen Narrative der Freiheit und das Recht auf individuelle Glückssuche entgegen. Der Konflikt zwischen einer Ordnung der dynamischen Veränderung und einem stationären Regime der Grenzen ist also auch ein Gegeneinander normativer Vorstellungen.
In der politischen Realität bleibt es aber nicht beim unvermittelten Gegeneinander der zwei Idealtypen von Ordnung, sondern es kommt zu Arrangements, in denen beide Ordnungsvorstellungen miteinander verbunden sind. Solche Arrangements entstehen, weil Gesellschaften an Überbevölkerung leiden und ihre Ressourcen nicht mehr ausreichen, um die auf ihrem Territorium lebenden Menschen zu ernähren. Auswanderung dient dann dazu, Hungerkatastrophen, den Anstieg des Gewaltniveaus innerhalb einer Gesellschaft oder den Ausbruch eines Bürgerkriegs zu vermeiden. Die Auswanderung aus Irland im 19. Jahrhundert, in deren Folge die Bevölkerung der Insel von 8,2 Millionen Einwohnern im Jahre 1841 auf 6,5 Millionen im Jahre 1851 sank, die Auswanderung aus Deutschland, insbesondere aus den Mittelgebirgen von Eifel und Hunsrück bis zum Erzgebirge, schließlich die kontinuierliche Auswanderung aus Nord- und Süditalien sind Beispiele für Migrationsströme, die auf die Überbevölkerung von Räumen und dadurch verursachte Krisen zurückgehen.[7] Die Forschung hat sich insgesamt mehr für die Zielländer der Migration als für deren Herkunftsländer interessiert, weshalb es keine systematischen Studien darüber gibt, welche sozialen und wirtschaftlichen Folgen die Ab- und Auswanderung dort hatte. Dass es nicht nur positive waren, etwa der Abbau des Bevölkerungsüberschusses, sondern auch Sozialbeziehungen und Vertrauensstrukturen zerfielen, blieb lange Zeit unbeachtet.[8] Nicht alle Einwände, die gegen ein an den Erfordernissen der Wirtschaft orientiertes liberales Migrationsregime geltend gemacht werden, sind grundsätzlich reaktionär oder nationalkonservativ. Es kann darin auch um die Überlebensfähigkeit der Auswanderungsländer gehen.
Schärfer wird die Debatte über die Vor- und Nachteile von Migration freilich in den Zielländern geführt; hier prallen die gegensätzlichen Positionen mit größerer Unversöhnlichkeit aufeinander. Auf der einen Seite stehen heute jene, die das Erfordernis einer Zuwanderung von Arbeitskräften herausstellen, wenn man auf längere Sicht das erreichte Wohlstandsniveau halten und in der internationalen Konkurrenz um globale Märkte bestehen möchte. Diese Position ist nicht mit einer humanitären Argumentation zu verwechseln, die sich um die Not der Flüchtlinge aus Elends- und Bürgerkriegsgebieten dreht, aber sie kann mit ihr ohne weiteres ein Bündnis im Kampf um die politische Mehrheit in einer Gesellschaft eingehen. Entscheidend sind dabei die Präferenzen in der gesellschaftlichen Mitte. Dem steht eine Sichtweise gegenüber, der zufolge Zuwanderung, wenn sie ein gewisses Niveau überschreitet, den Zusammenhalt der Gesellschaft und deren zentrale Werte bedroht. In der gemäßigten Variante dieser Sicht wird auf die soziopolitische Kultur des Landes verwiesen; in der extremen geht es um die ethnische Identität des Volkes, die durch die nicht dazu passenden Zuwanderer gefährdet sei. Eine mittlere beziehungsweise vermittelnde Position stellt die Erfordernisse der Wirtschaft in Rechnung, macht aber geltend, dass Migranten eine erkennbare Bereitschaft zur Akkulturation an die Lebensweise und Werteordnung der Aufnahmegesellschaft mitbringen müssten: Es wird keine völlige Assimilation der Neuankömmlinge erwartet, aber in ihren soziokulturellen Gepflogenheiten sollen sie sich an das Aufnahmeland, in dem sie womöglich dauerhaft bleiben werden, schon anpassen. So jedenfalls stellt sich die vielschichtige Diskussionslage in Deutschland dar.
Im Fall der Arbeitsmigration geht es freilich nicht nur um Diskurse, sondern auch um tatsächlich realisierte Gesellschaftsmodelle. Zwei gegensätzliche Typen lassen sich dabei unterscheiden: Auf der einen Seite stehen die tief in ihren Traditionen verwurzelten Gesellschaften, die, weil sie sich wesentlich oder ausschließlich über die eigene Geburtenrate reproduzieren, eine Politik der maximalen Aufwertung ihrer knappen Humanressourcen betreiben. Das wichtigste Beispiel für diesen Typ, den der italienische Demograph und Migrationsforscher Massimo Livi Bacci als «geschlossene Gesellschaft» bezeichnet, ist Japan.[9] Dem stellt er die «offene Gesellschaft» gegenüber, die das Angebot von Einwanderungskandidaten gezielt ausnutzt, Zuwanderung systematisch steuert und in die Fähigkeiten der Zugewanderten investiert. Australien und Kanada (bis vor kurzem auch die Schweiz) repräsentieren diesen Typ, der nicht nur auf biologische, sondern auch auf soziale Reproduktion des Arbeitskräfteangebots setzt. Bacci weist darauf hin, dass sich im öffentlichen Diskurs der meisten europäischen Länder unter dem Druck der jüngsten Wirtschaftskrise die Vorgaben einer geschlossenen Gesellschaft durchgesetzt haben, was aber nicht heißt, dass die europäischen Länder auch tatsächlich geschlossene Gesellschaften sind; die demographische Lage zwingt sie nämlich dazu, eine begrenzte Zuwanderung zuzulassen. Aber weil sie sich dazu nicht offen bekennen, können sie diese Zuwanderung nicht nach ihren Erfordernissen steuern.
Die europäischen Staaten schwanken zwischen beiden Formen des Umgangs mit Migration und sind nicht in der Lage, eine definitive Entscheidung für den einen oder anderen Typ zu treffen. Bacci bemerkt dazu: «Die Gesellschaft soll ‹geschlossen› sein, ‹aber nicht zu sehr›, und die Gesellschaft soll ‹offen› sein, ‹aber nicht zu sehr›. Oder anders gesagt, die Europäer möchten eine geschlossene Gesellschaft, aber sie sind gezwungen, sie zu öffnen, und laufen damit Gefahr, die schlimmste und schizophrenste aller Entscheidungen zu treffen, das heißt, eine de facto offene Gesellschaft mit einer Politik zu verwalten, die für eine geschlossene Gesellschaft entworfen wurde.»[10] Eine Folge dieser schwankenden Politik ist ein zahlenmäßig deutliches Anwachsen der illegal in der EU befindlichen Migranten, die auf sieben bis zehn Millionen geschätzt werden. Eine andere Folge ist: Während sich die USA, Kanada und Australien durch eine entsprechende Einwanderungspolitik die Zuwanderer aussuchen, die sie brauchen und die zu ihnen passen, tun die Europäer das genaue Gegenteil; in der Konkurrenz zwischen Nordamerika und Europa wird das über kurz oder lang Auswirkungen haben. Kanada hat sich darum bemüht, Syrer aus der gebildeten Mittelschicht ins Land zu holen; Deutschland hingegen hat die aufgenommen, die es bis hierher geschafft haben. Das war zunächst eine Folge unterschiedlicher Konstellationen: einer langfristig angelegten Einwanderungspolitik Kanadas und einer humanitär motivierten Reaktion auf die katastrophale Versorgungslage der Flüchtlinge auf der Balkanroute. Vergleicht man beides aber unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlich notwendigen Zuwanderung, ist das kanadische Modell das überlegene.
Die Bundesrepublik Deutschland ist dabei freilich in einer ganz besonderen Situation, denn im Unterschied zu fast allen anderen Ländern der EU leidet sie nicht an einer Unterbeschäftigungskrise, sondern befindet sich in einer ökonomischen Wachstumsphase, und dementsprechend ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf einem relativ niedrigen Stand. Gleichzeitig hat Deutschland eine der niedrigsten Geburtenraten in der EU und ist darum auf die Zuwanderung von Arbeitskräften angewiesen, wenn es seine ökonomische Position in Europa und der Welt nicht verlieren und das Wohlstandsniveau der Bevölkerung halten will. Der Zukunftsforscher Christian Böllhoff sieht Deutschland «in der Altersfalle» und prognostiziert, «das letzte Jahrzehnt der Prosperität» habe begonnen: Im Jahr 2040 werde es eine Fachkräftelücke von knapp vier Millionen Menschen geben; während zurzeit auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter 35 Rentenbezieher kämen, würden es 2040 schon 56 sein, weil die Zahl der Erwerbsfähigen bis dahin um 15 Prozent zurückgehen werde.[11]
Das sind indes Berechnungen, die ausschließlich auf der biologischen Reproduktionsrate beruhen und in die deren soziales Pendant, also die Zu- und Einwanderung, nicht einbezogen ist. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Zeit der Erwerbsfähigkeit auszudehnen. Aber selbst eine deutliche Verlängerung der Lebensarbeitszeit dürfte nicht ausreichen, um die Folgen der gestiegenen Lebenserwartung der Menschen in der Rentenkasse auszugleichen. Letzten Endes wird also alles von der sozialen Reproduktion, der Zuwanderung von Arbeitskräften, abhängen. Das dürfte mit einer der Gründe gewesen sein, warum die Bundesregierung im Sommer/Herbst 2015 einen von den anderen EU-Ländern abweichenden Kurs gesteuert und mehr als eine Million Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und Afghanistan ins Land gelassen hat. Nicht alle von ihnen werden bleiben, einige, weil sie es nicht wollen, andere, weil sie es aus rechtlichen Gründen nicht dürfen; aber in die Befähigung derjenigen, die bleiben, wird die Bundesrepublik erheblich investieren, damit sie einen relevanten Beitrag zur Schließung der beschriebenen Lücke leisten können.
Die Bundesrepublik Deutschland hat, wiewohl das aufgrund der demographischen Prognosen angezeigt gewesen wäre, in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten keine systematische Einwanderungspolitik betrieben. Die Vernachlässigung dieses Politikfeldes hatte vorwiegend ideologische Gründe, die in der Formel «Deutschland ist kein Einwanderungsland» ihren Niederschlag gefunden haben. Eine Formel, die nicht nur politisch kurzsichtig, sondern auch empirisch falsch war. Tatsächlich ist die Bundesrepublik Deutschland schon seit langem ein Zu- und Einwanderungsland, beginnend bei den Vertriebenen und Aussiedlern der unmittelbaren Nachkriegszeit über die bis 1961 in die Bundesrepublik kommenden DDR-Flüchtlinge bis zu den Russlanddeutschen, die nach 1990 nach Deutschland kamen, von den «Gastarbeitern» aus Italien, Jugoslawien und der Türkei, die zu Einwanderern wurden, ganz zu schweigen.[12]