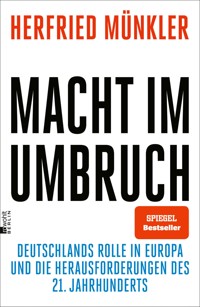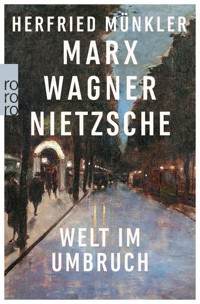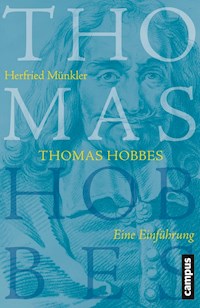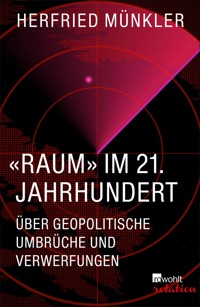12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Staatserzählungen: Ein aktueller Blick auf die Rolle des Staates in Zeiten politischer Unordnung In einer Welt voller Extremismus, Globalisierung und weltpolitischer Verwerfungen ist es wichtiger denn je, die Rolle des Staates zu hinterfragen. Staatserzählungen versammelt Beiträge renommierter Experten wie Herfried Münkler, Jürgen Kaube, Wolfgang Schäuble, Horst Bredekamp und Georg Nolte, die aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten, was der Staat heute leisten kann und muss. Die Autoren widmen sich grundlegenden Fragen: Was bedeutet es, in der heutigen Zeit Staatsbürger zu sein? Wie haben sich die Bilder des Staates in der Bundesrepublik gewandelt? Welche Rechte hat der Staat im Kampf gegen Gewalt und Terror? Und warum brauchen wir eine neue Erzählung Europas? Ergänzt durch den Blick von Wolfgang Schäuble aus der politischen Praxis, bietet dieses Buch eine dringend benötigte Bestandsaufnahme und zeigt Wege auf, wie die Demokratie zukunftsfähig gemacht werden kann. Ein Muss für alle, die verstehen wollen, was der Staat heute leisten muss, um die politische Ordnung zu gestalten und den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Grit Straßenberger • Felix Wassermann (Hg.)
Staatserzählungen
Die Deutschen und ihre politische Ordnung
Über dieses Buch
In Zeiten der politischen Unordnung: Was kann der Staat heute noch leisten?
Wer über Politik spricht, muss über den Staat sprechen. Der Staat durchdringt alle Lebensbereiche, prägt unsere politische Ordnung – und will immer wieder aufs Neue hinterfragt werden: Was ist der Staat eigentlich? Und was bedeutet es heute, Staatsbürger zu sein? Diesen und anderen Fragen widmen sich in diesem Band einige der renommiertesten Vertreter ihres Faches aus unterschiedlichsten Perspektiven. So zeigt der Kunsthistoriker Horst Bredekamp, wie sich die Bilder des Staates – wortwörtlich verstanden – in der Bundesrepublik gewandelt haben. Das komplizierte Verhältnis von Beratern und Machthabern bis zu den Einflüsterern der Kanzlerin schildert Jürgen Kaube, während der Völkerrechtler Georg Nolte ganz aktuell nach dem Recht des Staates im Krieg fragt: Was darf er tun, um Gewalt und Terror zu bekämpfen? Neben weiteren Beiträgen erklärt Herfried Münkler, warum wir eine neue Erzählung Europas brauchen, und all dies ergänzt Wolfgang Schäuble durch den Blick aus der politischen Praxis auf das Verhältnis von Staat und Religion in der pluralistischen Gesellschaft.
In Zeiten von Extremismus, Globalisierung und weltpolitischen Verwerfungen ist diese Bestandsaufnahme nötiger denn je. Ein Buch, das nicht zuletzt zeigt, wie die Demokratie zukunftsfähig gemacht werden kann.
Vita
Die Autoren: Herfried Münkler, Professor für Politikwissenschaft; Jürgen Kaube, Herausgeber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung»; Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages; Horst Bredekamp, Gründungsintendant des Berliner Humboldt-Forums; Georg Nolte, Professor für Völkerrecht; Steffen Martus, Professor für Neuere Deutsche Literatur; Wilfried Nippel, Professor für Alte Geschichte; Friedbert W. Rüb, Professor für Soziologie; Gabriele Metzler, Professorin für die Geschichte Westeuropas; Grit Straßenberger, Professorin für Politikwissenschaft; und Felix Wassermann, Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Mai 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
Umschlagabbildung Markus Lange/Getty Images
ISBN 978-3-644-10059-6
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Der Staat ist ins Gerede gekommen. Geredet wird über Staatshilfen, Staatsbürgschaften und Staatsanleihen. Über Staatsgrenzen, Staatsaufgaben und Staatsversagen. Über den starken Staat, den schwachen Staat und den zerfallenden Staat. Über den Abschied von Staaten aus der Europäischen Union und über die Rückkehr des Nationalstaates. Über die Überforderung des Staates durch weltweite Kapital-, Menschen- und Informationsströme und über das staatspolitische Versagen der Eliten. Geredet wird auch über neue und doppelte Staatsbürger – und über diejenigen, die von ihrem Staat enttäuscht sind, ihn gar abschaffen oder, umgekehrt, ihn zurückhaben wollen.
Was erwarten die Deutschen heute von ihrem Staat? Was muss er, was kann er leisten? Wie soll und wird er in Zukunft aussehen? Über den Staat wird viel geredet, vieles wird auch zerredet. Die Lage ist unübersichtlich – für die Staatslenker ebenso wie für die Staatsbürger: Welchem politischen Gemeinwesen werden sich die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft zugehörig fühlen? Welcher Art von Gemeinschaft gilt ihre Loyalität? Kommt es auf politische Loyalität überhaupt noch an in einer individualisierten, global vernetzten Welt?
Staatserzählungen stiften – anders als das bloße Gerede über den Staat – Orientierung und Identität. Sie erzählen uns davon, wer wir sind und wer wir sein wollen. Sie berichten Freunden und Fremden, woher wir kommen und wohin wir als politische Gemeinschaft gehen wollen. Sie geben Sinn und stützen politische Entscheidungen in unübersichtlichen Zeiten. Sie beurteilen die politischen Wege, die eingeschlagen wurden, und erinnern uns an die ausgeschlagenen Alternativen. Sie machen die Risiken politischen Handelns sichtbar, und sie zeigen auf, was wir aus historischen Erfahrungen lernen können. Damit sind Staatserzählungen die eigentlichen Stützen der politischen Ordnung. Sie helfen Staatslenkern und Staatsbürgern, den Überblick zu wahren und die politische Gemeinschaft auf ihrem Weg in eine offene Zukunft zusammenzuhalten.
Was der Staat ist, was er sein kann und was er sein soll, muss immer wieder neu erzählt werden – gerade zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Denn das Funktionieren des Staates erschöpft sich nicht in der effizienten Verwaltung von Sachaufgaben. Der Staat begegnet uns immer auch in seinen Symbolen und Repräsentationen, etwa in Nationalflaggen und Staatsgebäuden. Diese aber bedürfen der Deutung, der Sinnstiftung, der Erzählung: Was bedeutet «Schwarz-Rot-Gold» noch für uns, und wie wollen wir das zukünftig deuten? Was meint «Dem deutschen Volke» heute, und wen soll es morgen meinen? Welchen Staat erleben und wünschen sich die Deutschen als ihre politische Ordnung?
Dieser Band versammelt Neuerzählungen des deutschen Staates. Die Autorinnen und Autoren wagen darin gegen das allgemeine Staatsgerede neue, mutige Erzählungen aus unterschiedlichen Perspektiven. Als Wissenschaftler, Journalisten und Intellektuelle, politische Praktiker und Kommentatoren verbindet sie die Sorge um den Staat und seine prekär gewordene politische Ordnungsleistung. Pointiert und streitbar beziehen sie hierzu Stellung. Denn sie wollen die Gemeinschaft der Staatsbürger mit ihren Erzählungen überzeugen. Zugleich reflektieren sie ihre eigene Rolle als Staatserzähler, auf die die Demokratie in Zeiten der populistischen Kritik an Eliten und Experten mehr denn je angewiesen ist. Auch davon erzählt dieser Band.
Grit Straßenberger und Felix Wassermann, März 2018
Jürgen Kaube
Fürstenberatung mit und ohne den Fürsten
Die Täuschung ist ihrem Wesen nach eine Profession, zu der man sich nicht bekennen kann.
Torquato Accetto
I.
In seiner Schrift «Die Germanen» kommt Tacitus unter anderem auf die Art zu sprechen, in der sie kollektiv verbindliche Entscheidungen herbeizuführen pflegen. Da sind zunächst die Lose und Wahrsagungen. Bei Letzteren fällt ihm auf, dass dieses Volk es auch mit Vorahnungen von Pferden versucht: «Sie werden auf öffentliche Kosten in Hainen und auf Waldlichtungen gehalten, sind glänzend weiß und von keiner irdischen Arbeit berührt [nullo mortali opere contacti].» Je nachdem, wohin die Pferde laufen, fällt die Entscheidung für die eine oder die andere Option.
Dann wendet sich Tacitus den Volksversammlungen zu. Dort sprechen die Clanchefs (rex vel princeps), und der Adel murrt entweder oder er klatscht. Etwas später, er ist eigentlich schon beim Privatleben der Germanen, schiebt Tacitus noch eine Beobachtung nach. Über Frieden und Krieg berieten sie sich «sehr häufig bei Gelagen, gleich als meinten sie, dass zu keiner Zeit der Sinn so sehr für einfache Gedanken [simplices cogitationes] erschlossen sei oder sich für große erwärme». Ohne Verschlagenheit und Schläue nämlich teile das Volk in der Ungebundenheit eines heiteren Anlasses seine innersten Gedanken: «ergo detecta et nuda omnium mens».
In allen drei Fällen, bei den Losen, den Pferden und den Beratungen unter Einfluss geistiger Getränke, geht es ersichtlich darum, für kollektive Entscheidungen eine offene Situation zu schaffen. Wer sich darüber erhebt, dass einfache Gesellschaften der Wahrsagerei, dem Orakel und der Deutung von Naturzeichen so großen Raum gegeben haben, sollte mitbedenken, dass hier nicht nur ein Tribut an einen ebenso sinnhaft wie angstvoll empfundenen Kosmos entrichtet werden sollte. Was uns als Auslieferung an den Zufall erscheinen kann, war auch ein Mittel, um strategische Kommunikation und den Einfluss interessierten Rats zu begrenzen. «Sie beraten», schreibt Tacitus mit Blick auf den Bierkonsum bei Entscheidungsverfahren, «wenn es ihnen nicht gelingt, sich zu verstellen, und beschließen, wenn sie sich nicht irren können [deliberant, dum fingere nesciunt, constituunt, dum errare non possunt].»
Dann können sie nicht viel beschlossen haben, möchte man aus der Perspektive der modernen Demokratie sagen. Das Problem, wie mit dem Misstrauen gegenüber den Interessen der Ratgebenden umgegangen wird, ist eine politikhistorische Konstante, die Menge an Entscheidungen aber hat dramatisch zugenommen. Heute wird schlechterdings alles beschlossen, auch wenn man sich irren kann. Vielleicht sollte man Demokratie, so wie wir sie kennen, ohnehin als Entscheidungsstruktur behandeln, die auf ein anwachsendes Bedürfnis reagiert: zu fast allem kollektiv verbindliche Normen zu bilden und dann die Folgen davon abzufangen, dass Entscheidungen unter diesen Umständen stark irrtumsanfällig sind oder mit wechselnden Mehrheiten – Mehrheitsirrtümern gewissermaßen – schwanken. Auf Dissens, so könnte man das auch formulieren, wird inzwischen nicht mehr konservativ reagiert, indem das Strittige unentschieden bleibt, sondern progressiv, indem entschieden wird, aber Entscheidungen jederzeit rückgängig gemacht werden können: Maastricht-Kriterien und ihre sofortige Nichtanwendung, Verlängerung der Restlaufzeiten und Energiewende, Verweis auf das Dublin-Abkommen und anschließender Verweis auf seine Dysfunktionalität, unbegrenzte Aufnahme von Migranten und Rückführungsabkommen – wir leben in einer Zeit prominenter Beschlüsse, die wir fassen, auch wenn wir uns irren können. Wir. Die Jurisprudenz, die alle diese Entscheidungen einfangen und jede für rechtens, also zu Entscheidungen eines «Wir» frei von Willkür erklären soll, macht mitunter einen geradezu atemlosen Eindruck.
Aber das nur nebenbei. Für das folgende Argument ist der erste Teil des Befundes von Tacitus ausschlaggebend: Politische Beratung ist seit jeher mit dem Problem befasst, wie garantiert werden kann, dass sie nicht «durchtrieben und verschlagen» erfolgt. Denn immer schon wurde befürchtet, dass auf die kollektiv verbindliche Entscheidung Einfluss genommen wird, der nicht das Gemeinwohl im Sinn hat, sondern vor allem das eigene, ein partikulares Interesse. Lobbyisten sehen sich selbst als Berater im politischen Prozess. Wenn also nicht nur zu allen denkbaren Fragen politische Entscheidungen verlangt werden, sondern ganze Apparate existieren, die darauf Einfluss zu nehmen versuchen – wie stellt sich diese Lage dann aus Sicht der Entscheider dar? Wie kann gegenüber Machthabern sachlich kommuniziert werden, und wie können sie ihrerseits entscheiden, was ein sachlicher Beitrag ist? Die Geschichte der politischen Beratung kennt eine ganze Reihe von Einrichtungen, die ein spontanes, sachangemessenes und von strategischen Absichten möglichst ungestörtes Entscheiden absichern sollen. Man könnte sagen: Sie kennt eine ganze Reihe von funktionalen Äquivalenten für Bier.
II.
Um das Kommunikationsproblem der politischen Beratung richtig zu verstehen, ist es zunächst nötig, eine kleine Mehrdeutigkeit aufzulösen. Kann doch Beratung zweierlei bedeuten, je nachdem, ob mehrere sich beraten oder einer den anderen berät. Tacitus spricht von Beratungen, die deliberativ erfolgen: Die Entscheider – hier die Clanchefs – beraten also untereinander, um gemeinsam zu einer Entscheidung zu finden. Asymmetrisch ist die Situation hingegen, wenn ein schon feststehender Entscheider, dem im kritischen Fall sogar Willkür zugestanden ist, von Leuten beraten wird, die ihrerseits nur durch ihren Rat an der Entscheidung beteiligt sind. In beiden Situationen, in der Ratsversammlung wie bei der Fürstenberatung, im Gremium wie in der Unterredung von Gremien vor dem Letztentscheider, kommt die Frage auf, wie gesichert werden kann, dass die Entscheidung nicht auf falschen oder undurchsichtigen Informationen beruht. Im Folgenden interessiert uns vor allem der asymmetrische Fall. Er ist historisch häufiger und auch gegenwärtig einschlägiger.
Im Hintergrund der Frage nach einer nichtmanipulativen Beratungssituation steht die Tatsache, dass Entscheider, kybernetisch gesprochen, «high in energy, but low in information» sind. Talcott Parsons, der diese Unterscheidung in die Soziologie eingeführt hat, illustriert sie mit dem Reiter (high in information) eines Pferdes (high in energy), der aufgrund seiner kognitiven Möglichkeiten und technischen Befähigung das an sich stärkere System kontrollieren und steuern könne. Doch nicht nur in Sondersituationen – man denke an das Pferd von Jacques dem Fatalisten, Diderots Romanhelden, das immer dann unbeherrschbar durchbricht, wenn es einen Galgen in der Nähe wittert, und erst unter dem Galgen wieder haltmacht – kann sich diese Kontrollhierarchie umkehren. Sie ist von vornherein umgekehrt, wenn es um machtgesteuerte Entscheidungszusammenhänge geht. Wir sehen, so hat das der spanische Jesuit Baltasar Gracián im 17. Jahrhundert formuliert, das meiste nicht selbst, sondern hören nur davon, weswegen die Ohren die Hintertür der Wahrheit, aber die Eingangstür der Täuschung seien. Besonders Vorgesetzte, Chefs, Kanzler, Minister, Fürsten haben gegenüber ihrem Apparat und denen, die auf sie Einfluss nehmen können, den Nachteil, dass ihre Verarbeitungsmöglichkeiten eng begrenzt sind. «Auch ihre Aufmerksamkeit», heißt es bei Niklas Luhmann, «hat Grenzen, auch ihr Tag hat nur 24 Stunden. Durch Aufstieg in der Hierarchie bekommt man nicht mehr Bewusstsein, nicht mehr Kapazität für Aufmerksamkeit.» Oben ist Macht, die Konflikte formell entscheiden kann (high in energy), unten ist Macht, die Entscheidungen vorstrukturiert, kontrolliert, was überhaupt das Bewusstsein des Vorgesetzten erreicht und mit welcher Menge an Konflikten er oder sie sich befassen muss (high in information).
Das heißt nicht, dass es nicht auch Informationen gibt, über die nur Vorgesetzte verfügen. Beispielsweise können sie als Einzige vergleichen, was ihnen von verschiedenen Seiten vorgetragen wird, sofern diese Seiten sich nicht vorher untereinander abgestimmt haben. Und sie monopolisieren in Organisationen eine bestimmte Sorte externer Zugänge: etwa die Kommunikation mit anderen Vorgesetzten (vorausgesetzt, der Dienstweg wird eingehalten). Grundsätzlich aber kennen sie viele Sachzusammenhänge, über die sie entscheiden sollen, nur vom Hörensagen. Ungewiss bleibt für sie meist, ob das, was ihnen mitgeteilt wird, spontan und sachlich oder strategisch und mit sozialen Absichten mitgeteilt wurde. «Yes, Minister» – wenn der Vorgesetzte hinzutritt, ändert sich die Gesprächslage, weil sowohl das Motiv, dem Vorgesetzten zu gefallen, wie das Motiv, ihn zu lenken, einen unbezwingbaren Reiz ausüben; insbesondere die Idee, durch Gefallen zu lenken. Frühneuzeitliche Warnungen vor höfischen Schmeichlern, die bestenfalls nur nach dem Mund reden, schlimmstenfalls die Eitelkeit oder das Harmoniebedürfnis des Herrschers nutzen, um die eigene Sache voranzutreiben, füllen ganze Bibliotheksregale. Dass der Höfling niemals sagt, was er denkt, ist ein alter Topos, man findet ihn beispielsweise, lange vor Gracián, in George Puttenhams «The Arte of English Poesie» von 1589 oder auch in einem Vergleich von Louis Dorléans aus dem Jahr 1594: Der Mensch sei eine Auster, die sich nur öffne, wenn sie es wolle, seine Gedanken aber könne kein Sonnenstrahl durchsichtig machen.
Mitunter mögen solche Vergleiche nur dazu gedient haben, das Gerücht zu verbreiten, der Höfling denke überhaupt etwas. Doch für den Fürsten und jene, die sich Sorgen um ihn machen, war die Verstellung stets ein erstrangiges Problem, das nicht dadurch abgemildert wurde, dass auch die Empfehlung an den Herrscher lautete, die eigenen Gedanken vor seiner Umgebung verborgen zu halten: «Wer sich nicht zu verstellen versteht, versteht nicht zu regieren.» Denn wenn schlechterdings jeder dissimuliert, gehen, wie im Inneren der Auster, alle Lichter aus. Ratschläge wie derjenige Francesco Guicciardinis, eines Weggefährten Niccolò Machiavellis, der Fürst müsse seinen Ruf, tugendhaft und offen zu sein, mit der nur im Ernstfall eingesetzten Simulation kombinieren, weil nur die überraschend angewandte Täuschung wirksam sei, erneuerten bloß die Frage: Mit wem kann der Fürst sich besprechen, um zu entscheiden, ob der Ernstfall vorliegt? Und wie oft kann er ihn beanspruchen, ohne als nervös oder tyrannisch zu gelten? Ohne Täuschung geht es nicht. Aber man kann sich, wie der Philosoph Torquato Accetto 1641 nach einer einhundert Jahre langen Diskussion das Dilemma dieser Herrschaftstechnik zusammenfasst, zur Täuschung auch nicht bekennen. Accetto allerdings kannte den Lobbyismus noch nicht.
III.
Machtausübung ist, mit anderen Worten, nur als Zusammenarbeit denkbar, die ein Mindestmaß an Vertrauen darauf voraussetzt, dass die Motive für täuschende Kommunikation auf Distanz gebracht werden können. Wie das möglich ist, darüber hat sich die politische Literatur lange den Kopf zerbrochen. Allmählich ging sie dabei von moralischen Qualifikationen – der Ehrlichkeit der Beteiligten, ihrer religiösen Einstellung, ihren Werten – stärker zum «Legitimitätsglauben» der nachgeordneten Stellen und zu organisatorischen Gesichtspunkten über. Zunächst hieß es beispielsweise, die Berater sollten hohen Ranges und untereinander ranggleich sein, damit sie keinen Grund hätten, sich um des Aufstiegs willen einzuschmeicheln oder falsche Mitteilungen zu machen. Andererseits durfte ihr Rang nicht so hoch sein, dass sie auf die Idee kommen konnten, selbst Fürst werden zu wollen. Insofern war der Ehrgeiz dessen, der die eigene Karriere ganz an Loyalität bindet und um den Preis, von allen anderen und vor allem von seinesgleichen dafür gehasst zu werden, alles auf eine Karte setzt, nie zu verachten. Der Aufbau von Verwaltungen gilt, so gesehen, nicht nur einem Machtinstrument, sondern auch einem System des Bewährungsaufstiegs von Ratgebern. Eine vergleichbare Möglichkeit in den frühneuzeitlichen Herrschaftssystemen ist, dass die Berater in Verwandtschaftsbeziehungen zum Beratenen stehen, weil sie damit in ein System der Gegenseitigkeit und des Tauschs eingebettet sind. Heute finden sich an dieser Stelle Parteien samt den Ressourcen, auf die sie und Amtsinhaber zugreifen können, um Loyalität mit Gunsterweisen zu erwidern.
Auch diese letzten beiden Möglichkeiten setzen allerdings eine Lösung des Problems der Rivalität um die Position des Fürsten oder allgemeiner gesagt: des Vorgesetzten voraus. Denn solange es noch besteht, sind ja gerade Verwandte und Parteigenossen gefährlich. In einer historischen Lage, in der die Position des Fürsten ständig umkämpft werden und für Feindschaft sorgen konnte, musste jede Beratung zugleich als ein kommunikativer Test darauf wahrgenommen werden, ob der Fürst Schwächen zeigt. Rat ist desto fragwürdiger, je gefährlicher Entscheiden und je gefährdeter die Position des Entscheiders ist. Jede Sachfrage wird dann von einer Machtfrage überdeckt, alles kann als Zeichen für Regierungsunfähigkeit ausgelegt werden. Wer zu viel Gehör schenkt, gilt als abhängig, wer keines schenkt, verzichtet auf die Möglichkeit, Irrtümer anderen zuzurechnen.
Machiavelli zieht im dreiundzwanzigsten Kapitel von «Der Fürst» daraus eine erste Konsequenz. Der Fürst ist ein, und zwar der wesentliche Faktor in jeder Kommunikation, in die er eintritt. Also hängt die Qualität der Beratung vor allem von ihm ab. Gute Ratschläge beruhen auf der Informiertheit des Fürsten, nicht seine Informiertheit auf der Güte des Rats. Nur ein weiser Fürst werde auch gut beraten, heißt es. Nicht nur, weil er die Berater ja selbst auswählen muss. Die Art, wie der Fürst zuhört, ist selbst eine Kunst. Was auch bedeutet: Sie selbst kann zum Gegenstand von Rat werden. Machiavelli, der sich als Ratgeber empfahl, entwirft das Bild eines denkenden Fürsten, der nicht einfach nur Impulsen oder gängigen Maximen folgt, sondern sich ständig selbst im Spiegel seiner Umgebung beobachtet. Spätestens damit ist die politische Beratung reflexiv geworden.
Machiavellis Befund ist, dass Unehrlichkeit nicht einfach dadurch bekämpft werden kann, dass sich der Fürst an Schmeichelei desinteressiert zeigt und seinem Gegenüber versichert, die Wahrheit zu sagen habe für ihn keine negativen Folgen. Denn, so Machiavelli, «wenn Dir jeder die Wahrheit sagen darf, hört die Ehrfurcht auf». Kritisch sind also nicht nur Mitteilungsabsichten, sondern auch Mitteilungsfolgen. Vor dem Fürsten stellen schon Dritte eine Öffentlichkeit dar, also einen Kontext, in dem er das Gesicht verlieren kann. Der Ruf des Herrschers ist eine Ressource und will darum gepflegt werden. Machiavellis Lösung für das Dilemma, dass Informationsfragen immer auch Status- und Ansehensfragen aufwerfen, sind Arbeitsteilung und Rollentrennung. Der Fürst solle Berater berufen, die offen und angstfrei zu ihm sprechen können und denen er zu verstehen gibt, dass sie nur geschätzt werden, wenn sie keine Reserven zeigen. Aber sie sollten nicht über alles sprechen, sondern nur über das, wonach der Fürst sie fragt. Hier zeichnet sich schon der Spezialist, der Gutachter im Unterschied zum Vertrauten ab, so wie sich in dem merkwürdigen Umstand, dass Machiavelli seine Ratschläge zum Druck beförderte und zugleich mittels ihrer Zugang zum neuen Fürsten erlangen wollte, die spätere Differenzierung von politischer Theorie und politischem Rat andeutet. Rat ist Praxis. Guter politischer Rat ist darum einer, der nicht sofort und im besten Fall überhaupt nicht die Runde macht. Der lateinische Satz, dass die besten Berater die Toten sind, kann demnach nicht nur so gedeutet werden, dass die Toten keine Interessen mehr haben, sondern mag auch auf ihre Verschwiegenheit anspielen. «Indeed, this counsellor / Is now most still, most secret, and most grave», sagt Hamlet über den toten Polonius (III, 4).
IV.
Eine Lösung des Problems politischer Vertrauensbildung gegenüber Ratgebern ist also die Institutionalisierung von Rat, seine Überführung in organisierte Dienste und Karrierepfade, seine Spezialisierung. Ergänzt wird das im Zuge der Verberuflichung von Politik durch Gruppenkarrieren («Seilschaften») mit entsprechender Arbeitsteilung zwischen denen, die Mehrheiten beschaffen und mit ihrer Person dafür einstehen, und denen, die ihnen den Rücken freihalten; ihnen ist ein offenes Wort erlaubt, weil sie von vornherein auf jede Rivalität verzichten. Politischer Rat überzeugt nur, wenn er diesseits von Ambition und Bühne erfolgt. Die Vertrauten des Fürsten sehen den Menschen, die Person und das Amt – und niemand sieht ihnen dabei zu.
Dass der politische Entscheider einerseits ein Mensch ist und andererseits eine öffentliche Person, wurde schon früh festgehalten – am nachdrücklichsten von dem Humanisten Fadrique Furió Ceriol in seinem großartigen «El concejo y consejeros del príncipe» von 1559 –, um zwei Arten der Beratung voneinander zu unterscheiden: eine, die den Menschen unterrichtet, und eine, die den Politiker verbessert. Man dürfe, lautete der Rat an die Ratgeber, das eine mit dem anderen nicht verwechseln. «Öffentliche Person» meinte dabei allerdings nicht viel anderes als «politischer Amtsträger», jemanden, der mit der «res publica» befasst ist. Und «Mensch» meinte keine stark individualisierte Komponente, wie sich Ceriols These entnehmen lässt: Das, was den Fürsten als Menschen verbessere, teile er mit allen anderen Menschen; das, was ihn als Fürsten verbessere, sei die Orientierung an klassischen Beispielen erfolgreichen Regierens.
Demgegenüber ändert sich vieles, wenn der Politiker nicht nur ein Individuum ist, sondern als solches politisch wirksam wird, weil in Wahlkämpfen, aber auch in den innerparteilichen Auseinandersetzungen seine Beliebtheit, sein Stil und seine mediale Wirkung eine große Rolle spielen. Das Amt kann nicht unpersönlich ausgefüllt werden, es ernährt sich von der Person, prägt sie um, es frisst ihre Ehe, ihre Gesundheit, ihre Bildung. Die im Absolutismus aufkommende Ansicht, Ratgeber sollten dem Souverän sagen, was das Beste nicht für ihn, sondern für den Staat sei, den er repräsentiere, lässt die moderne Demokratie mit ihrer Parteienkonkurrenz insofern hinter sich. Als sie im 18. Jahrhundert Konturen gewinnt, heißt es bald, der wahre, obschon unsichtbare Souverän sei die öffentliche Meinung. Machtausübung bedeutet entsprechend: Agieren in der Sache, gegen die Rivalen und zugleich im Spiegel der Medien, weswegen der moderne Fürst auch nicht mehr schweigsam oder geheimnisvoll oder abwesend sein kann – das würde schlecht über den Sender kommen. Der Souverän sagt dem Fürsten, der darum keiner mehr ist, täglich, was er von ihm hält, wie der Fürst zu sein hat, warum das Gegenteil von dem, was entschieden wurde, richtig gewesen wäre, und er interessiert sich für schlechterdings alles am Fürsten, sogar für seine Spesenabrechnungen oder Jugendsünden.
Beratung diesseits der Expertise heißt unter diesen Umständen, beide Körper dieses Nichtherrschers aufeinander zu beziehen: die Person und die Funktion. Vertraute sind dann diejenigen, die auch die Schwächen des Beratenen thematisieren können, ohne dass gefürchtet werden muss, es gelange davon etwas an die Öffentlichkeit. Nicht Ehrlichkeit, sondern Publizität ist inzwischen das zentrale Problem des politischen Rats. Die wenigen Vertrauten bleiben im Unterschied zu Ratgebern qua Amt, den Ministern etwa oder den Experten, der öffentlichen Beobachtung folgerichtig stärker entzogen. Sie erheben nicht die Stimme, am wenigsten, wenn Kameras laufen. Wer kennt noch Eduard Ackermann, einen von Helmut Kohls engsten Vertrauten? Wer weiß etwas über Beate Baumann, die Angela Merkel berät?
Die Öffentlichkeit in modernen Demokratien thematisiert ihrerseits ständig Schwächen, Fehler, Kosten der Regierenden. Sie ist der Ratgeber, der vom Fürsten nicht um seine Meinung gebeten wurde und sie trotzdem laut äußert. Darum wird bei jeder Entscheidung mitbedacht, wie sie dort ankommt, was die Konkurrenz daraus machen könnte und wie das Entscheiden kommuniziert werden sollte. In einer vergleichsweise ideologiearmen Zeit sind die feststehenden Typen für eine solche Kommunikation allerdings rar geworden. Man kann nicht mehr einfach sagen: «Das kommt bei Christen, Freiberuflern, Proletariern aller Länder, Bauern auf jeden Fall gut an», oder: «So haben es König Numa, Cesare Borgia, Bismarck und Churchill auch gemacht.» Erkenntnisgewinn kann über solche Gewissheitsverluste hinwegtrösten: Was die Sachdimension des Entscheidens angeht, herrscht an Kennern der jeweiligen Materie kein Mangel, auch wenn beispielsweise Kriege oder IWF-Programme nicht immer den Eindruck machen, als konzentriere sich die Länderkenntnis bei den außen- und wirtschaftspolitischen Beratern.
Doch auch die Berater sind mit Unsicherheit konfrontiert, sobald es öffentliche Meinung gibt. Es steht für sie nicht fest, weshalb sie gehört werden: ihres Wissens und ihrer Urteilskraft wegen, aus symbolischen Gründen – damit überhaupt Beratung stattgefunden hat –, um den medialen Druck zu erhöhen oder, im Gegenteil, um eine Entscheidung aufzuschieben, weil die Beratungslage ist, wie sie immer ist: unklar. Die Mitglieder von Sachverständigenräten, Kommissionen und Beiräten können ein Lied davon singen.
Da auch ihr Rat medial beobachtet und mit dem Begriff «Technokratie» belegt wird, kehrt sich das ursprüngliche Dilemma der Beratung fast um. Das berühmte «Sie kennen mich» der Kanzlerin, das, in Kameras gesprochen, einen Sieg im Wahlkampf vorwegnahm, nahm in Anspruch, was einst Berater zum Fürsten gesagt haben mögen. Demokratie heißt, dass unwahrscheinliches Vertrauen unten, nicht oben aufgebaut werden muss. Entsprechend kehren sich auch die Motivprobleme um. Man kann sich beispielsweise leicht Situationen vorstellen, in denen feststeht, was zu tun ist, wenn man etwa nicht möchte, dass Flüchtlinge im Mittelmeer zu Tode kommen. Wenn Machiavelli die Welt des politischen Entscheidens nicht völlig verfehlt hat, enthebt eine solche sachlich klare Situation die Entscheider aber nicht der Frage, ob derlei Alternativlosigkeit dem sogenannten Souverän auch kommuniziert werden kann, ohne dass er sich in seiner Fähigkeit zu einem politischen Willen eingeschränkt fühlt. Souveräne, die zwar nur so heißen und es gar nicht sind, sondern mehr eine Meinungswolkenformation, die aber aus ihrer Bezeichnung als Souverän durchaus Folgerungen ziehen, können ungemütlich werden, wenn ihnen die Politik wiederholt Zwangsläufigkeiten vorrechnet. So wie einst der Fürst nervös geworden sein dürfte, wenn ihm die Berater sagten, es gehe nur so oder gar nicht. Nichts individualisiert mehr als der Widerstand gegen Sachgesetzlichkeiten – das gilt für Fürsten, das gilt aber auch für Wahlbevölkerungen auf der Suche nach «Identität».
Hier liegen die Grenzen der Technokratie und des Managements; es sind symbolische, nicht operative Grenzen, aber sie limitieren auch den operativen Spielraum, weil Symbole nicht gleichgültig sind. Politik wird darum, wenn sie rational in einem etwas umfassenderen Sinne sein will, mit einbeziehen, dass Rationalität nicht alles ist. Sie benötigt auch außerhalb des inneren Zirkels eine Sprache für das Gewollte im Unterschied zum sachlich Gebotenen. Wird zu stark betont, die politische Entscheidung sei gar keine, sondern zwangsläufig, kommt zwangsläufig vor allem Misstrauen auf; der Verweis auf «Sachlichkeit» sei auch nur eine Art zu dissimulieren.
V.
Der amerikanische Soziologe Harold Garfinkel hat vor gut fünfzig Jahren ein kleines Experiment durchgeführt, das für die Frage instruktiv ist, ob politische Beratung ehrlich erfolgen muss, um erfolgreich zu sein. Studenten seiner Universität wurden gebeten, im Rahmen einer psychotherapeutischen Beratung – es ging etwa darum, ob man religiös exogam heiraten soll – einem Experten zehn Fragen zu stellen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Anschließend wurden die Studenten aufgefordert, ihre Schlussfolgerungen aus den Antworten zu formulieren und mit dem Experten zu diskutieren. Die Pointe des Experiments bestand darin, dass die Abfolge der Ja-Nein-Antworten nach Zufallsprinzip festgelegt worden war, noch bevor die Fragen bekannt waren. Von den Beratenen wurden die Antworten dennoch als sinnhaft und hilfreich empfunden, was sich in ihren Kommentaren von Zufallsrat zu Zufallsrat dokumentierte. Existiert ein grundsätzliches Vertrauen in die Expertise der Experten, so könnte man daraus schließen, werden ihre Antworten selbst dann, wenn es gar keine sind, als Vorschläge in einem Prozess behandelt, in dem herausgefunden werden muss, was eigentlich die relevanten Themen der Beratung sind. Jegliche Mitteilung kann als ein Beitrag zur Herstellung eines verbindenden Musters verarbeitet werden, das am Beginn der Beratung gar nicht feststeht.
Im Hinblick auf politischen Rat formuliert: Jede politische Entscheidung hat eine solche Menge an Nebenfolgen zu gewärtigen, dass die Frage, worum es in ihr eigentlich geht, eine offene Frage ist. Griechenland: Geht es um die Einheit der Europäischen Union, das Festhalten an ökonomischen Regeln, um deren Rationalität, um die Rettung von Banken, um Signale an andere Länder? Flüchtlinge: Geht es um Fragen des Staats-, Völker- und EU-Rechts, um Humanität, um Fernsehbilder oder erneut um die Einheit der Europäischen Union oder Signale an andere Länder? Oder geht es jeweils um die Einschätzung, ob ein gewählter Kurs gegenüber Dritten (der eigenen Partei, Bayern, den Wahlbürgern, Kommunen, Brüssel, dem Budget, den Medien) durchzuhalten ist?
Das führt noch einmal zum Anfang zurück, zu den Losen als politischen Entscheidungshilfen. Oder sagen wir: zum Zufall. Oder sagen wir: zu den Pferden. Wie hatte Tacitus sie charakterisiert? «Sie werden auf öffentliche Kosten in Hainen und auf Waldlichtungen gehalten, sind glänzend weiß und von keiner irdischen Arbeit berührt.» Das gilt auch für Wissenschaftler. Im besten Fall halten sie sich, öffentlich finanziert, in Hainen auf, glänzen dort und haben keine Lastarbeiten zu verrichten. Was sie hervorbringen, sind aus Sicht der Politik Antworten, die, wie diejenigen in Garfinkels Experiment, etwas Zufälliges behalten. Viele der Antworten, die Politikberatung gibt, stehen ja ebenfalls durchaus ganz empirisch fest, bevor die Politik ihre Fragen überhaupt formuliert hat. Insofern ist die Analogie zu Garfinkels Test nicht willkürlich. Sie besagt nicht, im Kanzleramt werde gewürfelt. Umgekehrt: Rat, der stets, was seine Qualität, seine Anwendbarkeit, seine Quellen angeht, zufälliger Natur ist, wird weitgehend unabhängig von seinen Eigenschaften zu Entscheidungen verarbeitet. Wichtig ist nur, dass die Politik sich einen Reim auf Antworten zu machen vermag, die Antworten auf Fragen sind, die sie so gar nicht gestellt hat. Es geht darum, sich in einer Welt kontingenter Situationen ohne Wahrheiten zurechtzufinden. Wozu es wiederum, folgt man Machiavelli, vor allem eines intelligenten Entscheiders und nicht nur gelehrter Berater bedarf. Die Probleme der Fürstenberatung sind darum letztlich solche der Erziehung, man kann auch sagen: der Bildung des Personals.
Steffen Martus
Politische Erzählkunst im 19. Jahrhundert: die «Kinder- und Hausmärchen» der Brüder Grimm
Die bis heute populärste Staatserzählung des 19. Jahrhunderts handelt von einem Frosch. Die großen politischen Narrative dieser Zeit sind allenfalls noch historisch interessant: die Geschichte vom «Befreiungskrieg» des «Volks» gegen die napoleonische Besatzung, von der «Revolution» des Jahres 1848 oder von der Gründung eines «Deutschen Reichs». Diese Erzählungen berichten zu offenkundig von nationaler Ermächtigung und erinnern an die Defizite der deutschen Geschichte. Der Frosch aber konnte unbehelligt über alle Epochengrenzen hinweg bis in die Gegenwart hüpfen, weil seine politische Botschaft gar nicht auffiel. Er überlebte sogar den «mythenpolitischen Schnitt», den das Jahr 1945 für Deutschland bedeutete.[1] Wer die «Kinder- und Hausmärchen» der Brüder Grimm aufschlägt, stößt gleich zu Beginn auf die Geschichte vom Froschkönig. Der bildungsbürgerliche Zitatenschatz mag heute seinen Anspielungswert weitgehend eingebüßt haben, aber dieser Erzählanfang hat sich unsterblich ins kollektive Gedächtnis eingenistet: «In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien.»[2]
Die gelangweilte Jugendliche vertreibt sich die Zeit mit einer goldenen Kugel, doch sie entgleitet ihr und fällt in einen tiefen Brunnen. Ein Frosch wird auf die kläglich weinende Prinzessin aufmerksam und bietet ihr seine Hilfe an. In unsäglicher Trauer um das verlorene Spielgerät macht die Königstochter ein verhängnisvolles Angebot: «Ach ja», sagte sie, «ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wiederbringst.» Das Tier aber interessiert sich nicht für das zeremonielle Beiwerk, nicht für Gewänder, Kostbarkeiten aus der Staatsschatulle oder gar für Herrschaftsinsignien. Der unattraktive Frosch verschmäht die materielle Seite der Macht, denn nur so kann er den tiefen Graben überbrücken, der ihn schon allein körperlich von der Königstochter trennt. Ihn verlangt es nach innerlicher Zuwendung, nach Anerkennung und Respekt: «Deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine, und deine goldene Krone, die mag ich nicht; aber wenn du mich lieb haben willst, und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen: wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen.»
Die Königstocher willigt ein, weil sie auf die selbstverständliche Geltung natürlicher Grenzen und Hierarchien vertraut. Die Egalitätsphantasie erscheint zu pervers. Der «einfältige Frosch», so die Überlegung, werde sich stets «im Wasser bei seinesgleichen» aufhalten; er «kann keines Menschen Geselle sein». Das Tier aber beharrt auf dem Handel. Es will von den Tiefen des dunklen Brunnens in den inneren Zirkel der Herrschaftsfamilie aufsteigen. «Plitsch, platsch, plitsch, platsch» – eines Tages kommt das Geschöpf «die Marmortreppe heraufgekrochen, und als es oben angelangt war, klopfte es an die Tür und rief: ‹Königstochter, jüngste, mach mir auf›». Die Prinzessin weigert sich. Der Vater aber erteilt ihr eine moralische und letztlich eben auch politische Lektion. Die Regeln verlässlichen Miteinanders gelten für jedermann: «Was du versprochen hast, das mußt du auch halten», verkündet der König. Und als die gemeinsame Nacht bevorsteht, erläutert er: «Wer dir geholfen hat, als du in der Not warst, den sollst du hernach nicht verachten.»
Die Nacht verläuft für den Frosch anders als geplant: «Da war sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften wider die Wand.» Statt im Bett der schönen Frau landet der Frosch – «bratsch!»[3] – am königlichen Gemäuer. Nun folgt die erste merkwürdige Wendung des Märchens, denn die impulsive Reaktion stellt die politisch-sozialen Verhältnisse nicht in Frage, sondern wieder her. Auf den Boden fällt anstelle eines arg lädierten Tiers «ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen», der ideale «Gemahl» für eine Prinzessin. Eine «böse Hexe» habe ihn «verwünscht […], und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein, und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen». Darauf folgt die zweite merkwürdige Wendung. Die Geschichte endet nämlich nicht auf dem trivialliterarischen Höhepunkt mit einer prunkvollen Hochzeit. Stattdessen öffnet sich ein neuer Erzählstrang. In seinem Zentrum steht ein Diener, der das frisch vermählte Paar in das Königreich des Bräutigams kutschiert: Der «treue Heinrich» hatte nach der Verzauberung des Prinzen «drei eiserne Bande […] um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zerspränge». Nun aber fallen die Herzensbande mit so lautem Krachen ab, dass die Wageninsassen einen Unfall befürchten:
«Heinrich, der Wagen bricht.»
«Nein, Herr, der Wagen nicht,
es ist ein Band von meinem Herzen,
das da lag in großen Schmerzen,
als Ihr in dem Brunnen saßt,
als Ihr eine Fretsche [Frosch] wast [wart].»
Wie in vielen Märchen der Brüder Grimm steht auch im «Froschkönig» die politische Ordnung auf dem Spiel. Zum einen erzählen die Texte von der Verlässlichkeit, die die Herrschenden ihren Untertanen schulden; zum anderen feiern sie die Herzensneigung der Untertanen zu ihren Herrschern. Im Kinderton fabulierten Jacob und Wilhelm Grimm auf diese Weise über die große realpolitische Herausforderung ihrer Zeit, die eine Zeit der dauerhaften Regierungskrise war. Sie arbeiteten am deutschen Märchenschatz, als fundamentale Veränderungen die etablierten Ordnungsmuster von Grund auf in Frage stellten und sich jahrzehntelang in Form revolutionärer Bewegungen und Ereignisse artikulierten. Als Kinder verfolgten die Grimms sehr genau die Entwicklung der Französischen Revolution und erlebten die Revolutionskriege in unmittelbarer Nachbarschaft mit; nach ihrem Studium wirkten sie im Zentrum des napoleonischen Modellstaates Westphalen, in dem der Masterplan einer neuen Regierungskunst umgesetzt werden sollte; als Journalisten und im diplomatischen Dienst begleiteten die Brüder den Wiener Kongress und litten danach unter den unzeitgemäßen Herrschaftsformen der Restaurationszeit, die von der Julirevolution zwar heftig, aber letztlich nur episodisch bekämpft wurde.[4] Mit der Affäre um die ‹Göttinger Sieben› schließlich avancierten die Professoren Jacob und Wilhelm Grimm zu politischen Berühmtheiten. Sie setzten sich für eine Verfassung ein, die ihnen von der Sache her herzlich egal war, stritten jedoch für die wechselseitige Treue im Verhältnis eines Königs zu seinen Staatsdienern, wurden dafür entlassen und verbannt. Die Mitwirkung im Paulskirchen-Parlament, in dem sich die Hoffnungen der 48er-Revolution in Luft auflösten, beschloss die Serie politischer Enttäuschungen.
In der Widmung der vierten ‹großen› Ausgabe der «Kinder- und Hausmärchen» aus dem Jahr 1840, die Wilhelm Grimm wie stets an Bettine von Arnim richtete, setzte er die Märchenwelt direkt mit den politischen Ereignissen in Beziehung: «Kann ich eine bessere Zeit wünschen, um mit diesen Märchen mich wieder zu beschäftigen? Hatte ich doch auch im Jahr 1813 an dem zweiten Band geschrieben, als wir Geschwister von der Einquartierung bedrängt waren, und russische Soldaten neben in dem Zimmer lärmten […].»[5] Gerade Phasen des Umbruchs also – bei der ersten Auflage die Befreiungskriege gegen Napoleon, bei der vierten Auflage die Affäre um die ‹Göttinger Sieben› – erschienen Wilhelm Grimm als idealer Kontext für die Märchenarbeit. Tatsächlich zählt es zu den symbolisch bedeutsamen Zufällen im Leben der Brüder Grimm, dass die beiden Bände der «Kinder- und Hausmärchen» in der Erstausgabe den Niedergang der napoleonischen Herrschaft nach dem Russlandfeldzug (1812) und die Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress (1814/15) rahmten. Jacob Grimm notierte zum Datum der Vorrede von 1812 handschriftlich: «Gerade ein Jahr vor der Leipziger Schlacht»[6] – als wäre das ganze Märchenprojekt von der politischen Ahnung einer Zeit durchdrungen gewesen, in der sich die Verhältnisse Schlag auf Schlag veränderten.
I.
Die Märchen begleiteten Zeiten des Umbruchs und reagierten darauf mit großer Anpassungsfähigkeit. Flexibilität war aus Perspektive der Grimms die Voraussetzung für Stabilität, wohingegen das starre Festhalten am Gegebenen Aufstände und Revolten provoziere. Die beiden Brüder hielten Distanz zu radikalen Verfassungsbewegungen oder demokratischen Bestrebungen, auch wenn sie das historische Recht dieser Proteste zunehmend bejahten – Wilhelm Grimm weniger, Jacob Grimm mehr. Ihre Kritik galt jedoch nicht allein den Erhebungen ‹von unten›, sondern ebenso der Reformunfähigkeit ‹von oben›, dem Starrsinn der deutschen Fürsten. Sie machten beide Seiten für die politische Unruhe verantwortlich, die die Gesellschaft in Parteiungen zersplitterte. Wenn ein Regent die Zeichen der Zeit nicht erkennt, so die feste Überzeugung von Jacob und Wilhelm Grimm, dann staut sich eine historische Flut auf, die letztlich nicht einzudämmen ist, so dass die «Gewässer» irgendwann über ihm «zusammenschlagen».[1]
Insofern stellte bereits der Umgang mit den Märchen und deren historischer Variabilität ein politisches Prinzip aus, das zudem für den Mythos generell gilt, denn wenn dieser «zum Dogma wird, verliert er das spezifisch Mythische: das permanente Fort- und Umerzählen».[2] Die Brüder Grimm bearbeiteten ihre Märchensammlung daher unablässig.[3] Umfang und Anordnung veränderten sich von Ausgabe zu Ausgabe – dem fiel etwa der «Gestiefelte Kater» zum Opfer, der den Grimms dann doch zu wenig ‹deutsch› erschien. Die märchenhaften Landschaften stellten sich ebenso erst im Lauf der Zeit ein wie die Märchensprache mit ihren berühmten Formeln. So begann die Erzählung vom Froschkönig in der frühesten handschriftlichen Version (1810) ganz umstandslos: «Die jüngste Tochter des Königs ging hinaus in den Wald, und setzte sich an einen kühlen Brunnen.»[4] In der ersten Publikationsfassung (1812) leiteten die Grimms die Erzählung dann schon mit dem legendären «Es war einmal …» ein, und erst danach berichteten sie von «den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat».
Auch inhaltlich nahm Wilhelm Grimm, der die Märchenarbeit im Wesentlichen verantwortete, gewichtige Änderungen vor, nicht zuletzt in Verbeugung vor der bürgerlichen Erziehungsmoral: In der Handschrift fiel der Frosch als Prinz direkt ins Bett der Königstochter, «da legte sich die Königstochter zu ihm». Auch in der Ausgabe erster Hand machten die jungen Leute keine großen Umstände: «[…] sie hielt ihn werth wie sie versprochen hatte, und sie schliefen vergnügt zusammen ein». Schließlich aber ging alles seinen geregelten Gang: Der Prinz blieb dem Bett zunächst fern; bevor es zu intrikaten Situationen kommen konnte, folgte die Königstochter des «Vaters Willen» und heiratete den Thronfolger. All diese Eingriffe aber änderten eines nicht: Jede der vielen Ausgaben ihrer «Kinder- und Hausmärchen» eröffneten die Grimms mit dem Märchen vom Froschkönig, dessen Titel auf seine eigentümliche Doppelstruktur deutet: «Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich». Warum also war den beiden Brüdern dieses Märchen so wichtig? Warum ließen sie damit ihr berühmtestes Werk beginnen und erzählten eine phantastische Aufstiegsgeschichte, die am Ende auf die Wiederherstellung monarchischer Herrschaft hinausläuft?
Die «Kinder- und Hausmärchen» zählen zu einer ganzen Serie von Sammlungen, mit denen die Brüder Grimm den Mythenbedarf der Deutschen erst stimulierten und dann stillten – genauer: mit denen sie überhaupt erst bestimmen wollten, was die Deutschen einmal waren, was sie sein könnten und worin die Bedeutung der Mythen für diese Nation bestehen sollte.[5] Mit den «Deutschen Sagen» veröffentlichten sie kurz nach der Erstausgabe der Märchen ein Fundbuch der Dichtung des 19. Jahrhunderts, in dem sich zahlreiche Autoren, von E.T.A. Hoffmann über Heinrich Heine, Franz Grillparzer, Annette von Droste-Hülshoff oder Ludwig Uhland bis hin zu Theodor Storm, Richard Wagner oder Gerhart Hauptmann, bedienten.[6] Den Titel dieser Sammlung machte Jacob Grimm zum Prototyp einer Serie und erkundete die nationalen Eigentümlichkeiten der Deutschen in einem Gefüge aus Sprache («Deutsche Grammatik»), Recht («Deutsche Rechtsalterthümer») und Religion («Deutsche Mythologie»). Die Poesie zählte selbstverständlich dazu, und dies schon deswegen, weil Jacob Grimm glaubte zeigen zu können, «dasz recht und poesie miteinander aus einem bette aufgestanden waren». Beide sollten nicht einfach willkürlich erfunden, sondern historisch gefunden werden. «Nur die gerechtigkeit», so statuierte Jacob Grimm gegen jede souveräne und rationale Rechtsetzung, «ist dem volke recht und untrüglich, die aus ‹der ältesten frommer kundschaft› genommen wird; nur solche sagen behagen ihm eigentlich, die es mit der milch eingesogen und bei sich unter einem dache wohnen gesehen hat.»[7] Stilistisch ausgenüchtert bedeutet dies: Regeln, denen eine gewisse Triftigkeit abgeht und an die sich das Handeln nicht gewöhnt, weil sie nicht zu den alltäglichen Routinen passen, mangelt es an «Gesetzeskraft» und selbstverständlicher «Autorität».[8]
Weil die Anweisungsfähigkeit juristischer Regulierung auf einem untergründigen Bündnis mit der normativen Kraft des Faktischen basiert, steigt der Bedarf an mythischer Legitimation und politischen Erzählungen, sobald «Politik sich nicht in routinisiertem Administrieren erschöpft, sondern einschneidende Reformen erforderlich werden oder politisches Neuland zu betreten ist».[9] Die Grimms waren mithin am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Sie nahmen ihre mythopoetische Stabilisierungsarbeit auf, als einer der größten deutschen Mythen, symbolischer Garant für die Behauptung einer Jahrhunderte währenden Kontinuität, durch die Französische Revolution definitiv verabschiedet wurde: die Erzählung vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.[10] Als Gelehrte antworteten sie auf verdichtete Zeiterfahrungen des Umsturzes, der radikalen Veränderung und der Infragestellung grundlegender Ordnungsprinzipien und versorgten die Deutschen mit Erzählgut aus einem Mythenschatz, den sie gerade erst als Zeugnisse des Ursprünglichen bargen. Sie wussten um die Unwiederbringlichkeit des Vergangenen, aber ihr Anliegen war prinzipiell konservativ, und ihre politischen Sympathien gehörten der Monarchie.
Für die Stabilität der Verhältnisse traten sie jedoch mit revolutionären Mitteln ein: mit einer «Andacht zum Unbedeutenden» (Sulpiz Boisserée), die die Fundamente des Politischen in jene Zonen verlegte, die Gesetze und Anweisungen nicht erreichen, weil explizite Regeln nur bis zu einem bestimmten Grad wiederum regulativ gesichert werden können. Die Mythopoiesis der Grimms ist ein Beispiel dafür, dass politische Erzählungen nicht entweder «konservativ oder revolutionär» sein müssen,[11] sondern beides zugleich sein können. Als zwei der modernsten Traditionalisten ihrer Zeit griffen sie zwar auch kämpferisch-direkt in die politischen Entwicklungen ein, etwa in Zeitungsartikeln oder Pamphleten. Eigentlich aber arbeiteten sie subtiler und untergründiger am Politischen und beförderten nach Kräften den «Mythisierungsschub des 19. Jahrhunderts».[12]
Das Pathos des ‹noch› versorgte ihre Recherche nach den «Deutschen und ihren Mythen» mit Energie. Für viele ihrer Werke ernteten die Grimms die Bewunderung ihrer Zeitgenossen, mit einigen zogen sie jedoch auch radikale Kritik auf sich. Ihre Projekte waren lange Zeit nicht erfolgreich (dies galt sogar für die erste Ausgabe ihrer Märchen). Nicht wenige scheiterten unbemerkt von der Öffentlichkeit. Immer wieder wunderten sich Rezensenten kopfschüttelnd darüber, dass die beiden Brüder ihren Lesern einen Haufen gelehrten Schutts vor die Füße kippten und dem Publikum unbedeutende Kleinigkeiten, Ammenmärchen und anderen Kinderkram zumuteten. In gewisser Weise durften sich Jacob und Wilhelm Grimm durch solche Polemiken bestätigt sehen, denn sie opponierten gegen einen Zeitgeist, der die Überlieferung bedrohte – noch einmal: eine Überlieferung, die in dieser Form und in dieser Qualität zunächst nicht jenseits der Grimm’schen Philologie existierte. Dagegen setzten sie besagtes Pathos des ‹noch›: Noch also war der Geist der guten alten Zeit zu fassen, noch waren die Quellen der eigenen Vergangenheit nicht versiegt, aber wenn man den Schatz der Tradition jetzt nicht bergen würde, so der emphatische Appell dieser großen Erzählung, dann wäre er ein für alle Mal verloren.[13] Die Gegenwart hätte die Verbindung zu ihren sozialen, politischen und kulturellen Quellgründen verloren. Dieses Narrativ wiederholten sie gebetsmühlenartig und variierten es auch in der Märchen-Vorrede in einem dramatischen Einleitungspassus:
Wir finden es wohl, wenn von Sturm oder anderem Unglück, das der Himmel geschickt, eine ganze Saat zu Boden geschlagen wird, daß noch bei niedrigen Hecken oder Sträuchen, die am Wege stehen, ein kleiner Platz sich gesichert hat und einzelne Ähren aufrecht geblieben sind. Scheint dann die Sonne wieder günstig, so wachsen sie einsam und unbeachtet fort: keine frühe Sichel schneidet sie für die großen Vorratskammern, aber im Spätsommer, wenn sie reif und voll geworden, kommen arme Hände, die sie suchen, und Ähre an Ähre gelegt, sorgfältig gebunden und höher geachtet als sonst ganze Garben, werden sie heimgetragen und winterlang sind sie Nahrung, vielleicht auch der einzige Samen für die Zukunft.
So ist es uns, wenn wir gesehen haben, wie von so vielem, was in früherer Zeit geblüht hat, nichts mehr übriggeblieben, selbst die Erinnerung daran fast ganz verloren war, als unter dem Volke Lieder, ein paar Bücher, Sagen und diese unschuldigen Hausmärchen. Die Plätze am Ofen, der Küchenherd, Bodentreppen, Feiertage noch gefeiert, Triften und Wälder in ihrer Stille, vor allem die ungetrübte Phantasie sind die Hecken gewesen, die sie gesichert und einer Zeit aus der andern überliefert haben.
Es war vielleicht gerade die Zeit, diese Märchen festzuhalten, da diejenigen, die sie bewahren sollen, immer seltener werden. […] die Sitte selber nimmt immer mehr ab, wie alle heimlichen Plätze in Wohnungen und Gärten, die vom Großvater bis zum Enkel fortdauerten, dem stetigen Wechsel einer leeren Prächtigkeit weichen, die dem Lächeln gleicht, womit man von diesen Hausmärchen spricht, welches vornehm aussieht und doch so wenig kostet.[14]
Die Grimms trugen damit zu einer wirkmächtigen Niedergangserzählung bei: Weil die guten alten Zeiten einer gleichsam ‹warmen› sozialen Gemeinschaft allmählich der Vergangenheit angehörten, weil die Modernisierung, die Verbürgerlichung und Rationalisierung der Lebensverhältnisse jene wohligen Momente am Spinnrad und Kaminfeuer, in denen Märchen traditionell erzählt wurden, nicht mehr zeitgemäß erscheinen ließen, drohe der Strom der Überlieferung auszudünnen und letztlich zu versiegen. Es bedürfe daher einer heroischen Anstrengung, um das nationale Kulturgut und damit die Identität zu bewahren, andernfalls werde die Gegenwart historisch verarmen und jene kulturellen Bindekräfte verlieren, die der Gesellschaft letztlich Zusammenhalt und Einheit verleihen. Wichtig ist dabei: Die Grimms dachten die Einheit immer ausgehend von der «inneren Einigkeit der Gegensätze».[15]