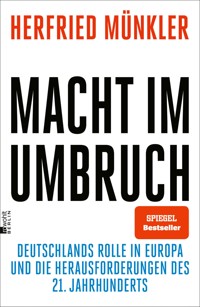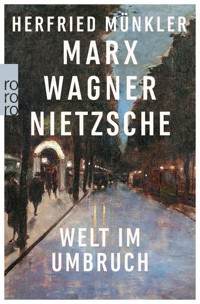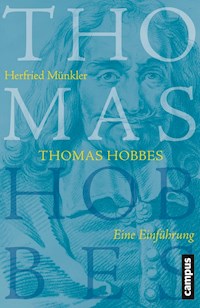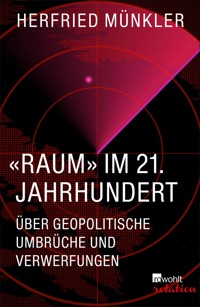24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Spätestens seit dem Abzug westlicher Truppen aus Afghanistan und dem russischen Überfall auf die Ukraine wissen wir, dass die bislang geltende Ordnung an ihr Ende gekommen ist. Die Welt ist in Aufruhr. Doch wie wird sie sich neu sortieren, und wie wird sie im 21. Jahrhundert aussehen? Vor welchen Umwälzungen, Brüchen und Umbrüchen stehen wir? Eine auf Werten und Normen fußende Weltordnung durchzusetzen, übersteigt die Fähigkeiten des Westens. Die USA, einst «Weltpolizist», befinden sich trotz internationalen Engagements auf dem Rückzug; die UN, der man diese Rolle ebenfalls zugedacht hatte, blockiert sich selbst. Und die Europäer sind schlicht nicht imstande, eine Weltordnung zu hüten. Eine prekäre, risikoreiche Lage, in der auch ein Blick in die Geschichte und auf frühere weltpolitische Konstellationen hilfreich ist, um Hinweise auf die künftige, sich jetzt herausbildende Ordnung zu erhalten. Herfried Münkler zeigt in dieser gedankenfunkelnden geopolitischen Analyse, wo in Zukunft die Konfliktlinien verlaufen. Viel spricht dafür, dass ein neues System regionaler Einflusszonen entsteht, dominiert von fünf Großmächten. Wo liegen die Gefahren dieser neuen Ordnung, wo ihre Chancen? Wäre es ein austariertes Mächtegleichgewicht – oder Chaos? Und wie sollten sich Europa und Deutschland in den zu erwartenden globalen Auseinandersetzungen verhalten? Ein aufregender, Maßstäbe setzender Ausblick auf die Machtkonstellationen im 21. Jahrhundert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Herfried Münkler
Welt in Aufruhr
Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung iStock
ISBN 978-3-644-01428-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Motto
Einleitung: Vom Wandel der Weltordnung
Kapitel 1 Das jüngste Ringen um die politische Ordnung Europas – und der Welt
Das Ende des Kalten Krieges: Deutschland und Europa rüsten ab
Friedensordnung I: das Vegetius-Modell
Friedensordnung II: das Dante-Modell
Friedensordnung III: das Comte-Spencer-Modell
Die europäische Integration als konkretisiertes Modell
Wie lässt sich Russland in die europäische Friedensordnung einbinden?
Die Herausforderung einer jeden Friedensordnung durch revisionistische Mächte
Drei Strategien im Umgang mit revisionistischen Mächten
Die strategischen Defizite der deutschen und europäischen Russlandpolitik
Eine alternative Erklärung für den russischen Angriff auf die Ukraine
Kapitel 2 Geopolitik und Weltordnung
Eine kleine Typologie der Großreichsbildung
Raumrevolutionen und ihre Bedeutung für die Vorstellung von «Welt»
Die «heliotrope» Abfolge der Imperien mit einigen bedeutenden Ausnahmen
«Westen» und «Osten» als geopolitische Orientierungsbegriffe
Die Geostrategie der kontrollierten Gegenküste
Imperiale Staffelübergabe und das Ende der europäischen Kolonialreiche
Geopolitik und Wertebindung
Geopolitische Mittellage: Deutschland als Beispiel
Kapitel 3 Module der Weltordnung
Wie umfassend ist die «Welt» der Ordnung?
Russische Geopolitik in der Nachfolge von Carl Schmitts Großraumtheorie
Polarität und Polarisierung
Die Schlüsselfrage einer jeden unipolaren Ordnung: Wer ist der «Herr» und «Hüter»?
Multipolare Ordnung und «Anarchie der Staatenwelt»
Ein Beispiel für Multipolarität: die europäischen Pentarchien
Die notorische Schwäche der Vereinten Nationen
Die Abhängigkeit der Weltordnung von den inneren Verhältnissen großer und kleiner Mächte
Die Ordnung des Binären
Symmetrie
Souveränität
Das Gleichgewicht der großen Mächte
Kapitel 4 Erzählungen und Bilder der Weltordnung
Narrative und Symbole
Das ukrainische Narrativ
Das russische Narrativ
Das US-amerikanische Narrativ
Das chinesische Narrativ
Die kritische Dimension der imperialen Narrative
Mythische Tiere und apokalyptische Szenarien
Leviathan und Behemoth bedrohen die Weltordnung
Die Apokalypse des Johannes: das Narrativ vom Untergang der falschen Ordnung
Wer sind Behemoth und Leviathan? Eine unendliche Debatte über die Weltordnung
Ein antikapitalistischer Blick auf Seemacht und Welthandel
Land und Meer: Carl Schmitt und die Ortung der Ordnung
Kapitel 5 Analytiker des großen Umbruchs: Thukydides, Machiavelli, Clausewitz
Drei Politiktheoretiker im Vergleich
Thukydides’ palimpsestförmige Kriegsanalysen
Der «letzte und wahre Grund» des Krieges
Machiavellis Dilemma
Der weite Blick: Machiavelli auf Gesandtschaftsreisen
Lageanalyse und Antizipationen der politischen Entwicklung
Die Revolution des Kriegswesens in der Clausewitzschen Analyse
Clausewitz’ Theorie des «absoluten» und des «wirklichen» Krieges
Kapitel 6 Die Weltordnung der großen Fünf
Warum fünf? Und nicht drei oder sieben?
Einflusszonen und konkurrierende Wertesysteme
Was heißt unter diesen Umständen «zweite Reihe»?
Überlappungszonen und Bruchlinien der Weltordnung
Die Rückwirkungen der entstehenden Weltordnung auf den Innenraum der fünf großen Mächte
Literatur
Dank
«Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern.»
André Malraux
«Der Vorzug der neuen Richtung ist, dass wir nicht dogmatisch die Welt antizipieren, sondern erst aus der Kritik der alten Welt die neue finden wollen.»
Karl Marx
Einleitung:Vom Wandel der Weltordnung
Die letzten Jahrzehnte sind von tiefgreifenden und folgenreichen Veränderungen der weltpolitischen Konstellationen geprägt, nachdem die Weltordnung zuvor für mehr als vierzig Jahre in Beton gegossen zu sein schien – jedenfalls, wenn man, wie die Deutschen, vor allem die Bipolarität von Ost und West mitsamt ihrer gesellschafts- und wertepolitischen Unterfütterung vor Augen hatte. Sieht man jedoch etwas genauer hin und weitet das Blickfeld auf den globalen Süden, so hat es auch in der Zeit zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Zerfall des Sowjetimperiums eine Reihe disruptiver Entwicklungen gegeben, wie etwa das Ende der europäischen Kolonialreiche. Von diesen waren zwar bereits während des Weltkriegs einige ins Wanken gekommen, aber die überwiegende Mehrheit der politischen Akteure ging bei Kriegsende davon aus, dass sie weiterhin eine weltpolitisch bedeutende Rolle spielen würden.
Als Winston Churchill 1946 in Zürich seine berühmte Rede mit der Forderung nach einer Vereinigung (West-)Europas hielt, dachte er mitnichten daran, dass Großbritannien ein Bestandteil dieses geeinten Europa sein werde, sondern sah im Britischen Weltreich einen eigenständigen Akteur der weltpolitischen Szene, die wesentlich von drei großen Mächten bespielt würde: den USA, der Sowjetunion und eben dem British Empire. Das vereinte Europa, wie Churchill es forderte, sollte als sicherheitspolitisches Glacis gegenüber der Sowjetunion dienen. Dass es das Empire schon bald nicht mehr geben würde, war für ihn unvorstellbar. Indem die Züricher Rede später in die Vorgeschichte des Europaprojekts gerückt und mitunter als dessen Startschuss bezeichnet wurde, ist der tiefe Bruch, den die weltpolitische Entwicklung gegenüber Churchills damaligem Weltordnungsentwurf darstellte, kurzerhand wegerzählt worden. Aus dem Bruch wurde eine geglättete Fortschrittserzählung, als deren Visionär Churchill figurierte.
Man muss sich dieses Beispiel vor Augen führen, wenn man verstehen will, warum die jüngsten Veränderungen als «Weltunordnung» bezeichnet werden. Es ist die Wahrnehmung vor allem derer, in deren Vorstellung die Weltordnung auf dem Ost-West-Gegensatz beruhte und in deren Aufmerksamkeitsfokus es jenseits dessen weltpolitisch kaum anderes gab. Tatsächlich war die bipolare Ordnung des globalen Nordens der große Bremser von Veränderungen, und sie gab eine Struktur der globalen Konstellationen vor, die auch den Süden des Globus erfasste; gegen deren Dominanz kam die Bewegung der «Blockfreien» nicht an. Der für diese Epoche häufig verwendete Begriff der «Eiszeit» hatte eine vielfältige Bedeutung: Nicht nur die Beziehungen zwischen beiden Seiten waren frostig bis eisig, sondern auch die auf Veränderung abzielenden Kräfte wurden im Osten eingefroren, um zu verhindern, dass sie sich politisch bemerkbar machen konnten. Auf jedes «Tauwetter» folgte darum entsprechend den Imperativen der bipolaren Ordnung eine neue «Eiszeit». Je stärker sich die Kräfte der Veränderung bemerkbar gemacht hatten, desto frostiger wurde im Ostblock anschließend das politische Klima. Bis zu den Reformen Gorbatschows war das eine quasi gesetzmäßige politische Thermik.
Das hat sich mit dem Ende des Ost-West-Konflikts grundlegend verändert. Die Sowjetunion, der konservative – oder präziser noch: der konservierende – Pol der Weltordnung, zerfiel, wobei auch im Rückblick frappiert, wie unspektakulär sich das Ende dieses vormals zentralen Akteurs der Weltpolitik vollzog. Mit einem Mal war er nicht mehr da, was vielen im Westen zum Anlass wurde, sich am Beginn einer Ära der Sorglosigkeit zu wähnen. Dem Untergang des von Lenin geschaffenen Reichs stand am Ende des 20. Jahrhunderts der rasante Aufstieg Chinas gegenüber, der sich zunächst relativ unauffällig vollzog und im Westen vielfach von der Erwartung begleitet wurde, mit der Einführung kapitalistisch-marktwirtschaftlicher Elemente im Reich der Mitte werde auch die Einparteienherrschaft der Kommunisten verschwinden und eine demokratisch-rechtsstaatliche Ordnung an ihre Stelle treten. Die Welt, so die Vorstellung, war nicht länger geteilt, weder machtpolitisch noch ideologisch, sondern wuchs zusammen, und die bis dahin durch den Ost-West-Gegensatz paralysierten Vereinten Nationen, so die Erwartung, würden bei der Bewältigung der Menschheitsaufgaben eine zentrale Rolle spielen.
Dieser bis vor kurzem noch dominante «Erwartungshorizont» (Koselleck) ist der zweite Grund, warum uns die gegenwärtigen Konstellationen als Weltunordnung erscheinen. Der Erwartungshorizont ist inzwischen nämlich schon wieder verschwunden, und man sollte nicht davon ausgehen, dass er in absehbarer Zeit noch einmal auftauchen wird. Stattdessen ist China zum neuen Gegenpol der USA geworden, und die Vorstellung, es werde nach dem Ende der Bipolarität zur globalen Durchsetzung des westlichen Politik- wie Wirtschaftsmodells kommen, hat sich in nichts aufgelöst. Ob diese Vorstellung je realistisch war oder ob es sich bei ihr von Anfang an um eine große Selbsttäuschung handelte, mag hier dahingestellt bleiben. Über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg hat jedenfalls die Vorstellung dominiert, es könne eine nicht von Konfrontation, sondern von Kooperation getragene Weltordnung entstehen, in der zwischenstaatliche Kriege zum historischen Auslaufmodell geworden seien.
Für eine begrenzte Zeit war viel von dem «unipolaren Moment» die Rede, das den USA zugefallen sei und das der «einzig verbliebenen Supermacht» die Chance eröffne, zum «Hüter» einer globalen Ordnung zu werden, einer Ordnung, die nicht wesentlich durch Feindschaften und Gegensätze, durch Konfrontation und den sie begleitenden Zwang zur Parteinahme gekennzeichnet sei, sondern in der die bis dahin im politischen Bereich bloß rhetorische Formel von der Menschheit und ihren Herausforderungen politische Gestalt annehmen werde. Doch auch daraus ist nichts geworden: Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, einem weiteren disruptiven Ereignis, haben die USA sich dazu verlocken lassen, die allgemein prognostizierte Entwicklung zur Durchsetzung von Demokratie und marktwirtschaftlich organisiertem Kapitalismus in der arabisch-muslimischen Welt notfalls auch mit Gewalt durchsetzen zu wollen, um deren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu konstatierende Selbstblockade aufzulösen – und sind damit auf ganzer Linie gescheitert. Sie haben sich nicht nur in der arabisch-muslimischen Welt militärisch verzettelt, sondern auch global an politischer Reputation verloren. Reputation aber ist eine der wichtigsten Währungen internationaler Politik. Was der amerikanische Politikwissenschaftler Joseph Nye als «soft power» bezeichnet hat, beruht wesentlich auf Reputation. Im Vergleich zu «hard power» ist sie sehr viel kostengünstiger und stellt damit die Voraussetzung für globale Einflussnahme ohne die Gefahr einer materiellen Überforderung der jeweiligen Vormacht dar. Indem die USA ihre Reputation verspielten, wurde es für sie immer aufwendiger, den «unipolaren Moment» zu nutzen, bis es unbezahlbar war.
Bereits unter US-Präsident Obama wurde das Projekt der unipolaren Weltordnung beerdigt, und dem folgte das Eingeständnis, dass die USA nicht länger zu einer gleichzeitigen und gleichgewichtigen Machtprojektion in den atlantischen und den pazifischen Raum hinein in der Lage seien. Dieses Eingeständnis ist zwar von seiner weltpolitischen Bedeutung her nicht mit dem Zerfall der Sowjetunion gleichzusetzen, aber es steht doch für die erodierte Macht des anderen Pols der ehemals bipolaren Ordnung. Zwei Jahrzehnte nach dem Ende der Bipolarität begann die Erosion der Unipolarität.
Währenddessen ist den USA in China ein ernstzunehmender Konkurrent mit globalem Anspruch erwachsen. Das hat, seitdem China überaus selbstbewusst und energisch auftritt, zu einem neuen Entwurf der Weltordnung geführt, bei dem manche schon davon sprachen, auf das amerikanische werde ein chinesisches Zeitalter folgen. Des Weiteren ist an die Stelle einer politisch saturierten Sowjetunion, bis 1989/90 der Gegenpol des Westens in einer auf Stabilität angelegten Weltordnung, ein revisionistisches Russland getreten, das die territoriale Souveränität einiger seiner Nachbarstaaten in Frage stellt, also nicht auf Bewahrung, sondern auf Veränderung aus ist. Die Vorstellung, man könne «Frieden schaffen mit immer weniger Waffen», ist infolgedessen zerbröselt und fortgespült worden wie eine Sandburg am Strand.
Derweil sucht die Europäische Union nach ihrer Rolle unter den sich formierenden Weltmächten. Für sie gilt, was man einst von der Bundesrepublik Deutschland gesagt hat: wirtschaftlich ein Riese, politisch ein Zwerg. Die Europäer – und keineswegs nur die Deutschen – waren nach dem Ende des Ost-West-Konflikts davon überzeugt, dass ihrem Projekt, Frieden wesentlich mit wirtschaftlichen Mitteln zu schaffen, die Zukunft gehöre. Das kam dem Portfolio der Machtsorten, über das die Europäer verfügten, durchaus entgegen. Vermutlich hat man in Europa auch darum so lange an dieser Vorstellung festgehalten, weil darin ein ethisch attraktiver Weltordnungsentwurf mit einer herausgehobenen Stellung der Europäer zusammenfiel, einer Position zumal, deren Behauptung keine großen Kosten verursachte und sich politisch weithin risikolos ausnahm. Inzwischen müssen sich die Europäer freilich sputen, den Rückstand im Bereich der militärischen Macht, den sie sich dabei eingehandelt haben, möglichst schnell aufzuholen. Es geht um die Frage, ob Europa beziehungsweise die Europäische Union in der sich herausbildenden Weltordnung ein relevanter Akteur oder eine quantité négligeable, eine vernachlässigbare Größe, sein wird.
Viele sprechen angesichts dieser Entwicklung inzwischen von der Weltunordnung. Das klingt alarmistisch, hat einen durchweg nervösen Grundton und signalisiert, man müsse möglichst schnell aus diesem Zustand wieder herauskommen – ohne dass man sagen kann, wie das erfolgen soll. Das nimmt die zunächst besorgte und seit dem 24. Februar 2022 aufgeregte Stimmung in der deutschen Gesellschaft auf. Die Unordnung, von der die Rede ist, bemisst sich an der Vorstellung einer Weltfriedensordnung, die durch die Herrschaft des Rechts und die Ausbreitung globalen Wohlstands gekennzeichnet sein sollte. Daran gemessen handelt es sich tatsächlich um eine große Unordnung. Die nachfolgend entwickelten Vorstellungen gehen jedoch in eine andere Richtung: Wir haben es, so die Grundthese, mit einem Wandel der Weltordnung zu tun, wie er eigentlich immer wieder stattgefunden hat, in der Vergangenheit über längere Zeitstrecken, seit dem 20. Jahrhundert jedoch immer schneller. So findet das, was sich früher nur im Zeitraffer beobachten ließ, nunmehr in Echtzeit vor unseren Augen statt. Das ist beunruhigend. Darin wiederholt sich hinsichtlich der globalen Ordnung, was ein durchgängiges Signum der modernen Welt ist: eine umfassende Beschleunigung der Veränderung, die zeitweilig als Fortschritt, als Annäherung an ein normativ ausgemaltes Ziel der Geschichte, beschrieben worden ist – und nunmehr als Balancieren am Abgrund wahrgenommen wird. Von daher könnte man zu dem Schluss kommen, das Fortschrittsnarrativ, das in den letzten Jahrzehnten auch die Theorie der Internationalen Beziehungen dominiert hat, habe wie ein starkes Beruhigungsmittel gewirkt, indem es die sich beschleunigenden Veränderungen als Verwirklichung eines großen Friedensprojekts erzählt hat. Haben wir uns in der Vergangenheit die Entwicklung schöngeredet und darüber versäumt, uns auf die durchaus abzusehenden Herausforderungen vorzubereiten? Sind vor allem die Europäer in die Falle eines weltpolitischen Biedermeier gegangen?
Was sich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts über zwei bis drei Jahrzehnte als Schritt für Schritt erfolgender Ordnungsgewinn ausgenommen hat, ist für die meisten inzwischen zum Einbruch des Chaos in eine vormals wenigstens ansatzweise geordnete Welt geworden. Danach ist es die Aushebelung des Fortschrittsnarrativs durch gegenläufige Entwicklungen, die den Begriff «Unordnung» zum vorherrschenden Klassifikationsbegriff gemacht hat. Auch das ist nicht ungewöhnlich, stehen sich doch seit der Aufklärung, spätestens seit der Französischen Revolution, Fortschrittliche und Konservative mit unterschiedlichen Bewertungen der allgemeinen Entwicklung gegenüber. Dabei kamen sie in der Regel zu einem Gesamturteil, in dem sie die Veränderungen insgesamt als entweder gut oder schlecht bewertet haben. Man war in jedweder Hinsicht politisch ein Parteigänger der Veränderung, die man als Fortschritt ansah, oder stand auf Seiten der Beharrung und Bewahrung, war also konservativ. Das ist heute kaum noch der Fall, denn die Bewertung von Veränderungen geht wild durcheinander. Auch das spielt beim vorherrschenden Eindruck der Weltunordnung eine Rolle: So mancher, der die Veränderungen im gesellschaftlichen Mikrobereich durchgehend begrüßt, wünscht sich beim Blick auf die internationale Ordnung die stabilen und übersichtlichen Konstellationen der Bipolarität zurück. Andere dagegen, die auf die programmatische Formel «Frieden schaffen mit immer weniger Waffen» gesetzt haben, beobachten die lebensweltlichen Neuerungen mit Misstrauen und Unbehagen.
Wenn sich die geschichtsphilosophisch grundierten Orientierungsmuster mit den entgegengesetzten Polen des Konservatismus und der Progressivität bei der Beurteilung politischer und sozialer Entwicklungen auflösen, wird der sich beschleunigende Wandel unübersichtlich, und für viele wird er zu Tumult und Aufruhr. Querdenker-Gruppierungen, wie sie zuvor als Opponenten der staatlich verordneten Corona-Schutzmaßnahmen hervorgetreten sind, lassen sich nun auch im Hinblick auf die veränderte Weltlage beobachten. Das alte Muster der politischen Sortierung nach rechts, links und Mitte hat viel von seiner Aussagekraft eingebüßt. So kommen der beschleunigte Wandel der Weltordnung und die Erosion der Bewertungsmuster zusammen; die Folge ist die Wahrnehmung einer «Welt in Aufruhr». Was daran tatsächlich «Aufruhr» ist und was auf eine sich verändernde «Ordnung der Mächte» hinausläuft, soll nachfolgend untersucht werden. Es sind diese einander entgegengesetzten Perspektiven, die im Titel des Buches annonciert werden: der Rückfall in eine «Anarchie der Staatenwelt» und die Herausbildung einer neuen «Ordnung der Mächte» in den globalen Verhältnissen.
Die Beschleunigung des weltpolitischen Wandels, die sich immer schneller vollziehende Veränderung der Weltordnung, ist nicht zuletzt die Folge einer Raumrevolution, die sich in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat. In deren Verlauf ist es zu einer «Raumschrumpfung» in Verbindung mit einer «Zeitschrumpfung» gekommen: Die Entfernungen sind infolge schnellerer Verkehrsmittel, ihrer dichteren Vertaktung und der sich tendenziell in Echtzeit verbreitenden Informationen über Krisen und Katastrophen am «anderen Ende der Welt» in der allgemeinen Wahrnehmung immer kleiner geworden, so dass uns Nachrichten aus geographischen Räumen bedrängen, die frühere Generationen entweder gar nicht erreichten oder weithin kaltgelassen haben, weil sie erst spät eintrafen und man davon ausging, dass man mit so weit entfernten Krisen und Katastrophen nichts zu tun hatte.
Das Gespräch der beiden Frankfurter in Goethes Faust, immerhin Bürger einer Handelsstadt mit internationalen Wirtschaftskontakten, deren Geschäfte auf einen zügigen Informationsfluss angewiesen waren, ist heutzutage nicht mehr denkbar: «Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen / Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, / Wenn hinten, weit, in der Türkei, / Die Völker aufeinander schlagen. / Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus / Und sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe gleiten; / Dann kehrt man abends froh nach Haus, / Und segnet Fried und Friedenszeiten.» – Worauf der andere Frankfurter ergänzt: «Herr Nachbar, ja! so lass ich’s auch geschehn, / Sie mögen sich die Köpfe spalten, / Mag alles durcheinander gehn; / Doch nur zu Hause bleib’s beim Alten.» – Ganz selbstverständlich gehen die beiden davon aus, dass der Tumult und Aufruhr der Welt ihr ruhiges Leben nicht beeinträchtigt und sie in der Sicherheit ihres Hauses die ebenso neugierigen wie gelassenen Beobachter des Weltgeschehens bleiben können. Ein paar Jahrzehnte später, mit dem Ende der Biedermeierzeit, hätte man die beiden als «Philister» bezeichnet, ein der Studentensprache entnommener Begriff, der eine abgründige Distanz der auf Veränderung Bedachten gegenüber dem Spießertum der beiden Osterspaziergänger zum Ausdruck brachte.
Seit längerem schon ist ein Gespräch wie das der beiden Frankfurter nicht mehr vorstellbar – auch wenn der Wunsch, wieder so denken und empfinden zu können, die Grundstimmung der «neuen Friedensbewegung» in Deutschland insgeheim prägen dürfte. Das allgegenwärtige Wissen um Kriege und Katastrophen in der Welt führt freilich dazu, dass manches, was über kurze Zeit für helle Aufregung sorgt, rasch wieder in den Hintergrund tritt und vergessen wird. Die schlechten Nachrichten überlappen und überlagern sich, und was zuunterst zu liegen kommt, spielt schon bald keine Rolle mehr. Was als Erinnerung zurückbleibt, ist das Bedrohliche und Erschreckende, das dafür sorgt, dass Ängste und Sorgen ins allgemeine Bewusstsein Einzug halten. Die Dauerpräsenz des Schrecklichen in der Welt hat eine Atmosphäre des Bedrohtseins entstehen lassen, die von den Demoskopen Woche für Woche abgefragt und abgebildet wird. Und die Dauerpräsenz von Ängsten und Sorgen wiederum ist in den demokratischen Gesellschaften, die für kommunikative Interventionen von außen offen sind, zum Resonanzboden für autoritäre Despoten geworden; deren Interesse ist, diese Ängste mit Warnungen und Drohungen zu bespielen, sie noch einmal zu steigern, um so ihre politischen Ziele leichter durchsetzen zu können. Was unter diesen Umständen dahinschmilzt, ist die Fähigkeit, strategisch zu denken und zu handeln. Die erwähnte «Zeitschrumpfung» greift um sich, und das Denken der Menschen wird beherrscht von den Eindrücken des Augenblicks. Das wiederum spielt denen in die Hände, die langfristige Pläne verfolgen, eben den Despoten und Autokraten.
In solchen Konstellationen ist ein Blick in die Geschichte hilfreich, die Geschichte der Weltordnungen, der Imperien und Staatensysteme, aber auch in die Geschichte der reflektierten Auseinandersetzung mit diesen Ordnungen, ihrer Entstehung wie ihrem Zerfall; dazu ein Blick auf geopolitische Entwürfe, die zumeist vorausschauend und imperativisch angelegt sind, und auf historische Analysen, die im Rückblick Zerfall und Scheitern erklären wollen. Darum wird es in diesem Buch über weite Strecken gehen. Dieser Blick ist, wenn man so will, das Gegenteil dessen, was hier als «Raum- und Zeitschrumpfung» bezeichnet wird: Er stellt so etwas wie eine «Raumdehnung» aufgrund einer «Zeitdehnung» dar, die uns den Wandel von Weltordnungen gleichsam in Zeitlupe beobachten lässt; obendrein hat das den Vorteil, dass wir das, was sich in unserer Gegenwart im globalen Rahmen abspielt, in begrenzten Räumen mit einem sehr viel niedrigeren Interferenzniveau in Ruhe, ohne Aufgeregtheit oder Nervosität, studieren können. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte soll also dazu dienen, den Blick für die gegenwärtigen Entwicklungen und Verwerfungen zu schärfen und ihn mit politischer Urteilskraft auszustatten. Denn das Beobachten von Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen Gegenwart und Vergangenheit kann es ermöglichen, Zukünftiges zu antizipieren.
Der gegen ein solches Verfahren immer wieder erhobene Einwand, dass das, womit wir es jetzt zu tun haben, etwas grundlegend anderes sei als das, was man in der Vergangenheit beobachten könne, verwickelt sich in einen Widerspruch, weil er die prinzipielle Unähnlichkeit von Vergangenheit und Gegenwart ja nur geltend machen kann, nachdem er sich zuvor selbst auf das Verfahren des Vergleichs eingelassen hat. Deswegen lässt sich die Frage, ob wir aus der Geschichte lernen können und, wenn ja, was wir daraus lernen, nicht allgemein und abstrakt, sondern nur konkret und im Hinblick auf bestimmte Aussagen beantworten. Dabei ist immer im Auge zu behalten, dass es bei Ähnlichkeit und Differenz «nur» um Plausibilität geht und nicht um eine exakte Kongruenz zwischen Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigem. Zweck dessen ist, wie gesagt, die Erarbeitung von Urteilskraft, die durchaus auf wissenschaftlichem Wissen beruht, aber mit diesem nicht identisch ist. Der Vergleich ist keine Gleichsetzung, sondern die Nutzung von Ähnlichkeit und Unterschied, um sich des eigenen Standpunkts zu vergewissern. Wir vergleichen permanent, sind uns dessen aber nicht bewusst, reflektieren die Vergleiche nicht – und neigen deswegen zu Gleichsetzungen, die gefährliche Simplifikationen enthalten. Gegen diese Gefahr ist die hier gepflegte Sorgfalt des historischen Vergleichens gerichtet. Vor allem aber schützt der Blick in die Vergangenheit davor, sich bei den Überlegungen zu einer neuen Weltordnung in Wünschbarkeiten zu verlieren, wie das in den letzten drei Jahrzehnten der Fall war. Die Rückversicherung bei der Geschichte ist so etwas wie eine «Erdung» des Blicks in die Zukunft.
Bei der Beschäftigung mit den geographischen Räumen, die den Blick in die Geschichte ergänzt und erweitert, werden die diversen Akteure bei der Errichtung und Zerstörung von «Weltordnungen» sichtbar. Darüber stellt sich die Frage, wie sich historische Konstellationen und große Persönlichkeiten beziehungsweise theoretische Modelle und geschichtsmächtige Akteure zueinander verhalten: Werden Herrscher und Politiker zu großen Persönlichkeiten, weil ihre Problemwahrnehmung und Handlungsfähigkeit mit den Konstellationen, in denen sie tätig werden, zusammenstimmen – was heißt, dass der Weg zu historischer Größe mit Zufällen und Unwägbarkeiten gepflastert ist –, oder schaffen große Politiker erst die Konstellationen, derer sie bedürfen, um ihren politischen Gestaltungswillen zur Geltung zu bringen? Im Grundsatz ist das eine Frage, die sich für die Geschichtsbetrachtung immer wieder gestellt hat und die je nach vorherrschenden Methoden und Erwartungen des Publikums in die eine wie die andere Richtung beantwortet wurde. In dieser Allgemeinheit gestellt, handelt es sich um eine Frage, die auf den Methodenkanon der Geschichtswissenschaft und die Selbstreflexivität der Historiker abzielt. In diesem strengen Sinn ist sie hier nur von beiläufiger Relevanz.
Was sie für das Thema eines Wandels der Weltordnung jedoch bedeutsam macht, ist der Umstand, dass Herrschern und Politikern, die ihrem Land einen herausgehobenen Platz verschafft oder an der Um- und Ausgestaltung der internationalen Mächteordnung führend mitgewirkt haben, von der Historiographie gern das Epitheton «der» oder «die Große» verliehen worden ist: Alexander der Große hat im buchstäblichen Sinn ein Weltreich zusammenerobert; Karl der Große hat eine die germanischen regna übergreifende Ordnung geschaffen und im Zusammenwirken mit Papst Leo III. das Römische Reich im Westen Europas erneuert; Zar Peter der Große hat Russland zu einer europäischen Macht gemacht, und Zarin Katharina die Große hat weite Gebiete im Süden des Reichs dazugewonnen und Russland dem Osmanischen Reich gegenüber politisch-militärische Dominanz verschafft; Friedrich der Große wiederum hat Preußen durch seine Eroberungen und deren erfolgreiche Verteidigung in einem langen Krieg zu einer europäischen Großmacht gemacht. Wer Weltordnungen oder die Ordnung der Mächte aufbaut oder verändert, erwirbt dadurch offenbar den Anspruch, «der» oder «die Große» genannt zu werden.
Das hat bei Herrschern und Politikern einen Drang hervorgebracht, «in die Geschichtsbücher einzugehen», hat also erheblichen Einfluss auf ihr Handeln – zumindest bei jenen, die sich nicht mit einem Platz in der Galerie der bloß aufeinanderfolgenden Könige, Kanzler und Premierminister begnügen wollen, sondern eine herausgehobene Position und eine die anderen deutlich überstrahlende Sichtbarkeit erstreben. Das wird vor allem dann relevant, wenn ein Politiker in der Gefahr steht, nur ein weiteres Glied in der Geschichte des Niedergangs einer vormaligen Großmacht zu sein. Bei einigen der sonst nur schwer nachvollziehbaren Entscheidungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin dürfte das die ausschlaggebende Rolle gespielt haben. Man kann darum die handelnden Akteure beim Um- und Ausbau von Weltordnungen nicht in Modellen und Konstellationen verschwinden lassen, aber man sollte ihnen auch nicht die alles überragende Gestaltungsmacht attestieren, wie das in Biographien und Memoiren oft der Fall ist.
Politische Akteure sind umgeben von Helfern und Beratern, die in der einen oder anderen Weise auf ihre Entschlüsse einwirken und ohne deren Unterstützung sie ihre Entscheidungen nicht in operative Politik umsetzen können. Die Ratschläge und Empfehlungen der Entourage kommen indes nicht aus dem luftleeren Raum, sondern sind durch die in der Gesellschaft oder einem politischen Raum zirkulierenden Ideen und Narrative geprägt. Sie spielen auch bei der Übernahme von Vorschlägen durch den politischen Entscheider eine wichtige Rolle. Anstatt über Psychogramme der Mächtigen zu spekulieren, werde ich hier versuchen, den vorherrschenden Narrativen und geopolitischen Entwürfen nachzugehen, deren implizite Imperative zu dechiffrieren und alternative Optionen zu erkunden, um auf diese Weise nicht nur getroffene Entscheidungen zu erklären, sondern auch die Spannweite möglicher Entschlüsse in der Zukunft zu antizipieren. Den identitätsstiftenden Narrativen eines politischen Raumes messe ich darum eine größere Rolle bei, als das sonst in politischen Studien üblich ist.
Was nun den tatsächlichen Einfluss von Helfern und Beratern auf einen politischen Entscheider anlangt, so ist bei dessen Beurteilung das «Gesetz einer progredierenden Verdummung von Autokraten» zu beachten. Analog zu der von dem antiken Historiker Xenophon im Dialog Hieron aufgeworfenen Frage, ob ein Tyrann Freunde haben könne, da die Grundlage seiner Herrschaft doch generalisiertes Misstrauen sei, stellt sich hier die Frage: Wie viel Vertrauen kann ein Autokrat, der sich von Konkurrenten um die Macht umgeben weiß, zu seinen Beratern haben, beziehungsweise wie lange haben diese den Mut, den allmächtigen Politiker mit dem ihnen verfügbaren Wissen zu versorgen? Oder teilen sie ihm nur noch das mit, wovon sie glauben, dass es seinen Vorstellungen entspricht und er es hören will? Das wiederum ist ein großer Vorzug demokratischer Rechtsstaaten gegenüber Autokratien: dass die Berater vor dem Beratenen keine Angst haben müssen. Sie können sich zwar unbeliebt machen und aus dem Kreis der Berater entfernt werden, aber sie müssen nicht um ihre Freiheit und ihr Leben bangen, wenn sie schlechte Nachrichten überbringen oder den Vorstellungen der Mächtigen widersprechen. Das ist mit Blick auf den sich herausbildenden weltpolitischen Gegensatz von demokratischen Ordnungen und autokratischen Regimen festzuhalten: Autokraten haben Vorteile bei der Entwicklung langfristig angelegter Strategien; Demokratien sind im Vorteil, wenn es darum geht, die Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken solcher Strategien abzuwägen.
Selbstverständlich wird es im Folgenden auch um Werte und Normen gehen sowie um zwischenstaatliche Regeln und internationales Recht, was freilich immer in Verbindung mit der Frage steht, wer bereit und in der Lage ist, Recht und Regeln durchzusetzen. Das vielleicht größte Defizit in der Vorstellung, es solle, ja müsse möglich sein, Frieden zu schaffen mit immer weniger Waffen, war die stillschweigende Unterstellung, es genüge, Regeln aufzustellen und Werte für verbindlich zu erklären, ohne die Frage zu beantworten, wer denn der «Hüter» dieser Werte und Regeln sei. Der häufig zu hörende Hinweis auf die Vereinten Nationen war kaum zufriedenstellend, denn die Vereinten Nationen waren für diese Aufgabe unzureichend ausgestattet beziehungsweise blockierten sich selbst, sobald sie mit größeren und politisch kontroversen Herausforderungen konfrontiert wurden. Man müsse sie eben reformieren und ertüchtigen, war die Antwort, die nicht zur Kenntnis nahm, dass die Selbstblockade der Weltorganisation auch und gerade für die immer wieder angemahnten Reformen gilt. Stattdessen wurden dem normativ angelegten Weltordnungsentwurf immer anspruchsvollere Werte und striktere Regeln aufgesattelt, während gleichzeitig die permanenten Verstöße dagegen unsanktioniert blieben. Sieht man genauer hin, so war der mit dem Rückzug des Westens aus Afghanistan und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gescheiterte normative Weltordnungsentwurf selbst eine Form struktureller Unordnung: Die Schere zwischen Wertevorgabe und Regelbindung auf der einen und ihrer tatsächlichen Durchsetzung gegen Werteverächter und Regelbrecher auf der anderen Seite öffnete sich immer weiter, und man konnte nicht erkennen, wie und wann sie sich schließen würde.
Das heißt nicht, dass die im Entstehen befindliche neue Weltordnung eine ohne Regeln und Werte wäre. Aber die in ihr geltenden Regeln werden weniger sein und eine geringere Tiefe haben, und vor allem wird es sich bei ihnen nicht um Einforderungen von Nichtregierungsorganisationen handeln, sondern um Verabredungen und Verträge zwischen den großen Mächten, den dominierenden Akteuren dieser Ordnung. Das dürfte in ähnlicher Form auch für die in Anschlag gebrachten Werte gelten – wohlgemerkt: für Werte und Regeln im globalen Maßstab, nicht für Werte und Regeln im Einflussbereich der jeweiligen großen Mächte. Im Innenraum der Mächte freilich werden die Werte und Regeln zur Anwendung kommen, die ihre politische Identität ausmachen, und das werden in der demokratischen Welt andere sein als in den autoritären Systemen. Dabei ist nicht auszuschließen, dass die Werte und Normen innerhalb der demokratischen wie der autoritären Ordnungen eine gewisse Bandbreite aufweisen. Und sie werden sich im reichen Norden von denen der in Armut und Elend verharrenden Regionen des globalen Südens unterscheiden. Das heißt dann aber auch, dass der «Westen», wer immer dazugehören mag, den globalen Geltungsanspruch seiner Werte und Normen einschränkt und sich stattdessen wesentlich auf sein eigenes Territorium konzentriert.
Das ist realistisch, weil der Westen diese Werte und Normen gegen seine großen Konkurrenten und Widersacher ohnehin nicht durchsetzen kann und ihm die Aufrechterhaltung ihres Geltungsanspruchs Probleme machen wird, sobald es um die Festlegung von Regeln im Verhältnis der großen Mächte zueinander geht. Je weniger von Werten die Rede ist, desto leichter werden sich Regeln im Umgang der großen Mächte miteinander festlegen lassen. Man muss sich also entscheiden, was einem wichtiger ist: das folgenlose Geltendmachen von Werten oder die Verständigung auf verbindliche Regeln. Auch im Umgang mit schwächeren Akteuren, den Staaten der weltpolitisch zweiten und dritten Reihe, dürfte es ratsam sein, normativ zurückhaltend aufzutreten, um sie nicht ins Lager der Autokraten zu treiben. Das politische Ringen um die Unterstützung und Parteinahme dieser zweiten und dritten Reihe hat seit dem russischen Angriff auf die Ukraine begonnen, und es wird nicht enden, auch wenn der Krieg vorbei sein wird.
Im Ergebnis wird das darauf hinauslaufen, dass geopolitische Aspekte gegenüber wertepolitischen Vorstellungen an Gewicht gewinnen – nicht innerhalb der Binnenstrukturen der großen Akteure, aber im Verhältnis zwischen ihnen und im Umgang mit der zweiten und dritten Reihe der weltpolitisch relevanten Mächte. Einen Vorgeschmack darauf bietet das Hofieren der arabischen Erdöl- und Erdgaslieferanten, das nach Reduzierung der Lieferungen aus Russland einsetzte, um die Versorgung der Europäer sicherzustellen. Mit einem Mal traten die Menschenrechtsfragen, die im gegenseitigen Verhältnis im Vordergrund gestanden hatten, wieder zurück, und man verständigte sich darauf, sie, wenn überhaupt, hinter verschlossenen Türen zu besprechen. Man wird davon ausgehen können, dass diese Form des Umgangs mit Wert- und Normfragen Schule machen wird. Dass sich Geopolitik im Konfliktfall gegen Wertbindung durchsetzt, ist eigentlich nichts Neues; bei einem Gang durch die Geschichte lassen sich dafür zahllose Beispiele finden. Davon wird nachfolgend häufiger die Rede sein.
Bleibt noch die Frage, wie viele große Akteure die derzeit entstehende Weltordnung prägen und sich dabei gegenseitig als solche anerkennen werden. Man kann den russischen Angriff auf die Ukraine zum Zweck ihrer Einverleibung in die Russländische Föderation als Ausdruck der russischen Angst deuten, trotz der weiterhin vorhandenen Atomwaffen und Trägersysteme nicht oder nur gerade noch zu diesen Großen zu gehören. Das hat mit dem relativen Bedeutungsverlust militärischer gegenüber wirtschaftlicher Macht zu tun. In einer Welt der Kooperation spielten Nuklearwaffen keine sonderliche Rolle. Das ist in einer Welt der Konflikte und Kriege anders. Im Hinblick auf die im Entstehen begriffene Weltordnung ist die russische Führung an einer Umgewichtung der Machtsorten interessiert. Dazu gehört auch eine Politik der Destruktion, die Russland seit längerem der EU gegenüber betreibt, mit dem Ziel, die Europäer nicht zu einem eigenständigen und handlungsmächtigen Akteur werden zu lassen, sondern sie gegeneinander auszuspielen, zu schwächen und einige Mitgliedstaaten in den eigenen Einflussbereich zu ziehen. Wäre diese Politik erfolgreich, so würden es drei große Mächte sein, die die Weltordnung bestimmen: China, die USA und Russland.
In milderer Form hat sich eine die Europäer schwächende Linie auch in der US-amerikanischen Politik bei dem früheren Verteidigungsminister Donald Rumsfeld beobachten lassen, als er ein von ihm so genanntes «neues Europa» gegen das «alte Europa» ausspielte, und des Weiteren in den Jahren der Präsidentschaft Donald J. Trumps, der mehrfach bekundete, ihm komme ein politisch handlungsfähiges Europa nicht gelegen. Offenbar setzte auch Trump auf eine Weltordnung der Drei, wobei er eine Koalition der USA mit Russland gegen China präferierte. Dieses Projekt ist auf ganzer Linie gescheitert; unter Präsident Joe Biden werden die Europäer wieder als ein verbündeter, aber doch eigenständiger Akteur behandelt. Das könnte auf ein System der Fünf hinauslaufen: neben den USA, China und Russland also noch die EU und Indien. Davon wird im letzten Kapitel ausführlich die Rede sein. Wie auch immer – die Europäer werden sich erheblich anstrengen müssen, um dem kleinen Kreis der die Weltordnung dominierenden Akteure anzugehören, und das heißt, dass sie sich aus einem Regelgeber und -bewirtschafter in eine politisch handlungsfähige Macht verwandeln müssen. Ob sie das schaffen, wird sich wohl noch in diesem Jahrzehnt entscheiden.
Es ist ein in jeder Hinsicht riskantes Projekt, auf das ich mich beim Blick auf die Mächteordnung des 21. Jahrhunderts eingelassen habe. Es wäre weniger riskant, hätte ich die Wünschbarkeiten aufgeschrieben, die zwar an der tatsächlichen Entwicklung zerschellen können, deren normativer Anspruch dadurch aber nur begrenzt in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Antizipation eines Prozesses ist erheblich verwundbarer, dafür aber politisch sehr viel nötiger als eine weitere Runde von Wünschen und Hoffnungen, bei denen man zum Zeitpunkt der Niederschrift schon weiß, dass sie nicht in Erfüllung gehen werden. In dem paradoxen Sinn der beiden vorangestellten Mottos von Malraux und Marx dient darum die ständige Rückversicherung bei Früherem als Gegengewicht zum Hinauslehnen in eine mit vielen Fragezeichen versehene Zukunft.
Kapitel 1Das jüngste Ringen um die politische Ordnung Europas – und der Welt
Das Ende des Kalten Krieges: Deutschland und Europa rüsten ab
Nach dem überraschenden Ende des Kalten Krieges, der Europa vier Jahrzehnte lang in Bann gehalten hatte, schien vieles möglich, was zuvor als ausgeschlossen galt: Wenn eine Umwälzung dieses Ausmaßes tendenziell gewaltfrei vonstattengehen und ein waffenstarrendes Regime buchstäblich über Nacht implodieren konnte, wenn es möglich war, dass die über Jahrzehnte eingefrorenen Verhältnisse mit einem Mal zu tanzen begannen und die Politik mit einer nie erlebten Leichtigkeit die eben noch schwer bewachten Grenzen auflöste – dann sollte es doch auch möglich sein, das in den vorangegangenen Jahren immer wieder als Alternative zur Logik der wechselseitigen militärischen Abschreckung beschworene Projekt eines «Friedens mit immer weniger Waffen» Wirklichkeit werden zu lassen.[1] Die bewaffnete Konfrontation beider Blöcke hatte sich binnen weniger Monate in nichts aufgelöst, und die vormaligen Feindschaften erschienen mit einem Mal als ein einziges großes Missverständnis, von dem im Nachhinein keiner so recht zu sagen wusste, weswegen es eigentlich so lange das politische Denken und Empfinden beider Seiten bestimmt hatte.
Das machte auch die zuvor als utopisch angesehene Idee plausibel, das Militär aller Staaten nicht nur deutlich zu reduzieren, sondern so weit abzurüsten, bis es auf einen Restposten zusammengeschrumpft war, der nur noch symbolische Bedeutung hatte. Die Vorstellung von einem Militär, das den repräsentativen Rahmen bei Staatsempfängen bildete, aber nicht gegen andere Staaten einsetzbar war, machte die Runde. Europa, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Schauplatz der furchtbarsten Kriege in der jüngeren Geschichte geworden war und in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts den in globaler Hinsicht am stärksten militarisierten Raum dargestellt hatte, sollte zum Ausgangspunkt einer Veränderung werden, die den Krieg als Mittel der Politik zum Verschwinden brachte. Eine der großen Menschheitsutopien, deren Anfänge bis zu den biblischen Propheten und den römischen Dichtern des augusteischen Zeitalters zurückreichen,[2] schien Wirklichkeit zu werden.
Man musste freilich keineswegs so weit gehen, eine Welt des «Friedens ohne Waffen» als Ziel vorzugeben, um eine Politik der forcierten Abrüstung, zunächst in Europa und von hier aus auf andere Konflikträume übergreifend, für geboten zu halten. Realistisch war zunächst die Zielsetzung eines «Friedens mit immer weniger Waffen», was politisch durch die anlaufende Truppenentflechtung der beiden Militärblöcke ohnehin auf der Tagesordnung stand. Das betraf als Erstes die Deutschen, die nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten zeitweise mehr als eine Dreiviertelmillion Mann unter Waffen hatten; infolge der in der Bundesrepublik und der DDR bestehenden Wehrpflicht verfügten sie über große, im Konfliktfall mobilisierbare Reserven, und ihre Arsenale waren mit Panzern der unterschiedlichsten Typen, Artillerie- und Raketensystemen, Kampfbombern und Abfangjägern prall gefüllt. Eine derart überdimensionierte deutsche Armee hätte nach dem Abzug der Sowjets aus Mitteleuropa und der Reduzierung der US-Truppen im Westen bei den europäischen Nachbarn größte Sicherheitsbedenken ausgelöst. Schon deshalb musste sie abgerüstet werden.
Seit den 1950er Jahren lief der politische Konsens in Westeuropa darauf hinaus, dass die Bundesrepublik zwar wirtschaftliche Macht aufbaute, nicht aber militärische. Die Divisionen der Bundeswehr standen unter NATO-Kommando, und spiegelbildlich war die Nationale Volksarmee der DDR in die Kommandostrukturen des Warschauer Pakts eingegliedert. Den Warschauer Pakt gab es jedoch nicht mehr, und was aus der NATO werden würde, war zu Beginn der 1990er Jahre weitgehend offen. Allgemein war die Rede, aus dem Militärbündnis solle nunmehr ein vor allem politisches Bündnis werden. Also musste das Militär des vereinten Deutschlands drastisch reduziert werden, um die neue politische Ordnung des Kontinents nicht zu konterkarieren; die absehbare ökonomische Potenz machte den westlichen Nachbarn, die sich mit der alten Bundesrepublik zuvor auf Augenhöhe gesehen hatten, schon genug zu schaffen. Das vereinte Deutschland würde an Bevölkerungszahl (mit Ausnahme Russlands) und Wirtschaftskraft jeden anderen europäischen Staat deutlich übertreffen. Vor allem Frankreich und Großbritannien hatten zunächst gezögert, der deutschen Vereinigung zuzustimmen und stattdessen zeitweilig auf den Fortbestand der Zweistaatlichkeit gesetzt.[3] Die deutliche Reduktion des deutschen Militärs war mithin Voraussetzung dafür, dass Europa die Vereinigung akzeptierte.
Das war indes keine Forderung, die gegen die Deutschen und ihre Vorstellungen von der politischen Zukunft des Landes durchgesetzt werden musste – ganz im Gegenteil. Im Westen war das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Bundeswehr ohnehin distanziert geblieben: Adenauer hatte die Aufstellung eigener Streitkräfte gegen den Widerstand der sozialdemokratischen Opposition und erheblicher Teile der Bevölkerung als Eintrittsbillett für die Westintegration durchgesetzt, und diese Entscheidung ist im Verlauf der 1960er Jahre dann auch von den anfänglichen Gegnern akzeptiert worden. Aber eine innige Beziehung zum Militär, wie sie für das Kaiserreich und noch die Weimarer Zeit, von den zwölf Jahren NS-Regime ganz zu schweigen, typisch war, hatte sich daraus nicht entwickelt. Die Bundeswehr war und blieb ein notwendiges Übel angesichts der Bedrohung aus dem Osten, was spiegelverkehrt zum Teil wohl auch für die Bevölkerung der DDR und ihr Verhältnis zur Nationalen Volksarmee galt. Ein wichtiger Unterschied zwischen Bundesrepublik und DDR bestand freilich darin, dass Letztere ihr Militär zum zentralen Bestandteil des Staatszeremoniells gemacht hatte, es also bei jeder sich bietenden Gelegenheit im Paradeschritt und mit einem Defilee schwerer Waffen präsentierte. Im Staatszeremoniell der Bundesrepublik spielte das Militär eine eher bescheidene Rolle, und politische Feiertage wurden in geschlossenen Räumen begangen. Aber nun gab es die DDR nicht mehr. Die schlagartig entstaatlichte Gesellschaft im Osten war mit den Problemen ihres wirtschaftlichen Umbaus beschäftigt und hatte für das Militär keine besondere Aufmerksamkeit mehr. Außerdem war klar, dass sie es aus eigener Kraft nicht mehr würde finanzieren können.
Überhaupt spielte im Nachwendedeutschland der zielgerichtete Einsatz von ökonomischen Ressourcen die politische Hauptrolle. Dabei ging es vor allem um die soziale Abfederung der wirtschaftlichen Verwerfungen in den neuen Bundesländern, also um Finanztransfers aus den westlichen in die östlichen Bundesländer und um Wirtschafts- und Finanzhilfen an die Länder Mittel- und Osteuropas, eingeschlossen die in einer schweren Wirtschaftskrise steckende Sowjetunion. Um diese Mittel aufbringen zu können, war eine drastische Reduzierung der Militärausgaben naheliegend. Man konnte sich diese «Friedensdividende» – ein von Helmut Kohl gern gebrauchter Begriff – durchaus leisten, weil ja der Grund für die vormalige Höhe des Verteidigungsetats, die Blockkonfrontation, entfallen war. Und da sich der sozioökonomische Umbau des Ostens als kompliziert und langwierig erwies, wurden die deutschen Streitkräfte mit den Jahren immer weiter reduziert. Die Höhe des Sozialetats lag schon bald weit über der des Wehretats, womit nebenbei eine alte Forderung der politischen Linken eingelöst wurde. Als sei das selbstverständlich, gewöhnte man sich in Deutschland an die Vorstellung, es sei möglich, in einem «Frieden mit immer weniger Waffen» zu leben – nicht nur als Interim zwischen zwei Perioden der Aufrüstung, sondern als dauerhafter Zustand politischer Stabilität.
Diese Sichtweise war im Übrigen nicht nur in Deutschland vorherrschend, sondern bestimmte, wenn auch nicht in so ausgeprägter Form, die Entwicklungsrichtung aller europäischen Länder: denen im Osten, weil sie sich ein im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftsleistung überdimensioniertes Militär schlichtweg nicht mehr leisten konnten – und nicht mehr leisten wollten, nachdem der von Moskau ausgehende Erwartungsdruck, bestimmte militärische Fähigkeiten bereitzustellen, entfallen war –, und denen im Westen, weil auch für sie die zuvor angenommene Bedrohungslage weggefallen war.[4] Verstärkt wurde die Vorstellung einer nicht nur prinzipiell möglichen, sondern politisch gebotenen umfassenden Abrüstung noch durch die nachträgliche Rechtfertigung der einstigen Aufrüstungspolitik: Die Sowjetunion sei vor allem zusammengebrochen, weil sie dem von US-Präsident Ronald Reagan forcierten Rüstungswettlauf auf Dauer ökonomisch nicht gewachsen gewesen sei.[5] Von dieser Anstrengung, die dem Westen weniger wirtschaftlich als politisch in der Gestalt von Protesten und «bürgerlichem Ungehorsam» zu schaffen gemacht hatte, wollte man sich jetzt erholen.
Der Hotspot der Demilitarisierung war in den 1990er Jahren also Deutschland, weil es seine eigenen Streitkräfte erheblich reduzierte und die auf seinem Territorium stationierten Truppen der Verbündeten abzogen, sowjetische im Osten, amerikanische im Westen, dazu die britische Rheinarmee und die in Südwestdeutschland stationierten französischen Verbände. Aus einem Land mit der weltweit höchsten Militärdichte wurde eines, das sich im Vergleich zur vorangegangenen Zeit als nahezu demilitarisiert ausnahm. Man muss sich das in Erinnerung rufen, um das lange Festhalten der deutschen Politik an einer seit 2014, dem Beginn des Krieges in der Ukraine, in die Kritik geratenen nichtmilitärischen Friedenssicherung nachvollziehen zu können. Auf die setzte man selbst dann noch, als am südöstlichen Rand Europas die von Russland ausgehende militärische Gewalt bereits Grenzen verändert hatte. Das galt freilich auch für andere Staaten Europas.
Man konnte den Eindruck gewinnen, einige westeuropäische Staaten hätten die Positionen der Friedensbewegung aus den 1980er Jahren übernommen, die ja auch einen «Frieden mit immer weniger Waffen» gefordert hatte. Er sollte gemäß den Vorstellungen der Friedensbewegung dem Einstieg in die Abrüstung eine Leitlinie vorgeben, während der «Frieden ohne Waffen» das Ziel einer auf lange Sicht hin angelegten Politik war. Und das hieß vor allem: ein Frieden ohne Atomwaffen. Atomwaffen und ihre Trägersysteme, insbesondere Mittelstreckenraketen – sowjetische SS-20 sowie US-amerikanische Pershing II und Cruise Missiles –, waren in den 1980er Jahren zum negativen Symbol der Friedensbewegung und ihres Widerstands gegen eine neue Aufrüstungsrunde geworden. Dabei ging es weniger um die Raketen als solche als um deren Bestückung mit Atomsprengköpfen, die, wären sie zum Einsatz gekommen, West-, Mittel- und Osteuropa in eine nukleare Wüste verwandelt hätten. Noch vor dem Ende des Kalten Krieges wurden auf Grundlage des INF-Vertrages von 1987[6] die auf beiden Seiten aufgestellten Raketen abgezogen und verschrottet, und auch die einsatzfähigen Nuklearsprengköpfe wurden deutlich reduziert. Ihre Zahl liegt zurzeit mit 1550 strategischen Gefechtsköpfen auf beiden Seiten etwas unterhalb der in den START-Verträgen festgelegten Höchstgrenzen. Insofern war der unmittelbare Anlass für Protest und Widerstand gegen die Stationierung der Mittelstreckenraketen in Europa verschwunden.
Die Fähigkeit der USA und Russlands als nuklearer Nachfolgestaat der Sowjetunion, einen vernichtenden Atomkrieg zu führen, bestand freilich fort, war aber bis zum Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 aus dem Fokus der politischen Debatte verschwunden. Trotz des Hinzukommens weiterer Atommächte verfügen beide nach wie vor über etwa neunzig Prozent aller Sprengköpfe. Die wechselseitige nukleare Geiselnahme, die für die Konstellation des Kalten Krieges prägend gewesen war, hatte zwar ihre politisch-psychologische Brisanz verloren, war aber binnen kurzer Zeit wiederherzustellen.[7] Dass sie für drei Jahrzehnte kein politisches Thema mehr war, hatte auch damit zu tun, dass sich mit dem Abbau der Mittelstreckenraketen die Vorwarnzeiten wieder vergrößert hatten, was die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs infolge eines Irrtums oder technischen Fehlers erheblich verringerte. Hinzu kam, dass inzwischen andere Typen des Krieges die politische Agenda dominierten: innergesellschaftliche Kriege, militärische Interventionen zur Beendigung solcher Bürgerkriege, Kriege gegen Terrorgruppen und ihre staatlichen Unterstützer sowie hybride Kriege, in denen Cyberangriffe und Desinformationskampagnen an die Stelle der mit kinetischer Energie geführten Kriege traten.[8]
Der grundsätzliche Dissens zwischen denen, die auf die Vorstellung vom «Frieden mit immer weniger Waffen» setzten, und jenen, die einen «Frieden ohne Waffen» anstrebten, trat über lange Zeit auch darum nicht offen zutage, weil in der Formel «immer weniger Waffen» die Art der Waffen nicht angesprochen war, die verschwinden sollte. Der De-facto-Fortbestand nuklearer Vernichtungskapazitäten wurde durch die umfassende Reduzierung konventioneller Waffen verdeckt. Obendrein fanden zahlreiche Konferenzen mit Resolutionen zum Abbau von Atomwaffen statt, die aber an den vorhandenen Kapazitäten mit den darauf fußenden Strategien wenig änderten. Die allgemeine Aufmerksamkeit galt den Konferenzen und nicht den weiter vorhandenen Nuklearwaffen. Darüber hinaus spielte beim Abebben der Kritik am «bewaffneten Frieden» eine Rolle, dass Nuklearwaffen seit dem Abbau der Mittelstreckenraketen wieder als politische Waffen galten, deren bloße Existenz die Schwelle zu einem konventionellen Krieg zwischen den großen Mächten so weit anhob, dass solche Kriege zwischen den Blöcken tendenziell ausgeschlossen waren: Das Risiko, dass konventionelle zu atomaren Kriegen eskalierten, war zu groß, als dass sich namentlich die USA und Russland auf einen mit konventionellen Waffen geführten Krieg hätten einlassen können. Die Atomwaffen der beiden waren so etwas wie eine Garantie, dass sie alles dafür tun würden, um eine direkte konventionelle Konfrontation zu vermeiden.
Als Beleg für die Verlässlichkeit dieser Sicht wurde auf die Geschichte des Kalten Krieges verwiesen, in der zwar zahllose Stellvertreterkriege (proxy wars) stattgefunden hatten, es aber zu keiner direkten Konfrontation zwischen sowjetischem und US-amerikanischem Militär gekommen war.[9] Die Forderung nach Abschaffung aller Atomwaffen wurde dementsprechend von der Sorge gebremst, durch den Wegfall der nuklearen Eskalationsrisiken könne die Eintrittsschwelle zu konventionellen Kriegen zwischen den großen Mächten wieder sinken, die Ächtung von Atomwaffen also letztlich zu einer Häufung konventioneller Kriege führen. Aus einigen politischen Brandherden hätten tatsächliche Großbrände werden können. Das war dann doch zu riskant. Dementsprechend war die Forderung nach Abschaffung aller Atomwaffen eher deklaratorisch, als dass sie für die operative Politik eine größere Relevanz besaß, und insgeheim war klar, dass die Atomwaffen erst verschwinden würden, wenn es keine Großmächte mehr gab und eine politisch geeinte Menschheit an deren Stelle getreten war. Das lag in ferner Zukunft.
Tatsächlich blieb die Frage, welchen Frieden man eigentlich anstrebte, den mit weniger Waffen oder den ganz ohne Waffen, politisch ungeklärt, weil das Problem der Friedensordnung selten konsequent durchdacht wurde: War der Friede, der jetzt in Europa herrschte, ein Ergebnis dessen, dass die Führung eines unprovozierten Krieges, eines Angriffskrieges, für den Angreifer Kosten hatte, die selbst im Falle seines Sieges jeden vorstellbaren Nutzen überstiegen? Oder war der europäische Friede das Ergebnis dessen, dass die Vorteile des Friedens für alle in der Friedensordnung so groß waren, dass für sie schon der Gedanke an die Möglichkeit eines Krieges ausgeschlossen war? Ersteres war politisch mit dem Fortbestand der NATO, Letzteres mit einer sukzessiven Ausweitung der EU verbunden. Auf den ersten Blick mag die Differenz zwischen beidem marginal sein, aber tatsächlich haben wir es mit einem gravierenden Unterschied zu tun.
An dieser Stelle noch einige Bemerkungen zum Nutzen analytischer Modelle bei der rekonstruierenden Beschäftigung mit Entwicklungen und Ereignissen, die einige Zeit zurückliegen, deren Folgen und Ergebnisse aber unmittelbar auf die Gegenwart einwirken und von hier aus bewertet werden. Dabei gibt die Beurteilung der jeweiligen Konstellation das Urteil vor, während frühere Beurteilungen häufig als naiv, vorurteilsbeladen oder schlichtweg falsch verworfen werden. Mit dem Fortgang der Ereignisse kann sich dieses Urteil freilich auch wieder ändern, und so manches, was aus der gegenwärtigen Evidenz heraus als zutreffend und wahr erscheint, kann dann selbst unter den Vorwurf der Naivität oder Vorurteilsbeladenheit geraten. Der Satz, dass «die Wahrheit im Auge des Betrachters liegt», gilt nicht nur für den einzelnen Betrachter, sondern auch für die Konstellationen, aus denen heraus er seine Urteile trifft. Mitunter treten diese unterschiedlichen beziehungsweise gegensätzlichen Beurteilungen auch gleichzeitig auf und werden als Begründung für politische Reaktionen oder Zukunftsperspektiven genutzt. Das ist gerade an der abrupten Veränderung der deutschen wie der gesamteuropäischen Politik gegenüber Russland zu beobachten: Von den einen wird die frühere deutsche Russlandpolitik als naiv und idealistisch kritisiert, während andere sie als realistisch und friedenspolitisch weitblickend verteidigen. Dementsprechend unterschiedlich wird dann auch die von Kanzler Scholz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ausgerufene «Zeitenwende» bewertet.
Ein weiterer Streitpunkt bei der Beurteilung der vormaligen Russlandpolitik Berlins und Brüssels ist die Frage, mit welchem Ereignis man den Weg in den Krieg und die neue Konfrontation zwischen Ost und West in Europa beginnen lässt: erst mit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 oder mit der vorangegangenen Annexion der Krim im Jahre 2014? Womöglich mit dem Georgienkrieg von 2008 oder bereits mit den beiden Tschetschenienkriegen, dem von 1994 bis 1996 und dem von 1999 bis 2009? In jedem Fall ist bei einer solchen Ereignisabfolge Russland der initiative Akteur, der die militärische Gewalt ins Spiel gebracht hat.
Man kann diese Zeitordnung, wo auch immer sie ansetzt, freilich als eine kritisieren, die durchgängig so angelegt ist, dass Russlands aggressives Agieren am Anfang des Krieges in der Ukraine steht und der Kreml für den Zusammenbruch einer auf Regeln und Verträgen begründeten europäischen Friedensordnung verantwortlich ist. Im Gegensatz dazu kann man die Abfolge der Kriege auch mit den USA als initiativer Macht beginnen lassen, indem man den Dritten Golfkrieg, also die US-geführte Intervention zum Sturz Saddam Husseins im Jahre 2003, an den Anfang stellt oder aber die NATO-Luftangriffe auf Serbien vom 24. März bis 12. Juni 1999, mit denen der Rückzug serbischer Truppen aus dem Kosovo erzwungen wurde. Tatsächlich hat Russland diese Angriffe auf Serbien, die ein neuerliches Massaker wie das von Srebrenica verhindern sollten, als eine schwere Demütigung empfunden, mit der ihm vor Augen geführt wurde, dass es sich mit den USA oder dem Westen nicht mehr auf Augenhöhe befand. In den russischen Rechtfertigungen für das eigene gewaltsame Agieren wird regelmäßig auf das gegen Serbien gerichtete Bombardement der NATO verwiesen, und die westliche Legitimation der Luftschläge im Jahre 1999, der Schutz ethnischer Minderheiten, avancierte zur russischen Begründung für militärisches Eingreifen von Georgien über die Krim bis zum Donbas: Auch hier war durchweg vom Schutz der russischen Minderheit die Rede.
Nun kann man mit guten Gründen geltend machen, dass der Gebrauch militärischer Gewalt in den beiden Ereignisketten nicht gleichzusetzen sei, insofern im Donbas wie auf der Krim bei der Abstimmung über die Unabhängigkeit der Ukraine vom Sommer 1991 eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung für diese Unabhängigkeit gestimmt hat, die russischen Militäraktionen also im Gegensatz zu dieser Willensbekundung standen, während die NATO der Mehrheit der im Kosovo beheimateten Albaner zu Hilfe kam. Obendrein könne von einer politischen oder kulturellen Diskriminierung der Russischsprachigen in der Ukraine nicht die Rede sein. Aber dann befindet man sich bereits in einem politischen Disput, der sich im Austausch gegensätzlicher Positionen erschöpft. Die letzten Endes willkürliche Herstellung historischer Evidenzen, wie sie in der Befassung mit der Frage erfolgt, wer denn «mit der Gewalt angefangen» habe, hilft hier einer wissenschaftlich distanzierten Beschäftigung nicht weiter. Will man eine politische Festlegung durch eine bestimmte Temporalität der Ereignisreihung vermeiden, so ist man auf die Konstruktion von Modellen verwiesen, in denen die Bedingung der Möglichkeit von Friedensordnungen umrissen, zugleich aber auch die Risiken politischen Scheiterns infolge von Fehlentscheidungen oder falschen Beurteilungen beschrieben werden. Auf deren Grundlage können dann politische Entwicklungen zwischen Krieg und Frieden nachgezeichnet werden. Dabei geht es zunächst nicht um Schuld und Verantwortung, sondern um die Risiken, die aus unübersehbaren Konstellationen resultieren, um Entscheidungen unter der Voraussetzung unvollständiger oder falscher Informationen und um Dilemmata, in die politische Mächte in den jeweiligen Friedensordnungen geraten können.
Solche Modelle werden nachfolgend in einer doppelten Abfolge entwickelt: Zunächst geht es um Typen der Friedensordnung, die sich durch vertikale oder horizontale Achsen der politischen Machtverstrebung oder durch die ihnen jeweils zugrunde liegenden sozioökonomischen Konstellationen unterscheiden. Sie werden hier der leichteren Identifizierbarkeit halber nach ihren theoretischen Hauptvertretern als Vegetius-, Dante- und Comte-Spencer-Modell bezeichnet. Darin sind die Voraussetzungen und Direktiven einer Friedensordnung entwickelt, anhand derer sich nachvollziehen lässt, wann und inwiefern ein relevanter Akteur diese Vorgaben verfehlt oder gegen sie gehandelt hat. So wird jenseits der Willkürlichkeit bei der Konstruktion historischer Evidenzen eine Folie aufgespannt, um die Aktionen großer Mächte zu beurteilen; zugleich werden mögliche Perspektiven einer europäischen oder weltumspannenden Friedensordnung entwickelt, die für die weiteren Überlegungen dieses Buchs als intellektuelle Leitplanken dienen.
In einem zweiten Schritt wird dies noch einmal wiederholt an den Optionen, revisionistische Mächte einzubinden, die auf Veränderungen der bestehenden Friedensordnung aus sind; hier werden ökonomische Verschränkung, politisches Appeasement und militärische Abschreckung als Instrumente zur Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung gegeneinander konturiert. Bei diesem zweiten Schritt der Modellkonstruktion rücken die Überlegungen unmittelbar an die jüngsten Geschehnisse in Ostmitteleuropa heran, sind aber auch für die Entwicklungen im pazifischen Raum relevant. Die zweimal drei Modelle werden dabei gleichsam zu Ferngläsern, durch die sich Entwicklungen und Ereignisse sehr viel besser beobachten und beurteilen lassen, als wenn man unmittelbar vor ihnen steht – und dabei den Überblick verliert. Um die Beschäftigung mit diesen Modellen nicht zu abstrakt werden zu lassen, werden sie durchgängig mit historischen Beispielen gespickt, in denen das, was die Wirkweise des Modells wie dessen Probleme und Risiken ausmacht, an konkreten Konstellationen der Geschichte veranschaulicht wird.
Friedensordnung I: das Vegetius-Modell
Wird der Frieden als eine Folge davon angesehen, dass die Kosten eines Krieges prinzipiell höher sind als die seines potentiellen Ertrags, und das nicht zuletzt deswegen, weil sich mit Beginn eines Angriffskrieges politische und militärische Allianzen gegen den Angreifer bilden, die ihm militärisch untragbare Verluste oder schwerwiegende politische und wirtschaftliche Nachteile zufügen, welche ihn um alle Vorteile des Angriffskrieges bringen, dann muss es im politischen System mindestens drei Akteure geben, deren militärische Fähigkeiten so groß sind, dass sie jedem Friedensbrecher gewaltigen Schaden oder gravierende Nachteile zufügen können. Das Erfordernis von mindestens drei Akteuren, die in der Lage sind, einen Regelbrecher und Friedensstörer in die Schranken der bestehenden Ordnung zu weisen, ergibt sich daraus, dass bei einem geschlossenen System einer von diesen Dreien selbst der Regelbrecher und Friedensstörer sein kann, so dass mindestens zwei Mächte vorhanden sein müssen, die seine Gewinne aus Regelbruch und Friedensstörung zunichtemachen, und man sich zudem uneingeschränkt auf ihr entschiedenes Gegenhandeln verlassen kann. Der Grund dieser Verlässlichkeit würde darin bestehen, dass sonst ihre eigene Position in der Ordnung deutlich geschwächt würde und sie sich gleichzeitig aufgrund ihrer überlegenen Fähigkeiten in der Lage sehen, dem Regelbrecher und Friedensstörer entgegenzutreten.
Die Pointe dieses Typs von Ordnung besteht somit darin, dass – modelltheoretisch betrachtet – ihre Verteidiger, indem sie die eigenen Interessen verfolgen, für den Fortbestand der Ordnung und die Aufrechterhaltung oder notfalls auch Wiederherstellung des Friedens sorgen. Man muss ihnen also keine Verpflichtung zu einem in der Ordnungsverteidigung bestehenden Gemeinwohl auferlegen, bei dem unklar bleibt, ob sie solchen – im weiteren Sinn moralischen – Forderungen folgen würden, sondern es genügt, dass sie ihr bloßes Eigeninteresse im Auge haben.[10] Um diese Aufgabe erfüllen zu können, müssen sie freilich militärische Fähigkeiten besitzen, die hinreichend groß sind, um einen potentiellen Regelbrecher und Friedensstörer von seinem Vorhaben abzuschrecken oder ihn, wenn er sich nicht hat abschrecken lassen, in die Schranken zu weisen und sicherzustellen, dass er aus Regelbruch und Krieg keine Vorteile zieht. Dieses Modell folgt der von dem römischen Militärtheoretiker Flavius Vegetius formulierten Devise si pacem vis para bellum – wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor, oder, vielleicht treffender übersetzt: sei auf den Krieg vorbereitet.[11] Nennen wir dieses System das Vegetius-Modell und die ihm zugrunde liegende Anforderung den Para-bellum-Imperativ.[12]
Die politischen Risiken des Vegetius-Modells bestehen neben einer Verabredung der Starken gegen die Schwachen darin, dass es einerseits bei der Bevölkerung der dem System angehörenden großen Mächte Akzeptanz finden muss und andererseits für diejenigen glaubwürdig zu sein hat, gegen die sich die Kriegsvorbereitung zur Verhinderung eines Krieges richtet. Das Vegetius-Modell mit dem Para-bellum-Imperativ ist strukturell kontraintentional: Was man faktisch betreibt, ist das Gegenteil dessen, was man tatsächlich anstrebt. Man bereitet sich auf die Führung eines Krieges vor, um in Frieden leben zu können. Aber dabei kann bei Freund und Feind, bei der eigenen Bevölkerung (das ist im Wesentlichen ein Problem von Demokratien) wie bei denen, die durch die Kriegsvorbereitung zur Wahrung des Friedens gebracht werden sollen, der Eindruck entstehen, man rede bloß vom Frieden, bereite tatsächlich aber einen Krieg vor, in dem es keineswegs um die Wahrung des Status quo gehe, sondern um die Ausweitung der eigenen Macht beziehungsweise die Eroberung und Annexion von zu anderen Staaten gehörenden Territorien. Unter dem Deckmantel der Friedenswahrung, so der Verdacht, schaffe man die Voraussetzungen für einen Krieg, um die bestehende Ordnung zu ändern oder auch eine ganz andere zu errichten. Wer kann schon mit Sicherheit sagen, ob das Paradoxon des si pacem vis para bellum tatsächlich eines der vielen Paradoxa der Politik ist? Oder ob es sich um eine Täuschung handelt, bei der das als kontraintentional Behauptete das tatsächlich Intendierte, das pacem velle (Frieden wollen) die Tarnfarbe für das bellum gerere (Krieg führen) ist. Historische Beispiele dafür lassen sich zuhauf finden.
Sobald man der Bindung an die Paradoxie misstraut, entsteht ein Sicherheitsdilemma, das sich wie folgt beschreiben lässt: Die eine Seite des Systems erhöht ihre Rüstungsanstrengungen, weil sie davon ausgeht, dies sei zur Aufrechterhaltung eines militärischen Gleichgewichts und zur Einbindung der anderen Seite in die bestehende Ordnung vonnöten. Von der Gegenseite wird das jedoch als eine Politik des militärischen Übergewichts wahrgenommen, weswegen sie ihrerseits Aufrüstungs- beziehungsweise Nachrüstungsanstrengungen unternimmt, was dann von der ersten Seite wiederum als eine gegen sie gerichtete Bedrohung angesehen wird. Die reagiert darauf mit zusätzlichen Rüstungsanstrengungen – mit der Folge, dass die Beteiligten in eine nach oben offene Rüstungsspirale hineingeraten. Gefährlich wird das dann, wenn eine Seite dabei zu dem Ergebnis kommt, ein kurzer Krieg sei für sie besser als das Gefangensein in einer sich endlos drehenden Rüstungsspirale. Der Weg in den Ersten Weltkrieg lässt sich, zumindest teilweise, als Entscheidung zum Krieg zwecks Ausnutzung eines augenblicklichen Übergewichts rekonstruieren.[13] Rüstungsspiralen sind dadurch gekennzeichnet, dass die eine Seite einen zeitweiligen militärischen Vorteil hat, womit sich für sie ein Zeitfenster öffnet, in dem sie, wenn alles gut läuft, siegen kann. Solche Zeitfenster haben eine erhebliche politische Suggestivität. Sie sind damit die größte Gefährdung für politisch-militärische Gleichgewichtskonstellationen.
Das Vegetius-Modell funktioniert also nur dann zuverlässig, wenn die Gefahr des Eintritts in endlose Rüstungsspiralen durch entsprechende Rüstungsbegrenzungsabkommen beschränkt ist und keiner der dem System Angehörenden damit rechnen muss, auch ohne Krieg – durch immer weitere Rüstungen der Gegenseite, auf die zu reagieren ihn ökonomisch überfordert – zugrunde gerichtet zu werden. Das war die Gefahr, mit der die Friedensbewegung im Westen während der 1980er Jahre unter anderem argumentierte: dass die Sowjetunion, da sie von den verfügbaren Ressourcen und ihrer Technologie her der westlichen Rüstungsdynamik nicht würde folgen können, ihre Rettung in einem Präventivangriff auf den Westen suchen und in einem Verzweiflungsakt einen Krieg beginnen könnte. Ein solcher Ausbruch aus der Rüstungsspirale ist irrational, aber in Konstellationen struktureller Ausweglosigkeit nicht ausgeschlossen. Dazu ist es in den 1980er Jahren nicht gekommen, aber das war von den modelltheoretischen Annahmen her alles andere als selbstverständlich und womöglich nur die Folge eines kontingenten Vorgangs: der Wahl von Michail Gorbatschow zum Generalsekretär der KPdSU.
Zu den strukturellen Risiken des Vegetius-Modells gehört aber auch, dass gar nicht Rüstungsanstrengungen selbst, sondern der ökonomische Aufstieg eines Akteurs in Friedenszeiten bei stetigem Zurückfallen seines potentiellen Kontrahenten dazu führt, dass dieser sich zu einem Krieg entschließt, von dem er hofft, er werde die Nachteile wettmachen, welche er im Frieden hinnehmen muss. Man wechselt dann, spieltheoretisch betrachtet, die Konkurrenzbedingungen, um die Bahn des strukturellen Abstiegs zu verlassen. Das ist zurzeit das politische Risiko im Verhältnis zwischen den USA und China, das mit der Bezeichnung «Thukydides-Falle» belegt worden ist.[14] Wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Krieges zwischen den USA und China im konkreten Fall auch immer sein mag – das Risiko steigender Kriegswahrscheinlichkeit erwächst aus einer Infragestellung der paradoxen Logik des Vegetius-Modells, weil in diesem nur die genuin militärischen, aber nicht die sozioökonomischen Faktoren berücksichtigt sind. Neben dem Sicherheitsdilemma und der Verabredung der großen Mächte zum Nachteil der kleinen ist die Falle des Thukydides das dritte dem Vegetius-Modell und dem Para-bellum-Imperativ inhärente Problem.