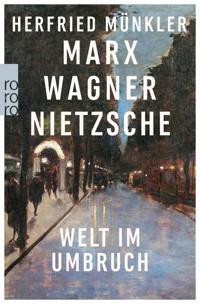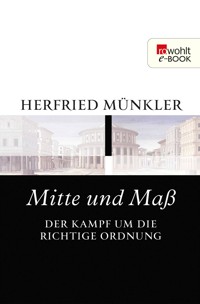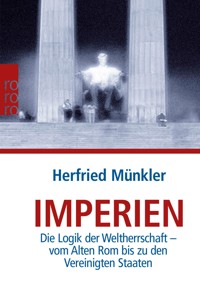Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kursbuch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Kursbuch 214 widmet sich sowohl den widersprüchlichen Romantiken von Freundschaft als auch den differenzierten Abgründen von Feindschaft. Aktueller könnte ein Thema fast nicht sein. Das Denken in Freund-/Feind-Schemata ist auf der Tagesordnung zurück, mit all seinen Untiefen, seinen Risiken, seinen normativen Implikationen und seinen Konsequenzen. Herfried Münkler untersucht in seinem Beitrag die historische und kategoriale Genese des Freund-Feind-Antagonismus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 27
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Herfried MünklerWas macht den Feind zum Feind? Und was den Freund zum Freund?Eine kleine Typologiereise
Der Autor
Impressum
Herfried MünklerWas macht den Feind zum Feind? Und was den Freund zum Freund?Eine kleine Typologiereise
Nach 1989/1990, dem Ende des Kalten Krieges, wollte man in Europa von Feind und Feindschaft nichts mehr hören. Und schon gar nicht wollte man Feind und Feindschaft als Begriffe des Politischen durchdenken. Wenn überhaupt, dann beschäftigte man sich mit Prozessen der Verfeindung, denen sich umgehend das Gegenprojekt einer Entfeindung beziehungsweise Befreundung gegenüberstellen ließ. Feindschaft, so legte die dekonstruktivistische Herangehensweise nahe, war ein ideologisches Konstrukt, das man ideologiekritisch sezieren und damit entschärfen konnte.
Das passte in den Entwurf einer Weltordnung, in der es zwar Konkurrenten, aber keine Feinde geben sollte. Konkurrenz wiederum wurde als Anreiz zur Selbstoptimierung angesehen und verwies damit auf einen selbst zurück. Man musste sich mit dem Konkurrenten nur unter dem Aspekt des Kompetitiven beschäftigen und konnte sich eine genauere Befassung mit dessen Motiven und Zielen ersparen. Das nämlich hätte dazu führen können, dass man bei ihm womöglich auf feindselige Absichten und Empfindungen gestoßen wäre – was zu Misstrauen gegenüber dem Konkurrenten geführt hätte. Misstrauen aber ist häufig der Anfang von Verfeindung, und das sollte im Ansatz verhindert werden.
Gegenüber Konkurrenten müssen – im Unterschied zu Feinden – deren Motive und Absichten nicht ergründet werden. Sie sind entweder von vornherein klar oder für die Austragung der Konkurrenz belanglos. Hat man es mit Konkurrenten zu tun, genügt es, Regeln aufzustellen, an die sich alle zu halten haben. Ist das der Fall, so ist ein fairer Wettbewerb gewährleistet. Dementsprechend war (und ist) von einer »regelbasierten internationalen Ordnung« die Rede. Dabei wird das Völkerrecht als Herzstück der Regelordnung angesehen. So konnte man zu der Überzeugung gelangen, Feind und Feindschaft als elementare Bestandteile der politischen Welt hinter sich gelassen zu haben. Man musste deswegen keineswegs mit allen anderen befreundet sein. Ein verbindliches Regelwerk verhindert Feindschaft und dispensiert vom Zwang zur Feindschaft. Dennoch war auffällig, dass, je weniger von Feinden gesprochen wurde, umso häufiger von Freunden die Rede war. So gänzlich traute man der Regeltreue dann doch nicht. Also beschwor man die Verlässlichkeit der Verhältnisse durch einen hypertrophen Gebrauch des Freundschaftsbegriffs. Tatsächlich hatte man allen Grund, der Regeltreue der politischen Akteure zu misstrauen, denn in der Weltordnung gab es keinen, der für die Regeleinhaltung im globalen Rahmen sorgte. Eine überbordende Freundschaftssemantik lenkte von diesem Manko der Regelordnung ab.
Die in den Kultur- und Sozialwissenschaften verbreitete Vorstellung von der Verfeindung als Ursache der Feindschaft 1 orientiert sich an der in der Nationalismusforschung prominenten These Ernest Gellners, wonach der Nationalismus der Entstehung von Nationen vorausgehe.2 Das lässt sich am deutschen Beispiel, aber auch an einer Reihe anderer mitteleuropäischer Natiogenesen bestätigen. Freilich muss die Idee der Nation, wie auch immer sie begründet sein mag, schon vorhanden sein, damit Nationalismus entstehen kann. Insofern muss es auch die Idee des Feindes, die Vorstellung von einem existenziellen Gegensatz, der gegebenenfalls auf Leben und Tod ausgetragen wird, geben, bevor Prozesse der Verfeindung in Gang kommen und »die Massen ergreifen« können.
Das wird im Konzept der Verfeindung als der Ursache von Feindschaft zumeist übersehen: Zumindest ein Begriff