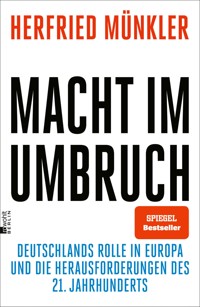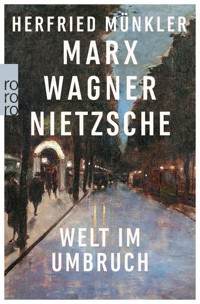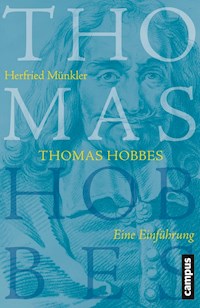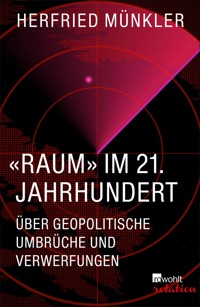14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zum Buch
Unsere Welt ist wieder politischer geworden. Eine Krise folgt auf die nächste, die Weltordnung hat sich in eine Weltunordnung verwandelt. Wo lässt sich Orientierung finden? Herfried Münkler und Grit Straßenberger führen den Leser in das Archiv politischen Denkens, wo die Ideen der großen Philosophen aufbewahrt werden – Platon und Aristoteles, Augustinus und Thomas von Aquin, Machiavelli und Thomas Hobbes, John Locke und Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu und Kant, Hegel und Marx, Max Weber und Carl Schmitt. Bei ihnen lässt sich Material finden für das Labor, in dem jeder für sich am Verständnis der Gegenwart werkeln muss. So führt dieses Buch ein in die politische Ideengeschichte und die politische Theorie, und zeigt dabei, was dieses Fach leisten kann, um Sichtachsen in unsere verworrene Zeit zu schlagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Herfried Münkler/Grit Straßenberger
POLITISCHE THEORIE UNDIDEENGESCHICHTE
Eine Einführung
Unter Mitarbeit von Vincent Rzepkaund Felix Wassermann
C.H.Beck
Zum Buch
Unsere Welt ist wieder politischer geworden. Eine Krise folgt auf die nächste, die Weltordnung hat sich in eine Weltunordnung verwandelt. Wo lässt sich Orientierung finden? Herfried Münkler und Grit Straßenberger führen den Leser in das Archiv politischen Denkens, wo die Ideen der großen Philosophen aufbewahrt werden – Platon und Aristoteles, Augustinus und Thomas von Aquin, Machiavelli und Thomas Hobbes, John Locke und Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu und Kant, Hegel und Marx, Max Weber und Carl Schmitt. Bei ihnen lässt sich Material finden für das Labor, in dem jeder für sich am Verständnis der Gegenwart werkeln muss. So führt dieses Buch ein in die politische Ideengeschichte und die politische Theorie, und zeigt dabei, was dieses Fach leisten kann, um Sichtachsen in unsere verworrene Zeit zu schlagen.
Über die Autoren
Herfried Münkler ist Professor für Theorie der Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin. 2009 erhielt er den Preis der Leipziger Buchmesse für sein Werk über die Mythen der Deutschen. Bei C.H.Beck ist von ihm erschienen: Lexikon der Renaissance (zus. mit Marina Münkler, 2005).
Grit Straßenberger ist Professorin für Politische Theorie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
INHALT
Vorwort
Einleitung: Was ist und wozu studiert man Politische Theorie und Ideengeschichte?
Die Stellung der Politischen Theorie und Ideengeschichte im Fach Politikwissenschaft
Einübung in politikwissenschaftliches Problemdenken
Der Challenge-and-Response-Ansatz der politischen Ideengeschichte
Zur Konzeption dieser Einführung
Anmerkungen
Kapitel 1: Die Politik und das Politische
Das Denken des Politischen: ein Überblick
Aristoteles und der (Neo)Aristotelismus
Politik als Kampf um Macht und Einfluss: Machiavelli und Weber
Carl Schmitt und die Freund-Feind-Unterscheidung als Kriterium des Politischen
Die «Wiederentdeckung» des Politischen
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Kapitel 2: Staat und Nation
Das schwierige Kompositum «Nationalstaat»
Vom Personenverbandsstaat zum institutionellen Flächenstaat
Staatsräson als politische Leitdirektive
Staatsmetaphorik und Staatsapparatur
Kant, Hegel und Marx über den Staat
Der Staat im 20. Jahrhundert und darüber hinaus
Nation und Nationalismus
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Kapitel 3: Herrschafts- und Verfassungsformen: Typologien der politischen Ordnung
Legitimationserzählung und Verfassungsbildung
Die Verfassungstypologie des Aristoteles
Der Kreislauf der Verfassungsformen und die Idee der Mischverfassung
Die Vorstellung von der Gewaltenteilung: Locke, Montesquieu, Madison
Die drei Idealtypen der Herrschaft bei Max Weber mit Seitenblicken auf Simmel und Marx
Die Wiederkehr patrimonialer Herrschaftsformen
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Kapitel 4: Souveränität und die Infrastruktur der Macht
Komponenten und Dimensionen des Souveränitätsbegriffs
Die Entstehung des Souveränitätskonzepts in den Bürgerkriegen des 16. und 17. Jahrhunderts
Von der Ritterschaft über die Condottieri zum miles perpetuus: das MilitärDie Beamtenschaft bei Machiavelli, Lipsius, Bodin und Hegel
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Kapitel 5: Republikanismus und Liberalismus
Was ist eine Republik?
Liberalismus und Republikanismus: theoretisch-methodische Voraussetzungen ihrer Kontrastierung
Die Bürgertugend und deren notorische Erosion
Lässt sich eine Republik durch die Tötung ihrer Feinde retten?
Der französische Tugenddiskurs: Montesquieu, Rousseau, Robespierre
Die Durchsetzung des Interessendiskurses auf dem Felde der Ökonomie: die Konstitution des Liberalismus
Bürgerliche Tugend und politische Freiheit: ein Ausblick
Anmerkungen
Weiterführende Litratur
Kapitel 6: Der Vertrag und die Erzählung. Kontraktualismus und Narration als Legitimationsformen der politischen Ordnung
Alles Narration? Ansätze einer politikwissenschaftlichen Narratologie
Thomas Hobbes’ staatsphilosophischer Kontraktualismus
Liberale und republikanische Versionen der Gesellschaftsvertragstheorie: John Locke und Jean-Jacques Rousseau
Der Staat der Vereinbarung und die Politik der Narration
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Kapitel 7: Freiheit und Gerechtigkeit
Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit
Freiheiten und Freiheit
Grundriss einer Ideengeschichte der Freiheit
Viele Antworten auf die Frage nach der Gerechtigkeit
Welche Gleichheit ist gerecht?
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Kapitel 8: Tyrannis und Diktatur
Der Kampf mit Begriffen und die Verwirrung der Begriffe
Charakteristika der Tyrannis: Geldgestützte Gewaltherrschaft
Über den Zugang zum Machthaber: der Intellektuelle und der Tyrann
Xenophons «Hieron» und die Einsamkeit des Tyrannen
Widerstandsrecht, Tyrannenmord und die «Tyrannei der Mehrheit»
Die Diktatur: Von der altrömischen Magistratur zur «Diktatur des Proletariats»
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Kapitel 9: Idealstaat und Utopie
Die neue Literaturgattung der Sozialutopie
Die Utopien der Frühen Neuzeit: Morus, Campanella, Bacon
Die antike Idealstaatsidee und die Idealstädte der Renaissance und des Barock
Von der Utopie zur Uchronie
Die Anti-Utopien des 20. Jahrhunderts
Die philosophisch-sozialwissenschaftliche Debatte über die Utopie
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Kapitel 10: Rebellion und Revolution
Begriffliche Klärungen: Beschleunigung der Geschichte oder Verteidigung menschlicher Würde
Die Französische Revolution und das ideengeschichtliche Bündnis von Revolution und Fortschritt
Theorien der Revolution und der Kampf um Deutungshoheit
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Kapitel 11: Staatenkrieg und Bürgerkrieg
Eine sehr kurze Geschichte von Krieg und Frieden
Die Auflösung von Gemengelagen des Krieges mit politischen und juridischen Mitteln
Ätiologien des Krieges: Frauenraub und Heldenruhm, politisch-kulturelle Selbstbehauptung und der Kampf um Macht und Größe
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Kapitel 12: Imperium und Staatensystem
Eine Florentiner Debatte über die politische Ordnung Europas und die venezianischen Ursprünge der Diplomatie
Gleichgewicht und Hegemonie in der Geschichte Europas
Imperien und Imperialismustheorien
Steppenimperien, Großreiche und langlebige Hybridbildungen
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Kapitel 13: Religion und Politik
Martin Luther und Thomas Müntzer über Widerstand und revolutionären Umsturz
Martin Luthers Vorstellung von der Obrigkeit als Instrument Gottes
Die Religion als Konfliktverschärfer oder Konfliktbegrenzer
Etappen der Religionskritik in der europäischen Ideengeschichte
Apokalyptische Bilder und kosmoskonservative Grundhaltung
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Personenregister
VORWORT
Diese Einführung in die Politische Theorie und Ideengeschichte geht neue Wege: Sie folgt nicht dem herkömmlichen Prinzip einer Darstellung des politischen Denkens in chronologisch geordneter Abfolge der wichtigsten Theoretiker und ihrer Werke, sondern ist an zentralen Leitbegriffen und zugehörigen Problemfeldern orientiert. Am Anfang eines jeden der dreizehn Kapitel steht eine knappe Vorbemerkung, die aus der Perspektive politisch aktueller Fragestellungen und ihrer analytischen Beschreibung heraus verfasst ist. In ihr werden die Herausforderungen skizziert, denen gegenüber die politiktheoretischen Begriffe Reaktionen darstellen bzw. dargestellt haben, an denen sie gescheitert sind oder, zumindest zeitweilig, von Erfolg getragen wurden. Politisches Denken wird hier nicht als Abfolge von Theorien und deren Dogmatisierungen vorgeführt, sondern als Bestandteil politischer Konflikte und Auseinandersetzungen, in denen eine bestimmte Antwort selten die einzige war und fast nie ungeteilte Zustimmung gefunden hat.
Auf eine solche Zustimmung waren die politischen Ideen und Theorien jedoch aus. Sie setzen eine spezifische Problemwahrnehmung voraus oder versuchen diese mit argumentativen und/oder suggestiven Mitteln plausibel zu machen, um auf diese Weise die Akzeptanz ihrer Antworten als Problemlösung oder doch vielversprechende Problembearbeitung vorzubereiten. Politische Theorien sind, die einen mehr, die anderen weniger, immer auch Interventionen in politische und gesellschaftliche Auseinandersetzungen, aber es sind dies Interventionen einer besonderen Art: Sie stellen weder eine abschließende Entscheidung dar noch können sie selbst auf die Instrumente des Zwangs zurückgreifen (auch wenn sie derlei verschiedentlich anraten), sondern sind allein auf die Plausibilität ihrer Beschreibungen und die Überzeugungskraft ihrer Argumente angewiesen.
Wir haben uns entschlossen, nicht einzelne Leitbegriffe zu bearbeiten, sondern sie paarweise zu gruppieren, wobei dies in gegensätzlicher, ebenso aber auch in komplementärer Form erfolgen kann. Im einen Fall markieren die Leitbegriffe die Eckpunkte eines Problemfeldes, im anderen stellen sie eher unterschiedliche Wahrnehmungen oder Ausleuchtungen dieses Problemfeldes dar. Über die paarweise Gruppierung der Leitbegriffe lassen sich die Problemfelder klarer konturieren und zugleich die Brückenschläge zu jüngeren politiktheoretischen Entwürfen aufzeigen. Eine solche Verbindung von politischer Theorie und Ideengeschichte gelingt in der hier gewählten Darstellung erheblich besser als dies bei einer autorenbezogenen und chronologisch aufgebauten Einführung möglich ist. Zudem entspricht dieses Vorgehen unserer Grundvorstellung, wonach die politische Ideengeschichte das Archiv und das Labor sei, deren sich die aktuelle Politische Theorie bedient, um Antworten für heutige Herausforderungen zu entwickeln.
Hinter dem Entschluss, statt Theoretikern und ihrer Werke Leitbegriffe und Problemfelder darzustellen, steht aber auch eine methodische Grundentscheidung im Umgang mit der Geschichte des politischen Denkens: Politische Ideen und Theorien werden hier als mehr oder weniger ausgearbeitete Antworten auf die sozio-politischen Herausforderungen ihrer Zeit verstanden. D.h. sie erwachsen nicht nur aus bestimmten sozialen und politischen, ökonomischen und ökologischen Konstellationen, sondern reagieren mit ihren Deutungsangeboten auf die sich im Verlauf der Geschichte wandelnden Herausforderungen und wirken auf diese selbst ein. Und da eine Idee oder Theorie selten die einzige Antwort auf ein Problemfeld ist, sondern mit anderen konkurriert oder kooperiert, sind Theorien immer auch Antworten auf andere Theorien und damit zugleich Reaktionen auf die durch diese Theorien veränderten Konstellationen. Diese Etappen in einem diachronen Diskurs darzustellen und an einigen Querschnitten in der Geschichte des politischen Denkens auszuleuchten, dient die hier gewählte Darstellungsform in Leitbegriffen. Ob dies gelungen ist, muss der Leser beurteilen.
Berlin und Bonn, August 2015
EINLEITUNG:WAS IST UND WOZU STUDIERT MAN POLITISCHETHEORIE UND IDEENGESCHICHTE?
Die Stellung der Politischen Theorie und Ideengeschichte im Fach Politikwissenschaft
Die Politikwissenschaft ist eine junge akademische Disziplin mit einer langen Tradition. Als Begründer der politischen Wissenschaft gilt der griechische Philosoph Aristoteles. In Abgrenzung zu Platon plädierte er dafür, das Politische als eine eigene Sphäre zu begreifen, in der nicht das Wissen, sondern das Handeln zentral ist. «Praktische Philosophie über die menschlichen Angelegenheiten» hat Aristoteles seinen neuen, genuin politischen Zugang zu diesem besonderen Handlungsbereich genannt und dabei thematisch und schriftenmäßig zwischen Politik und Ethik unterschieden: Während die Nikomachische Ethik die handlungstheoretischen und tugendethischen Grundlagen der guten politischen Ordnung enthält, werden in der Politik institutionelle Ordnungen, Verfassungsformen und gesellschaftliche Realisierungsbedingungen des guten Lebens (eu zēn) behandelt.
In Aristoteles’ Entwurf der praktischen Philosophie wird bereits eine zentrale Eigenart der Politikwissenschaft angedeutet: Sie ist eine Wissenschaft, die im Unterschied etwa zu den methodisch sehr viel ausgefeilteren Naturwissenschaften in der Wahl ihrer Gegenstände und Probleme nicht autonom ist. Was jeweils zum Thema der Politikwissenschaft wird, bestimmen nicht allein die Politikwissenschaftler; die Forschungsagenda wird vielmehr von großen politischen Fragen und Problemen der jeweiligen Gegenwart beeinflusst bzw. von einflussreichen politischen Akteuren mitbestimmt. Die Politik ist in der Politikwissenschaft also immer präsent, und zwar nicht nur im Hinblick auf die seit Platon und Aristoteles heftig diskutierte und bis heute unentschiedene Frage, worin das Wesen des Politischen besteht, sondern eben auch in dem unmittelbaren Sinne, dass Politikwissenschaft dem jeweiligen historisch-politischen Kontext verhaftet ist, auf konkrete politische Herausforderungen reagiert und zudem unter dem Druck steht, ihre Praxistauglichkeit immer wieder aufs Neue beweisen zu müssen.
Das Politische der Politikwissenschaft und die darin begründete Heteronomie dieser – jedenfalls im deutschen akademischen Kontext – jungen akademischen Disziplin hat spezifische Konflikte produziert, und zwar innerhalb der Politikwissenschaft selbst, sodann in ihrem Verhältnis zur Politik und schließlich im Kreis der etablierten universitären Disziplinen, von denen Themengebiete für sich selbst reklamiert wurden.[1] So sah sich die Politikwissenschaft in Deutschland, wo sie nach 1945 im Rahmen des sogenannten «reeducation»-Programms als «Demokratiewissenschaft» etabliert wurde, dem seinerzeit massiv vorgetragenen Vorbehalt der «klassischen» Fakultäten ausgesetzt, keine eigenständige wissenschaftliche Disziplin zu sein, sondern ihre Themenstellungen gewissermaßen parasitär der Rechtswissenschaft, der Geschichte, der Soziologie und partiell auch der Volkswirtschaftslehre sowie der Philosophie zu entlehnen. Die politisch initiierte Reetablierung der Politikwissenschaft als akademisches Fach und der Einspruch der kanonisierten universitären Disziplinen haben trotz der akademischen Anerkennung Anfang der sechziger Jahre das Selbstverständnis der Politikwissenschaftler und ihre innerdisziplinäre Diskussionskultur bis heute geprägt.
Seit ihrer Anerkennung als eigenständige akademische Disziplin – und unter den gegenwärtigen Bedingungen einer verschärften Konkurrenz um notorisch knappe Forschungsmittel und um das knappe Gut der öffentlichen Aufmerksamkeit noch einmal in verschärfter Weise – haben die politikwissenschaftlichen Teildisziplinen einen für die Stellung des Fachs innerhalb des akademischen Feldes, aber auch hinsichtlich ihrer öffentlichen Wahrnehmung eher kontraproduktiven Streit um ihren wissenschaftlichen Status und ihre Praxisrelevanz geführt. Dabei haben sich jeweils die Teildisziplinen durchgesetzt, die den Nachweis erbringen konnten, empirisch anschlussfähig und/oder auf der Höhe der praktischen Politikberatung zu sein. Die Politische Theorie und Ideengeschichte schneidet in diesem Kampf um öffentliche Anerkennung, Geld und Positionen derzeit nicht so gut ab. Bildete sie in der Bundesrepublik Deutschland seit mehreren Jahrzehnten einen der vier fest etablierten Teilbereiche der Politikwissenschaft, so wird ihr dieser Status seit geraumer Zeit von den drei anderen klassischen Lehr- und Forschungsbereichen – der Innenpolitik, der Vergleichenden Politikwissenschaft und der Internationalen Politik – sowie von der neu etablierten Governance-Forschung streitig gemacht.[2] Eine Begründung für die gegenwärtig zu beobachtende Umwidmung von Professuren für Politische Theorie und Ideengeschichte in sogenannte Bindestrich-Professuren lautet, dass zu jeder Wissenschaft Theorie gehörte, dass also die anderen politikwissenschaftlichen Teilbereiche das immer schon mitmachten, was die Politische Theorie und Ideengeschichte für sich als Alleinstellungsmerkmal beanspruchen würde. – Was ist dran an diesem Vorwurf?
Unbestritten kommt Wissenschaft nicht ohne Theorie aus. Das gilt für die Politikwissenschaft ebenso wie für die anderen Gesellschafts- und Sozialwissenschaften und natürlich auch für die Naturwissenschaften. Jede Wissenschaft, sei sie noch so empirisch oder politikberatend ausgerichtet, geht von bestimmten theoretischen Modellen und methodologisch begründeten Vorentscheidungen aus. Dass Wissenschaft auf theoretischen Voraussetzungen aufruht, ist also ein Allgemeinplatz, der als Argument gegen die Politische Theorie und Ideengeschichte nicht taugt. Auffällig an den Einsprüchen ist indes, dass das Alleinstellungsmerkmal «Theorie» in Frage gestellt wird, nicht aber die ideengeschichtliche Herangehensweise. Diese nämlich können die anderen politikwissenschaftlichen Teildisziplinen keineswegs für sich in Anspruch nehmen. Durch das «Anhängsel» Ideengeschichte gewinnt die Politische Theorie nicht nur einen in seiner Weite und Tiefe höchst spezifischen, von anderen politikwissenschaftlichen Teildisziplinen unterschiedenen Gegenstandsbereich, sondern dadurch praktiziert sie auch eine methodisch hoch differenzierte Selbstreflexion, die so bei keiner anderen Teildisziplin des Fachs zu beobachten ist. Nun ist aber eben diese in der Politischen Theorie und Ideengeschichte praktizierte Methodenvielfalt, ja der innerhalb dieser Teildisziplin selbst vehement geführte Streit um das methodische Profil des Fachs, zugleich ein Problem – und zwar kein wissenschaftliches, sondern ein wissenschaftspolitisches. «Innerparteilicher» Streit ist zwar wünschenswert, insofern durch das begründete Austragen von Differenzen und den Wettbewerb der Argumente wissenschaftliche Innovationen entstehen, aber in der Interessenvertretung nach außen, also im Kampf um Einfluss, Geld und Macht, lassen sich (wissenschafts-)politische Ansprüche umso besser vertreten und durchsetzen, je geschlossener sich eine Disziplin bzw. deren Teilbereiche in der Außenwirkung darstellen. Die Politikwissenschaft und insbesondere die politikwissenschaftliche Teildisziplin Politische Theorie und Ideengeschichte kennt diese Mechanismen, denn die Frage nach der Macht bildet einen ihrer Kernbereiche; zugleich aber besteht sie nicht ohne Grund darauf, dass die Wissenschaft einer anderen Logik folgen sollte als die Politik: Nicht Macht, sondern die Geltung von Argumenten sollte die wissenschaftliche Praxis leiten und jenen Erkenntnisfortschritt befördern, der über den wissenschaftlichen Bereich hinausreicht. Wie auch immer es um das aufklärerische Projekt einer selbstreflexiven, zur Kritik ihrer Normen, Institutionen und Praxen befähigten Gesellschaft bestellt sein mag, zu der die Politikwissenschaft beitragen will, die große Stärke der Politischen Theorie und Ideengeschichte, die methodischen Voraussetzungen ihrer Reflexion des Politischen selbst zum Gegenstand fachinterner bzw. teildisziplinärer Diskussion zu machen, erweist sich zugleich als ihre Achillesferse – es sei denn, es gelingt ihr, den Wettbewerb der Methoden, wie das Politische erfasst und begrifflich konzeptionalisiert werden kann, als Chance zu begreifen, ein eigenständiges Profil und eine teildisziplinäre Identität auszubilden, die für die Sichtbarkeit der Politikwissenschaft insgesamt förderlich ist und zudem die innerdisziplinäre Relevanz steigern kann. Nur dann könnte das weitergehende Argument entkräftet werden, die beiden additiv zusammengefügten Teilbereiche der Politischen Theorie und Ideengeschichte ließen sich sachlich aus der Politikwissenschaft ausklinken und ihren jeweiligen etablierten Disziplinen zuordnen: die «Politische Theorie» der (politischen) Philosophie und die «Ideengeschichte» der Geschichtswissenschaft.
Einübung in politikwissenschaftliches Problemdenken
Unter den Bedingungen notorischer Ungewissheit kann Politikwissenschaft die Politik nicht nur darauf vorbereiten, dass Gefahren anstehen – was in dieser allgemeinen Form ohnehin jeder kompetente Politiker weiß –, ihr Beitrag besteht vielmehr darin, bei der Antizipation und Analyse sowie der Bewältigung dieser Gefahren, also der Überführung in kalkulierbare Risiken, behilflich zu sein.[3] Damit die Politische Wissenschaft diese Leistungen für Politik erbringen kann, muss sie über unmittelbare Ursache-Wirkung-Relationen und kleinteilige Policy-Analysen hinaus die langen Wirkungszeiträume politischen Handelns und gesellschaftlicher Leitideen in den Blick nehmen. Politische Theorie und Ideengeschichte stellt eine solche Perspektive bereit. Die Ideengeschichte fungiert dabei als das «Archiv», in dem die Geschichte des politischen Denkens aufgespeichert und bewahrt wird, während die Theorie dieses Archiv in ein «Laboratorium» überführt, also die klassischen politischen Ideen und Theorien mit neuen Ingredienzen anreichert oder in einer bislang noch nicht getesteten Weise miteinander verbindet.[4] Der Gewinn für die Politik liegt darin, dass die Brauchbarkeit politischer Ideen vor ihrer realen Umsetzung intellektuell getestet werden kann; das Risiko für die Politische Theorie und Ideengeschichte liegt in dem Verspielen jener Distanz zum tagespolitischen Geschäft, die ihr reflexiv-kritisches Potenzial ausmacht. Denn je stärker eine politische Theorie durch die Probleme und Herausforderungen ihrer Zeit geprägt ist, desto geringer ist ihre Halbwertzeit. Die politische Ideengeschichte pflegt zur Ausbalancierung dieser Risiken Texte mit hoher Halbwertzeit. Sie ist mithin keineswegs nur eine Schatzkammer, die man auf der Suche nach einem originellen Appetizer gelegentlich aufsucht, sondern ein Arsenal der Politikanalyse. Zweieinhalb Jahrtausende der Geschichte des politischen Denkens sind hier nach systematischen und chronologischen Aspekten archiviert. In diesem Sinne handelt es sich sehr wohl um einen Schatz, dessen Mehrwert sich jedoch erst in seiner kompetenten Nutzung erweist bzw. sich im Vollzug erst realisiert. Die Ideengeschichte lässt sich als ein «Ort» beschreiben, an dem sichtbar wird, wie politische Denker die Probleme ihrer Zeit wahrgenommen und bearbeitet haben und wie sich daraus die spezifische Problembearbeitungskompetenz der jeweiligen Theorie ergeben hat. Die politiktheoretische Analyse gewinnt mit der politischen Ideengeschichte also nicht nur Bodenhaftung, sondern auch jene intellektuelle Sensibilität und Flexibilität, die für die Perzeption wie Bearbeitung neuer Probleme und Herausforderungen erforderlich ist.
Politische Ideengeschichte ist, wo sie nicht als pure Dogmengeschichte betrieben wird, ein unersetzlicher Exerzierplatz für die Einübung in ein politikwissenschaftliches Problemdenken, das Theorien als Antworten auf Herausforderungen begreift und die Entwicklung eines Gedankens in diesem Wechselspiel rekonstruiert. Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Marx – sie sind nicht als Produzenten fertiger Antworten interessant, sondern als politische Autoren, deren Denken mit der Bestandsaufnahme und Problemanalyse beginnt, um anschließend Antworten und Lösungsstrategien zu entwerfen. Nicht die fertigen Antworten, sondern das Weglassen und Hervorheben von Aspekten bei ihrer Entwicklung, die daraus erwachsende intellektuelle Attraktivität, aber auch die politischen Kosten dieser Komplexitätsreduzierung machen den analytischen und normativen Mehrwert der politischen Ideengeschichte aus.
Um diesen Mehrwert zu realisieren, darf die politische Ideengeschichte nicht in die Falle der Historizität gehen, indem sie Texte und Autoren säuberlich in die Folie ihrer eigenen Zeit verpackt und darin ruhen lässt. Sie muss diese vielmehr zu den Herausforderungen der eigenen Gegenwart in Bezug setzen, und das ist methodisch am ehesten durch theoretische Modellbildung möglich. Deswegen ist das «und» zwischen Theorie und Ideengeschichte entscheidend. Die Politische Theorie und Ideengeschichte gewinnt ihre intellektuelle Kraft und wissenschaftliche Attraktivität aus dem Vergleich, aus der Beobachtung von Ähnlichkeit und Differenz, Identität und Alterität. Aber im Unterschied zur professionellen Komparatistik muss sie sich dabei immer wieder auf hochriskante Vergleiche einlassen, und zwar solche diachroner wie synchroner Art. Hat der synchrone Vergleich, also die Analyse unterschiedlicher Zivilisationen hinsichtlich der vorherrschenden politischen Ordnungsmodelle und ihrer sozioökonomischen Grundlagen sowie der sie tragenden Ideen und Wertvorstellungen, eher die Erarbeitung operativer Szenarien, Strategien und Lösungen zum Ziel, so nimmt die diachrone Herkunfts- und Wirkungsanalyse die Genese von Ordnungsvorstellungen, ihre Konkurrenz und ihren Wandel in den Blick und dient vorrangig der epistemologischen Selbstaufklärung und dem Erkenntnisfortschritt. Dabei ist es oftmals gerade die sehr schwer zu bewerkstelligende Verbindung von synchroner und diachroner Analyse, in der sich das Potenzial von Politischer Theorie und Ideengeschichte einschließlich ihrer normativen Anteile entfaltet. Die politische Ideengeschichte dient dabei als jener «ferne Spiegel» (Barbara Tuchman), mit dem wir die eigene Gegenwart aus der Distanz studieren. Daraus ergeben sich überraschende und innovative Perspektiven. Um diese zu gewinnen, müssen die Theoriebestände freilich immer wieder neu gelesen und durchgearbeitet werden.
So verstanden verbindet der Lehr- und Forschungsbereich Politische Theorie und Ideengeschichte drei grundlegende politikwissenschaftliche Perspektiven: Die historisch-analytische Perspektive verfolgt Herkunft und Wandel politischer Kernbegriffe und zentraler politischer Ideen, wie Menschen- und Bürgerrechte, Souveränität, Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Diktatur und Revolution, und fragt nach deren Attraktivität und mobilisierenden Kraft für politische Bewegungen. Die Politische Theorie und Ideengeschichte ist, gerade weil sie praktische Wirkungsfragen zu berücksichtigen hat, immer mehr als reine Theoriegeschichte.[5] Sie erhebt zweitens einen zeitdiagnostischen Anspruch, d.h. sie analysiert gegenwärtige Krisen- und Konfliktsituationen in unterschiedlichen Politikbereichen – innere und äußere Sicherheit, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, bürgerschaftliches Engagement und Dritter Sektor oder die Transformation des Nationalstaates im Zuge von Europäisierung und Globalisierung sowie angesichts neuer Herausforderungen durch den internationalen Terrorismus – hinsichtlich ihrer Ursachen, Erscheinungsformen und möglichen Konsequenzen. Voraussetzung hierfür ist gleichwohl, dass Politische Theorie und Ideengeschichte systematisch ineinander greifen und zudem einen engen Kontakt zu den Diskursen um die gesellschaftspolitische Funktion von Theorie suchen. Schließlich behandelt Politische Theorie und Ideengeschichte prognostische bzw. therapeutische Fragen. Sie belässt es also nicht bei der Zeitdiagnose, sondern entwickelt und testet davon ausgehend Strategien und Szenarien des Umgangs mit Krisen und Konflikten, liefert alternative Konzeptualisierungen politischer Probleme, diskutiert kontroverse Lösungsvorschläge und eröffnet auf diese Weise neue Denkwege.
Die hier favorisierte Trias von historisch-analytischer Perspektive, Zeitdiagnose sowie Reaktions- und Reformvorschlägen erfordert freilich eine riskante Verknüpfung von kreativer Archivpflege und innovativem Laboratorium. Die von der Politischen Theorie und Ideengeschichte praktizierte Verbindung von theoretischer Innovation, gesellschaftlicher Selbstauslegung und politischer Ordnung stellt eine große methodologische Herausforderung dar, denn begrifflich-konzeptionelle Entwürfe können nicht allein mit Blick auf ihren systematischen Gehalt analysiert werden, wie dies die vornehmlich auf eine Kanonisierung von Klassikern abhebende politische Philosophie betreibt; vielmehr müssen politische Ideen, Begriffe und Konzepte historisch kontextualisiert werden. Erst wenn die politischen Herausforderungen sichtbar gemacht werden, auf die politische Denker mit ihren Konzepten reagieren, und die gesellschaftlichen Wirkungen von theoretischen Innovationen rekonstruiert werden, lassen sich die Vermittlung von politischer Theorie und Praxis analysieren und Handlungsvorschläge generieren, die für politische Entscheidungseliten wie für die politische Öffentlichkeit anschlussfähig sind.
Der Challenge-and-Response-Ansatz der politischen Ideengeschichte
Theorien als Antworten auf politische und gesellschaftliche Herausforderungen zu begreifen, also die Texte der politischen Ideengeschichte und die in ihnen entwickelten Argumente im Wechselspiel zwischen Bestandsaufnahme, Problemdiagnose und dem Entwurf von Lösungsstrategien zu analysieren, um einen neuen Blick auf die Gegenwart zu gewinnen, ist das zentrale Anliegen des Challengeand-Response-Ansatzes der politischen Ideengeschichte. In seiner Präferenz für ein historisch-kontextualistisches Verfahren der Analyse politischer Ideen, Institutionenarrangements und politischen Handelns besitzt er eine große Nähe zu dem prominent von Quentin Skinner und John Pocock vertretenen Ansatz der Cambridge School.[6]
Die Cambridge School gehört zu den sogenannten «adressatenzentrierten Ansätzen».[7] Entscheidend ist hier weniger, wer den Text geschrieben hat, welche Erfahrungen des Autors zentral waren und/oder in welchem Verhältnis die konkrete Schrift zum Gesamtwerk des Autors steht, sondern dass der Text «für jemanden geschrieben» wurde, sich also an einen bestimmten Adressatenkreis wendet, eine Botschaft vermittelt und damit im zeitgenössischen Kontext auf politische Wirkung abstellt. Um die politische Bedeutung eines Textes zu erfassen, müssen seine Kernaussagen in dem diskursiven und ideologischen Kontext analysiert werden, in dem er entstanden ist. Dementsprechend bildet nicht die in der klassischen Ideengeschichte eines Friedrich Meinecke favorisierte Diachronie der großen Denker, sondern die synchrone Textproduktion den Kontext der Analyse. Während Meineckes selektive Herangehensweise, sein offensives Eingeständnis, Ideengeschichte als eine Art Gipfelgespräch der großen Geister zu betreiben, als Beispiel dafür gelten kann, wie das ideengeschichtliche Archiv auf der Suche nach Lösungen für Probleme und Herausforderungen der je eigenen Zeit durchforstet wird,[8] steht Skinner für die semantische Erschließung des diskursiven Umfeldes der Theoriearbeit einzelner Autoren.[9]
Trotz der zuweilen sehr weit ausdifferenzierten historischen Diskurspanoramen ist der ideenpolitische Ansatz der Cambridge School in spezifischer Weise begrenzt: In seiner Fokussierung auf den «ideologischen» Umgang mit Begriffen[10] gerät zum einen die «Wissensordnung» aus dem Blick und damit auch das kritische Potenzial einer «Archäologie» politischer Ideengeschichte, wie sie Michel Foucault mit seiner gegen die traditionelle Ideengeschichte gerichteten genealogischen Methode der Diskurstheorie entwickelt hat.[11] Zentral ist hier der Status des Wissens als verdichtetes und autorisiertes Strukturmerkmal einer Gesellschaft, das auf die Herausbildung gesellschaftlicher Selbstdeutungen einen maßgeblichen Einfluss ausübt. Im Gegensatz zu Skinners Methode, politische und politiktheoretische Schriften als «Dokument» zu lesen, über das sich ein Autor absichtsvoll in die gesellschaftlichen Kontroversen seiner Zeit einmischt, versteht die von Foucault geprägte Diskurstheorie Texte als «Monument». Das Subjekt als intentionaler Autor und Urheber seiner Handlungen wird verabschiedet, und an seine Stelle tritt der (wissenschaftliche) Diskurs über die Standards der jeweiligen Zivilisation. Dieser wird zum eigentlichen Medium, in dem sich Macht konstituiert, und bildet damit den vornehmlichen Gegenstand der Untersuchung.[12]
Eine weitere (Selbst-)Begrenzung des ideenpolitischen Ansatzes der Cambridge School besteht in der weitgehenden Ausblendung der Frage, ob aus der historisch-politischen Analyse theoretisch-systematische Erkenntnisse gewonnen werden können, die eine kritische Evaluierung politischer Handlungsvorschläge ermöglichen. Eben dafür interessiert sich der Challenge-and-Response-Ansatz. In seiner stärker systematisch ausgerichteten Modellbildung stellt er darauf ab, die konzeptionellen Leistungen politiktheoretischer Entwürfe und ihre politischen Umsetzungschancen zu beurteilen – und zwar sowohl innerhalb ihres historischen Entstehungs- und Wirkungsrahmens als auch mit Blick auf die gesellschaftspolitischen Herausforderungen der Gegenwart.[13]
Die Annahme, dass die politische Ideengeschichte Potenziale für eine kritische Reflexion gegenwärtiger gesellschaftlicher Praxis enthält, ja dass im Rekurs auf die politische Geschichte und ihre begriffliche Tradierung in den Werken ausgewählter politischer Denker handlungsorientierende Vorbilder gewonnen werden können, hat der Challenge-and-Response-Ansatz mit hermeneutisch-interpretativen Theorien gemeinsam. Unter dieses weite Etikett fallen nicht nur die traditionellen Ansätze von Friedrich Meinecke, Leo Strauss und Arthur O. Lovejoy, die auf die zeit- und ortsunabhängige Geltung von Ideen abstellen, sondern dazu gehören auch performative Theorien des Politischen, die Politische Theorie als Intervention in gesellschaftliche Deutungskämpfe betreiben. Ausgangspunkt performativer Ansätze ist die Annahme, dass das Politische wesentlich sprachlich verfasst ist. Das betrifft sowohl das im engeren Sinne politische Handeln, also das in öffentlicher Rede und Gegenrede begründete Beraten und Entscheiden, als auch die begrifflich-konzeptionelle wie narrative Tradierung politischen Handelns, auf die sich Akteure interpretativ beziehen, wenn sie für ihre Vorschläge und Projekte um öffentliche Anerkennung und Unterstützung werben. Wie man etwa bei Hannah Arendt und Michael Walzer und radikaler – zumindest was die polemische Zuspitzung und postmoderne Kampfterminologie betrifft – bei Chantal Mouffe beobachten kann, messen performative Ansätze der theoretischen Reflexion selbst einen ideellkonstitutiven Beitrag für politische Praxis bei. Diesem hermeneutisch-performativen Verständnis politischer Praxis[14] zufolge ist es keineswegs bedeutungslos, wie und in welcher Absicht vergangenes und gegenwärtiges Tun ideengeschichtlich tradiert und begrifflich konzeptionalisiert wird. Über die Kritik dominanter Wahrnehmungskategorien des Politischen und die Um- und Neudeutung politischer Begriffe, wie Freiheit, Macht, Autorität, aber auch über alternative Lesarten hegemonialer Leitkonzepte[15] soll der kategoriale und narrative Bezugsrahmen, innerhalb dessen politische Akteure ihre Gestaltungsmöglichkeiten einschätzen, Handlungsoptionen abwägen und politische Projekte ent- oder verwerfen, rekonfiguriert und darüber politische Innovation befördert werden.
In methodischer Hinsicht bleibt der hermeneutisch-performative Ansatz jedoch defizitär. Zugunsten einer auf politische Intervention angelegten und polemisch gegen den tradierten Kanon der politischen Theorie gerichteten Neuerzählung des Politischen werden methodische Fragen weitgehend ausblendet. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die ideengeschichtlichen Referenzen eher nach den Vorgaben politischer Plausibilität arrangiert als begriffsgeschichtlich systematisch entwickelt werden. Der Challenge-and-Response-Ansatz macht demgegenüber die Transferleistung von politischer Ideengeschichte in eine Politische Theorie mit zeitdiagnostischem Anspruch und therapeutischem Programm explizit. Zudem ist er an einer wissenssoziologisch informierten Begriffsgeschichte interessiert. Im Unterschied zur Begriffsgeschichte, wie sie ihr prominentester Vertreter Reinhart Koselleck in dem von ihm gemeinsam mit Otto Brunner und Werner Conze herausgegebenen Werk Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland betrieben hat,[16] nimmt der Challenge-and-Response-Ansatz weitere ideengeschichtliche Kontexte in den Blick. Während sich die Geschichtlichen Grundbegriffe auf eine bestimmte Epoche zwischen Früher Neuzeit und Moderne konzentrieren, die Koselleck «Sattelzeit» nennt und von der er annimmt, dass politische Leitbegriffe hier einen tiefgreifenden Wandel erfahren hätten oder neue Begriffe geprägt worden seien, die für das moderne politische Denken entscheidend geworden sind, ist der Challenge-and-Response-Ansatz nicht nur historisch ausgreifender, sondern thematisiert die kulturhistorischen, sozioökonomischen und institutionellen Rahmenbedingungen, innerhalb derer politische Akteure wie politische Denker agiert haben. Von besonderem Interesse ist mithin auch das Wirken von Intellektuellen in ihrem mal mehr, mal weniger reflektierten Anliegen, auf die politischen Verhältnisse bzw. die politischen Entscheidungseliten Einfluss zu nehmen.[17] Die Selbstdeutungen von Intellektuellen, ihr Verständnis von politischer Theorie und Gesellschaftskritik und die Rolle, die sie sich als wirkmächtige Deuter politischer Wirklichkeit zusprechen, nehmen in dieser Einführung daher eine prominente Stellung ein.
Zur Konzeption dieser Einführung
In der vorliegenden Einführung in die Politische Theorie und Ideengeschichte werden zentrale Grundprobleme der Politikwissenschaft entlang der wichtigsten Denker der politischen Philosophie und politischen Theorie vermittelt. Der Zugriff auf das Archiv politischen Denkens erfolgt dabei über politische Kernbegriffe und zentrale politische Ideen, wie Staat, Herrschaft, Souveränität, Verfassung, Revolution, Krieg, Gerechtigkeit und Freiheit, deren Herkunft und Wandel ebenso dargestellt werden wie ihr ideenpolitischer Einsatz. Die kontroversen Konzeptionalisierungen zentraler Leitbegriffe werden sowohl in ihrem historischen Entstehungskontext erörtert als auch im Hinblick auf das zeitdiagnostische und prognostischtherapeutische Potenzial politiktheoretischer Problembearbeitung diskutiert. Ergänzt wird dieser begriffs- und problemorientierte Zugang durch die Darstellung komplementär-konkurrierender Diskursformationen, wobei hier exemplarisch auf die ideenpolitischen Strömungen Republikanismus und Liberalismus und deren jeweilige Leitbegriffe Tugend und Interesse eingegangen wird. Im Kapitel Der Vertrag und die Erzählung liegt der Schwerpunkt auf methodisch divergierenden Begründungen staatlicher Herrschaft und politischer Legitimität. Auch in dieser Gegenüberstellung kontraktualistischer und narrativ-hermeneutischer Ansätze kommt dem politisch-interventiven Selbstverständnis politischer Denker und der methodischen Reflexion der Theorie-Praxis-Vermittlung eine besondere Aufmerksamkeit zu.
Die insgesamt dreizehn Kapitel folgen einem ähnlichen Zuschnitt: Nach einem knappen, die Aktualität des Gegenstandsbereiches betonenden Auftakt wird zunächst der jeweils verhandelte Themenbereich in seinen vielgestaltigen Konzeptionalisierungen vorgestellt, um dann ausführlicher, mit Blick auf ausgewählte politische Denker und zentrale Kontroversen, die verschiedenen begriffstheoretischen Zugriffe auf die Politik und das Politische darzustellen. Jedes Kapitel endet neben den üblichen Quellenangaben und Anmerkungen mit einer Empfehlung weiterführender Literatur.
Angesichts von über 2500 Jahren politischen Denkens verbietet sich der Anspruch auf Vollständigkeit. Viele Autoren sind nicht berücksichtigt. Auch konnten nicht alle ideengeschichtlichen Diskussionen und politiktheoretischen Konzeptionen dargestellt werden. Auslassungen sind schmerzlich, aber in einem Einführungsbuch mit beschränktem Umfang kaum zu vermeiden. Dennoch beansprucht dieses Lehrbuch, wichtige Schneisen durch das weite Feld politischer Ideengeschichte und politiktheoretischer Modellbildung von der Antike bis zur Gegenwart zu schlagen und darüber Denkwege zu eröffnen, wie die Politik und das Politische begriffen werden können. Die Erwartung ist, hierdurch neue – und wohlmöglich teils auch ganz alte – Erkenntnisse über die (In)Stabilität demokratischer Ordnungen zu (re)generieren.
Anmerkungen
1 Dazu und zum Folgenden Herfried Münkler, «Politikwissenschaft. Zu Geschichte und Gegenstand, Schulen und Methoden des Fachs», in: Iring Fetscher/Herfried Münkler (Hgg.), Politikwissenschaft. Begriffe – Analysen – Theorien. Ein Grundkurs, Reinbek b. Hamburg 1985, S. 10–24.
2 Zum Status von Politischer Theorie und Ideengeschichte im Fach Politikwissenschaft vgl. Hubertus Buchstein/Dirk Jörke, «Die Umstrittenheit der Politischen Theorie. Stationen im Verhältnis von Politischer Theorie und Politikwissenschaft in der Bundesrepublik», in: Hubertus Buchstein/Gerhard Göhler (Hgg.), Politische Theorie und Politikwissenschaft, Wiesbaden 2007, S. 15–44.
3 Dazu und zum Folgenden Grit Straßenberger/Herfried Münkler, «Was das Fach zusammenhält. Die Bedeutung der Politischen Theorie und Ideengeschichte für die Politikwissenschaft», in: Buchstein/Göhler (Hgg.), Politische Theorie und Politikwissenschaft, S. 45–79.
4 Herfried Münkler, «Politische Ideengeschichte»; in: ders. (Hg.), Politikwissenschaft. Ein Grundkurs, Reinbek b. Hamburg 2003, S. 103ff.
5 Harald Bluhm, «Politische Ideengeschichte im 20. Jahrhundert. Einleitung», in: Harald Bluhm/Jürgen Gebhardt (Hgg.), Politische Ideengeschichte im 20. Jahrhundert. Konzepte und Kritik, Baden-Baden 2006, S. 9–26, S. 12.
6 Herfried Münkler/Vincent Rzepka, «Die Hegung der Öffentlichkeit. Der Challenge-and-Response-Ansatz und die Genese des Liberalismus aus der Krise des Republikanismus», in: Helmut Reinalter (Hg.), Neue Perspektiven der Ideengeschichte, Innsbruck 2015 [i. E.] – Einen zusammenfassenden Überblick zum Ansatz der Cambridge School bietet Hartmut Rosa, «Ideengeschichte und Gesellschaftstheorie. Der Beitrag der Cambridge-School zur Metatheorie», in: Politische Vierteljahresschrift, Jg. 35, H. 2, 1994, S. 197–223. Vgl. auch Raimund Ottow, «Die ‹Cambridge-School› und die Interaktion politischer Diskurse in England vor der Zeit Elisabeth’ I. bis zur Revolution», in: Lutz Raphael/Heinz-Elmar Tenorth (Hgg.), Ideen als gesellschaftliche Gestaltungskraft im Europa der Neuzeit. Beiträge für eine erneuerte Geistesgeschichte, München 2006, S. 31–69.
7 Ralph Weber und Martin Beckstein unterscheiden in ihrer Einführung in die Politische Ideengeschichte «adressatenzentrierte Ansätze» von «textzentrierten, «autorenzentrierten» und «leserzentrierten» Ansätzen und grenzen davon noch einmal solche Interpretationsansätze ab, die sich in der Fokussierung auf Begriffe und deren Wandlungen auf ein «Kollektiv von Texten» stützen, wie etwa der begriffsgeschichtliche Ansatz von Reinhart Koselleck; Ralph Weber/Martin Beckstein, Politische Ideengeschichte. Interpretationsansätze in der Praxis, Göttingen 2014, S. 19ff.
8 Vgl. beispielhaft Friedrich Meinecke, Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, München 1957 sowie ders., Weltbürgertum und Nationalstaat, München 1969 (2. Auflage).
9 Marcus Llanque, «Alte und neue Wege der politischen Ideengeschichte», in: Neue Politische Literatur 49. Jg., Heft 1, 2004, S. 34–51.
10 Reinhard Mehring, «Begriffssoziologie, Begriffsgeschichte, Begriffspolitik. Zur Form der Ideengeschichtsschreibung nach Carl Schmitt und Reinhart Koselleck», in: Bluhm/Gebhardt (Hgg.), Politische Ideengeschichte im 20. Jahrhundert, S. 31–50.
11 Matthias Bohlender hat im Rekurs auf Foucault eine Archäologie der Idee von Kritik entwickelt. Mit Blick auf Kant, Marx und Nietzsche legt er die geschichtliche Durchsetzung und Ausweitung eines Kritikgedankens frei, der ein reflexives Verständnis zu ideenpolitischen Operationen ermöglicht; Matthias Bohlender, «Was ist Kritik? Versuch einer Archäologie», in: Harald Bluhm/Karsten Fischer/Marcus Llanque (Hgg.), Ideenpolitik. Geschichtliche Konstellationen und gegenwärtige Konflikte, Berlin 2011, S. 3–18.
12 Llanque, «Alte und neue Wege der politischen Ideengeschichte», S. 45f.
13 Münkler/Rzepka, «Die Hegung der Öffentlichkeit. Der Challenge-and-Response-Ansatz und die Genese des Liberalismus aus der Krise des Republikanismus».
14 Zu Arendts hermeneutisch-performativem Verständnis politischer Praxis vgl. Grit Straßenberger, «Politik zwischen Freiheitsgewinn und Enttäuschungserfahrung. Zu den Kompensationsleistungen von politischer Theorie bei Hannah Arendt», in: Wolfgang Heuer/Irmela von der Lühe (Hgg.), Dichterisch denken. Hannah Arendt und die Künste, Göttingen 2007, S. 227–242; sowie dies., Hannah Arendt zur Einführung, Hamburg 2015.
15 So bezeichnet sich die als Radikaldemokratin oder «Linksschmittianerin» titulierte Chantal Mouffe selbst als Liberale, wobei sie – ihrem hegemonietheoretischen Ansatz folgend – für ein alternatives Verständnis von Liberalismus eintritt. Kern dieses anderen Liberalismus, den Mouffe gegen das derzeit hegemoniale Verständnis eines universalistischen, rationalistischen und individualistischen Liberalismus in Stellung bringt, ist die Idee eines in Konflikten ausgetragenen Pluralismus; vgl. dazu Vincent Rzepka/Grit Straßenberger, «Für einen konfliktiven Liberalismus. Chantal Mouffes Verteidigung der liberalen Demokratie», in: Zeitschrift für Politische Theorie, 5. Jg., H. 2, 2014, S. 217–233.
16 Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hgg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 8 Bde., Stuttgart 1972ff.
17 Zur Unterscheidung verschiedener Intellektuellentypen vgl. Reinhard Mehring, «Machiavelli oder Odysseus? Über alte und neue Intellektuelle», in: Bluhm/Fischer/Llanque (Hgg.), Ideenpolitik, S. 545–561; zur Typologie von Politikberatern und zu den paradoxalen Argumentationsstrategien in der theoretischen Reflexion der intendierten politischen Einflussnahme vgl. Felix Wassermann, «Die Paradoxie des Rats. Niccolò Machiavelli und Thomas Morus über und als politische Berater», in: ebd., S. 563–586.
Kapitel 1DIE POLITIK UND DAS POLITISCHE
Die Europäische Union, zumeist als «Brüssel» abgekürzt, treibt Politik, aber es fehlt ihr das Politische – so kann man das mehr oder minder diffuse Unbehagen vieler Bürger Europas an der EU auf den Punkt bringen. Von Brüssel aus wird Europa verwaltet, in vielen Fällen zur Zufriedenheit der Menschen, in anderen weniger, aber die Kritik richtet sich in den Fällen der Unzufriedenheit nicht auf Defizite oder Fehler der Administration, sondern auf das Fehlen von Alternativen, auf den Mangel an Kontroversen und auf die lautlose Einmütigkeit, mit der das Administrieren Europas erfolgt. Dem lässt sich auch durch Wahlen zum Europaparlament nicht abhelfen, wenn die Unterschiede zwischen den antretenden Parteien aus Sicht der Bürger kaum zu erkennen sind. Das politische Problem der EU ist, dass ihr das Politische abgeht und sich infolgedessen die Politik in einem mehr oder weniger effizienten Administrieren erschöpft.
Das «Politische» ist in der politischen Ideengeschichte jedoch keineswegs einheitlich entworfen worden. Worin es zu suchen und wie es zu gestalten ist, ist umstritten. Die Entscheidung darüber, was das Politische ist bzw. sein soll, wie es gegenüber dem Privaten, dem Verrechtlichten, dem Wirtschaftlichen usw. abgegrenzt wird, legt den Bereich fest, innerhalb dessen Politik gemacht werden kann, was also als Entscheidungsalternative zur Disposition der Bürger steht und anschließend im Sinne von kollektiv bindenden Entscheidungen zu befolgen bzw. hinzunehmen ist. Neben der topologischen Bestimmung des Politischen als ein besonderer, vom privaten wie gesellschaftlichen Bereich unterschiedener Raum des Handelns und Entscheidens ist das Politische mit normativen Erwartungen verbunden worden, etwa als Ort politischer Freiheit, an dem das, was alle angeht, auch von allen öffentlich besprochen und entschieden werden soll. Die öffentliche Diskussion gemeinsamer Angelegenheiten kann als konfliktiv oder konsensuell vorgestellt werden, was auf die modale Kennzeichnung des Politischen verweist. Davon ist die temporale Dimension des Politischen zu unterscheiden, bei der es um das Verhältnis von Politik und Zeit geht: Besitzt politisches Handeln eine die Kontinuität von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufsprengende Qualität oder ist es in historische Gesetzmäßigkeiten eingeschrieben, die fortschrittslogisch oder verfallstheoretisch vorgestellt werden können? Schließlich geht es bei der Frage nach dem Politischen immer auch um das Verhältnis von Handlungsmacht und institutioneller Bindung, also um die Ermöglichung und Begrenzung politischen Handelns.
Das Denken des Politischen: Ein Überblick
Im Grundsatz lassen sich im deutschen Diskurs zwei Vorstellungen von Politik unterscheiden: Da ist zunächst die Begriffsverwendung von Politik im Sinne eines Administrierens zentraler Bereiche des Gemeinwesens, der Bearbeitung von Aufgaben, die weder vom Markt noch von der Zivilgesellschaft erledigt werden können oder erledigt werden sollen, weil zu befürchten ist, dass dann besondere Interessenkonfigurationen aus der Gesellschaft die Oberhand bekommen. Die Politik wird hier tätig, weil die fraglichen Aufgaben weder von Wirtschaftsunternehmen noch von zivilgesellschaftlichen Akteuren zur allgemeinen Zufriedenheit und Akzeptanz erfüllt werden können. Dabei dient eine von Fall zu Fall näher zu bestimmende Vorstellung des Gemeinwohls als Zielmarke der politischen Aufgabenstellung. Politik wird in diesem Verständnis also als Komplementärbegriff zu Wirtschaft und Zivilgesellschaft gebraucht. Sie erledigt Aufgaben, die das Gemeinwesen als Ganzes betreffen, sorgt dafür, dass die erforderlichen Ressourcen verfügbar sind, und eröffnet eine (begrenzte) Diskussion über die Richtigkeit der verfolgten Ziele und die Effektivität bzw. Angemessenheit der dabei präferierten Mittel. Die Komplementarität von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft schließt im Übrigen Kooperation und Aufgabenteilung nicht aus, worauf im aktuellen, wesentlich von der Governance-Theorie angestoßenen Diskurs die Formate von private-public-partnership verweisen.
Daneben gibt es aber auch einen Politikbegriff, der auf die agonale Auseinandersetzung zwischen (mindestens) zwei politischen Willen abhebt. Politik wird hier als Kampf um die Macht im Sinne eines privilegierten Zugangs zu den Ressourcen der Machtausübung (Ämtern und Positionen) und der Verfügung über die gesellschaftlich vorherrschenden Deutungen (Hegemonie der Symbole und Narrative) verstanden. Dieser Politikbegriff hebt auf konfliktive Entscheidungen ab, in denen es um die grundsätzliche Ausgestaltung bzw. Entwicklungsrichtung eines Gemeinwesens geht. Zu diesem Politikbegriff gehört auch der Kampf um die Formen und Begrenzungen des Zugangs zu Macht und Einfluss, der zumeist durch Verfassungsgesetze geregelt ist, sowie die Festlegung von Regeln, nach denen der Markt funktioniert, sowie der Aufgaben und Problemfelder, die in den Zuständigkeitsbereich der Zivilgesellschaft fallen. Hier geht es nicht um Komplementarität, sondern um Über- und Unterordnung, Rangfolge und Gewicht. Das ist der Bereich des Politischen.
In der angloamerikanischen Politikwissenschaft dominieren anstelle dieser beiden komplementären Vorstellungen von Politik, als politics und the political wiedergegeben, üblicherweise drei Begriffe, die inzwischen Eingang in die deutsche politikwissenschaftliche Literatur gefunden haben. Mitunter werden sie freilich recht schematisch angewandt und verwandeln sich dadurch aus analytischen Begriffen in Schubkästen zur Herstellung einer mitunter zwanghaften Differenzierung, die der Komplexität des Politischen nicht genügen. So werden mit policy/policies Politikfelder bezeichnet, in denen die Strategien der Gemeinwohlverwirklichung bzw. Interessendurchsetzung erprobt und angewandt werden. Mit Blick auf die Inhalte der Politik, etwa Hochschulpolitik, Umweltpolitik, Sozialpolitik, Verkehrspolitik usw., wird auf die Administration des Gemeinwesens abgestellt. Der deutsche Begriff für policy würde eigentlich Policey lauten, und in der Policeywissenschaft des 17. und 18. Jahrhunderts waren damit die Praktiken des obrigkeitlichen Wohlfahrtsstaates gemeint. In dieser Literatur war von der ‹guten policey› die Rede, womit gesagt werden sollte, dass die Absichten des Landesherrn, die Strategien seiner Verwaltung und die Prosperität des Landes zusammenstimmten.[1] Unter den modernen Begriffen kommt good governance dem der guten policey am nächsten – wobei in der guten policey freilich auch Lebensbereiche der landesherrlichen Regulation unterworfen wurden, die seit der Trennung von Staat und Gesellschaft der politischen Ordnung entzogen wurden. Sowohl der Liberalismus als auch der Republikanismus des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts haben die Idee der ‹guten policey› und die ihr inhärenten Wohlfahrtsvorstellungen kritisiert, weil darin die Menschen als ‹unmündige› Kinder und nicht als ‹mündige› Bürger behandelt wurden. Politische Partizipation respektive verantwortliche Selbstregierung, so die Schnittstelle republikanischer und liberaler Vorstellungen, sollten an die Stelle obrigkeitlicher Beglückung treten.
Der Begriff politics akzentuiert demgegenüber den Kampf um Macht und Einfluss, um die Verfügung über den Verwaltungsapparat und die Erringung der Deutungshegemonie in politischen Fragen, also den politischen Prozess. Hier geht es um die Konflikte wie Kompromisse zwischen den großen politischen Akteuren, weswegen mit diesem Begriff, in Abgrenzung zu der auf das Innere bezogenen policy, häufig auch die äußere Politik der Staaten bzw. deren Agieren gegenüber anderen Mächten bezeichnet wird. Im Innern der Staaten wird dieser Machtkampf jedoch nicht nur als Ringen um Ämter und Positionen ausgetragen, sondern auch als Auseinandersetzung um die politisch-kulturelle Hegemonie, also um die Frage, welche Weltsicht und welche Problemperzeption dominant ist.
Mit polity schließlich werden die Verfassungsordnung und das politische Regelsystem, also die Form des Politischen, bezeichnet, innerhalb deren die Machtkämpfe und politischen Konflikte nach den durch die polity vorgegebenen Regeln und Verfahren ausgetragen werden. In der polity ist zugleich festgelegt, welche Politikfelder (policies) zu bearbeiten sind und nach welchen Grundsätzen dies zu geschehen hat. Polity ist somit die Rahmung für den Kampf um Macht und Einfluss (politics). Sie legt zugleich fest, was Politik können soll und können darf.
Im Deutschen und im Französischen hat sich eine andere begriffliche und konzeptionelle Unterscheidung herausgebildet, an der sich die Politische Theorie bis heute abarbeitet: Der deutschen Unterscheidung zwischen Politik und dem Politischen entspricht im Französischen das Begriffspaar la politique/le politique. Dieser Unterscheidung zufolge steht Politik für den routinierten Betrieb der Bewirtschaftung von Politikfeldern wie der institutionell gehegten Kämpfe um Macht und Einfluss, während das Politische die Konstituierungskonstellationen dieses Betriebs bezeichnet, in denen dieser geordnet, Neues auf den Weg gebracht oder die Grundstruktur der politischen Ordnung verändert wird. Das Politische begegnet uns gemäß dieser begriffspolitischen Perspektive besonders deutlich in Revolutionen und Umbruchsituationen, in grundlegenden Reformen oder Akten der Verfassungsgebung, in denen die bisherigen Regeln und Routinen außer Kraft gesetzt werden. Indem das Politische hier die Frage nach den Rahmenbedingungen des Politikbetriebs stellt und festlegt, was dessen Zweck und Aufgaben sind, geht es nicht nur um die bloße Feststellung, dass etwas funktioniert, sondern um die grundlegendere Frage, ob dieses Funktionieren sinnvoll und gerechtfertigt ist.
Will man die Differenz zwischen der Politik und dem Politischen sprachlich präziser fassen, so bietet sich die Unterscheidung zwischen dem Partizip Präsens Aktiv und dem Partizip Perfekt Passiv an. So kennt die Verfassungstheorie die konstituierende und die konstituierte Gewalt (pouvoir constituant, pouvoir constitué). Im Anschluss an diese Unterscheidung hat der griechisch-französische Gesellschafts- und Politiktheoretiker Cornelius Castoriadis von einer instituierenden und einer instituierten Macht gesprochen.[2] Ideengeschichtlicher Ausgangspunkt dieser Unterscheidung ist der Philosoph Baruch de Spinoza, der natura naturans und natura naturata einander gegenübergestellt hat. Mit Ersterem hat er die sich selbst hervorbringende und immer wieder aufs Neue verändernde Natur gemeint, von Ernst Bloch als «Prozessmaterie» übersetzt,[3] während mit Letzterem die festgewordene und erstarrte Natur ins Auge gefasst wird, die sich vermessen lässt, die Regelmäßigkeiten und Regelhaftigkeit aufweist und mit der wir deswegen «rechnen» können. Gegenüber dieser Regularität und Berechenbarkeit der natura naturata ist die natura naturans reine Kreativität, schöpferische Energie, Veränderung in Permanenz.[4] Diese Gegenüberstellung Spinozas ist in der jüngeren Politiktheorie, etwa von Michael Hardt und Antonio Negri, mehrfach aufgegriffen und mit Blick auf die Energie der rebellierenden Menge (multitudo, multitude), die sich den Routinen der Institutionen verweigert, fruchtbar gemacht worden.[5] Dementsprechend spielt Spinoza in der jüngeren politiktheoretischen Literatur, namentlich der aus Frankreich und Italien, eine erhebliche Rolle. Ist er in der Traditionslinie des Kontraktualismus lange in die Nähe von Hobbes und Locke gerückt worden, so hat mit Antonio Negris Spinozabuch eine Entwicklung eingesetzt, in der Spinoza zu einem Theoretiker der Subversion und Revolution geworden ist[6] – und einem der Ersten, der das Politische als Sprengsatz gegenüber seiner Einengung durch die Politik begriffen hat. In diesem Sinne stehen Hobbes und Spinoza für eine alternative Konturierung des Kanons der politischen Ideengeschichte: Hobbes für die durch den Vertrag verbindlich gemachte Ordnung; Spinoza für die bloß zeitweilige Dauer dieser Ordnung und die Kräfte, die sie herausfordern und verändern.
In Deutschland hat die Debatte über das Politische in der Zeit der Weimarer Republik und dann noch einmal im Hinblick auf deren Scheitern eine zentrale Rolle gespielt. Während Carl Schmitt unter dem Eindruck der Revolutionen von 1917/18 das Politische in der jeder staatlichen Ordnung vorausgehenden Frage nach der Unterscheidung von Freund und Feind gesehen hat,[7] hat Dolf Sternberger es in expliziter Wendung gegen Schmitt an der Verbindung des dem Menschen Zuträglichen mit dem Menschenmöglichen festgemacht.[8] Hannah Arendt wiederum hat im Rekurs auf das politische Denken der Griechen die Fähigkeit zum Zusammenhandeln (sympráttein) herausgestellt und dies in aller Schärfe gegen das Ökonomische bzw. dessen Dominantwerden in der modernen Gesellschaft abgesetzt.[9] Mit der Durchsetzung der Habermas’schen Theorie des Kommunikativen Handelns und deren juridisch-politologischen Abzweigungen[10] ist die Debatte über das Politische in Deutschland zwischenzeitlich abgeebbt, bis sie in jüngster Zeit, aus Frankreich kommend, als postmarxistische Neubewertung politischer Konflikte und Kämpfe wieder aufgelebt ist. Jenseits des marxistischen Modells, in dem das Politische aus dem Klassenkampf bzw. der sozio-ökonomischen Positionierung politischer Akteure hergeleitet worden ist,[11] geht es hier um eine Neubestimmung des Politischen, die gegen die Dominanz von «Wirtschaft» und «Gesellschaft» dem Politischen eine prioritäre Rolle zuweisen will. Auf diese aktuelle Wiederentdeckung des Politischen wird zurückzukommen sein; zuvor aber soll das europäische Denken des Politischen entlang von drei Traditionslinien nachgezeichnet werden, die sich mit den politischen Denkern Aristoteles, Machiavelli und Schmitt verbinden.
Aristoteles und der (Neo)Aristotelismus
Die Suche nach den Anfängen einer Reflexion auf das Politische in der Ideengeschichte führt zu Aristoteles, dem Begründer der abendländischen Politikwissenschaft, der das Politische konturiert hat, indem er es gegen das Despotische absetzte.[12] Das Politische ist danach nicht mit der puren Ausübung von Macht und Herrschaft identisch, zumal der gegenüber Schwächeren und Abhängigen; vielmehr handelt es sich um einen bestimmten Typus von Herrschaft, in dem sich die Freien und Gleichen zu handlungsmächtigen Verbänden zusammenschließen, ohne dadurch ihren Anspruch auf Freiheit und Gleichheit aufgeben zu müssen. Dieses Problem, wie nämlich politische Selbstregierung und verbindliche Entscheidungsfindung vermittelt werden können, spielt auch in Rousseaus Contrat Social eine entscheidende Rolle, wobei Rousseau die Lösung des Problems im Rahmen einer Vertragstheorie angestrebt hat.[13] Aristoteles’ Antwort besteht darin, dass er Bürgerschaft (politeía) als Gegenbegriff zu Herrschaft verstanden und diese Gegenbegrifflichkeit systematisch entwickelt hat.[14] Konkret wird diese Vorstellung von Bürgerschaft in Gestalt des politischen Reihendienstes, durch den die Einheit von Herrschen und Beherrschtwerden, archein und archesthai, sichergestellt werden soll. Bürgerschaft als Modus der Selbstregierung von Freien und Gleichen vermeidet die Klippe der Herrschaft, bei der es zu einer dauerhaften Aufspaltung des Verbandes in Herrschende und Beherrschte kommt; die symmetrische Reziprozität der Bürger soll durch deren konsekutive Ämterübernahme sicherstellt werden. So sind die Bürger gleichzeitig Herrschende und Beherrschte, und diese Gleichzeitigkeit macht Aristoteles’ zufolge das Charakteristische des politischen Lebens aus.
Aristoteles’ Definition des Politischen als Selbst-Beherrschung der Freien und Gleichen setzt sich nicht nur gegen das Despotische (von griech. despótes/Herr) im Sinne einer auf Dauer gestellten Herr-Knecht-Beziehung ab – eine Abgrenzung, die sich später bei John Locke wiederfindet, der, über Aristoteles hinausgehend, zwischen väterlicher, politischer und despotischer Gewalt unterscheidet,[15] sondern richtet sich zudem gegen das politische Expertentum, das Platon, der Lehrer des Aristoteles, normativ privilegiert, wenn er in seiner Politeia die Auffassung vertritt, die besten und kompetentesten Herrscher seien die nach seinen Vorgaben erzogenen Philosophen, und die Ordnung des Gemeinwesens solle nach Maßgabe der Reproduktionsbedingungen dieser philosophischen Politikspezialisten entworfen werden.[16] Gegenüber diesen Kompetenzsuggestionen des Spezialistentums hat Aristoteles darauf vertraut, dass die Selbstregierung der (in der Regel) philosophisch Inkompetenten auf Dauer zu befriedigenderen Ergebnissen führen werde als die Machtzusammenballung bei den Virtuosen der Norm- und Wertreflexion. Während Platon Politik als wertrationales Administrieren des Guten verstanden hat, hat Aristoteles das Politische als eine eigene Sphäre begriffen, in der nicht das Wissen, sondern das Handeln zentral ist.
Gleichzeitig hat sich Aristoteles mit seiner Konzeption des Politischen einer Professionalisierung der Verwaltungstätigkeit widersetzt, wie sie mit der Herausbildung des institutionellen Flächenstaats in Gestalt der Bürokratie in Europa seit dem 16./17. Jahrhundert entstanden ist. Er hat stattdessen auf eine Honoratioren- und Dilletantenverwaltung vertraut, die weder besondere Kenntnisse noch Fähigkeiten voraussetzte, sondern sich bei der Ausübung von Ämtern allein auf die bürgerliche Tüchtigkeit und Tugend (areté politiké) verließ. Aristoteles hat darin die Selbstverwaltungspraxis der griechischen polis theoretisiert und sie normativ gegen den professionellen Verwaltungsapparat der großen Reiche Mesopotamiens und des Niltals abgesetzt, wo ein spezialisierter Verwaltungsstab mit entsprechenden Kompetenzen entstanden war. Für Aristoteles war die Professionalisierung der Administration ein Begleiteffekt der Entwicklung von Herrschaft, also Ausdruck des Despotischen, und die Qualität bürgerschaftlicher Selbstregierung hing daran, dass es nicht zur Separation einer Bürokratie kam, die sich bürgerschaftlicher Kontrolle entzog. Die kommunale Honoratiorenverwaltung in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert kann als eine Ausprägung dieser Idee angesehen werden. Heute ist eigentlich nur noch die universitäre Selbstverwaltung diesem Konzept des Politischen verbunden, das ansonsten unter dem Begriff des ‹Ehrenamtes› ein Refugium im Bereich der Zivilgesellschaft, der Bürgerinitiativen und sozialen Bewegungen gefunden hat.[17] Man sollte dieses weite Bedeutungsfeld von pólis im Auge behalten, um die «Übersetzungsprobleme» zu verstehen, die der Begriff polis uns bereitet.[18]
Übersetzungsprobleme anderer Art sind mit Aristoteles’ Unterscheidung von oîkos und pólis verbunden, die am Anfang seiner Begründung des Politischen steht.[19] Zwischen dem Haus und der Stadt steht bei ihm das Dorf, aber das spielt in der Systematik seines Denkens keine besondere Rolle. Der oîkos, das «ganze Haus», wie es bei dem Historiker Otto Brunner heißt,[20] ist aus mehreren Beziehungen herrschaftlicher Art zusammengesetzt, in denen Gegensätze zentral sind: Mann und Frau, Vater und Sohn, Herr und Knecht bzw. Sklave. Die Einheit des Hauses als Ort sehr unterschiedlicher Formen von Herrschaft wird durch den Hausherrn (oikodespótes, lat. pater familias) hergestellt, der den dominanten Pol aller Herrschaftsbeziehungen bildet. Der Hausherr/Hausvater trifft die Entscheidungen, leitet und lenkt, straft und züchtigt, und dabei unterliegt er keinerlei Kontrolle durch die seiner Herrschaft Unterworfenen.
Der oîkos ist der Ort der physischen Reproduktion der Menschen; die pólis dagegen ist der Ort der (männlichen) Selbstverwirklichung. Aristoteles gebraucht den Begriff der Selbstverwirklichung zwar nicht, aber in dem, was er als Glückseligkeit (eudaimonía) bezeichnet, ist Selbstverwirklichung zumindest mitgemeint. Dabei hat sich nach Aristoteles die Größe der pólis an den Erfordernissen wirtschaftlicher Unabhängigkeit und Selbstgenügsamkeit (autárkeia) zu bemessen: Die Stadt darf, um bestehen zu können, auf nichts und niemanden außerhalb ihrer angewiesen sein. Sie ist um ihrer selbst willen da und nicht als Mittel auf ein Höheres bezogen. Die pólis ist die Form menschlicher Kooperation, in welcher der Mensch über sich und seine Zwecke selbst verfügt. Sie sind ihm nicht länger heteronom vorgegeben, sondern über sie entscheidet die Gemeinschaft der Freien und Gleichen aus eigener Autonomie. Alle anderen Formen des Zusammenlebens, in denen es um heteronome Erfordernisse und das Ensemble des Lebensnotwendigen geht, sind im Haus angesiedelt und von der Sphäre des Politischen separiert. Der oîkos bleibt, um eine Formel des 19. Jahrhunderts aufzugreifen, das «Reich der Notwendigkeit», während das «Reich der Freiheit» erst jenseits dessen, nämlich in der pólis beginnt. Hier – und nur hier – kommt der Mensch zu sich selbst bzw. wird zum Herrn über das, was an ihm Natur und fremdbestimmt ist.
Der aristotelischen Polis-Theorie liegen zwei anthropologische Annahmen zugrunde: dass der (männliche) Mensch ein zôon phýsei politikón sei, ein auf die Gemeinschaft der Freien und Gleichen hin angelegtes und sich (nur) in ihr verwirklichendes Lebewesen, und dass der Mensch als zÔon lógon échon, als ein über Sprache verfügendes Lebewesen, bei der Gestaltung seines Lebens und der Schaffung seines Lebensraums nicht instinktgesteuert, sondern verständigungsorientiert handelt. Gleichzeitig weiß Aristoteles aber auch, dass der Mensch ein gefährliches Lebewesen ist, das gebändigt werden muss, wenn es nicht fortgesetzt Unheil anrichten soll. Gebändigt wird der Mensch entweder durch einen Herrn oder durch sich selbst, also vermittelst der eigenen Vernunft. Der oîkos ist der Ort der Fremdbändigung, wo alle unter der Kontrolle und Aufsicht des Hausherrn stehen; die pólis hingegen ist der Ort bürgerschaftlicher Selbstbändigung – und insofern ist sie ein großes Experiment, das permanent gefährdet ist. Zur Selbstbändigung sind nach Aristoteles freilich nicht alle Menschen fähig: in keinem Fall die Knechte und Sklaven, auch nicht die Frauen, und auch die Söhne erst, nachdem sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Wer von den erwachsenen männlichen Einwohnern einer Stadt das Recht auf Selbstbändigung hat, also vollberechtigter Bürger ist, hängt von deren Verfassung ab: Es können einige sein, aber auch viele, bloß die Vermögenden oder auch die Armen. Aristoteles pointiert dies in der Gegenüberstellung von Oligarchie und Demokratie.
Während für Aristoteles der oîkos ein Ort der natürlichen Ungleichheit der Menschen ist und die pólis der Ort einer von den Menschen künstlich hergestellten Gleichheit, haben die frühneuzeitlichen Theoretiker des Gesellschaftsvertrags von Hobbes über Locke bis Rousseau diese Relation umgekehrt: Von Natur aus sind die Menschen gleich; erst die soziale bzw. politische Ordnung schafft Ungleichheit. Für Aristoteles ist die Gleichheit, für Hobbes und weitere in der Tradition des Kontraktualismus stehende Theoretiker ist die Ungleichheit artifiziell. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass politische Denker, die auf Aristoteles rekurrieren, dem Verdacht ausgesetzt waren, sie würden ein traditionalistisches und tendenziell elitäres Politikverständnis präferieren. Jedenfalls ist dieser Vorwurf Hannah Arendt, der wohl prominentesten Aristotelikerin im 20. Jahrhundert, gemacht worden,[21] die sowohl für den kommunitaristischen Neoaristotelismus, wie er sich seit Anfang der 1980er Jahre als ideenpolitisches Gegenprogramm zum politischen Liberalismus in Amerika entwickelt hat, als auch für die jüngere Republikanismusdiskussion zu einer zentralen Referenzautorin wurde. Arendt hat in ihrem Hauptwerk Vita activa die aristotelische oîkos-pólis-Unterscheidung aufgegriffen und den Ort des Politischen als den des Handelns bzw. Zusammenhandelns (práttein/sympráttein) bestimmt, während das Herstellen (poien) zur Ökonomie gehört und darum keinen wesentlichen Einfluss auf das Politische hat oder haben soll. Was in der freilich umstrittenen Etikettierung Arendts als konservative Neoaristotelikerin wie überhaupt in der Verschwisterung von Neoaristotelismus und Konservatismus weitgehend ausgeblendet wird, ist die Vielgestaltigkeit aristotelischer Konzeptionen des Politischen. So kann der Rückgriff auf Aristoteles inhaltlicher und/oder methodologischer Art sein, er kann als umfassende Vollrezeption betrieben werden oder als nur selektiver Rekurs auf bestimmte Elemente aristotelischen Denkens. Er tritt als konservative Moderne-Kritik auf oder als kreative Wiedererinnerung politischer Urteilsmaßstäbe nach dem Totalitarismus, umfasst sowohl traditionalistische Rückkehrbewegungen als auch moderne Transformationen und bietet gleichermaßen partikularistische wie universalistische Lesarten. Daher spricht Thomas Gutschker in seiner breit angelegten Untersuchung auch von aristotelischen «Denkfiguren», die zwar bestimmten zeitgeschichtlichen Diskursen zugeordnet werden können, inhaltlich, methodologisch und politisch aber zum Teil sehr kontroverse Positionen enthalten.[22]
Bei aller Vielfalt und Divergenz und selbst noch in seinen radikalsten Transformationen ist der Rückgriff auf Aristoteles’ politisches Denken jedoch eine besondere Form, in der Ideengeschichte betrieben wird, insofern damit der grundlegende Zweifel verbunden ist, dass die Moderne aus sich heraus imstande sei, handlungsorientierende Maßstäbe zu gewinnen. Und in der Tat steht Arendts an Aristoteles geschulte politische Handlungstheorie exemplarisch für die Wiedergewinnung eines genuin politischen Begriffs des Politischen, der kritisch gegen die modernen Entgrenzungen demokratischer Politik entworfen wird. Arendt zufolge stehen moderne demokratische Ordnungen grundsätzlich in der Gefahr, zu despotischen Wohlfahrtsstaaten zu degenerieren. Sie sieht darin eine illiberale Politisierung des privaten und des gesellschaftlichen Bereichs, die zum einen die Erosion der vorpolitischen Bedingungen des Politischen, nämlich die Entstehung von menschlicher Individualität und gesellschaftlicher Pluralität, befördert; zum anderen gefährdet die Politisierung sozialer Fragen die Konfliktbearbeitungskompetenz der republikanischen Ordnung. Mit dieser Krisendiagnose und ihrer Therapie, der Konzeption einer konfliktaffinen republikanischen Demokratie, hat Arendt zugleich eine ideengeschichtliche Demarkationslinie aufgebrochen, die Dolf Sternberger, einer der Gründungsväter der Politikwissenschaft in Deutschland nach 1945, zwischen der ‹guten› «Politologik» im Anschluss an Aristoteles und der ‹schlechten› «Dämonologik» im Anschluss an Machiavelli aufgemacht hat.[23] In ihrem um Freiheit zentrierten politischen Handlungsbegriff, der kommunikative und initiative – also etwas wesentlich Neues in Gang bringende – Dimensionen verbindet, stellt Arendt auf eine Verknüpfung dieser durchaus konträren Politikauffassungen ab. Sie liest Machiavelli nicht als «schwarzen» Machtpolitiker, der die Moral dem Zweck politischer Selbsterhaltung opfert und Gewalt als probates Mittel des Politischen auszeichnet, sondern als republikanischen Denker. So schreibt sie dem Autor der Discorsi wie des Principe entscheidende politikwissenschaftliche Leistungen zu: die Entwicklung eines neues Handlungskonzepts von Politik, das der initiativen Dimension politischen Handelns besondere Aufmerksamkeit widmet und darüber den Mut als politische Kardinaltugend auszeichnet, sowie die Konturierung eines agonalen Politikbegriffs, in dem das Austragen von Konflikten zum bevorzugten Modus politischer Integration wird.[24]
Politik als Kampf um Macht und Einfluss: Machiavelli und Weber
Dolf Sternberger hat in seinem Buch Drei Wurzeln der Politik zwischen dem Dämonologischen, dem Eschatologischen und dem Politologischen unterschieden.[25] Für die Definition des Politologischen, das von Sternberger mit dem hier zur Debatte stehenden Politischen identifiziert wird, ist die Verbindung des Möglichen mit dem Zuträglichen ausschlaggebend, während das Dämonologische dem Menschen wohl möglich, aber nicht zuträglich, das Eschatologische hingegen im Prinzip zuträglich, aber nicht möglich (und durch den Versuch seiner gewaltsamen Möglichmachung ebenfalls nicht zuträglich) ist.
Ideengeschichtlicher Repräsentant des Dämonologischen ist für Sternberger der Florentiner Politiker und Politikberater Niccolò Machiavelli, der in einigen Kapiteln seines Principe das Spiel mit Sein und Schein und die Entwicklung einer von den Vorgaben der Ethik und Moralphilosophie entkoppelten politischen Handlungslehre zum Erfolgsrezept des guten Politikers gemacht hat.[26] Ausschlaggebend für die Etikettierung Machiavellis als Begründer eines dämonologischen Politikbegriffs ist dessen Begriff der virtù, den Sternberger mit Blick auf den Principe und unter Ausblendung der Discorsi vereindeutigt und die damit verbundene dilemmatische Figur des uomo virtuoso historisch dekontextualisiert. Der Begriff der virtù wird von Machiavelli nämlich in zweifacher Hinsicht verwendet: Sie ist die politische Tugend der Bürger in einer wohlgeordneten Republik, und zugleich ist sie eine «politische Handlungskompetenz, die, von allen ethischen Vorgaben entbunden, nur dem Imperativ des politischen Erfolgs verpflichtet ist».[27] Diese virtù als spezifische Handlungskompetenz traut Machiavelli nur wenigen herausragenden politischen Führungsfiguren zu, und sie kommt in Gestalt des uomo virtuoso auch nur in außergewöhnlichen Situationen ins Spiel. Unter Korruptibilität versteht Machiavelli das Dominantwerden eines umfassenden individuellen Egoismus, der, zusammen mit einer radikalen Destabilisierung der politischen Institutionen und einem umfassenden Vertrauensverlust in die politischen Eliten, die Grundlagen des politischen Gemeinwesen derart nachhaltig zerrüttet, dass nur noch ein mit umfänglichen Handlungskompetenzen ausgestatteter diktatorischer Krisenmanager als Lösung in Frage kommt: der uomo virtuoso. «Allein in einer schweren politischen Krise, dem Endpunkt des Verfalls eines Staates, sind jene historischen Bedingungen gegeben, welche die Gründung oder Neugründung eines Staates ermöglichen.»[28] Der uomo virtuoso, den Machiavelli im Principe für das Florenz in der Krise und mit Blick auf den in Oberitalien zu errichtenden Einheitsstaat empfiehlt, bezeichnet einen mit allen Vollmachten ausgestatteten, souveränen Alleinherrscher, der ohne Skrupel und mit harter Hand das Gemeinwesen aus der Krise in die Stabilität führt.
Im siebzehnten Kapitel des Principe «Über Grausamkeit und Milde» wählt Machiavelli Cesare Borgia als Beispiel für einen derart erfolgreichen Politiker. Das Lob, das er diesem «skrupellosen Tatmenschen» zuspricht, der das moralisch Gebotene dem Nützlichen opferte, wendet sich vehement gegen eine verklärende politische Ethik, die den Staatsmann als gerecht, mutig, großgesinnt, besonnen, friedfertig und klug vorstellt. Gegen das, «was über Herrscher zusammenphantasiert wurde»,[29] stellt er die politische Wirklichkeit, die mitunter verlangt, dass man die Gesinnung der Realität anpasst, wenn das gewünschte Resultat nicht zur Gesinnung passt.[30] Für den uomo virtuoso gilt in zugespitzter Weise, was der «Machiavellist» Max Weber meinte, als er bestritt, dass gute Absichten in der Politik auch zu guten Ergebnissen führten und statt dessen die Möglichkeit ins Auge fasste, dass häufig das moralisch Fragwürdige zu den gewünschten Ergebnissen führe. «Auch die alten Christen wussten sehr genau, daß die Welt von Dämonen regiert sei, und daß, wer mit der Politik, das heißt: mit Macht und Gewaltsamkeit als Mitteln, sich einlässt, mit diabolischen Mächten einen Pakt schließt, und daß für sein Handeln es nicht wahr ist: daß aus Gutem nur Gutes, aus Bösem nur Böses kommen könne, sondern oft das Gegenteil: Wer das nicht sieht, ist in der Tat politisch ein Kind.»[31] Alois Riklin hat Machiavelli daher auch als Webers «Ghostwriter» bezeichnet – mit dem kleinen, aber in der Sache unwesentlichen Unterschied, dass Weber eine «schicklichere Verpackung» wählte, indem er Machiavellis Ratschlag an den Fürsten, zu lernen, nicht gut zu sein, «in den wohlgefälligen Mantel der ‹Verantwortungsethik›» hüllte.[32] Gleichwohl ist es eben diese Verantwortungsethik, mit der Weber in Politik als Beruf einen Politikertypus auszeichnet, der im Gegensatz zum Beamten bereit ist, den Kampf um die politische Macht zu führen und die politische Verantwortung für seine Entscheidungen zu übernehmen: «Der echte Beamte […] soll seinem eigentlichen Beruf nach nicht Politik treiben, sondern: ‹verwalten›, unparteiisch vor allem […]. Sine ira et studio, ‹ohne Zorn und Eingenommenheit› soll er seines Amtes walten. Er soll also gerade nicht das tun, was der Politiker, der Führer sowohl wie seine Gefolgschaft, immer und notwendig tun muß: kämpfen. Denn Parteinahme, Kampf, Leidenschaft – ira et studium – sind das Element des Politikers. Und vor allem: des politischen Führers. Dessen Handeln steht unter einem ganz anderen, gerade entgegengesetzten Prinzip der Verantwortung als die des Beamten. Ehre des Beamten ist die Fähigkeit, wenn – trotz seiner Vorstellungen – die ihm vorgesetzte Behörde auf einem ihm falsch erscheinenden Befehl beharrt, ihn auf Verantwortung des Befehlenden gewissenhaft und genau so auszuführen, als ob er seiner eigenen Überzeugung entspräche: Ohne diese im höchsten Sinn sittliche Disziplin und Selbstverleugnung zerfiele der ganze Apparat. Ehre des politischen Führers, also: des leitenden Staatsmanns, ist dagegen gerade die ausschließliche Eigenverantwortung für das, was er tut, die er nicht ablehnen oder abwälzen kann und darf.»[33