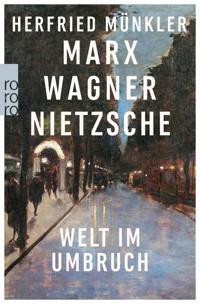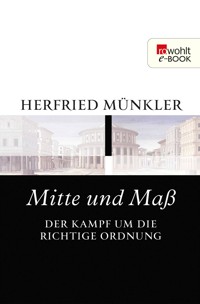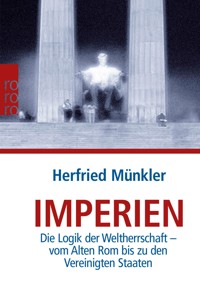14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Er fegte die alte Welt hinweg und haftet seit vier Generationen im kollektiven Gedächtnis: der Große Krieg. Als er ausbrach, am 1. August 1914, bejubelten noch viele, dass nun die Waffen sprachen. Doch vier Jahre später, im November 1918, war jede Illusion verflogen. Der Erste Weltkrieg, der in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Ostasien und auf den Weltmeeren von mehr als drei Dutzend Staaten geführt wurde, forderte mehr als zehn Millionen Tote, zerstörte die Weltordnung und weckte Revanchegelüste. Er veränderte alles: Nicht nur betraten die USA und die Sowjetunion die Weltbühne, auch die Ära der Ideologien und Diktaturen begann, die schließlich zum Zweiten Weltkrieg mit all seinen Verwerfungen führte. Herfried Münkler schildert in seiner großen Gesamtdarstellung diese «Urkatastrophe» des 20. Jahrhunderts, zeigt, wie der Erste Weltkrieg das Ende der Imperien besiegelte, wie er Revolutionen auslöste, aber auch den Aufstieg des Sozial- und Steuerstaats förderte. Ein Zeitpanorama von besonderem Rang, das nicht nur die politischen und menschlichen Erschütterungen vor Augen führt, sondern auch zahlreiche Neubewertungen dieses epochalen Ereignisses vornimmt. Wenn wir den Ersten Weltkrieg nicht verstehen, wird uns das ganze 20. Jahrhundert ein Rätsel bleiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1366
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Herfried Münkler
Der Große Krieg
Die Welt 1914 bis 1918
Über dieses Buch
Er fegte die alte Welt hinweg und haftet seit vier Generationen im kollektiven Gedächtnis: der Große Krieg. Als Ausbruch aus einem scheinbar stillstehenden Zeitalter der Sicherheit wurde sein Beginn am 1. August 1914 von vielen noch euphorisch begrüßt. An seinem Ende, im November 1918, waren zu bilanzieren: mehr als zehn Millionen Tote, eine in Trümmer gestürzte Weltordnung und ungestillte Revanchegelüste. Der Erste Weltkrieg veränderte alles. Nicht nur betraten die USA und die Sowjetunion die Weltbühne, auch die Ära der Ideologien und Diktaturen begann, die schließlich zum Zweiten Weltkrieg mit all seinen Verwerfungen führte. Herfried Münkler schildert in seiner großen Gesamtdarstellung diese «Urkatastrophe» des 20. Jahrhunderts, zeigt, wie der Erste Weltkrieg das Ende der Imperien besiegelte, wie er Revolutionen auslöste, aber auch den Aufstieg des Sozial- und Steuerstaats förderte. Ein Zeitpanorama von besonderem Rang, das nicht nur die politischen und menschlichen Erschütterungen vor Augen führt, sondern auch zahlreiche Neubewertungen dieses epochalen Ereignisses vornimmt. Wenn wir den Ersten Weltkrieg nicht verstehen, wird uns das ganze 20. Jahrhundert ein Rätsel bleiben.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2015
Copyright © 2013 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München, nach einem Entwurf von Frank Ortmann (Foto: picture alliance/Sueddeutsche Zeitung Photo)
ISBN 978-3-499-62785-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Einleitung
1. Lange und kurze Wege in den Krieg
Sarajewo, 28. Juni 1914
Krisenregion Balkan
Die deutsche Balkanpolitik
Zwischen Entspannung und Misstrauen
Der deutsche Militarismus als kriegstreibender Faktor?
Niedergangsängste und Einkreisungsobsessionen
Der vermeintliche Zwang zum Präventivkrieg
2. Auf der Suche nach der schnellen Entscheidung
Von Lüttich zur Sambre
Tannenberg und die Katastrophe des russischen Heeres
Das deutsche Scheitern an der Marne
Der Ruin des k.u.k. Heeres
«Wettlauf zum Meer»
3. Der Sinn und die Ziele des Krieges
Die Kriegserklärung als Fest
Vom Sinn des Krieges: innere Einheit und sittliche Läuterung
Der Antikapitalismus der deutschen Helden
«Deutscher Geist» in der Defensive
Die «deutsche Freiheit»
Politischer Überschwang und heroischer Opfersinn
4. Der festgefahrene Krieg
Die politische Frage: den Krieg beenden oder weiterkämpfen?
Die militärische Frage: strategische Kontroversen
Die Winteroffensiven
Krieg im Nahen Osten und in den deutschen Kolonien
Der abgewehrte Stoß in den «weichen Unterleib» der Mittelmächte: Gallipoli
Der Durchbruch von Gorlice-Tarnów
Der Kriegseintritt Italiens und die Niederlage Serbiens
Die Vorteile der Verteidigung gegenüber dem Angriff: der Stellungskrieg im Westen
Leben im Felde: Latrine und Bordell
Joffres Offensiven und der deutsche Gaskrieg
5. Entscheidungsschlachten ohne Entscheidung
Kriegsrat
«Weißbluten»: die Schlacht von Verdun
Der Krieg der Donaumonarchie
Hindenburg im Wartestand und der Kriegseintritt Rumäniens
Flugzeuge, Panzer und eine neue Taktik: die Schlacht an der Somme
Heldenbilder
6. Ausweitung des Kampfes
Risikoflotte und «Fleet in being»
Die deutsche Marine in der Defensive
«Das Rütteln der Deutschen an der Kerkertür»: Skagerrak
Der eingeschränkte und der uneingeschränkte U-Boot-Krieg
Ansätze zum strategischen Luftkrieg
«Augen der Artillerie» und «Ritter der Lüfte»
Die Politik der ‹revolutionären Infektion›
7. Der erschöpfte Krieg
Kriegswirtschaft und Wirtschaftskrieg
Handelsblockade, Mangelwirtschaft und Kriegsfinanz
Kampfstreiks und Meutereien
Gescheiterte Friedensinitiativen und der Sturz Bethmann Hollwegs
Die Flandernschlacht
8. Ludendorffs Vabanque und der Zusammenbruch der Mittelmächte
Wilsons Vierzehn-Punkte-Programm
Das kurzlebige Ostimperium der Deutschen
Die Entscheidung zur «großen Schlacht»
Erfolg und Scheitern: die deutsche Frühjahrsoffensive
Kriegswende
Revolution und politische Neuordnung
9. Der Erste Weltkrieg als politische Herausforderung
Ost- und Westfront im kollektiven Gedächtnis
Der Untergang der großen Reiche
Die Last der geopolitischen Mitte
Das heutige China in der Position des wilhelminischen Deutschland
Fatalismusfallen, Lernblockaden oder politische Psychotherapie
Der Erste Weltkrieg als Herrschaft der Paradoxien
Anhang
Literaturverzeichnis
Namenregister
Bildnachweis
Danksagung
Leseprobe: Kriegssplitter
Einleitung
Die Evolution der Gewalt im 20. und 21. Jahrhundert
Teil I
Die großen Kriege des 20. Jahrhunderts
Einleitung
Der Große Krieg von 1914 bis 1918 war nicht nur die «Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts», wie ihn der amerikanische Diplomat und Historiker George F. Kennan bezeichnet hat, sondern auch das Laboratorium, in dem fast alles entwickelt worden ist, was in den Konflikten der folgenden Jahrzehnte eine Rolle spielen sollte: vom strategischen Luftkrieg, der nicht zwischen Kombattanten und Nonkombattanten unterschied, bis zur Vertreibung und Ermordung ganzer Bevölkerungsgruppen, von der Idee eines Kreuzzugs zur Durchsetzung demokratischer Ideale, mit der die US-Regierung ihr Eingreifen in den europäischen Krieg rechtfertigte, bis zu einer Politik der revolutionären Infektion, bei der sich die Kriegsparteien ethnoseparatistischer, aber auch religiöser Strömungen bedienten, um Unruhe und Streit in das Lager der Gegenseite zu tragen. Der Erste Weltkrieg war der Brutkasten, in dem fast all jene Technologien, Strategien und Ideologien entwickelt wurden, die sich seitdem im Arsenal politischer Akteure befinden. Schon deswegen lohnt sich eine sorgfältige Beschäftigung mit diesem Krieg.
In Deutschland ist der Erste Weltkrieg über lange Zeit nur als Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg angesehen worden. Da dieser den Vorgängerkrieg an Zerstörung, Leid und Grausamkeit noch einmal deutlich übertroffen hat, ist das Interesse am Großen Krieg, wie er in England und Frankreich bis heute heißt, hierzulande zuletzt eher begrenzt gewesen. Er wurde nur noch als Ausgangspunkt einer Erzählung von deutscher Hybris und deutscher Schuld betrachtet, womit er der politiktheoretischen Analyse weitgehend entzogen war. Viele der Herausforderungen, die vor und nach 1914 das Handeln der Politiker und die Erwartungshaltung der Bürger geprägt haben, sind jedoch zwischenzeitlich zurückgekehrt und bestimmen auf die eine oder andere Weise erneut die europäische wie die globale Politik. Der Krieg von 1914 bis 1918 ist dadurch als Feld politischen Lernens wieder interessant geworden. Gerade weil er inzwischen in einem buchstäblichen Sinn Geschichte ist, lassen sich an ihm Konfliktabläufe untersuchen und die Folgen gefährlicher Bündniskonstellationen analysieren. Auf das damalige paradigmatische Reiz-Reaktions-Schema und den Zwang, sich rasch auf neue Situationen einzustellen, wird immer dann verwiesen, wenn sich weltpolitische oder regionale Konflikte wieder einmal gefährlich zuspitzen.
Bei einem weitgehend auf die deutsche Geschichte fixierten Blick mag es nachvollziehbar sein, den Ersten eng mit dem Zweiten Weltkrieg zu verbinden, bis hin zu deren analytischer Verschmelzung zu einem einzigen, nur durch einen längeren Waffenstillstand unterbrochenen Konflikt; manche Historiker haben die Zeitspanne von 1914 bis 1945 gar als einen neuen «Dreißigjährigen Krieg» bezeichnet. Aber schon für Europa vermag diese Engführung von Erstem und Zweitem Weltkrieg kaum zu überzeugen. Sie ist zu sehr auf die Bändigung des großen Störenfrieds der europäischen Politik fokussiert, auf das wilhelminische Reich als die unruhige Macht in der Mitte des Kontinents. Zweifellos war Deutschland im Sommer 1914 einer der maßgeblichen Akteure, die für den Kriegsausbruch verantwortlich waren – aber es trug diese Verantwortung keineswegs allein. Und dass die politischen Probleme, die in den Krieg von 1914 bis 1918 hineingeführt hatten, mit dem Jahr 1945 und der Teilung Deutschlands sowie der Auslöschung Preußens nicht erledigt waren, zeigte sich spätestens nach dem Ende des Kalten Kriegs: Als die Ordnung von Jalta und Potsdam zerfiel, brachen auf dem Balkan lange vergessen geglaubte Konflikte wieder auf. Damit konnte «1945» nicht länger als die Antwort auf die Frage von «1914» angesehen werden. Anstatt den Ersten Weltkrieg wesentlich vom Zweiten her zu betrachten, muss man ihn wieder als ein für sich allein stehendes, komplexes Ereignis behandeln. Ohnehin hat dieser Krieg, wenn man ihn als «Weltkrieg» betrachtet, sehr viel mehr Probleme hinterlassen als die instabile Ordnung Mittel- und Osteuropas. Immerhin ist auch im pazifischen Raum der Zweite Weltkrieg durch kriegerische Handlungen im Jahre 1914 vorbereitet worden: Zwar war etwa die japanische Eroberung einer deutschen Kolonie auf chinesischem Boden ein eher marginales Kriegsereignis und hatte für den Fortgang des Konflikts in Europa so gut wie keine Bedeutung; zusammen mit der Besetzung kleinerer Inselgruppen, die vordem zum deutschen Kolonialreich gehört hatten, verschob sie jedoch das ostasiatische Machtgefüge und führte so zu neuen und weitergehenden Begehrlichkeiten. Auch die Erschütterung der Kolonialverhältnisse in Afrika und Indien infolge des Ersten Weltkriegs war zunächst kaum bemerkbar, zeitigte dann aber doch immer größere Folgen. Das wahrscheinlich größte Problem, das dieser Krieg hinterlassen hat, ist der postimperiale Raum des Nahen und Mittleren Ostens, wo sich nach der Zerschlagung des Osmanischen Reichs Briten und Franzosen zeitweilig die «Beute» teilten, aber nicht in der Lage waren, eine stabile Ordnung mit entwicklungsfähigen Gesellschaften zu etablieren. Mit großer Wahrscheinlichkeit wäre Greater Middle East, wie die Region in der geopolitischen Terminologie der USA heute heißt, auch ohne den Großen Krieg zu einer Konfliktregion geworden (und der Balkan wie der Kaukasus wären es geblieben), aber die dramatischen Beschleunigungseffekte, die der Krieg mit sich gebracht hat, haben die politischen Bearbeitungsmöglichkeiten erheblich eingeschränkt.
Offenbar hat jede Zeit ihren eigenen Blick auf den Krieg von 1914 bis 1918, jede Zeit stellt die für sie dringlichen Fragen an ihn, setzt bei der Beschreibung seines Verlaufs unterschiedliche Schwerpunkte und bezieht ihn auf diese Weise auf ihr Selbstverständnis. Das gilt insbesondere für die Zwischenkriegsära sowie die Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs, als man den Krieg von 1914 bis 1918 als eine unmittelbare Herausforderung begriff und die Deutschen sich anheischig machten, dessen Ergebnisse zu korrigieren. Es zeigte sich aber auch im ersten großen Historikerstreit der Bundesrepublik, in dem es um die Frage ging, ob das Deutsche Reich systematisch auf den Krieg hingearbeitet habe, wie der Hamburger Historiker Fritz Fischer und seine Schüler behaupteten, oder ob politische Fehler und Ungeschick sowie ein verfassungstechnisch nicht unter Kontrolle gebrachtes Militär den Konflikt zum großen Krieg eskalieren ließen, wie Fischers Freiburger Widerpart Gerhard Ritter dagegenhielt. Diese Debatte liegt jetzt ein halbes Jahrhundert zurück, und sie war die letzte größere Auseinandersetzung über den Ersten Weltkrieg, die für die politische Kultur der Bundesrepublik Bedeutung erlangt hat. Spätere Debatten, wie etwa die über den Primat der inneren oder der äußeren Politik, also die Frage, wie die gesellschaftlichen Konstellationen in Deutschland den Weg in den Krieg beeinflussten, oder die über den Erschöpfungsgrad des deutschen Heeres im Herbst 1918, sind auf die Fachwissenschaft beschränkt geblieben. Der Krieg von 1914 bis 1918 hatte zwischenzeitlich seine Brisanz verloren, er war historisch geworden.
Die Historisierung von Ereignissen und Entwicklungen ist freilich die Voraussetzung dafür, dass sie zu einem Objekt politiktheoretischer Analysen werden können. Umso mehr erstaunt es, dass in Deutschland seitdem keine Gesamtdarstellung des Ersten Weltkriegs entstanden ist. Das letzte große Buch dieser Art ist Peter Graf Kielmanseggs Werk Deutschland und der Erste Weltkrieg aus dem Jahre 1968. Danach sind hierzulande eigentlich nur noch Arbeiten zu Einzelaspekten des Weltkriegs erschienen: Man beschäftigte sich mit seiner Entstehungsgeschichte oder mit seinem Ende und dessen Nachspiel, analysierte die Auswirkungen des Krieges auf die Gesellschaft und die Ordnung der Geschlechter, auf Männlichkeits- und Weiblichkeitskonstruktionen, auf Kunst und Literatur sowie den Schwund des Fortschrittsbewusstseins, der im Gefolge des Krieges in den meisten europäischen Ländern erfolgt ist. Das eigentliche Kriegsgeschehen sparte man dabei in der Regel aus, und wenn man sich ihm doch einmal zuwandte, dann vor allem im Hinblick auf seine Opfer. Diese Perspektive dominierte die historische und politiktheoretische Auseinandersetzung mit dem Krieg – den vielen Opfern wurden einige Verantwortliche gegenübergestellt, die als «Täter» fungierten. Nur lassen sich Täter und Opfer keineswegs immer klar voneinander trennen. Um die komplexen Interaktionszusammenhänge eines Krieges zu erfassen, bedarf es daher einer Gesamtdarstellung, die sich dem Krieg in seiner vollen Dauer sowie seinen unterschiedlichen Facetten widmet. Damit ist nicht gesagt, dass es Gesamtdarstellungen stets gelingt, die vielgestaltigen Wechselwirkungen eines Krieges zu erfassen und angemessen zu beschreiben, aber sie bilden zumindest die einzige Herangehensweise, die diesen Anspruch zu erheben vermag.
Die politische wie wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Weltkrieg war in Deutschland lange Zeit durch die Kriegsschuldfrage geprägt, wenngleich in unterschiedlicher Ausformung: In den zwei Jahrzehnten nach 1919 bemühten sich die deutsche Öffentlichkeit und Politik, den Artikel 231 des Versailler Vertrags zurückzuweisen, der die Alleinschuld des Deutschen Reichs feststellte; in den Jahrzehnten nach der Fischer-Kontroverse hingegen wurde diese Schuld allgemein akzeptiert – auch in der Bundesrepublik und nicht nur in der DDR, wo dem Deutschen Reich immer eine erhebliche Mitschuld am Krieg zugewiesen worden ist, freilich mit dem Hinweis verbunden, dass nicht nur das Deutsche Reich eine imperialistische Politik betrieben habe. Insofern waren die Thesen Fritz Fischers, die den Deutschen die Hauptschuld am Krieg anlasteten, um einiges radikaler als die der offiziellen DDR-Historiographie. Erst in den letzten Jahren hat man in Deutschland die Perspektive erweitert und die Pläne und Aktionen, Annahmen und Ziele aller in den Krieg verwickelten Mächte miteinander verglichen und dabei nicht mehr bloß nach der «Schuld» gefragt, sondern nach der jeweiligen politischen und moralischen «Verantwortung» für den Kriegsausbruch und nach den Gründen für die lange Dauer des Konfliktes. Anstatt sich auf die vermeintlich sinisteren Absichten einzelner Akteure zu konzentrieren, wurden nun die Handlungen aller Beteiligten analysiert und ihre Fehlurteile und Führungsprobleme untersucht. Dabei sind auch die spezifischen Bündniskonstellationen von 1914 und davor wieder in den Blick gekommen, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass ein regionaler Konflikt auf dem Balkan nicht begrenzt werden konnte, sondern zum Großen Krieg eskalierte. Dennoch war dieser Krieg nicht zwangsläufig oder überdeterminiert, wie die Imperialismusstudien behauptet haben. Er hätte vielmehr, das soll auch diese Darstellung zeigen, bei mehr politischer Weitsicht und Urteilskraft vermieden werden können. Eine Neukonturierung ist schon deswegen lohnend, weil sich daraus ein Lehrstück der Politik ergibt, in dem das Zusammenspiel von Angst und Unbedachtheit, Hochmut und grenzenlosem Selbstvertrauen analysiert werden kann, das auf einen Weg führte, auf dem schließlich keine Umkehr mehr möglich schien: Ende Juli 1914 nicht, als dies noch relativ einfach gewesen wäre, aber alle Seiten den damit verbundenen «Gesichtsverlust» scheuten, und auch nicht während des Krieges, als längst klar war, dass jeder weitere Schritt irreparable Verheerungen nicht nur beim Gegner, sondern auch in der eigenen Gesellschaft hinterlassen würde. Das Bild von den Lemmingen, die sich kollektiv in den Abgrund stürzen, ist oft bemüht worden, ohne dass damit erklärt werden konnte, warum sich eine ganze Generation von Politikern so verhalten hat.
Vor längerem schon hat sich die amerikanische Politikwissenschaft dieser Frage angenommen, insbesondere die sogenannte Realistische Schule der Internationalen Politik und deren Filiationen, die politisches Handeln als machtbewehrte Interessendurchsetzung begreifen, sowie eine spieltheoretisch angeleitete Interaktionsanalyse, die Entscheidungen im Hinblick auf ihre «Rationalität» analysiert. Dabei haben sie den Ersten Weltkrieg jedoch nicht in seinem Gesamtzusammenhang und über seine ganze Dauer untersucht, sondern sich auf einzelne Vorgänge beschränkt: Wie hätten bei vollständiger Information jeweils rationale Entscheidungen ausgesehen, und welche Entscheidungen haben die unzureichend informierten und voreingenommenen Akteure tatsächlich getroffen? Diese Methodik ist der Idee nach auch in die vorliegende Darstellung eingegangen, indem die Optionen skizziert werden, die den politischen und militärischen Verantwortlichen zur Verfügung standen. Das hat nichts mit retrospektiver Besserwisserei zu tun, sondern soll erklären helfen, warum die im Strudel der Ereignisse und obendrein unter Zeitdruck Stehenden so gehandelt haben, wie sie es taten. Warum etwa haben die Deutschen nach dem Scheitern ihrer Offensive gegen Frankreich nicht schon im September 1914 alles unternommen, um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, und warum haben Franzosen, Briten und Italiener, nachdem ihre eigenen Angriffsoperationen ein ums andere Mal steckenblieben, daraus immer nur die Konsequenz gezogen, dass umgehend die nächste Offensive vorbereitet werden müsse?
Der politischen und militärischen Führung Deutschlands sind zweifellos eine Reihe von Fehlurteilen und Fehleinschätzungen unterlaufen, aus denen dann Führungsfehler erwachsen sind, die zunächst in den Krieg und dann in die Niederlage geführt haben. Das beginnt beim Bau der deutschen Kriegsflotte und der ihr von Admiral Tirpitz zugedachten weltpolitischen Aufgabe, geht weiter über den vermeintlich genialen Plan des Generals von Schlieffen, das Problem eines möglichen Zweifrontenkriegs zu lösen, und reicht bis zu dem verhängnisvollen Entschluss zum uneingeschränkten U-Boot-Krieg, der die Mittelmächte endgültig auf die Verliererstraße brachte. Was bei der Analyse dieser Fehlurteile jedoch nicht übersehen werden sollte, ist die Bedeutung von Kontingenz, von Zufällen und unvorhergesehenen Ereignissen, in deren Folge sich manche auf den ersten Blick wohlkalkulierte und lange durchdachte Entscheidung ganz anders auswirkte als geplant. Meist resultierte dies aus überbewerteten Informationen und fehlender Voraussicht. Hätte die deutsche Seite im Frühsommer 1914 beispielsweise nicht durch einen in der Londoner Botschaft Russlands platzierten Spion von den britisch-russischen Gesprächen über eine gegen Deutschland gerichtete Marinekonvention erfahren, dann wäre Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg in den Tagen vor Kriegsausbruch vermutlich auf das britische Vermittlungsangebot eingegangen oder hätte es zumindest sorgfältiger geprüft; stattdessen maß er den britisch-russischen Gesprächen ein größeres Gewicht bei, als ihnen tatsächlich zukam, zumal die Briten beharrlich leugneten, dass es diese Gespräche überhaupt gab. Das dadurch geweckte Misstrauen hatte verheerende Folgen. Hätten die Deutschen umgekehrt zu Beginn des Jahres 1917 gewusst, dass in Russland wenige Wochen später eine Revolution ausbrechen würde, in deren Folge dieser lange Zeit furchteinflößende Gegner (die «russische Dampfwalze») im Sommer 1917 de facto aus dem Krieg ausschied, so hätte sich am 9. Januar 1917 vermutlich keine Mehrheit für die Eröffnung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges gefunden; die USA wären dann womöglich nicht in den Krieg eingetreten, Großbritannien und Frankreich hätten alleine weiterkämpfen müssen und wären daher wahrscheinlich zur Aufnahme von Friedensgesprächen bereit gewesen.
Im einen Fall war es ein Zuviel, im anderen ein Zuwenig an Wissen, das über Krieg oder Frieden, Eskalation oder Begrenzung entschied. Dabei hatte die deutsche Seite erhebliche Anstrengungen unternommen, um möglichst wenig dem Zufall zu überlassen. Alle kriegsbeteiligten Mächte sind mit klaren Plänen für ihre Aufmärsche und Offensiven in den Krieg eingetreten, aber bei keiner war dessen Verlauf so präzise und detailliert durchgeplant wie bei den Deutschen. Dass Unerwartetes eintrat, war nicht vorgesehen. Generalstabschef Helmuth von Moltke d.Ä. hatte Strategie noch als ein «System von Aushilfen» definiert, sein Nachfolger Alfred Graf von Schlieffen hingegen war bestrebt, Feldzüge mit der Vorhersehbarkeit und Genauigkeit preußischer Eisenbahnfahrpläne zu führen. Wenn allerdings im Vorhinein festgelegt wurde, bis wohin das deutsche Heer am vierzigsten Tag nach der Mobilmachung vorgestoßen sein sollte, konnte es durch Zufälle schnell aus dem Takt gebracht werden. Der preußische Offizier und Militärtheoretiker Carl von Clausewitz hat solche unkalkulierbaren Ereignisse als Friktionen bezeichnet und davor gewarnt, diese zu unterschätzen. Schlieffens Kriegsplanung, das «Geheimnis des Sieges», wie man im Generalstab ehrfürchtig dazu sagte, ist nicht zuletzt an ihrer Inflexibilität gescheitert. Zwar folgten die deutschen Truppen mit einer in der Kriegsgeschichte wohl einmaligen Präzision den Vorgaben des Schlieffenplans und standen am vierzigsten Tag nach der Mobilmachung tatsächlich in den Räumen, die Schlieffen für dieses Datum vorgesehen hatte. Die militärische Führung ignorierte dafür aber das Nachschubproblem, sodass die Truppen ihre Ziele in einem Zustand physischer Erschöpfung erreichten, und sie verkannte die Bedeutung der öffentlichen Meinung, die sich international gegen die Deutschen kehrte, als sie in Belgien mit großer Brutalität gegen die Zivilbevölkerung vorgingen. Wenn man sich auf solche Details einlässt, stößt man auf eine ganze Reihe von Paradoxien, die für den Verlauf dieses Krieges typisch sind.
Man muss sich schließlich bei der Betrachtung des Ersten Weltkriegs von der Vorstellung lösen, dass nur jene Gelehrten Intellektuelle gewesen seien, die als Vertreter der kritischen Vernunft und der klugen Zurückhaltung auftraten, wie dies eine weit verbreitete Vorstellung nahelegt. Nicht nur die wenigen Skeptiker und Pazifisten, die vor dem Krieg gewarnt und nach seinem Ausbruch auf seine schnelle Beendigung gedrängt haben, sondern auch die Annexionisten waren Intellektuelle. Viele von ihnen sind dezidiert regierungskritisch aufgetreten und haben dabei – ohne spezifische Expertise und rein wertorientiert argumentierend – im typischen Stil von Intellektuellen den auf eine Politik der Zurückhaltung und Mäßigung bedachten Reichskanzler Bethmann Hollweg aufs heftigste attackiert. Der Erste Weltkrieg war der erste Krieg, in dem die Intellektuellen, und zwar auf beiden Seiten, eine politisch einflussreiche Rolle gespielt haben: Die Deutungseliten haben sich nachhaltig in das Geschäft der Entscheidungseliten eingemischt, und dabei haben sie mehr zur Eskalation als zur Moderation des Kriegsgeschehens beigetragen. Viel bedeutsamer für eine kritische Stellungnahme zum Krieg als der «Ehrentitel» des Intellektuellen waren politische Urteilskraft und pragmatische Nüchternheit, über die beispielsweise Max Weber verfügte. Von Hause aus eigentlich ein glühender Nationalist und Anhänger einer imperialen Politik Deutschlands, erkannte er schon früh die prekäre Lage der Mittelmächte, drängte auf einen Verständigungsfrieden, lehnte Annexionen ab und sprach sich strikt gegen den uneingeschränkten U-Boot-Krieg aus.
Die intellektuellen Vordenker wie Kritiker des Kriegsgeschehens in Deutschland stehen für eine Ebene zeitgenössischer Reflexion, die in der nachfolgenden Analyse ihrerseits reflexiv gebrochen wird. Zu den «Fellow travellers» der Darstellung gehören Literaten wie Jaroslav Hašek, Ernst Jünger oder Robert von Ranke-Graves, auf die verschiedentlich als Kommentatoren des Geschehens wie als Verarbeiter des Kriegserlebnisses zurückgegriffen wird, ebenso wie auf Feldpostbriefe einfacher Soldaten. Dieser Rückgriff dient dabei auch dazu, den «Blick vom Feldherrnhügel» aus der Perspektive des einfachen Soldaten zu hinterfragen, der die von oben kommenden Befehle auszuführen und deren Folgen zu ertragen hatte. Viele der jüngeren deutschsprachigen Veröffentlichungen zum Krieg haben sich freilich ausschließlich auf die letztere Perspektive beschränkt, und infolgedessen ist der «Krieg des kleinen Mannes» zu einer einzigen und endlosen Geschichte des Erduldens und Leidens geworden, aus der heraus nicht erklärbar ist, warum er so lange gedauert hat und wieso auf Phasen der Erschöpfung immer neue Großoffensiven folgten. Nicht nur in den Stabsquartieren, sondern auch in den vordersten Gräben war der Krieg ein komplexes Zusammenspiel von Enthusiasmus und Niedergeschlagenheit, Siegeserwartung und Durchhaltewillen, aber auch Resignation und Kampfverweigerung. Dieses Ineinander und Gegeneinander lässt sich nur begreifen, wenn man die beiden Sichtweisen, die der «Schlachtenlenker» und die des «Menschenmaterials», zusammenführt. Die Rekonstruktion des Feldherrnblicks ist leicht, während die Sicht der einfachen Soldaten widersprüchlich, stimmungsabhängig und lokal begrenzt ist. Um sie zu erfassen, wurde neben diversen Briefsammlungen auch auf literarische Darstellungen zurückgegriffen. Dagegen lässt sich einwenden, deren Sichtweise sei nachträglich stilisiert worden; das gilt jedoch nicht nur für sie: Eine literatur- und sprachwissenschaftlich angeleitete Durchsicht der Feldpostbriefe hat gezeigt, dass auch sie als authentische Zeugnisse problematisch sind, weil das, was in ihnen erzählt wird, in hohem Maße durch sprachliche Stereotype geprägt ist. Den «Blick von unten» angemessen darzustellen, ist methodisch jedenfalls sehr viel schwieriger, als dies beim «Blick von oben» der Fall ist. Die Präferenz für literarische Zeugnisse begründet sich auch daraus, dass sie schon viele Male kritisch analysiert wurden und ihnen so der Authentizitätsgestus abhandengekommen ist.
Die Geschichte des Krieges stellt einen fließenden und stetigen Lernprozess dar, der sich auf unterschiedlichen Ebenen vollzogen hat: Es gab ein taktisches Lernen, in dessen Verlauf sich die Organisation der Verteidigung und die Durchführung von Angriffen grundlegend veränderte. Es gab ein strategisches Lernen, das in der permanenten Suche nach den starken und schwachen Punkten des Gegners bestand und immer wieder auf die Frage zulief, an welchen Stellen man besser ansetzen solle: Briten und Russen präferierten die schwachen, Franzosen und Deutsche die starken Punkte, und dementsprechend legten sie ihre jeweiligen Kriegspläne an. Und schließlich gab es auch ein politisches Lernen, das um die Frage kreiste, ob und wann man in einen Krieg eintreten und wann man ihn beenden beziehungsweise einen Separatfrieden schließen solle. Lenin, der das Ziel verfolgte, den Staatenkrieg in einen Klassen- oder Bürgerkrieg umzuwandeln, war in dieser Hinsicht besonders lernbereit; die Deutschen hingegen beschränkten ihre Lernbereitschaft vorwiegend auf den Bereich der militärischen Taktik. Tatsächlich hatte ihre Gefechtsführung bei Kriegsende nur noch wenig gemein mit der bei Kriegsbeginn; andernfalls hätten sie den Konflikt auch nicht so lange durchhalten und immer wieder aufs Neue auf den Sieg hoffen können, obwohl sie der Koalition ihrer Gegner an Menschen und Material von Anfang an hoffnungslos unterlegen waren. Gerade darin bestand aber das Verhängnis der Deutschen – ihre Lernerfolge im Bereich der Taktik, der rein militärischen Sphäre also, verminderten den Druck, auch im Bereich der Strategie und vor allem der Politik zu lernen. Um es zuzuspitzen: Weil die Deutschen in taktischer Hinsicht glänzende Lernerfolge hatten, glaubten sie, derlei auf politischem Terrain nicht nötig zu haben – und unter anderem daran sind sie in diesem Krieg gescheitert. Die Macht des Militärs, obwohl schon bei Kriegsbeginn vergleichsweise groß, wuchs immer weiter, sodass ein Taktiker wie der Erste Generalquartiermeister des deutschen Heeres Erich Ludendorff zuletzt die Politik vollständig unter seine Kontrolle brachte.
Wie aber konnte es zu diesem Ungleichgewicht zwischen militärtaktischem und politischem Lernen kommen? Und worin lagen dessen tiefere Ursachen? Zweifellos hat hier die Verfassung des Deutschen Reichs eine wichtige Rolle gespielt, die dem Generalstabschef unmittelbaren Zugang zum Kaiser gewährte und das Militär nicht der Kontrolle des Reichskanzlers oder gar des Reichstags unterwarf. Der Monarch vermochte den Generalstab allerdings nicht effektiv zu kontrollieren: Die Vorliebe Wilhelms II. für alles Militärische und seine Überzeugung, ein großer Feldherr zu sein, Friedrich dem Großen vergleichbar, kontrastierte mit seiner mangelhaften Ausdauer, sich über längere Zeit mit den entsprechenden Problemen zu beschäftigen. Ohne Rückendeckung des Kaisers konnte sich der Reichskanzler jedoch nicht gegen die militärische Führung durchsetzen, folglich stieg der politische Einfluss des Militärs weiter an, und der Primat der Politik konnte nicht zur Geltung gebracht werden. Während des Krieges war der Kaiser zudem ständig auf Reisen – freilich nicht mehr auf seiner Jacht in den norwegischen Fjorden oder in der Inselwelt der Ägäis, sondern im Sonderzug zwischen West- und Ostfront und oftmals auch weit weg vom militärischen Geschehen – und hielt sich nur selten in Berlin auf. Wilhelm verlor darüber den Sinn für die Realität des Geschehens und zog sich immer tiefer in eine Phantasie- und Wunschwelt zurück. Die zutiefst monarchisch gesinnten Männer seiner Umgebung registrierten mit Sorge, dass der Kaiser so gut wie keinen Kontakt mehr zur Bevölkerung hatte und sein Ansehen bei dieser rapide sank. Die kaiserliche Abwesenheit im Regierungszentrum hatte sicherlich auch mit dem Elend in Berlin, den langen Schlangen vor den Lebensmittelgeschäften und der wachsenden Missstimmung in der Bevölkerung zu tun. Der Krieg legte die Schwächen der preußischen Dynastie schonungslos offen, und er zeigte zugleich, in welchem Maße die Monarchen in Europa imageabhängig geworden waren. Die Legitimität des preußischen Königs und deutschen Kaisers erwuchs nicht mehr aus Gottes Gnaden, wie es in der Titulatur noch immer hieß, sondern aus Volkes Stimmung, und in dieser Beziehung stand es nicht gut um das Haus Hohenzollern.
Der Krieg hat aber auch die inneren Widersprüche des Deutschen Reichs sichtbar gemacht und zugleich verschärft. In vieler Hinsicht war Deutschland das modernste Land in Europa: Es hatte die bei weitem größte Industrieproduktion, war in den Zukunftsindustrien führend, verfügte über ein leistungsfähiges Schul- und Universitätssystem, besaß in den Natur- wie Geisteswissenschaften Weltgeltung und verfügte über ein lebhaftes kulturelles und künstlerisches Leben. Es hätte «ein deutsches Jahrhundert» werden können, wie der Historiker Fritz Stern im Rückblick auf das 20. Jahrhundert gemeint hat. Es waren freilich weniger die sozialen und politischen Widersprüche, an denen Deutschland gescheitert ist und die es auf den Weg in diesen Krieg gedrängt haben, als vielmehr eine Mischung aus Großmannssucht und Ängstlichkeit, wie sie für die deutsche Politik seit der Jahrhundertwende prägend war. Zweifellos gab es in Deutschland starke gesellschaftliche Gegensätze – wie alle anderen europäischen Länder war es eine Klassengesellschaft –, und es war politisch zutiefst gespalten. Aber diese politischen Spaltungen gab es auch in anderen Ländern. Die inneren Gegensätze als Ursache oder Motiv für eine «Flucht in den Krieg» geltend zu machen, wie es die Historiographie der Bundesrepublik zeitweilig getan hat, heißt, die «nivellierte Mittelstandsgesellschaft» der frühen Bundesrepublik zum Parameter der Friedensfähigkeit zu erklären.
Der Krieg hatte mit einer beeindruckenden Selbstmobilisierung der Gesellschaft begonnen: Schichten, die bislang nicht den von ihnen beanspruchten sozialen und politischen Platz gefunden hatten, wollten in dieser Ausnahmesituation ihre Unverzichtbarkeit für das Wohlergehen des Vaterlands beweisen. Insbesondere die Mittelschichten haben diesen Krieg zu «ihrem» Krieg gemacht, ihn begeistert begrüßt, zu wesentlichen Teilen durch Kriegsanleihen auch finanziert und schließlich verloren. In Deutschland galt dies in besonderem Maße und war auf die im Vergleich zu anderen Ländern größere gesellschaftliche Dynamik und die zum Teil besonders rückständigen Formen politischer Partizipation und sozialer Akzeptanz zurückzuführen. Die Darstellung des Krieges muss bei der Behandlung dieser Fragen freilich darauf achten, dass sie aus graduellen Unterschieden keine prinzipiellen Gegensätze macht, denn auch hierin unterschied sich Deutschland von Frankreich und England eher in Nuancen als im Grundsätzlichen. Im Wahlrecht zum Reichstag gehörte Deutschland zu den fortschrittlichsten Ländern, im preußischen Wahlrecht dagegen zu den zurückgebliebensten. Die komparativ angelegten Studien der letzten Jahrzehnte haben hier manches Klischee von der deutschen Rückständigkeit beiseitegeräumt.
Es würde freilich zu kurz greifen, den Krieg nur im Sinne George Kennans als «die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts» zu begreifen und es dabei zu belassen. Er hat auch einen – zugegebenermaßen häufig paradoxen – Modernisierungsschub ausgelöst, der die soziale und kulturelle Welt Europas von Grund auf verändert hat. Der Krieg hat zu einer beispiellosen sozialen Nivellierung geführt, und das keineswegs nur dort, wo in seiner Folge Regierungen mit sozialistischer Programmatik an die Macht gekommen sind. Die alteuropäische Gesellschaft der Stände und Klassen ist durch den Krieg und das egalisierende Kriegserlebnis in ihren Grundfesten erschüttert worden, und auch die moralischen und ästhetischen Wertungen, die zuvor allem avantgardistischen Widerspruch zu Trotz gesellschaftlich unerschütterlich erschienen, standen danach zur Disposition. Die Verfügung über das, was als wahr, schön und gut galt, war dem gehobenen Bürgertum und den ihm verbundenen Gelehrten entglitten. Nicht nur die Kronen lagen auf der Straße, wie Friedrich Engels das bereits 1895 für den Fall eines großen europäischen Krieges prognostiziert hatte, sondern auch die Werturteile und ästhetischen Maßstäbe, mit denen die Akademiepräsidenten zuvor den Kunstbetrieb gesteuert hatten, waren obsolet geworden. Aber auch hier ist die Destruktivität des Krieges mit einer gewaltigen Produktivität verbunden: Kein Krieg zuvor und danach hat eine so intensive künstlerische und literarische Verarbeitung erfahren wie der Krieg von 1914 bis 1918. Er ist dadurch zu einer kulturellen Wasserscheide geworden: Niemand hat Eric Hobsbawm widersprochen, als er erklärte, dass das «lange 19. Jahrhundert» 1914 geendet habe.
Was in der älteren Literatur zu sehr betont, in der neueren dagegen fast völlig in den Hintergrund gedrängt worden ist, soll in dieser Darstellung des Krieges und seiner Vorgeschichte möglichst angemessen berücksichtigt werden: die geopolitische Lage Deutschlands in der Mitte des Kontinents und die sich daraus ergebenden Ansprüche und Besorgnisse, Einflussmöglichkeiten und Bedrohungsszenarien. Das Deutsche Reich war weder stark genug, um die Verhältnisse auf dem Kontinent nach seinem Gutdünken zu regeln, noch konnte die deutsche Regierung eine vertrauensvolle Kooperation mit den Nachbarn aufbauen. Die aber fürchteten den mächtigen Akteur in der Mitte des Kontinents und suchten sich gegen ihn zu schützen, was zwangsläufig auf eine politische Einkreisung Deutschlands hinauslief. Der Umgang mit einer solchen Herausforderung setzte politisches Geschick voraus, das die auf Bismarck folgenden Reichskanzler nur sehr begrenzt und der Kaiser überhaupt nicht aufzubringen vermochten. Die Folge war ein Syndrom von Ängsten und Befürchtungen, das die Entscheidungen der Politiker und Militärs in Europa beeinflusste. Die Franzosen fürchteten ihre Marginalisierung, die Russen sorgten sich um den Einflussverlust nach der Niederlage gegen Japan im Jahre 1905, Österreich-Ungarn bangte um seinen Großmachtstatus, in Großbritannien herrschten Niedergangsängste, und in Deutschland litt man an der Einkreisungsobsession. Rationale Interessenverfolgung war unter solchen Umständen kaum möglich, zumal wenn solche Ängste durch geopolitische Überlegungen und demographische Entwicklungsstudien geschürt wurden, von denen sich die Politik unter Handlungsdruck gesetzt fühlte.
Der Macht in der Mitte des Kontinents kam in dieser Situation eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe zu, und vor dieser Aufgabe hat Deutschland versagt. Dieses Scheitern verlangt unsere Aufmerksamkeit umso mehr, als Deutschland nach 1990 wieder zu einer Großmacht in der Mitte Europas aufgestiegen ist und sich viele der Herausforderungen aus der Zeit vor 1914 erneut stellen – mit der freilich zentralen Differenz, dass an die Stelle des damaligen Mächtekonzerts ein zuverlässiges Bündnis- und Sicherheitssystem getreten ist und die Militärs längst nicht mehr über eine ähnliche Machtfülle verfügen wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Kultureller und vor allem wirtschaftlicher Macht kommt heute ein sehr viel größeres Gewicht zu, und, was vielleicht noch wichtiger ist, wir wissen um diese Gewichtsverschiebung. Doch die Herausforderungen der Position der Mitte bleiben, auch wenn diese heute nicht mehr militärstrategischer, sondern vor allem ökonomischer Art sind.
1. Lange und kurze Wege in den Krieg
Als sich Ende Juni 1991 Polizisten der kurz zuvor für unabhängig erklärten Republik Slowenien mit Angehörigen der Jugoslawischen Volksarmee erste Gefechte lieferten, begann auf dem Balkan eine Dekade von Zerfallskriegen. Kämpfer der neu entstandenen Nachfolgestaaten Jugoslawiens verübten zahlreiche Massaker an Zivilisten und Kriegsgefangenen und führten sogenannte ethnische Säuberungen durch – eine solche Brutalität hatte man in Europa nicht mehr für möglich gehalten. Ohne das Eingreifen von außen wären die Kriege eskaliert, und die Massaker hätten noch brutalere Ausmaße angenommen. Auch stand zu befürchten, dass die Gefechte die Grenzen des zerfallenden Jugoslawiens überspringen und die angrenzenden Gebiete erfassen könnten. Darüber hinaus zeichneten sich erneut die innereuropäischen Konfliktlinien von 1914 ab: So entdeckten etwa die Russen ihre traditionelle Verbundenheit mit den Serben wieder, und französische Politiker waren wie schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts bemüht, die Einflusssphäre Deutschlands und Österreichs auf dem Balkan zu begrenzen.[1] Was die Konstellation Mitte der 1990er Jahre von der des Jahres 1914 freilich unterschied, war die Rolle Großbritanniens und insbesondere der USA, die sich diesmal dafür einsetzten, diese Kriege einzudämmen und möglichst rasch zu beenden.
Hätte auch die Krise vom Juli 1914 einen anderen Verlauf nehmen können, anstatt sich zum großen Krieg auszuweiten, wenn Großbritannien damals eine aktivere Rolle in der Balkanpolitik gespielt hätte? In diesem Sommer war das britische Kabinett vollauf mit der Frage beschäftigt, wie es auf die Unabhängigkeitsbestrebungen der Iren reagieren sollte; die Brisanz des Balkankonflikts, so erklärten einige Minister später, habe man erst wenige Tage vor Kriegsausbruch erkannt. Zu diesem Zeitpunkt aber war es bereits unmöglich, noch entscheidend in den Gang der Ereignisse einzugreifen. Die jugoslawischen Zerfallskriege und das in den 1990er Jahren erfolgreiche europäisch-amerikanische Konfliktmanagement, dazu der Umstand, dass «Sarajewo» im 20. Jahrhundert zweimal zum politischen Symbol wurde – an seinem Anfang als die Stadt, in der der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand ermordet wurde, und am Ende des Jahrhunderts als Ort einer humanitären Katastrophe –, haben die Frage nach dem Ursprung des Ersten Weltkriegs neu aufgeworfen. Vor allem haben sie die lange als politisches Dogma geltende Vorstellung aufgebrochen, der Krieg von 1914 bis 1918 sei überdeterminiert gewesen, es habe also derart viele Faktoren gegeben, die auf seinen Ausbruch hingewirkt hätten, dass er unausweichlich gewesen sei.
Dabei hat die Kriegsursachenforschung schon seit langem gewusst, dass die Wirklichkeit komplizierter war und es sowohl «kurze» als auch «lange» Wege in den Krieg gab.[2] Gestritten wurde jedoch darüber, welche Bedeutung diesen Wegen jeweils zukam, wer welchen Weg wann beschritt und welche Folgen das hatte. Und weil dieser Streit lange Zeit unter dem Eindruck von Artikel 231 des Versailler Vertrags stand, der dem Deutschen Reich die Alleinschuld am Krieg zuwies, wurde die Kriegsursachendebatte zumeist als Kriegsschulddebatte geführt – die wissenschaftliche Analyse war somit von Anfang an von politisch-moralischen Wertungen überzogen. Dementsprechend erbittert war die Auseinandersetzung: Sind die europäischen Mächte in den Krieg «hineingeschlittert», wie die viel zitierte Formel des britischen Premiers David Lloyd George lautete, oder hat das Deutsche Reich diesen Krieg gewollt und systematisch auf ihn hingearbeitet, wie der Historiker Fritz Fischer meinte? Die These vom «Hineinschlittern» betont die kurzen Wege in den Krieg und sieht die langfristige Entwicklung als prinzipiell offen an; die Thesen Fischers hingegen stellen die strukturellen Kriegsursachen heraus und messen den kurzen Wegen eine nur geringfügige Bedeutung bei.
Die kurzen Wege beginnen zumeist erst am 28. Juni 1914, also mit dem Attentat bosnisch-serbischer Nationalisten auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajewo; die entsprechende Sichtweise konzentriert sich somit auf das Krisenmanagement unmittelbar nach dem Attentat beziehungsweise auf das Versagen der Politiker, einen zunächst bloß regionalen Konflikt einzuhegen. Dabei geht es um die Rolle der «Falken» in Wien, Berlin und St. Petersburg sowie um die politische Durchsetzungsschwäche der «Tauben». Die Kriegsursachenanalyse konzentriert sich hier auf einen Zeitraum von nicht einmal fünf Wochen.[3]
Die langen Wege hingegen führen bis ins 19. Jahrhundert zurück: Sie betreffen langfristige Prozesse und mentale Dispositionen, kollektive Mentalitäten und ökonomische Entwicklungen, weltpolitische Konstellationen und kumulative Entscheidungen. Hier stehen die Probleme des Imperialismus und Militarismus, geostrategische Fragen, Niedergangsängste und Einkreisungsobsessionen im Vordergrund. Die Ereignisse vom 28. Juni in Sarajewo sind dieser Sichtweise zufolge nur der Funke, der ein lange zuvor aufgestelltes Pulverfass zur Explosion gebracht hat. Auf diese Sichtweise geht auch die Unterscheidung zwischen ‹Anlass› und ‹Ursache› zurück. Danach war das Attentat von Sarajewo nur der Anlass für einen Krieg, der auch infolge eines anderen Ereignisses hätte ausbrechen können. Wer die Kriegsursachenanalyse auf die wenigen Wochen vor dem 1. August 1914 und somit auf die kurzen Wege in den Krieg beschränke, so wird argumentiert, bekomme die eigentlichen Ursachen nicht in den Blick. Er konzentriere sich auf bloß nebensächliche Detailfragen und übersehe die treibenden Kräfte, die zwangsläufig zu einem Kontinental- und schließlich Weltkrieg geführt hätten.
Aber lassen sich die tieferen Ursachen des Krieges wirklich von den langen Wegen her analysieren? Dieser Zugang hat eine gefährliche Nähe zu der fatalistischen Vorstellung vom «unvermeidlichen» Krieg, die einige der politischen Akteure im Juli 1914 tatsächlich daran hinderte, alle Anstrengungen zu unternehmen, den Konflikt einzudämmen.[4] Wer die kurzen Wege lediglich als Restkontingenz begreift, nur als letzte Möglichkeit also, eine eigentlich bereits vorherbestimmte Entwicklung doch noch zu beeinflussen, bestreitet retrospektiv, dass die Entscheidungsträger in den Wochen vor Kriegsausbruch größere Handlungsspielräume gehabt haben. Die kurzen Wege münden dieser Sicht zufolge beinahe zwangsläufig in den Krieg, weil die langen Wege dies so vorgegeben haben. Aber ist das wirklich so zwingend? In der jüngeren Forschung ist die Annahme einer Quasi-Determination zunehmend in Frage gestellt worden.
Sarajewo, 28. Juni 1914
Über der Suche nach den langfristigen Ursachen des Krieges ist dessen unmittelbarer ‹Anlass› in der älteren Forschung weitgehend aus dem Blick geraten. Dabei ist es durchaus einer genaueren Untersuchung wert, ob das Attentat von Sarajewo vielleicht doch mehr war als eben nur ein Anlass, ob die übrigen Faktoren womöglich gar nicht zum Krieg geführt hätten, wenn es diesen Mordanschlag nicht gegeben hätte. Wirklich ausschließen kann das nur eine Geschichtsbetrachtung, die den Krieg als überdeterminiert ansieht. Dann aber müssten sich auch politische Akteure identifizieren lassen, die den Krieg unbedingt gewollt und das Attentat nur zum Vorwand genommen haben, um endlich loszuschlagen. Hat man diese Akteure nicht oder kommt man zu dem Ergebnis, dass keine der beteiligten Großmächte den Krieg unter allen Umständen gewollt hat, so kehrt die Kontingenz in die Ereignisse zurück – und das 20. Jahrhundert hätte einen ganz anderen Verlauf nehmen können, wenn es in Sarajewo nicht zu einer Verkettung unglücklicher Umstände gekommen wäre.[1] Als der amerikanische Sozialwissenschaftler Steven Pinker in seiner Geschichte der Gewalt den Attentäter Gavrilo Princip als die wichtigste Person des 20. Jahrhunderts bezeichnete, hat er diesen Gedanken zu Ende gedacht.[2]
Die Vorstellung von der Wirkmacht des Zufalls hat etwas ebenso Verführerisches wie Entsetzliches.[3] Es hätte dann weder die zehn Millionen Gefallenen gegeben noch die Millionen Toten, die infolge des Krieges an Hungerkatastrophen und Pandemien gestorben sind, ebenso wenig die Opfer des russischen Bürgerkriegs als indirekter Kriegsfolge oder die Opfer des Stalinismus, weiterhin nicht die Opfer von Faschismus und Nationalsozialismus und auch keinen Zweiten Weltkrieg. Das muss nicht heißen, dass die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts gänzlich ohne Kriege verlaufen wäre. Aber wenn es sich dabei um Kriege wie jene im 19. Jahrhundert gehandelt hätte, dann wäre es eine gänzlich andere Geschichte geworden als die, auf die wir heute zurückblicken. Intuitiv wehren wir uns dagegen, dem Zufall einen solchen Einfluss zuzubilligen, würde dies doch heißen, dass der Lauf der Geschichte völlig unberechenbar und unkontrollierbar ist. In der Kriegsursachendebatte spielte dies immer eine wichtige Rolle – man könnte meinen, die Sicht, wonach das Attentat bloß der Anlass zu einem ohnehin vorherbestimmten Prozess war, habe sich aus psychotherapeutischen und nicht aus wissenschaftlichen Gründen durchgesetzt. Die Erzählung von der Zwangsläufigkeit des Krieges erschien erträglicher als die von der furchtbaren Macht des Zufalls. Deutsche Historiker zumal haben eine Großerzählung geschaffen, in der so viele Wege auf den Krieg zuliefen, dass man ihn buchstäblich nicht verfehlen konnte: Waren es bei den einen Militarismus und Imperialismus, so konzentrierten sich andere auf die wilhelminische Flottenpolitik oder auf das ebenso laute wie törichte Auftreten des deutschen Kaisers, und wieder andere suchten nachzuweisen, dass Politik und Militär des Kaiserreichs diesen Krieg seit geraumer Zeit gewollt und in voller Absicht vom Zaun gebrochen hatten. Der Große Krieg war dieser Sicht zufolge überdeterminiert, und dadurch wurde der Zufall bedeutungslos.
Tatsächlich hatte der Zufall am 28. Juni 1914 in Sarajewo gleich mehrfach seine Hand im Spiel: Zuerst prallte die von einem der Attentäter auf den Wagen des Erzherzogs Franz Ferdinand geschleuderte Bombe am zurückgeklappten Verdeck des Fahrzeugs ab und detonierte auf der Straße. Durch die Explosion wurden drei Insassen des nachfolgenden Autos sowie einige am Straßenrand Stehende leicht verletzt. Anstatt den Besuch abzubrechen, entschied der Erzherzog, das Programm protokollgemäß fortzusetzen, und ließ sich zum geplanten Empfang ins Rathaus fahren. Als dieser eine knappe Stunde später beendet war, wollte Franz Ferdinand zunächst die Verletzten im Militärspital besuchen – die Route wurde also geändert, dies aber nicht mit der örtlichen Polizei abgesprochen. Daraufhin wurden die Fahrzeuge doch auf die ursprünglich vorgesehene Strecke geleitet. Als General Oskar Potiorek, der Landeschef und Militärgouverneur von Bosnien-Herzegowina, das bemerkte, ließ er die Kolonne stoppen, um zur geänderten Route zurückzukehren. Doch just an der Stelle, wo das Auto mit Franz Ferdinand und seiner Frau Sophie anhielt, befand sich der bosnische Serbe Gavrilo Princip. Als Einziger der Attentäter hatte er nach dem Fehlschlag des ersten Anschlagversuchs nicht aufgegeben, sondern war an der vorgesehenen Route geblieben und hatte auf eine zweite Chance gewartet. Die bot sich ihm jetzt, und er feuerte auf das zum Stillstand gekommene Fahrzeug zwei oder drei Schüsse ab. Ein Schuss traf den Erzherzog in die Halsvene, ein anderer die Herzogin Sophie in den Bauch. Der Wagen raste nun zur Residenz des Militärgouverneurs, die sich nur wenige Minuten vom Ort des Attentats entfernt befand. Von einem Begleiter nach seinem Befinden gefragt, versicherte Franz Ferdinand, es sei nichts, und wiederholte dies mehrfach. Als die Fahrzeugkolonne die Residenz erreichte, war Herzogin Sophie bereits ihren schweren Verletzungen erlegen; eine Viertelstunde später starb auch der österreichisch-ungarische Thronfolger.[4]
Derweil war Gavrilo Princip von österreichischen Gendarmen festgenommen worden. Er hatte versucht, die Pistole gegen sich selbst zu richten, aber dabei war ihm einer der Umstehenden in den Arm gefallen. Ohnehin herrschte an der Stelle des Attentats ein dichtes Gedränge. Ursprünglich hatte auch Princip eine Bombe schleudern wollen, dann aber bemerkt, dass er infolge der eng beieinanderstehenden Menschen nicht weit genug ausholen konnte; erst daraufhin hatte er sich entschlossen, die Pistole zu verwenden. Nachdem der Versuch, sich selbst zu erschießen, gescheitert war, schluckte Princip eine Giftkapsel, musste sich aber sogleich erbrechen, sodass das Gift keine Wirkung entfalten konnte. In einigen Berichten heißt es, die Gendarmen hätten Princip vor der aufgebrachten Menge schützen müssen, die ihn lynchen wollte. In dem Tumult, der auf die Schüsse folgte, wurden auch mehrere weitere Personen nahe des Tatortes festgenommen; Fotografien vom Tag des Attentats zeigen, wie einer der Verdächtigen, ein junger Mann im Anzug mit hellem Hemdkragen und Weste, von österreichischen und bosnischen Gendarmen festgehalten und abgeführt wird.[5] Einige von ihnen haben ihre Säbel gezogen und demonstrieren so den Ordnungsanspruch der Staatsgewalt.[6] Man kann in diesen blankgezogenen Säbeln ein Symbol der nun endenden Epoche sehen. Im anschließenden Krieg haben Blankwaffen nur noch eine untergeordnete Rolle gespielt.
Unmittelbar nach den tödlichen Schüssen auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und dessen Frau in Sarajewo verhaften bosnische und österreichische Polizisten einen Mann, den sie verdächtigen, am Attentat beteiligt gewesen zu sein. Tatsächlich hatte er den Attentäter Gavrilo Princip vor einer Menge zu schützen versucht, die ihn lynchen wollte. Das Bild lässt eine aggressive Haltung bei den bosnischen Sicherheitskräften vermuten.
Es war freilich nicht bloß der Zufall, der an diesem 28. Juni 1914 Regie geführt hat – ebenso folgenreich waren die Unachtsamkeit und Nachlässigkeit der Verantwortlichen. Der Besuch des Erzherzogs in Sarajewo fiel auf den St. Veitstag, den Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld, und das war für die in Bosnien lebenden Serben eine politische Provokation: Diese Schlacht stand für den serbischen Freiheitsdrang und Unabhängigkeitsanspruch, und der wurde gedemütigt, wenn der österreichische Thronfolger am Tag ihres Gedenkens ein von Serbien beanspruchtes Gebiet besuchte. Ungeachtet dieser angespannten Lage waren die Sicherheitsvorkehrungen miserabel. So fuhr das Erzherzogspaar im offenen Wagen durch die Stadt, es gab keine Kontrollen und Absperrungen, sondern nur ein paar entlang der Route postierte Polizisten. Einige von ihnen trugen zwar Zivilkleidung, gaben sich aber bei der Vorbeifahrt der Fahrzeugkolonne zu erkennen, weil sie der Dienstvorschrift gemäß salutierten. Hätte man im Übrigen den ersten Attentäter, der die Bombe geworfen hatte, umgehend verhört, hätte man womöglich erfahren, dass noch weitere Angreifer an der Fahrtroute postiert waren. Außerdem musste man generell mit Anschlägen rechnen – Attentate auf Herrscher und Politiker waren damals an der Tagesordnung. Andererseits war die österreichische Zurückhaltung in Sicherheitsfragen ein Zeichen des politischen Entgegenkommens: Angeblich hatte Franz Ferdinand selbst es abgelehnt, dass entlang der Straße die bei Kaiserbesuchen übliche Doppelreihe von Soldaten aufgestellt wurde. Das Militär, das er als Generalinspektor des österreichisch-ungarischen Heeres zuvor inspiziert hatte, war außerhalb Sarajewos geblieben, um die in der Stadt lebenden Serben nicht zu provozieren. Es rückte erst nach dem Attentat ein, als es zu Unruhen kam, derer die örtliche Polizei nicht Herr wurde: Prohabsburgische katholische, jüdische und muslimische Jugendliche warfen die Scheiben serbischer Geschäfte und Wohnhäuser ein und machten Jagd auf Personen, die als proserbisch bekannt waren. Jetzt musste das Militär die Ruhe in Sarajewo wiederherstellen.[7]
Angesichts dieser Nachlässigkeiten und Schlampereien kam kurzzeitig der Verdacht auf, gewisse Kreise in Wien oder Budapest hätten das Attentat geradezu gewollt. Schließlich war die Ermordung Franz Ferdinands nicht zuletzt deshalb so folgenreich, weil sie die Kräfteverhältnisse innerhalb der politisch-militärischen Elite der Doppelmonarchie veränderte.[8] Das Habsburgerreich war in der Frage, wie die stärker werdenden Fliehkräfte der in ihm verbundenen Nationen zu bändigen waren, zutiefst gespalten: Auf der einen Seite standen jene, die sich von einem kurzen Krieg die Lösung der Probleme versprachen; durch ihn sollte die Handlungsfähigkeit der Monarchie unter Beweis gestellt und die Armee als wichtigste Klammer des Reichs gestärkt werden. Kopf dieser Partei war der Generalstabschef Franz Conrad – seit 1910 in den Freiherrenstand erhoben, aber meist nicht mit dem damals erhaltenen Namenszusatz «von Hötzendorf» genannt. Er drängte schon seit Jahren auf einen Präventivkrieg, am besten gegen Italien, das territoriale Ansprüche auf das Trentino und die istrische Küste erhob, notfalls aber auch gegen den balkanischen Störenfried Serbien.[9] Conrad sah kein Problem darin, dass sich Italien nach wie vor in einem Defensivbündnis mit Österreich-Ungarn (und Deutschland) befand. Ihm ging es darum, einen begrenzten Krieg als Revitalisierungsquelle des Vielvölkerreichs zu nutzen. Die Gegenpartei mit Franz Ferdinand an der Spitze argumentierte hingegen, die Monarchie brauche keinen Krieg, sondern Frieden; nur so lasse sich der Reformstau auflösen, der sich in der über sechzigjährigen Herrschaft Kaiser Franz Josephs aufgebaut habe. Der Schlüsselbegriff für den vom Thronfolger angestrebten inneren Ausgleich lautete «Trialismus»: Die slawischen Völker sollten neben Deutschen und Ungarn zur dritten Säule des Reichs aufsteigen und damit gegenüber den Verlockungen des Panslawismus immunisiert werden – jener Ideologie, die von der russischen Führung gezielt gefördert wurde, um den Einfluss des Zarenreichs auf dem Balkan auszuweiten. Eine Stärkung der Slawen im Habsburgerreich wäre freilich auf einen Macht- und Einflussverlust der Ungarn innerhalb der bisherigen Doppelmonarchie hinausgelaufen, weswegen diese von solchen Zukunftsvisionen wenig angetan waren. Welche Abneigung Franz Ferdinand im östlichen Reichsteil entgegenschlug und mit welch unverhohlener Befriedigung man dort auf seinen Tod reagierte, hat Joseph Roth in seinem Roman Radetzkymarsch geschildert: Als Gerüchte über die Ermordung des Thronfolgers in der ostgalizischen Provinz eintreffen, wo Leutnant von Trotta stationiert ist, baut sich unter den ungarischen Offizieren des Regiments eine heiter-gelöste Stimmung auf; schließlich erklärt einer von ihnen, er sei froh, dass «das Schwein hin ist».[10] Nach der Ermordung Franz Ferdinands in Sarajewo sprach in Wien kaum noch jemand von einem Ausgleich mit den Slawen. Von nun an hatten die «Falken» das Sagen.
Wilhelm II. und der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand haben sich persönlich gut verstanden. Man durfte erwarten, dass das gute Verhältnis zwischen ihnen dem Bündnis beider Mächte zugutekommen würde. Wilhelm war ein leidenschaftlicher Jäger und nutzte Hofjagden (hier die im niedersächsischen Springe am 23. November 1912) zur politischen Vertrauensbildung und zur Pflege dynastischer Beziehungen.
Zwar gab es nach dem Mordanschlag zunächst keinen Anlass zur Internationalisierung des Konflikts, denn der Attentäter Gavrilo Princip war als bosnischer Serbe ein österreichischer Untertan. Aber die Gruppe um Princip hatte die Waffen sowie den Sprengstoff vom serbischen Geheimdienst erhalten und war von serbischen Geheimdienstoffizieren auf serbischem Gebiet im Umgang mit Waffen ausgebildet worden.[11] Es gab somit gute Gründe, die Hintermänner des Attentats in Belgrad zu vermuten und auf einer Bestrafung Serbiens zu bestehen.[12] Hinter Serbien stand jedoch Russland – musste ein energisches Vorgehen gegen Belgrad nicht diese mächtige Schutzmacht auf den Plan rufen? Bislang hatte die österreichische Führung die Konfrontation mit den Russen gescheut. Die wollte die Regierung in Wien erst wagen, wenn sie sich der politisch-militärischen Rückendeckung durch das Deutsche Reich sicher sein konnte.
Lange Zeit hatte man in Berlin kein Interesse an einer eigenständigen und aktiven Balkanpolitik gezeigt; es galt Bismarcks berühmtes Wort aus der Reichstagsrede vom 5. Dezember 1876, wonach Balkanfrage und Orientkrise, solange keine vitalen deutschen Interessen betroffen seien, nicht «die gesunden Knochen eines einzigen pommerschen Musketiers wert» seien.[13] Was also hat die deutsche Führung dazu veranlasst, Österreich-Ungarn am 6. Juli 1914 den sogenannten Blankoscheck für ein hartes Vorgehen gegen Serbien auszustellen und öffentlich zu erklären, in dem Konflikt mit Serbien «im Einklang mit seinen Bündnisverpflichtungen und seiner alten Freundschaft treu an der Seite Österreich-Ungarns [zu] stehen»? Das ist die Schlüsselfrage bei der Untersuchung des kurzen Weges in den Krieg. Und auch hier zerfällt die Antwort in mindestens zwei Varianten, die von einem stärker defensiven oder einem eher offensiven Agieren des Deutschen Reichs ausgehen. Der defensiven Sichtweise zufolge stellte sich die deutsche Regierung hinter Österreich-Ungarn, weil die Wiener Doppelmonarchie der einzige zuverlässige Verbündete des Deutschen Reichs war. Italien galt seit dem Libyenkrieg von 1911 als ein ausgesprochen unsicherer Partner, und auch auf die Bündnistreue Rumäniens, des geheimen Vierten im Dreibund, meinten die Verantwortlichen in Berlin und Wien sich nicht verlassen zu können.[14] Dementsprechend bezogen sie die Regierungen beider Länder in den Wochen nach dem Attentat weder in die politischen Konsultationen ein noch informierten sie diese über ihr weiteres Vorgehen. Die Führung in Rom hat dies zum Anlass genommen, die Kriegspolitik Russlands gegenüber Deutschland und Österreich-Ungarn nicht als Bündnisfall zu betrachten, wozu sie eigentlich verpflichtet gewesen wäre. Damit hatte man in Berlin und Wien freilich gerechnet. Dass sich Italien trotz seiner Gebietsansprüche gegenüber der Doppelmonarchie am Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt dem Zweibund der beiden Kaiserreiche angeschlossen und diesen somit zum Dreibund gemacht hatte,[15] lag an Gebietsstreitigkeiten mit Frankreich, die es zunächst höher bewertete: Seitdem sich die Franzosen in Nordafrika festgesetzt und 1881 Tunis annektiert hatten, fürchtete man in Italien, vom Nachbarland eingekreist zu werden, und suchte deshalb die Anlehnung an Deutschland. In Berlin und Wien war man jedoch bloß an einem Gegengewicht zu Frankreich interessiert und wollte die italienischen Ansprüche auf die nordafrikanische Küste nicht unterstützen. Der Dreibund, so hieß es, sei keine «Erwerbsgesellschaft».[16] In dem am 20. Mai 1882 geschlossenen geheimen Defensiv- und Neutralitätsabkommen versprachen sich Wien, Rom und Berlin wechselseitige Hilfe gegen einen Angriff französischer Streitkräfte. Dass hingegen im Falle eines Krieges mit Russland kaum mit Italien zu rechnen war, galt in Berlin als sicher. Unter diesen Umständen war das Deutsche Reich auf die Donaumonarchie angewiesen, zumal verschiedentlich unternommene Anläufe zu einem politischen Ausgleich mit Russen oder Briten nicht weit gekommen waren.
Die Deutung der deutschen Politik als offensiv beruht hingegen auf der Annahme, das Reich habe auf dem Balkan eine eigene geostrategische Agenda verfolgt und sich nur aus taktischen Erwägungen für die österreichischen Interessen eingesetzt. Tatsächlich teilte man in Berlin die in Wien kursierenden Befürchtungen über den drohenden Niedergang und möglicherweise gar Zerfall des Habsburgerreichs. In den Jahren zuvor hatte die deutsche Führung in den Konflikten zwischen Österreich-Ungarn und Serbien noch eine zurückhaltende Position bezogen, inzwischen jedoch war man sich über die Bedrohlichkeit der Lage auf dem Balkan im Klaren. Und gerade diese bedrohliche Lage ließ es geraten erscheinen, Wien nun einen «Blankoscheck» auszustellen: Die Regierung hoffte nicht nur, der Zar werde, wie Kaiser Wilhelm am 6. Juli äußerte, «keine Königsmörder decken»,[17] sondern vor allem, dass in St. Petersburg die Partei der Verständigung angesichts des hohen Einsatzes gegenüber der Kriegspartei die Oberhand behielt. Berlin spielte auf Risiko, um die Gefahr eines eskalierenden Krieges zu bannen, und eröffnete Wien die Möglichkeit eines begrenzten Militärschlags gegen Serbien, um einen Krieg gegen Russland mit allen zu erwartenden Weiterungen zu verhindern.[18]
Dieser Deutung nach mag die deutsche Politik im Sommer 1914 waghalsig gewesen sein, verantwortungslos aber war sie keineswegs, zumal eine nur begrenzte Unterstützung Wiens ebenfalls viele Risiken barg. Es waren dies freilich andere Risiken – und zwar in erster Linie die erwähnte Möglichkeit, auch noch den letzten Bündnispartner durch dessen inneren Zusammenbruch zu verlieren, ohne gleichzeitig zu einem nachhaltigen Ausgleich mit Russland zu kommen, durch den das französisch-russische Bündnis, der Kern der deutschen Einkreisungsängste, aufgelöst wurde. Außerdem musste man infolge des serbischen Strebens nach der Position einer europäischen Mittelmacht ohnehin mit weiteren Krisen auf dem Balkan rechnen. Diese konnten jederzeit zu dem Krieg führen, den man jetzt durch politische Zurückhaltung vermieden hätte. Nicht bloß militärisch (wegen der angelaufenen russischen Heeresvergrößerung), sondern auch politisch hätte Deutschland dann viel schlechter dagestanden. Hier spielte das Argument des Königsmords als angenommene Risikobegrenzung hinein: Wenn nämlich der Zar die russische Macht einsetzte, um Königsmörder zu decken, dann konnte er seiner eigenen Herrschaft nicht mehr sicher sein.[19] Es gab somit gute Gründe für die Annahme, Russland werde sich zurückhalten, und diese Gelegenheit sollte ausgenutzt werden, um Belgrad eine Lektion zu erteilen. Insofern nahm sich die Hochrisikopolitik des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg durchaus als verantwortbar aus – zumindest so lange, wie man davon ausgehen konnte, dass die anderen Akteure den Rationalitäten folgten, die in Berlin als für sie maßgeblich unterstellt wurden.
In dieser Situation hing jedoch alles davon ab, dass Wien den Augenblick nutzte und schnell handelte. Die öffentliche Empörung über das Attentat, insbesondere die in den westlichen Ländern, musste noch wirksam sein, um zu vermeiden, dass die Russen sich aus einer Mischung von Machtinteresse und panslawischer Ideologie uneingeschränkt auf die serbische Seite stellen konnten.[20] Doch während die Regierung in Berlin unausgesetzt zum Handeln drängte, agierten ihre österreichisch-ungarischen Verbündeten eher hinhaltend und zögerlich.[21] Erst am 23. Juli forderte die Führung in Wien die Regierung in Belgrad ultimativ dazu auf, binnen achtundvierzig Stunden österreichische Beamte an den Nachforschungen nach den Hintermännern des Attentats zu beteiligen und einreisen zu lassen; außerdem habe sie jede gegen Österreich-Ungarn gerichtete Propaganda in ihrem Land zu unterbinden und Beamte, die an Aktionen beteiligt waren, die sich gegen Wien richteten, aus dem Staatsdienst zu entfernen und zu bestrafen. Die Organisation Narodna Odbrana («Volksschutz») sei aufzulösen, und aus dem Unterricht an serbischen Schulen seien alle gegen Österreich-Ungarn gerichteten Materialien zu entfernen.[22] Diese Zögerlichkeit hatte vor allem zwei Gründe: einen, der in der politischen Verfassung der Doppelmonarchie lag, und einen, der aus deren Militärwesen erwuchs. Österreich-Ungarn hatte unterhalb der Person des Kaisers zwei Machtzentren, und während sich in Wien die Falken durchgesetzt und inzwischen auch den Kaiser für einen Militärschlag gegen Serbien gewonnen hatten, war der ungarische Ministerpräsident Iştván Tisza hinsichtlich dessen Erfolgsaussichten skeptisch und zögerte eine schnelle Entscheidung hinaus.[23] Es lag aber keineswegs nur an Tisza, dass die Militäroperationen gegen Belgrad nicht bereits wenige Tage nach dem Attentat anliefen. Vielmehr zeigte sich das k.u.k. Militär von der Situation überfordert. So ging Generalstabschef Conrad davon aus, dass die Truppen erst ab dem 12. August, also anderthalb Monate nach dem Attentat, einsatzfähig seien. Zwar beschossen österreichische Kanonenboote die serbische Hauptstadt bereits vom 28. Juli an, aber das war eine eher symbolische Aktion. Und obwohl es sich bei den Streitkräften der Doppelmonarchie offiziell um eine Berufsarmee handelte, die innerhalb weniger Tage einsatzfähig sein sollte, befanden sich die meisten ihrer Einheiten im Sommer 1914 im Ernteeinsatz; sie zurückzurufen, kostete Zeit. Deshalb verstrichen die ersten Juliwochen, ohne dass etwas Nennenswertes passiert wäre. Als dann das Ultimatum der Regierung in Wien an Belgrad auslief, war der Zusammenhang mit dem Attentat nicht mehr zwingend und der geeignete Zeitpunkt, gegenüber Serbien Stärke zu beweisen, somit verstrichen. Österreich-Ungarn war dem Tempo der modernen Welt nicht gewachsen.
Franz Joseph, Kaiser von Österreich und König von Ungarn, am 23. Juli 1914, dem Tag des Ultimatums an die serbische Regierung. Der Monarch konnte bei Kriegsbeginn auf eine Regierungszeit von mehr als fünfundsechzig Jahren zurückblicken und war somit das Symbol für die Kontinuität des Habsburgerreichs. Die Kriege, die er in den Jahrzehnten seiner Regentschaft geführt hatte, waren für ihn jedoch wenig glücklich ausgegangen. Der im Sommer 1914 noch recht rüstige Monarch alterte während des Krieges schnell; er starb am 21. November 1916.
Krisenregion Balkan
Warum war es für Wien aber überhaupt so wichtig, Serbien eine «Lektion» zu erteilen? Warum glaubte man, es nicht bei einer Bestrafung der in das Attentat verwickelten Personen belassen zu können? Immerhin hatte die serbische Regierung in ihrer Antwort auf das österreichische Ultimatum eine solche Bestrafung ausdrücklich zugesagt. Und warum bestand man darauf, dass österreichische Beamte an den Untersuchungen auf serbischem Staatsgebiet beteiligt wurden? Vor allem dieses Ansinnen hat Belgrad nach zeitweiligem Schwanken abgelehnt und auf seinem Recht als souveräner Staat bestanden.[1] In der Forschung wird fast durchgängig geltend gemacht, Wien habe damit bewusst eine für Serbien unerfüllbare Forderung gestellt, um so einen Vorwand für den Krieg zu erhalten.[2] Tatsächlich hatte die Regierung ihren Botschafter in Belgrad instruiert, umgehend abzureisen, wenn sich die österreichischen Beamten nicht an der Untersuchung beteiligen durften. Die Abreise kam einer Vorankündigung der Kriegserklärung gleich. Dass die serbische Regierung zeitweilig erwogen hat, der Forderung nachzukommen, zeigt allerdings, dass sie keineswegs unerfüllbar war. Im Gegenteil: Ein solches Zugeständnis würde heute als Geste des guten Willens gewertet.
Indem Belgrad in dieser Frage auf seiner Souveränität beharrte, machte es Ansprüche geltend, die man in Wien nicht akzeptieren konnte, ohne die Rolle als Ordnungsmacht des westlichen Balkans aufzugeben. Der Balkan war, soweit er nicht ohnehin zum Staatsgebiet Österreich-Ungarns gehörte, im 19. Jahrhundert gewissermaßen zum imperialen Hinterhof der Donaumonarchie geworden, in dem sie gewisse Sonderrechte beanspruchte. Derartige Konstellationen lassen sich auch in späteren Jahrzehnten und anderen Regionen beobachten; ganz selbstverständlich hätten etwa die beiden Supermächte des Kalten Krieges, die USA und die UdSSR, in einer vergleichbaren Situation darauf bestanden, an den Untersuchungen in einem Land beteiligt zu werden, das der Komplizenschaft mit terroristischen Akteuren verdächtigt wird. Wäre ihnen das nicht zugestanden worden, hätten sie ebenfalls militärisch interveniert. Imperiale Mächte akzeptieren in solchen Fällen die Souveränitätsansprüche kleinerer Staaten nicht, weil andernfalls ihre Vormachtstellung in Frage gestellt würde.[3] In diesem konkreten Fall kam noch hinzu, dass sich das Attentat in eine lange Reihe politischer Störfälle einreihte: Die serbische Führung war in den zurückliegenden Monaten und Jahren immer wieder als politischer Unruhefaktor auf dem Balkan hervorgetreten und hatte die Regierung in Wien ein ums andere Mal provoziert. Die Serben stellten die Pax Austriaca auf dem Balkan ganz offen in Frage, und die Donaumonarchie musste um ihren Großmachtstatus fürchten, wenn sie diesen Herausforderer nicht in die Schranken wies. Insofern könnte man sagen, es habe sich für das österreichische Kaiserhaus bei der Krise vom Juli 1914 tatsächlich «um eine Schicksalsstunde» gehandelt, wie der Vertreter Bayerns in Berlin die Lage zusammenfasste.[4]
Überblickt man die stattliche Anzahl der «vermiedenen Kriege» vor 1914, so stellt man fest, wie wichtig das Zusammenspiel der fünf europäischen Großmächte (Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und Österreich-Ungarn) für die Kriegsvermeidung und das Konfliktmanagement war.[5]