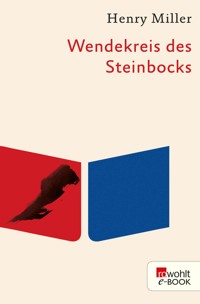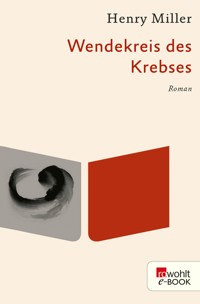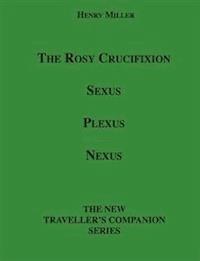9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reise nach Griechenland Henry Millers berühmtes Griechenland-Buch entstand 1940, nachdem er im Jahr zuvor fünf Reisemonate in dem mythenträchtigen Land verbracht hatte. Ein faszinierender Erfahrungsbericht, in dem die archaische Landschaft, die Welt der klassischen Mythen von der wilden Phantasie Millers neu belebt und durchtränkt wird. Zugleich liest sich sein Buch als das Dokument eines Reinigungsprozesses, an dessen Ende Miller etwas von der Heimat und dem Frieden erfährt, den zu finden sein ruheloser Geist ausgezogen war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Henry Miller
Der Koloß von Maroussi
Eine Reise nach Griechenland
Über dieses Buch
Eine Reise nach Griechenland
Henry Millers berühmtes Griechenland-Buch entstand 1940, nachdem er im Jahr zuvor fünf Reisemonate in dem mythenträchtigen Land verbracht hatte. Ein faszinierender Erfahrungsbericht, in dem die archaische Landschaft, die Welt der klassischen Mythen von der wilden Phantasie Millers neu belebt und durchtränkt wird. Zugleich liest sich sein Buch als das Dokument eines Reinigungsprozesses, an dessen Ende Miller etwas von der Heimat und dem Frieden erfährt, den zu finden sein ruheloser Geist ausgezogen war.
Vita
Henry Miller, der am 26. Dezember 1891 in New York geborene deutschstämmige Außenseiter der modernen amerikanischen Literatur, wuchs in Brooklyn auf. Die Dreißiger Jahre verbrachte Miller im Kreis der «American Exiles» in Paris. Sein erstes größeres Werk, das vielumstrittene «Wendekreis des Krebses», wurde – dank des Wagemuts eines Pariser Verlegers – erstmals 1934 in englischer Sprache herausgegeben. In den USA zog die Veröffentlichung eine Reihe von Prozessen nach sich; erst viel später wurde das Buch in den literarischen Kanon aufgenommen. Henry Miller starb am 7. Juni 1980 in Pacific Palisades, Kalifornien.
Impressum
Die Originalausgabe erschien im Verlag New Directions, New York, unter dem Titel «The Colossus of Maroussi»
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2020
Copyright © 1965 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
All rights reserved in all countries: Henry Miller, Big Sur, Cal., USA
Covergestaltung Umschlag-Konzept: any.way, Hamburg Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Coverabbildung Gettyimages/Thoth_Adan
ISBN 978-3-644-00624-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
I
HÄTTE ICH NICHT BETTY RYAN, ein junges Mädchen, das in Paris im selben Haus wie ich wohnte, kennengelernt, wäre ich nie nach Griechenland gegangen. Eines Abends erzählte sie mir bei einem Glas Weißwein von ihrem Vagabundieren durch die Welt. Ich hörte ihr stets aufmerksam zu, da ihre Erlebnisse ungewöhnlich waren und sie ihre Reisen bildhaft zu schildern wußte – alles, was sie erzählte, blieb in meinem Hirn haften wie die Meisterwerke eines Malers. An jenem Abend war die Unterhaltung besonders merkwürdig: wir fingen bei China und der chinesischen Sprache, die sie gerade zu studieren begonnen hatte, an und befanden uns bald in der Wüste Sahara unter Stämmen, von denen ich noch nie gehört hatte. Und dann war sie plötzlich ganz allein, wanderte an einem Flußufer, das Licht war grell, und ich folgte ihr, so gut ich konnte, in der prallen Sonne; doch bald verschwand sie, und ich war in einem fremden Land und lauschte einer Sprache, die ich noch nie gehört hatte. Betty ist keine methodische Erzählerin, sie ist eine Künstlerin; noch nie hat mir jemand die Atmosphäre eines Landes so deutlich vermittelt wie sie die Griechenlands. Später erst stellte ich fest, daß sie sich in der Nähe von Olympia verirrt hatte und ich mit ihr, doch damals war diese Gegend für mich ganz einfach Griechenland, eine Welt des Lichtes, wie ich sie erträumt und nie zu sehen erhofft hatte.
Lange vor dieser Unterhaltung hatte mir mein Freund Lawrence Durrell, der Korfu gewissermaßen zu seiner Heimat gemacht hatte, mehrere Briefe geschrieben, die erstaunlich waren und mir phantastisch vorkamen. Durrell ist ein Dichter, und seine Briefe waren dichterisch; sie richteten in mir eine gewisse Verwirrung an, da in ihnen Traum und Wirklichkeit – die historische und die mythologische – kunstvoll ineinander übergingen. Später erst stellte ich fest, daß diese Verwirrung Wirklichkeit ist und sich nicht nur auf dichterische Fähigkeiten zurückführen läßt. Doch zu jener Zeit glaubte ich, daß er übertrieb, daß er mich verlocken wollte, seine mehrfachen Einladungen zu einem längeren Besuch anzunehmen.
Einige Monate vor Kriegsausbruch beschloß ich, ausgiebig Ferien zu machen. Ich hatte mir schon immer gewünscht, das Dordogne-Tal kennenzulernen. So packte ich meinen Koffer und nahm den Zug nach Rocamadour, wo ich eines Morgens in aller Frühe bei Sonnenaufgang ankam; der Mond strahlte noch am Himmel. Es war ein genialer Einfall von mir, in diese Gegend zu fahren, ehe ich mich in die glitzernde weiße Welt Griechenlands stürzte. Selbst ein flüchtiger Ausblick auf den schwarzen, geheimnisvollen Fluß bei Dômme von der wunderschönen steilen Anhöhe am Stadtrand aus ist etwas, für das man das ganze Leben lang dankbar sein muß. Für mich gehört dieser Fluß, dieses Land dem Dichter Rainer Maria Rilke. Es ist nicht französisch, nicht österreichisch, nicht einmal europäisch, es ist das verzauberte Land, das von Dichtern entdeckt wurde und auf das nur sie Anspruch erheben dürfen. Diesseits von Griechenland kommt nichts dem Paradies so nahe. Nennen wir es großzügig das Paradies der Franzosen. Es muß schon vor Tausenden von Jahren ein Paradies gewesen sein, wohl schon zu Zeiten des Cro-Magnon-Menschen, trotz der großen Höhlen, in denen Versteinerungen auf ein eher wildes und erschreckendes Leben deuten. Ich glaube, daß der Cro-Magnon-Mensch sich hier niederließ, weil er äußerst intelligent war und einen hochentwickelten Schönheitssinn besaß. Ich glaube, daß auch sein religiöses Gefühl bereits sehr entwickelt war und daß es hier gedieh, obwohl er wie ein Tier in den tiefen Höhlen hauste. Ich glaube, daß dieses friedliche weite Gebiet Frankreichs stets ein heiliger Fleck Erde für den Menschen bleiben wird, und wenn die Städte die Dichter umgebracht haben, wird dies der Zufluchtsort und die Wiege künftiger Dichter sein. Ich wiederhole, daß dieser Besuch in der Dordogne außerordentlich wichtig für mich war; dieses Land verleiht mir Hoffnung für die Zukunft der Menschheit, für die Zukunft der ganzen Welt. Es mag der Tag kommen, an dem Frankreich untergeht, aber die Dordogne wird weiterleben wie alle Träume, die die Seelen der Menschen nähren.
In Marseille nahm ich das Schiff zum Piräus. An Bord waren viele Levantiner, die ich zwischen den Amerikanern, Engländern und Franzosen sofort erkannte. Ich hatte den dringenden Wunsch, mit Arabern, Türken, Syriern und ihresgleichen zu sprechen, ich wollte wissen, wie sie die Welt sahen, und da die Reise vier, fünf Tage dauerte, hatte ich genügend Zeit, die Menschen kennenzulernen, die mich interessierten. Durch Zufall war meine erste Bekanntschaft ein griechischer Medizinstudent, der aus Paris kam. Wir sprachen französisch miteinander. Am ersten Abend unterhielten wir uns bis drei, vier Uhr morgens, hauptsächlich über Knut Hamsun, der, wie ich feststellte, von den Griechen leidenschaftlich verehrt wird. Zunächst fand ich es merkwürdig, über dieses Genie des Nordens zu sprechen, während wir in südliche Gewässer fuhren. Doch diese Unterhaltung lehrte mich sofort, daß die Griechen ein begeisterungsfähiges, leidenschaftliches, wißbegieriges Volk sind. Leidenschaft – das war etwas, das ich seit langem in Frankreich vermißt hatte. Aber nicht nur Leidenschaft, auch Widersprüche, Verwirrung, Chaos – all diese gediegenen menschlichen Eigenschaften entdeckte ich wieder und schätzte sie an meinem neuen Freund. Und Großzügigkeit. Ich hatte fast geglaubt, sie sei von dieser Erde verschwunden. Doch da waren wir, ein Grieche und ein Amerikaner, und hatten etwas gemeinsam, obwohl wir zwei völlig verschiedenartige Menschen waren. Es war eine wunderbare Einführung in jene Welt, die sich mir eröffnen sollte. Ich war bereits in Griechenland und die Griechen verliebt, bevor ich auch nur einen Blick auf das Land geworfen hatte. Schon jetzt sah ich, daß sie liebenswürdige, gastfreie Menschen sind, mit denen man sich leicht vertragen kann.
Am nächsten Tag kam ich mit den anderen ins Gespräch: einem Türken, einem Syrier, ein paar Studenten vom Libanon und einem Argentinier italienischer Abstammung. Der Türke war mir sofort unsympathisch; er hatte eine Vorliebe für Logik, die mich wütend machte, und dazu war es noch eine falsche Logik. Ich geriet mit ihm aneinander, denn er hatte die amerikanische Mentalität in ihrer schlimmsten Form angenommen. Alle diese Leute waren besessen von Fortschritt – mehr Maschinen, mehr Leistungen, mehr Kapital, mehr Komfort – das ist ihr einziges Gesprächsthema. Ich fragte sie, ob sie noch nie von den Millionen Arbeitslosen in Amerika gehört hätten. Sie überhörten die Frage. Ich fragte sie, ob ihnen nicht klar sei, wie leer, wie rastlos, wie elend die Amerikaner mit all ihrem mechanisierten Luxus und Komfort seien. Sie waren unempfänglich für meinen Sarkasmus, sie hatten nur den einen Wunsch: Erfolg, Geld, Macht, einen Platz an der Sonne. Keiner von ihnen wollte in sein Heimatland zurückkehren, doch aus irgendwelchen Gründen mußten sie es gegen ihren Willen tun. Sie sagten, für sie sei das Leben in ihrem Land nicht mehr erträglich. Was für ein Leben sie denn haben möchten, wollte ich wissen. Sie möchten all die Dinge besitzen, die es in Amerika oder Deutschland oder Frankreich gibt. Für sie bestand das Leben hauptsächlich aus Maschinen, entnahm ich ihren Reden. Leben ohne Geld? Unmöglich! Man braucht Kleider, ein schönes Heim, ein Radio, ein Auto, einen Tennisschläger und so weiter. Ich erwiderte, daß ich nichts von all diesen Dingen besäße und mich dennoch für glücklich hielte, daß ich Amerika den Rücken gekehrt hätte, gerade weil mir diese Dinge nichts bedeuteten. Sie sagten, ich sei der seltsamste Amerikaner, der ihnen je über den Weg gelaufen wäre. Aber ich gefiel ihnen; sie hängten sich während der ganzen Reise an mich, plagten mich mit allen möglichen Fragen, deren Beantwortung ihnen nichts nutzte. Die Abende verbrachte ich mit dem griechischen Studenten. Wir verstanden einander besser, viel besser, trotz seiner Bewunderung für Deutschland und das Hitler-Regime. Auch er wollte natürlich eines Tages nach Amerika auswandern. Jeder Grieche träumt davon, dorthin zu gehen, um das Huhn zu entdecken, das goldene Eier legt. Ich versuchte nicht, es ihm auszureden, ich vermittelte ihm ein Bild von Amerika, wie ich es kannte, wie ich es gesehen und erlebt hatte. Das schien ihn etwas zu erschrecken, er bekannte, das habe er noch nie über Amerika gehört. «Gehen Sie hin», riet ich ihm, «überzeugen Sie sich selbst, ich mag mich irren, ich erzähle Ihnen nur das, was ich aus eigener Erfahrung weiß ... Und», fügte ich hinzu, «Knut Hamsun hatte dort gar keine schöne Zeit, auch nicht Ihr geliebter Edgar Allan Poe ... »
Bei Tisch saß mir ein französischer Archäologe, der nach Griechenland zurückging, gegenüber. Er hätte mir viel über Griechenland sagen können, doch ich gab ihm keine Gelegenheit dazu, da er mir auf den ersten Blick mißfiel. Von allen Mitreisenden gefiel mir der Italiener aus Argentinien am besten. Ich hatte noch nie einen so unwissenden – und gleichzeitig charmanten – Menschen kennengelernt wie ihn. In Neapel gingen wir zusammen an Land, um gut zu essen und Pompeji zu besichtigen, von dessen Existenz er noch nie gehört hatte. Trotz der unerträglichen Hitze genoß ich diesen Ausflug sehr; wäre ich mit einem Archäologen zusammen gewesen, hätte ich mich zu Tod gelangweilt. Im Piräus ging ich wieder mit ihm an Land, um die Akropolis anzuschauen. Es war noch heißer als in Pompeji, was höchst unangenehm war. Schon um neun Uhr morgens waren es fünfzig Grad in der Sonne. Kaum hatten wir die Hafensperre hinter uns, als wir einem gerissenen griechischen Fremdenführer in die Hände fielen, der etwas Englisch und Französisch konnte und versprach, uns gegen ein geringes Entgelt alles Interessante zu zeigen. Wir versuchten ausfindig zu machen, wieviel er für seine Dienste beanspruchte, es gelang uns nicht, und es war zu heiß, um über Preise zu diskutieren. Wir nahmen ein Taxi und verlangten, auf dem kürzesten Weg zur Akropolis gefahren zu werden. Auf dem Schiff hatte ich meine Franken in Drachmen umgewechselt und hatte ein dickes Bündel Banknoten in der Tasche, so daß ich glaubte, auch die ungeheuerlichste Rechnung bezahlen zu können. Ich wußte, daß man uns beschwindeln würde, und ich freute mich darauf. Das einzige, was sich mir fest eingeprägt hatte, war, daß man den Griechen nicht trauen kann. Welche Enttäuschung, wenn sich unser Führer als großmütig und ritterlich erwiesen hätte! Mein Gefährte hingegen, der nach Beirut weiterfahren wollte, war beunruhigt, ich hörte ihn förmlich im Geiste rechnen, während wir in erstickender Hitze und dichtem Staub dahinfuhren.
Die Fahrt von Piräus nach Athen ist eine gute Einführung für Griechenland. Sie hat nichts Einladendes an sich, man fragt sich, wieso man den Wunsch gehegt hatte, dieses Land zu besuchen. Die Gegend ist nicht nur kahl und trostlos, sie hat auch etwas Erschrekkendes an sich; man kommt sich ausgeplündert, nackt, fast ausgelöscht vor. Der Chauffeur war wie ein Tier, das durch ein Wunder gelernt hat, eine wahnwitzige Maschine zu bedienen. Unser Führer gab ihm ständig Anweisungen, nach rechts oder links abzubiegen, als hätten sie diese Fahrt noch nie gemacht. Ich empfand große Sympathie für den Chauffeur, der, wie ich wußte, ebenfalls beschwindelt werden würde, und der mir den Eindruck machte, als könne er nicht bis hundert zählen; auch hatte ich das Gefühl, er würde in einen Abgrund fahren, wenn man es befähle. Als wir zur Akropolis kamen – es war irrsinnig, sofort dorthin zu gehen –, waren mehrere hundert Menschen vor uns, die das Tor stürmten. Die Hitze war inzwischen so grauenhaft geworden, daß ich nur den einen Wunsch hatte, mich in den Schatten zu setzen. Ich fand einen verhältnismäßig kühlen Platz und wartete dort, während der Argentinier etwas für sein Geld erhielt. Unser Führer war mit dem Chauffeur am Tor zurückgeblieben, nachdem er uns einem der amtlichen Führer übergeben hatte; er wollte uns, sobald wir die Akropolis «gemacht» hätten, den Jupiter-Tempel und das Theseion und andere Stätten zeigen. Natürlich schauten wir uns diese Sehenswürdigkeiten nicht an, sondern ließen uns sofort in die Stadt an einen kühlen Ort zurückfahren, um uns Eis zu bestellen. Gegen halb elf setzten wir uns auf die Terrasse eines Cafés. Jedermann schien von der Hitze erledigt zu sein, selbst die Griechen. Wir verzehrten unser Eis, tranken Eiswasser, aßen wieder Eis und tranken wieder Eiswasser. Danach bestellte ich heißen Tee, weil mir plötzlich einfiel, daß mir jemand gesagt hatte, heißer Tee lösche am besten den Durst.
Das Taxi wartete mit laufendem Motor am Trottoirrand. Unser Führer schien der einzige Mensch zu sein, der nicht unter der Hitze litt. Er dachte wohl, wir würden uns ein bißchen abkühlen und dann von neuem in der Sonnenglut Ruinen und Monumente besichtigen. Wir hingegen sagten ihm, daß wir seine Dienste nicht mehr benötigten. Er h be es nicht eilig, erwiderte er, er habe nichts Besonderes zu tun und sei glücklich, uns Gesellschaft zu leisten, woraufhin wir ihm erklärten, wir hätten für heute genug und möchten mit ihm abrechnen. Er rief den Kellner und zahlte die Rechnung aus seiner Tasche. Dann drängten wir ihn, uns zu sagen, was wir ihm schuldeten, aber es war nichts aus ihm herauszukriegen. Er wollte von uns wissen, was uns seine Dienste wert seien. Wir erwiderten, wie wüßten es nicht, wir überließen es ihm. Daraufhin musterte er uns lange von Kopf bis Fuß, kratzte sich, schob den Hut in den Nacken, wischte sich die Stirn ab und so weiter und verkündete schließlich mit sanfter Stimme, er halte zweitausendfünfhundert Drachmen für angemessen. Durch einen Blick forderte ich meinen Gefährten auf, das Feuer zu eröffnen. Selbstverständlich war der Mann auf unsere Reaktion vorbereitet. Ich muß gestehen, daß mir die Griechen besonders gefallen, wenn sie gerissen und schlau sind. Wie aus der Pistole geschossen erklärte er: «Gut, wenn Sie meinen Preis nicht angemessen finden, machen Sie ein Angebot.» Das taten wir. Unser Angebot war ebenso lächerlich niedrig wie das seine unverschämt hoch war. Dieses rauhe Feilschen schien ihm zu gefallen. Es gefiel uns allen. Seine Dienste wurden zu etwas Greifbarem, zu einer Handelsware. Wir wogen sie und schätzten sie ab wie eine reife Tomate oder einen Maiskolben. Und schließlich einigten wir uns, nicht auf einen angemessenen Preis, denn das wäre für die Fähigkeiten unseres Führers eine Beleidigung gewesen, wir einigten uns darauf, daß wir wegen dieser einzigartigen Gelegenheit, wegen der Hitze, weil wir nicht alles gesehen hatten und so weiter, einen gewissen Preis zahlen und gute Freunde bleiben würden. Eine der Kleinigkeiten, über die wir uns lange stritten, war der Betrag, den er dem amtlichen Führer auf der Akropolis gezahlt hatte. Er schwor, er habe dem Mann hundertfünfzig Drachmen gegeben. Ich hatte jedoch die Transaktion mit eigenen Augen beobachtet und wußte, daß es nur fünfzig Drachmen gewesen waren. Er schwor, ich hätte falsch gesehen. Wir schafften diese Differenz aus der Welt, indem wir vortäuschten, zu glauben, er habe dem Mann versehentlich hundert Drachmen mehr gezahlt – eine Spitzfindigkeit, die so völlig ungriechisch war, daß er vor einem griechischen Gericht recht bekommen hätte, wenn er unser ganzes Vermögen hätte rauben wollen.
Eine Stunde später verabschiedete ich mich von meinem Gefährten, nahm in einem kleinen Hotel ein Zimmer zum Doppelten des üblichen Preises, zog mich aus, legte mich nackt aufs Bett und schlief in einer Schweißlache bis neun Uhr abends. Dann ging ich in ein Restaurant, versuchte zu essen, verzichtete aber nach ein paar Bissen darauf. Noch nie in meinem Leben war mir so heiß gewesen; in der Nähe einer elektrischen Lampe zu sitzen war eine Qual. Nachdem ich einige eisgekühlte Getränke getrunken hatte, verließ ich die Terrasse und ging in den Park. Obwohl es schon etwa elf Uhr war, strömten noch Menschen aus allen Richtungen heran, es erinnerte mich an unerträglich heiße New Yorker Augustnächte. Wieder inmitten einer Herde sein! In Paris hatte ich nie dieses Gefühl gehabt, außer während der fehlgegangenen Revolution. Ich schlenderte durch den Park zum Jupiter-Tempel. Längs den staubigen Wegen standen kleine Tische; Pärchen saßen ruhig in der Dunkelheit und plauderten leise vor einem Glas Wasser. Das Glas Wasser ... überall sah ich das Glas Wasser. Es wurde zu einer Besessenheit, Wasser wurde für mich etwas Neues, ein wesentliches Lebenselement, Erde, Luft, Feuer, Wasser. Augenblicklich war das Wasser das Hauptelement. Der Anblick der Liebespärchen, die in der Dunkelheit saßen und Wasser tranken, die friedlich und ruhig dasaßen und leise miteinander sprachen, vermittelte mir ein treffendes Bild des griechischen Charakters. Der Staub, die Hitze, die Armut, die Kahlheit, die Genügsamkeit dieser Menschen und allenthalben das Wasser, das in kleinen Gläsern zwischen den ruhigen, friedlichen Pärchen stand, flößten mir ein Gefühl ein, daß der Park etwas Heiliges an sich habe, etwas Nahrhaftes, Erhaltendes. Wie verzaubert wanderte ich an diesem ersten Abend im Zappeion umher; kein anderer Park bleibt mir so unvergeßlich. Er ist die Quintessenz aller Parks, das, was man zuweilen empfindet, wenn man ein Gemälde betrachtet oder von einem Ort träumt, an dem man sein möchte und den man nie findet. Er ist auch am Morgen lieblich, wie ich später herausfand. Doch am Abend, wenn man aus dem Nichts kommt, wenn man den hartgewordenen Staub unter den Füßen spürt und ein Sprachengewirr hört, das einem fremd ist, hat er etwas Zauberhaftes an sich; für mich war er wohl besonders zauberhaft, weil er von den ärmsten Menschen der Welt bevölkert war und den liebenswertesten. Ich bin froh, daß ich während dieser unglaublichen Hitzewelle nach Athen kam, froh, daß ich diese Stadt unter den schlimmsten Umständen kennenlernte. Ich spürte die unverhüllte Kraft der Menschen, ihre Reinheit, ihren Adel, ihre Resignation. Ich sah ihre Kinder, ein Anblick, der mir zu Herzen ging, denn in Frankreich dachte ich, es gebe auf der Wel. keine Kinder mehr, es würden keine mehr geboren. Ich sah in Lumpen gehüllte Menschen, und auch das war ein läuternder Anblick. Der Grieche versteht trotz seiner Lumpen zu leben, sie sind für ihn nichts Degradierendes und Beschmutzendes – wie in anderen Ländern.
Am nächsten Tag beschloß ich, das Schiff nach Korfu zu nehmen, wo mich mein Freund Durrell erwartete. Wir fuhren gegen fünf Uhrnachmittags vom Piräus ab, die Sonne brannte noch immer wie ein Hochofen. Ich hatte den Fehler gemacht, ein Billett zweiter Klasse zu nehmen; als ich aber unzählige Tiere an Bord kommen sah, Bettzeug und all den verrückten Krimskrams, den die Griechen auf Reisen mit sich schleppen, wechselte ich prompt in die erste über, die nur wenig teurer war als die zweite. Noch nie in meinem Leben war ich erster Klasse gereist, außer in der Métro in Paris – ich empfand es als puren Luxus. Der Kellner ging ständig mit einem Tablett voll Gläsern mit Wasser umher. Ich lernte nun das erste griechische Wort: nero – Wasser – und was für ein schönes Wort! Die Dunkelheit brach herein, und die Inseln wurden in der Ferne sichtbar, sie schwebten über dem Wasser, sie berührten es nicht. Die Sterne strahlten in prächtigem Glanz, der Wind wehte sanft und kühl. Ich spürte sofort, was Griechenland ist, was es gewesen war und was es immer sein wird, selbst wenn es das Unglück haben sollte, von amerikanischen Touristen überlaufen zu werden. Als mich der Steward fragte, was ich zu Abend essen möchte, und ich dann begriff, was ich zu essen bekommen würde, brach ich fast zusammen und weinte. Das Essen auf einem griechischen Schiff ist etwas Verblüffendes. Ich ziehe ein gutes griechisches Mahl einem entsprechenden französischen vor, obwohl das eine Ketzerei zu sein scheint. Es gab viel zu essen und viel zu trinken; die Luft war lau und der Himmel voll Sterne. Vor der Abreise von Paris hatte ich mir vorgenommen, ein Jahr lang keinen Strich zu tun; es waren meine ersten richtigen Ferien seit zwanzig Jahren, und ich wollte sie genießen. Alles schien mir vollkommen. Es gab keine Zeit mehr, es gab nur mich, der ich in einem langsamen Schiff dahintrieb, gewillt, jeden Menschen, der mir begegnete, kennenzulernen, alles, was sich mir bot, in mich aufzunehmen. Aus dem Meer tauchten, als hätte Homer persönlich es für mich angeordnet, in dem schwindenden Licht die Inseln auf, einsam, verlassen, geheimnisvoll. Mehr konnte ich nicht verlangen, und mehr wünschte ich mir nicht. Ich hatte alles, was sich ein Mensch ersehnen kann, und ich wußte es. Ich wußte auch, daß ich es vielleicht nie wieder haben würde. Ich fühlte, daß der Krieg nahte, mit jedem Tag näherrückte. Doch für eine kleine Weile würde es noch Frieden geben, und die Menschen sich noch wie Menschen verhalten.
Da der Kanal von Korinth durch einen Erdrutsch gesperrt war, umfuhren wir den Peloponnes. Am zweiten Abend liefen wir in Patras, gegenüber von Missolonghi, ein. Ich bin seither mehrere Male in diesem Hafen angekommen, immer zur gleichen Zeit, und jedesmal war ich von neuem begeistert. Man fährt unmittelbar ins Land hinein wie ein Pfeil, der in einen Berghang dringt. Die elektrischen Lampen längs dem Ufer erinnern an Japan; die Beleuchtung aller griechischen Häfen wirkt fast improvisiert, als stehe ein Fest bevor. Sobald das Schiff Anker wirft, kommen kleine Boote voll mit Passagieren und Gepäck und Vieh und Bettzeug und Mobilia heran. Die Männer rudern stehend, sie schieben die Riemen, statt s e durchzuziehen. Müdigkeit scheinen sie nicht zu kennen, sie lenken .1 re schweren Lasten nach Belieben mit geschickten und fast unmerkbaren Drehungen des Handgelenks. Sowie sie neben dem Schiff anlegen, entsteht ein Tohuwabohu. Alles strebt in die falsche Richtung, alles ist durcheinander, chaotisch, tumultuarisch. Doch nie geht jemand verloren oder verletzt sich, nie wird etwas gestohlen, nie gibt es Prügeleien. Es ist eine Art Gärung, die entsteht, da für den Griechen jedes Ereignis, mag es auch noch so banal sein, etwas Einzigartiges ist. Er tut das gleiche stets wie zum erstenmal; er ist neugierig, unersättlich neugierig, gierig auf Neues. Er sucht das Neue des Neuen wegen, nicht um eine bessere oder wirksamere Methode ausfindig zu machen. Er liebt es, mit seinen Händen zu arbeiten, mit seinem ganzen Körper, ja gleichsam mit seiner Seele. Darum ist Homer noch heute lebendig. Obwohl ich noch nie eine Zeile von Homer gelesen habe, glaube ich, daß der Grieche von heute im Grunde der gleiche geblieben ist, ja sogar noch bewußter griechisch ist. Und hier muß ich in Parenthese meinen Freund Mayo, den Maler, den ich in Paris kennenlernte, erwähnen. Sein richtiger Name ist Maliarakis, und ich glaube, er stammt aus Kreta. An ihn mußte ich denken, als wir in Patras einliefen. Mir fiel ein, daß ich ihn einmal in Paris gebeten hatte, mir von Griechenland zu erzählen, und jetzt, im Hafen von Patras, verstand ich plötzlich alles, was er mir an jenem Abend hatte sagen wollen, und ich bedauerte, daß er nicht bei mir war, um mein Entzücken zu teilen. Ich erinnerte mich, wie er, nachdem er mir, so gut er es vermochte, das Land beschrieben hatte, voll ruhiger, fester Überzeugung sagte: «Miller, Griechenland wird Ihnen gefallen, ich weiß es.» Diese Worte hatten einen tieferen Eindruck auf mich gemacht als alles andere, was er mir über Griechenland gesagt hatte. Es wird Ihnen gefallen ... Das haftete in meinem Gedächtnis. «Jawohl, es gefällt mir!» sagte ich wieder und wieder, während ich an der Reling stand und das Tohuwabohu betrachtete. Ich lehnte mich zurück und blickte zum Himmel empor. Noch nie hatte ich einen solchen Himmel gesehen er war herrlich. Ich fühlte mich völlig gelöst von Europa, ich hatte ein neues Reich als ein freier Mensch betreten – alles hatte sich vereinigt, um dieses Erlebnis einzigartig und fruchtbringend zu gestalten. Mein Gott, war ich glücklich! Und zum erstenmal in meinem Leben war ich glücklich im vollen Bewußtsein meines Glückes. Es tut wohl, einfach und schlicht glücklich zu sein; zu wissen, daß man glücklich ist, ist noch besser, aber sein Glück zu verstehen weil man weiß, warum und wie und durch welche Fügung von Ereignissen und Umständen, und dennoch glücklich zu sein, glücklich im Sein und Erkennen, das ist mehr als Glückseligkeit, das ist eine Gnade Gottes, und wenn man ein bißchen Verstand hätte, sollte man sich auf der Stelle umbringen und es dabei belassen. So erging es mir – nur hatte ich weder die Kraft noch den Mut, mich auf der Stelle umzubringen. Es war auch gut, daß ich es nicht tat, denn es sollten noch großartigere Augenblicke folgen, jenseits jeder Glückseligkeit, und wenn jemand versucht hätte, es mir zu beschreiben würde ich es höchstwahrscheinlich nicht geglaubt haben. Damals wußte ich noch nicht, daß ich eines Tages in Mykenä oder in Phaistos stehen würde oder daß ich eines Morgens aufwachen und durch die Kabinenluke mit eigenen Augen den Ort sehen würde, über den ich in einem Buch geschrieben hatte, ohne zu ahnen, daß er wirklich existiert, daß er wirklich den Namen trägt, den ich ihm in meiner Phantasie gegeben hatte. Wundersame Dinge geschehen einem in Griechenland – wundersame, gute Dinge, die sonst nirgends auf der Welt geschehen können. Irgendwie steht Griechenland unter dem besonderen Schutz des Schöpfers – man glaubt, Ihn wohlwollend nicken zu sehen. Die Menschen mögen ihre kümmerlichen, jämmerlichen Teufeleien begehen, auch in Griechenland – aber Gott läßt noch immer Seinen Zauber wirken, und ganz gleich, was die Menschenkinder tun oder versuchen zu tun, ist Griechenland noch immer geheiligter Boden und wird es, davon bin ich überzeugt, bis zum Ende der Zeiten bleiben.
Es war fast Mittag, als das Schiff in Korfu anlegte. Durrell erwartete mich mit Spiro Americanus, seinem Faktotum, am Quai. Die Fahrt nach Kalami, dem kleinen Dorf am Nordende der Insel, wo Durrell wohnte, dauerte ungefähr eine Stunde. Ehe wir zu Mittag aßen, gingen wir noch vor dem Haus schwimmen. Ich war seit fast zwanzig Jahren nicht mehr im Wasser gewesen. Durrell und seine Frau Nancy waren wie Delphine, sie lebten gewissermaßen im Wasser. Nach dem Essen machten wir ein Schläfchen, und dann ruderten wir zu einer etwa anderthalb Kilometer entfernten kleinen Bucht, wo sich eine kleine weiße Kapelle befand. Wiederum eine Taufe in dem kühlen Wasser. Am Abend wurde ich Kyrios Karamenaios, dem Ortsgendarmen, und Nicola, dem Dorfschullehrer, vorgestellt. Wir wurden sofort innige Freunde. Mit Nicola sprach ich in einem gebrochenen Französisch, mit Karamenaios in einer Art Gegacker, das hauptsächlich auf gutem Willen und dem Wunsch nach Verständigung beruhte.
Einmal in der Woche fuhren wir mit dem Ruderboot zur Stadt. Ich habe die Stadt Korfu nie gemocht; die Luft ist trügerisch und treibt einen zum Wahnsinn, wenn es Abend wird. Ständig setzt man sich hin und trinkt etwas, was man nicht trinken will, oder spaziert ziellos hin und her und kommt sich wie ein Gefangener vor. Meist benutzte ich diese Besuche, mich rasieren und mir die Haare schneiden zu lassen; ich tat es, um die Zeit totzuschlagen und weil es so lächerlich billig war. Wie man mir sagte, bediente mich der Friseur des Königs, und das Ganze kostete mich etwa dreieinhalb Cent, Trinkgeld inbegriffen. Korfu ist ein typischer Exilort. Der deutsche Kaiser hatte dort, bevor er die Krone verlor, seine Sommerresidenz gehabt, und eines Tages besuchte ich, aus Neugier, den Palast. Paläste finde ich immer traurig und düster, aber dieses Irrenhaus des Kaisers ist wohl das schlimmste an Kitsch, was ich je gesehen habe. Es würde ein ausgezeichnetes Museum für surrealistische Kunst abgeben. Allerdings liegt am Ende der Insel, gegenüber dem leerstehenden Palast, ein Fleckchen Erde namens Kanoni, von dem aus man einen Blick auf die verzauberte Toteninsel hat. Hier sitzt Spiro allabendlich und träumt von seinem Leben auf Rhode Island, als der Alkoholschmuggel in voller Blüte stand. Eigentlich sollte dieser Platz meinem Freund Hans Reichel, dem Aquarellisten, gehören. Ich weiß, daß hier alles mit Homer verbunden ist, aber für mich hat es mehr mit Stuttgart gemein als mit dem antiken Griechenland. Wenn der Mond scheint und kein Laut außer dem Atem der Erde ertönt, herrscht die Atmosphäre, die Reichel hervorbringt, wenn er wie versteinert träumt und sich zu Vögeln und Schnecken und Wasserspeiern hingezogen fühlt, zu verschleierten Monden und schwitzenden Steinen oder zu der klagenden Musik, die ständig in seinem Herzen tönt, sogar wenn er sich wie ein tollwütiges Känguruh aufbäumt, das alles um sich herum mit seinem Schwanz zerschmettert. Es würde mich sehr glücklich machen, wenn er das je lesen sollte und somit erführe, daß ich an ihn dachte, während ich die Toteninsel sah, wenn er erführe, daß ich nie sein Feind war, wie er glaubte. Vielleicht wurde Reichel, der nur Liebe für die Franzosen empfand, gerade an einem der Abende, da ich mit Spiro in Kanoni saß und auf diesen zauberhaften Fleck hinabblickte, aus seiner Höhle im Impasse Rouet herausgezerrt und in ein jämmerliches Konzentrationslager gesteckt.
Eines Tages tauchte Theodor auf – Dr. Theodor Stephanides. Er wußte alles über Pflanzen, Blumen, Bäume, Gesteine, Mineralien, niedere Tierarten, Mikroben, Krankheiten, Sterne, Planeten, Kometen und so weiter. Noch nie war mir ein Mensch mit einem so umfassenden Wissen begegnet. Und ein Heiliger ist er obendrein. Er hat auch mehrere griechische Gedichte ins Englische übertragen. Von ihm hörte ich zum erstenmal den Namen Seferis, das Pseudonym von Georg Seferiades. Dann, in einer Mischung von Liebe, Bewunderung und feinem Humor, erwähnte er den Namen Katsimbalis, der merkwürdigerweise sofort auf mich Eindruck machte. An diesem Abend gab uns Theodor eine tolle Beschreibung seines Lebens im Schützengraben mit Katsimbalis an der Balkanfront während des Ersten Weltkrieges. Am nächsten Tag schrieben Durrell und ich einen begeisterten Brief an Katsimbalis, der in Athen war, und verliehen der Hoffnung Ausdruck, daß wir uns dort bald kennenlernen würden. Katsimbalis ... uns wurde der Name so vertraut, als hätten wir ihn von jeher gekannt. Bald danach verließ uns Theodor, und dann tauchte die Gräfin X. mit Niki und einer Familie junger Akrobaten auf. Sie kamen überraschend zu uns in einem kleinen Boot, das mit wunderbaren Lebensmitteln und seltenen Weinen vom Gut der Gräfin beladen war. Mit dieser bunten Schar von Linguisten, Jongleuren, Akrobaten und Wassernymphen gab es von Anfang an ein heilloses Durcheinander. Niki hatte nilgrüne Augen, und ihr Haar bestand aus schlangengleichen Flechten. Zwischen dem ersten und zweiten Besuch dieser ungewöhnlichen Truppe, die stets in einem mit guten Dingen schwer beladenen Boot kam, kampierten die Durrells und ich auf einem Sandstrand am Meer. Hier war die Zeit völlig ausgelöscht. Am Morgen wurden wir von einem verrückten Schafhirten geweckt, der seine Herde hartnäckig über unsere ausgestreckten Körper führte. Auf einem Felsen, unmittelbar hinter uns, erschien dann plötzlich eine wahnsinnige Hexe, die den Hirten schimpfend verjagte. Kein Morgen ohne eine neue Überraschung; wir wachten auf mit Stöhnen und Verwünschungen, denen Lachsalven folgten. Dann sprangen wir ins Meer, von wo aus wir zusehen konnten, wie die Ziegen die steilen Felshänge hinaufkletterten – das Schauspiel war eine fast naturgetreue Wiedergabe der Felsenzeichnungen von Rhodos, die man im Musée de l'Homme in Paris sehen kann. Zuweilen, wenn wir in guter Form waren, kletterten wir hinter den Ziegen her, und stiegen zerkratzt und zerschunden wieder hinunter. So verging eine Woche, in der wir keinen Menschen sahen außer dem Bürgermeister eines ein paar Kilometer entfernten Bergdorfes, der nach uns Ausschau hielt. Er kam eines Tages, als ich allein im Schatten eines riesigen Felsens döste. Ich kannte ungefähr zehn griechische Wörter, und er etwa drei Wörter Englisch, doch trotz unserer beschränkten Sprachkenntnisse führten wir eine bemerkenswerte Unterhaltung. Da ich erkannte, daß er nicht ganz bei Trost war, verlor ich jedwede Hemmung; die Durrells waren nicht da, um mich vor solchen Possen zu warnen, und so führte ich ihm von mir erdachte irrsinnige Lieder und Tänze vor, ahmte weibliche und männliche Filmstars nach, einen chinesischen Mandarin, ein wildes Pferd, einen Taucher und gab noch ähnlichen Unsinn zum besten. Das schien ihn riesig zu amüsieren, und aus einem unerfindlichen Grund interessierte er sich vor allem für meine chinesische Vorführung. So fing ich an, mit ihm chinesisch zu reden, ohne ein Wort der Sprache zu kennen, woraufhin er zu meinem Staunen auf chinesisch antwortete – er sprach sein eigenes Chinesisch, das ebensogut war wie das meine. Am nächsten Tag brachte er einen Dolmetscher mit, nur um mir eine faustdicke Lüge zu erzählen: Vor einigen Jahren sei an dieser Stelle eine chinesische Dschunke gestrandet und etwa vierhundert Chinesen hätten hier am Strand lange gehaust, bis ihr Schiff wieder flott war. Er behauptete, er liebe die Chinesen sehr, sie seien prächtige Menschen, und ihre Sprache sei außerordentlich musikalisch und sehr verständig. Ich fragte ihn, ob er verständlich meine, aber nein, er meinte verständig. Auch die griechische Sprache sei verständig, ebenso die deutsche. Dann erzählte ich, daß ich in China gewesen sei, was auch gelogen war, und nachdem ich das Land beschrieben hatte, schweifte ich nach Afrika hinüber und erzähle ihm von den Pygmäen, bei denen ich ebenfalls eine Weile gelebt hätte. Er erzählte daraufhin, daß es in einem Nachbardorf ein paar Pygmäen gäbe. So ging es stundenlang von einer Lüge zur andern, während wir Wein tranken und Oliven aßen. Dann zog jemand eine Flöte hervor, und wir tanzten, es war ein wahrer Veitstanz, der endlos weiterging und schließlich im Meer endete, wo wir einander wie Krebse bissen und in allen Sprachen der Welt brüllten und grölten.
Eines frühen Morgens brachen wir unsere Zelte ab und kehrten nach Kalami zurück. Es war ein eigenartig drückender Tag, und wir hatten einen zweistündigen steilen Anstieg vor uns bis zu dem Bergdorf, wo Spiro uns mit dem Wagen erwartete. Zunächst mußten wir einen Sandstreifen im Galopp überqueren, denn der Sand verbrannte einem durch die Sandalen hindurch die Füße. Dann folgte ein langer Marsch durch ein ausgetrocknetes Flußbett; das Geröll war selbst für die kräftigsten Fußgelenke eine wahre Plage. Schließlich gelangten wir zu dem Pfad, der den Berghang hinaufführte; er war allerdings eher eine Rinne als ein Pfad und fiel sogar den Bergpferden, die unser Gepäck trugen, schwer. Während des Kletterns begrüßte uns von oben eine unheimliche Melodie. Wie der dichte Nebel, der aus dem Meer aufstieg, umhüllte sie uns mit sehnsüchtigen Klängen und erstarb dann plötzlich. Ein paar hundert Fuß höher gelangten wir zu einer Lichtung, in deren Mitte ein riesiges Faß mit einer giftigen Flüssigkeit stand, einem insektentötenden Mittel für die Olivenbäume; junge Mädchen rührten es um und sangen dabei. Es war ein Totenlied, das eigentümlich zu der nebligen Landschaft paßte. Hier und dort, wo sich die Nebelfetzen teilten und eine Baumgruppe oder kahle, krallengleiche Felsstumpen enthüllten, erklang der Widerhall des unheimlichen Liedes wie der Trompetenchor eines Orchesters. Ab und zu tauchte ein Streifen des blauen Meeres aus dem Nebel auf, nicht auf der Erdoberfläche, sondern wie nach einem Taifun zwischen Himmel und Erde schwebend. Auch die Häuser schienen in der Luft zu hängen, wenn ihre massiven Formen die Luftspiegelung durchbrachen. Die ganze Atmosphäre war von einer erregenden biblischen Pracht, die noch gesteigert wurde durch das Glockengeläute der Pferde, den Widerhall des Gesanges, das leise Brausen der Brandung unter uns und ein undefinierbares Gemurmel, das wahrscheinlich nichts anderes war als das Hämmern unserer Schläfen in dem starken und drückenden Dunst dieses ionischen Morgens. Am Rand des Abhanges hielten wir ab und zu an, viel zu hingerissen von dem Schauspiel, um sogleich durch den Paß in die klare glänzende Alltagswelt des kleinen dahinterliegenden Bergdorfes vorzudringen. In diesem opernhaften Reich, in dem sich das Tao-teh-king und die alten Veden dramatisch und kontrapunktisch vermengten, schmeckten die leichten griechischen Zigaretten noch mehr als sonst nach Stroh. Selbst der Gaumen paßte sich hier metaphysisch an: es war das Drama der Lüfte, der oberen Regionen, das Drama des ewigen Konfliktes zwischen Seele und Geist.
Dann der Paß, den ich stets als einen Ort sinnloser Metzelei in Erinnerung behalten werde. Hier mußten während der endlosen blutigen Vergangenheit der Menschheit wieder und wieder die entsetzlichsten, grausamsten Massaker verübt worden sein. Er ist eine von der Natur zum Unheil der Menschen erdachte Falle. Griechenland ist voll solcher Todesfallen. Sie sind wie ein mächtiges kosmisches Zeichen, das der berauschenden, leuchtenden Welt Klang verleiht, einer Welt, in der die heroischen und mythologischen Gestalten der glänzenden Vergangenheit ständig das Bewußtsein zu beherrschen drohen. Der antike Grieche war ein Mörder: er lebte in einer Welt von brutaler Klarheit, die den Geist quälte und verwirrte. Er befand sich mit der gesamten Menschheit im Krieg, auch mit sich selbst. Aus dieser wilden Anarchie entstanden die klaren, heilsamen, metaphysischen Spekulationen, die sogar heute noch die Welt bezaubern. Während wir über den Paß wanderten – wobei wir mäanderförmige Haken schlagen mußten, um auf das Hochplateau zu gelangen –, war mir, als watete ich durch ein gespenstisches Meer von Blut; die Erde war gebleicht und verrenkt, so wie die zerschmetterten Glieder der Dahingeschlachteten gewesen sein mochten, die hier liegen gelassen worden waren, um zu verfaulen und mit ihrem Blut in der erbarmungslosen Sonne die Wurzeln der wilden Oliven zu netzen, die sich mit Geierklauen an die steilen Berghänge klammern. Auf diesem Bergpaß muß es auch reine, visionäre Momente gegeben haben, wenn Menschen ferner Völker Hand in Hand dastanden und einander voll Sympathie und Verständnis in die Augen schauten. Hier müssen Menschen pythagoräischer Prägung geweilt haben, die in Stille und Einsamkeit meditierten, um aus der staubbedeckten Stätte des Gemetzels erneute Klarheit, neue Visionen zu gewinnen. Ganz Griechenland ist von so widerspruchsvollen Plätzen gekrönt; das erklärt vielleicht, daß sich Griechenland als Land, als Nation und als Volk emanzipiert hat, um einer neuen Menschheit als leuchtender Wegweiser zu dienen.
In Kalami verflogen die Tage wie ein Lied. Ab und zu schrieb ich einen Brief oder versuchte ein Aquarell zu malen. Es fehlte nicht an Büchern im Haus, doch ich hatte keine Lust, auch nur ein einziges zu öffnen. Durrell versuchte, mich dazu zu bringen, Shakespeares Sonette zu lesen; nachdem er mich eine Woche lang damit gelöchert hatte, las ich eines, wohl das geheimnisvollste, das Shakespeare je geschrieben hat. (Ich glaube, es war «Der Phönix und die Schildkröte».) Bald danach erhielt ich mit der Post ein Exemplar «Die Geheimlehre», auf das ich mich stürzte. Auch las ich von neuem Nijinskys Tagebuch. Ich weiß, daß ich das Buch wieder und wieder lesen werde. Es gibt nur wenige Bücher, die ich immer wieder lesen kann – eines die «Mysterien» und das andere «Der ewige Gatte» ... ich sollte wohl noch «Alice im Wunderland» hinzufügen. Wie dem auch sei, es war viel besser, die Abende plaudernd und singend zu verbringen oder auf den Felsen an der Küste zu stehen und mit einem Fernrohr die Sterne zu betrachten.
Als die Gräfin wieder auf der Bildfläche erschien, überredete sie uns, sie für ein paar Tage auf ihrem Gut in einem andern Teil der Insel zu besuchen. Wir verbrachten dort drei wundervolle Tage, und dann wurde, mitten in der Nacht, die griechische Armee mobilisiert. Der Krieg war zwar noch nicht erklärt worden, aber die hastige Rückkehr des Königs nach Athen wurde von jedermann als ein böses Zeichen angesehen. Wer die Möglichkeit hatte, schien entschlossen zu sein, dem Beispiel des Königs zu folgen. In der Stadt Korfu brach eine richtige Panik aus. Durrell wollte in die griechische Armee eintreten, um an der albanischen Front Dienst zu leisten. Spiro wollte, obwohl er die Altersgrenze überschritten hatte, ebenfalls seine Dienste anbieten. So vergingen einige Tage mit hysterischen Gesten, und dann, wie von einem Impresario arrangiert, warteten wir alle gemeinsam auf das Schiff nach Athen, das um neun Uhr morgens eintreffen sollte; es wurde vier Uhr morgens des nächsten Tages, bis wir an Bord gehen konnten. Bis dahin hatte sich der Quai mit einem unbeschreiblichen Durcheinander von Gepäckstücken angefüllt, auf denen die fieberhaft aufgeregten Besitzer saßen oder sich ausstreckten und vortäuschten, sorglos dreinzublicken, doch tatsächlich vor Furcht zitterten. Das schandbarste Schauspiel folgte, als die Leichter schließlich anlegten: Wie üblich bestanden die Reichen darauf, zuerst an Bord zu gehen. Da ich ein Billett erster Klasse hatte, befand ich mich unter den Reichen. Ich war angeekelt und halb entschlossen, nicht mitzufahren, sondern still zu Durrells Haus zurückzukehren und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Dann entdeckte ich, daß wir, die Reichen, durch eine wundersame Fügung erst nach den andern an Bord gehen sollten. All die feinen Gepäckstücke wurden aus den Leichtern geholt und wieder auf den Quai geworfen. Bravo! Mein Herz schlug höher. Die Gräfin, die das meiste Gepäck hatte, ging als allerletzte aufs Schiff. Später erfuhr ich zu meinem Staunen, daß sie es war, die das veranlaßt hatte. Die Untüchtigkeit hatte sie verärgert – nicht die Frage von Klasse oder Privilegien. Vor den Italienern hatte sie anscheinend nicht die geringste Furcht, sie hatte nur etwas gegen diese Unordnung, gegen dieses schandbare Durcheinander. Es war, wie ich sagte, vier Uhr morgens, und ein heller Mond leuchtete über einer rauhen See, als wir in den kleinen Ruderbooten vom Quai abstießen. Ich hatte nie damit gerechnet, Korfu unter solchen Umständen zu verlassen, und war wütend auf mich, weil ich zugestimmt hatte, nach Athen zu gehen. Die Unterbrechung meiner glücklichen Ferien berührte mich mehr als die Gefahr des drohenden Krieges. Es war noch immer Sommer, und ich hatte keineswegs genug von Sonne und Meer. Ich dachte an die Bauersfrauen, an die zerlumpten Kinder, die bald ohne Nahrung sein würden, und an den Ausdruck ihrer Augen, als sie uns zum Abschied winkten. Ich fand es feige, so davonzulaufen und die Schwachen und Unschuldigen ihrem Schicksal zu überlassen. Immer wieder das Geld! Wer Geld hat, entkommt; wer keines hat, wird massakriert. Ich wünschte insgeheim, daß die Italiener uns abfangen würden, damit wir nicht so schamlos billig davonkämen.
Als ich erwachte und an Deck ging, lief das Schiff durch eine schmale Meerenge; zu beiden Seiten erhoben sich kahle niedere Hügel, sanfte, mit violetten Büschen bedeckte Erderhebungen in so vertrauten menschlichen Proportionen, daß man vor Freude hätte weinen können. Die Sonne stand schon hoch, ihr Glanz war blendend, intensiv. Ich befand mich inmitten jener kleinen griechischen Welt, deren Grenzen ich vor ein paar Monaten in Paris in meinem Buch beschrieben hatte. Es war, als wachte ich aus einem Traum auf und sähe, daß er Wirklichkeit ist. Diese leuchtende Unmittelbarkeit der beiden violettfarbenen Ufer hatte etwas Urtümliches an sich. Wir glitten genauso dahin, wie es Rousseau, «der Zöllner», in seinen Gemälden dargestellt hat. Es war nicht nur Griechenland, es war Dichtung, es war zeitlos, und es war keine Stätte, wie Menschen sie wirklich kennen. Das Schiff war die einzige Verbindung mit der Wirklichkeit. Es war bis zum Rand mit verlorenen Seelen gefüllt, die sich verzweifelt an ihre wenigen irdischen Besitztümer klammerten. Zerlumpte Frauen mit nackten Brüsten suchten vergebens, ihre heulende Brut zu stillen; sie saßen auf dem Boden des Decks in einer Lache von Blut und Gespienem, und der Traum, durch den sie glitten, berührte nie ihre Lider. Wären wir in diesem Augenblick torpediert worden, wir wären inmitten von Blut, Gespienem und Tohuwabohu in die finstere Unterwelt eingegangen. In jenem Augenblick freute ich mich, daß ich frei war von Besitz, frei von allen Bindungen, frei von Furcht und Neid und Mißgunst. Ich hätte leicht von einem Traum in einen anderen hinübergleiten können, ohne etwas zu besitzen, ohne etwas zu bereuen, ohne etwas zu wünschen. Nie war ich mehr davon überzeugt, daß Leben und Tod ein und dasselbe sind, und daß man das eine ohne das andere nicht zu genießen oder in sich aufzunehmen vermag.
In Patras beschlossen wir, an Land zu gehen und den Zug nach Athen zu nehmen. Das Hotel Cecil, in dem wir abstiegen, ist das beste Hotel, das ich kenne, und ich kenne viele. Das Zimmer kostete etwa dreiundzwanzig Cent pro Tag, ein ähnliches hätte man in Amerika nicht unter fünf Dollar bekommen. Ich hoffe, daß jeder, der durch Griechenland reist, im Hotel Cecil absteigen und sich selbst davon überzeugen wird; es ist unvergeßlich. Gegen zwölf Uhr frühstückten wir auf der Terrasse des Solariums, mit Blick auf das Meer. Durrell und seine Frau stritten schrecklich miteinander. Ich war ganz ratlos und konnte beide nur aus tiefstem Herzen bedauern. Eigentlich war es ein persönlicher Streit, der Krieg war nur ein Vorwand. Der Gedanke an Krieg macht die Menschen hektisch, sie werden völlig verrückt, selbst wenn sie so gescheit und einsichtig sind wie Durrell und Nancy. Der Krieg hat noch andere schlimme Auswirkungen, er flößt jungen Menschen Schuldbewußtsein ein und bereitet ihnen