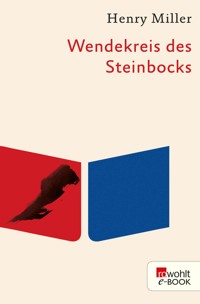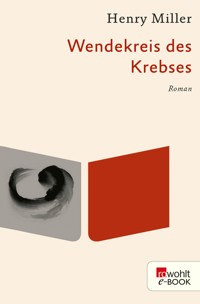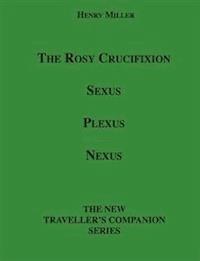7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nexus - Henry Millers fesselnde Fortsetzung seines autobiografischen Meisterwerks Plexus In Nexus knüpft Henry Miller nahtlos an die Fäden an, die er in Plexus gesponnen hat. Unvergessene Gestalten erscheinen erneut, während neue, ausgeprägte Charaktere mit unverkennbarer Physiognomie aus dem unergründlichen New Yorker Menschenmeer auftauchen. Beschworen von der Gewalt der Erinnerungen und Millers einzigartiger Sprachkraft, erwachen sie zu farbenprächtigem, inständigem, vitalem und geistigem Leben. Wie in seinen anderen Werken wie Opus Pistorum, Wendekreis und Stille Tage in Clichy schafft Miller auch in Nexus einen fesselnden autobiografischen Roman voller Skandale und Provokationen. Seine lebendigen Schilderungen des New Yorks der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ziehen den Leser unwiderstehlich in seinen Bann. Nexus ist ein Muss für alle Fans von Henry Miller und ein Klassiker der modernen amerikanischen Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Henry Miller
Nexus
Roman
Über dieses Buch
Mit «Nexus» nimmt Henry Miller die Fäden wieder auf, die er in «Plexus» angesponnen hat. Unvergessene Gestalten erscheinen wieder, neue treten hinzu. Ausgeprägte Charaktere mit unverkennbarer Physiognomie tauchen auf aus dem unergründlichen New Yorker Menschenmeer. Beschworen von der Gewalt der Erinnerungen und magischer Sprachkraft, gewinnen sie farbiges, inständiges, vitales und geistiges Leben.
Vita
Henry Miller, der am 26. Dezember 1891 in New York geborene deutschstämmige Außenseiter der modernen amerikanischen Literatur, wuchs in Brooklyn auf. Die dreißiger Jahre verbrachte Miller im Kreis der «American Exiles» in Paris. Sein erstes größeres Werk, das vielumstrittene «Wendekreis des Krebses», wurde – dank des Wagemuts eines Pariser Verlegers – erstmals 1934 in englischer Sprache herausgegeben. In den USA zog die Veröffentlichung eine Reihe von Prozessen nach sich; erst viel später wurde das Buch in den literarischen Kanon aufgenommen. Henry Miller starb am 7. Juni 1980 in Pacific Palisades, Kalifornien.
Impressum
Die Originalausgabe erschien bei The Obelisk Press, Paris, unter demselben Titel.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2020
Copyright © 1961 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © by Henry Miller, Big Sur, Cal., USA
Covergestaltung Konzept any.way, Hamburg Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Coverabbildung Gettyimages/Thoth_Adan
ISBN 978-3-644-00628-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1
Wuff! Wuff wuff! Wuff! Wuff! Bellen in der Nacht. Bellen, Bellen. Ich rufe, aber niemand antwortet. Ich schreie, aber nicht einmal ein Echo ist zu hören.
«Was willst du – den Osten des Xerxes oder den Osten Christi?»
Allein – mit Gehirnekzem.
Endlich allein. Wunderbar! Nur ist es nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Wenn ich doch nur mit Gott allein wäre!
Wuff! Wuff, wuff!
Mit geschlossenen Augen zaubere ich mir ihr Bild her. Es schwimmt in der Dunkelheit, eine Maske, die aus dem Gischt auftaucht: Der Tilla Durieux-bouche, der sich wie ein Bogen spannt, weiße gleichmäßige Zähne, die Augen dunkel unterlegt, die Lider ein dickflüssiges, glitzerndes Blau. Das Haar fällt wild und dicht, schwarz wie Ebenholz. Die Schauspielerin aus den Karpaten und der Wiener Mansardenwohnung. Wie Venus dem Flachland Brooklyns entstiegen.
Wuff! Wuff wuff! Wuff! Wuff!
Ich schreie, aber für alle Welt klingt es wie ein Geflüster.
Ich heiße Isaac Staub. Ich bin in Dantes fünftem Himmel. Wie Strindberg in seinem Delirium wiederhole ich: «Was macht es, ob man der einzige ist oder noch einen Nebenbuhler hat? Was will das besagen?»
Warum fallen mir plötzlich diese sonderbaren Namen ein? Alles Klassenkameraden von der lieben alten Alma mater: Morton Schnadig, William Marvin, Israel Siegel, Bernard Pistner, Louis Schneider, Clarence Donohue, William Overend, John Kurtz, Pat McCaffrey, William Korb, Arthur Convissar, Sally Liebowitz, Frances Glanty. Keiner von ihnen hat bisher den Kopf gehoben. Aus dem Hauptbuch gestrichen. Unschädlich gemacht wie Schlangengezücht.
«Seid ihr da, Kameraden?»
Keine Antwort.
Bist du's, lieber August, der da im Dunkeln den Kopf hebt? Ja, es ist Strindberg, der Strindberg, dem zwei Hörner auf der Stirn sprossen. Le cocu magnifique.
In glücklicheren Zeiten – wann? Wie lange liegen sie zurück? Auf welchem Planeten war es? – ging ich von Wand zu Wand, um diesen oder jenen zu begrüßen, alles alte Freunde: Leon Bakst, Whistler, Lovis Corinth, Breughel den Älteren, Botticelli, Bosch, Giotto, Cimabue, Piero della Francesca, Grünewald, Holbein, Lucas Cranach, Van Gogh, Utrillo, Gauguin, Piranesi, Utamaro, Hokusai, Hiroshige – und die Klagemauer. Auch Goya und Turner. Jeder hatte etwas Kostbares mitzuteilen. Aber besonders Tilla Durieux, sie mit den beredten, sinnlichen Lippen, dunkel wie Rosenblätter.
Die Wände sind jetzt kahl. Selbst wenn sie mit Meisterwerken behangen wären, würde ich keines erkennen. Es ist alles in Dunkel gehüllt. Wie Balzac lebe ich mit Bildern, die nur in meiner Vorstellung existieren. Selbst die Rahmen sind erdacht.
Isaac Staub – von Staub bist du genommen und sollst wieder zu Staub werden. Füge ein Kodizill hinzu, altem Brauch zuliebe.
Anastasia, alias Hogoroboru, alias Bertha Filigran vom Tahoe-Titicaca-See und dem Zarenhof ist zur Beobachtung ihres Geisteszustandes vorübergehend im Irrenhaus. Sie ging aus eigenem, freiem Entschluß dorthin, um herauszufinden, ob sie noch richtig bei Sinnen sei oder nicht. Saul bellt in seinem Delirium, im Glauben, er sei Isaac Staub. Wir sind eingeschneit – in einem Schlafzimmer im Erdgeschoß mit einem eigenen Waschbecken für jeden und einem Doppelbett. Ab und zu blitzt es. Graf Bruga, dieses entzückende Püppchen, ruht auf der Kommode, umgeben von javanischen und tibetanischen Götzenbildern. Er hat den bösen, lüsternen Seitenblick eines Verrückten, der eine Schale Methylalkohol austrinkt. Auf seiner Perücke aus roten Fäden sitzt ein von der Galerie Dufayel importierter winziger Hut à la Bohème. Mit dem Rücken lehnt er sich gegen ein paar auserlesene Bände, die Stasia bei uns deponiert hat, bevor sie ins Irrenhaus ging.
The Imperial Orgy – The Vatican Swindle – A Season in Hell – Death in Venice – Anathema – A Hero of our Time – The Tragic Sense of Life – The Devil's Dictionary – November Boughs – Beyond the Pleasure Principle – Lysistrata – Marius the Epicurean – The Golden Ass – Jude the Obscure – The Mysterious Stranger – Peter Whiffle – The Little Flowers – Virginibus Puerisque – Queen Mab – The Great God Pan – The Travels of Marco Polo – Songs of Bilitis – The Unknown Life of Jesus – Tristram Shandy – The Crock of Gold – Black Bryony – The Root and the Flower.
Nur eine einzige Lücke: Rozanovs Metaphysics of Sex.
In ihrer eigenen Handschrift (auf einem Streifen Einwickelpapier) finde ich die folgende Notiz, offenbar ein Zitat, aus einem der Bände: «Dieser sonderbare Denker, N. Federov, ein echter Russe, wird seine eigene, staatsfeindliche Form des Anarchismus begründen.»
Wenn ich diesen Zettel Kronski zeigte, würde er sofort zum Irrenhaus laufen und ihn als Beweis vorzeigen. Als Beweis für was? Als Beweis dafür, daß Stasia ihre fünf Sinne beisammen hat.
War das gestern? Ja, gestern um vier Uhr in der Frühe ging ich zur U-Bahn-Station, um nach Mona Ausschau zu halten. Und siehe da, wen erblicke ich? Mona und ihren Freund Jim Driscoll, den Ringkämpfer, wie sie gemächlich durch das Schneetreiben stapfen. Wenn man sie so sah, hätte man glauben können, sie suchten auf einer goldenen Wiese nach Veilchen. Kein Gedanke an Schnee oder Eis, sie kümmerten sich nicht um die Polarwinde, die vom Fluß herwehten, sie fürchteten weder Gott noch Menschen. Lachend, schwatzend, summend schlenderten sie dahin. Frei wie Feldlerchen.
Hört, hört, die Lerche am Himmelstor singt!
Ich folgte ihnen eine Weile, beinahe angesteckt von ihrer lässigen Bummelei. Plötzlich bog ich scharf links ab in Richtung auf Osieckis Wohnung zu. Besser ausgedrückt–sein «Büro». Tatsächlich, es brannte Licht, und das Pianola spielte leise Morceaux Choisis von Dohnanyi.
«Heil euch, süße Läuse!» dachte ich und ging weiter. Drüben über dem Gowanus-Kanal stieg Nebel auf. Wahrscheinlich schmolz dort ein Gletscher.
Als ich heimkam, war sie dabei, ihr Gesicht einzucremen.
«Wo in Gottes Namen bist du gewesen?» fragte sie beinahe vorwurfsvoll.
«Bist du schon lange daheim?» entgegne ich.
«Bereits einige Stunden.»
«Sonderbar. Ich könnte schwören, daß ich erst vor zwanzig Minuten fortgegangen bin. Vielleicht habe ich einen Anfall von Schlafwandeln gehabt. Komisch, aber ich meine, ich sah dich und Jim Driscoll Arm in Arm gehen . . . »
«Val, du mußt krank sein!»
«Nein, nur angeheitert. Von innen her, meine ich. Es kann eine Sinnestäuschung gewesen sein.»
Sie legt mir eine kalte Hand auf die Stirn, fühlt meinen Puls. Es ist anscheinend alles normal. Es ist ihr ein Rätsel. Warum erfinde ich solche Geschichten? Nur um sie zu quälen? Haben wir nicht schon Sorgen genug, wo Stasia im Irrenhaus und die Miete noch nicht bezahlt ist? Ich sollte mehr Rücksicht auf sie nehmen. Ich gehe zum Wekker und deute auf die Zeiger. Sechs Uhr. «Ich weiß», sagte sie.
«Du warst es also nicht, die ich vor ein paar Minuten gesehen habe?»
Sie sieht mich an, als wäre ich dem Irrsinn nahe.
«Mach dir keine Gedanken darüber», zirpe ich. «Liebste, ich habe die ganze Nacht Champagner getrunken. Ich bin mir jetzt sicher, du warst es nicht, die ich gesehen habe, es war dein Astralleib.» Pause. «Stasia ist jedenfalls okay. Ich habe gerade eine lange Unterredung mit einem Stationsarzt gehabt… »
«Du … ?»
«Ja. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, dachte ich mir, ich könnte mal rübergehen und sehen, wie es ihr geht. Ich habe ihr Charlotte russe gebracht.»
«Du solltest zu Bett gehen, Val, du bist erschöpft.» Pause. «Wenn du wissen willst, warum ich noch so spät auf bin, will ich dir's sagen. Ich habe mich gerade von Stasia verabschiedet. Ich habe sie vor etwa drei Stunden herausgeholt.» Sie kicherte in sich hinein – oder war es mehr ein Gegacker? «Ich werde dir morgen alles erzählen. Es ist eine lange Geschichte.»
Zu ihrem Erstaunen erwiderte ich: «Das hat Zeit, ich habe mir soeben die ganze Geschichte erzählen lassen.»
Wir drehten das Licht aus und krochen ins Bett. Ich konnte hören, wie sie sich ins Fäustchen lachte. Zum Schluß gab ich ihr einen kleinen Nasenstüber zum Einschlafen und flüsterte: «Bertha Filigran vom Titicaca-See.»
Oft, nach einer Sitzung mit Spengler oder Elie Faure, warf ich mich angekleidet aufs Bett und wühlte mich, anstatt über alte Kulturen nachzudenken, durch ein Labyrinth von Lügen und Falschheiten. Keine von beiden scheint fähig, die Wahrheit zu sagen, selbst nicht über eine so einfache Angelegenheit wie auf die Toilette gehen. Stasia, eine im Grunde wahrheitsliebende Seele, nahm diese Gewohnheit an, um Mona zu gefallen. Selbst in der phantastischen Erzählung, sie sei ein Abkömmling der Romanows, steckte ein Körnchen Wahrheit. Sie trägt die Lüge niemals so dick auf wie Mona. Wenn man sie überdies mit der Wahrheit konfrontiert, bekommt sie keinen hysterischen Anfall oder geht wie auf Stelzen aus dem Zimmer. Nein, ihr Gesicht weitet sich nur zu einem breiten Grinsen, das sich allmählich zu dem reizenden Lächeln eines engelhaften Kindes mildert. Es gibt Augenblicke, in denen ich glaube, ich kann mit Stasia aus- und weiterkommen. Aber gerade wenn ich fühle, daß die Zeit reif ist, entführt Mona sie schnell, wie ein Tier, das sein Junges schützt.
Eine der seltsamsten Lücken in unseren intimen Unterhaltungen – denn hin und wieder geben wir uns langen Redeschmausereien hin, die scheinbar mit Aufrichtigkeit gewürzt sind –, eine dieser unerklärlichen Auslassungen, sage ich, hat mit der Kindheit zu tun. Wie sie spielten, wo und mit wem bleibt ein undurchdringliches Geheimnis. Sie sprangen offenbar von der Wiege gleich ins volle weibliche Leben. Nie wird ein Jugendfreund oder ein herrlicher Jux erwähnt, an dem sie beide ihre Freude hatten, nie reden sie von einer Straße, die sie gern hatten, einem Park, in dem sie spielten, oder einem Spiel, das sie besonders liebten. Ich habe sie schlankweg gefragt: «Könnt ihr schlittschuhlaufen? Könnt ihr schwimmen? Habt ihr je Hopse gespielt?» Ja, das alles können sie oder haben es getan, und noch mehr. Warum nicht? Aber sie vermeiden es streng, in die Vergangenheit zurückzuschlüpfen. Nie erwähnen sie, wie man es oft in lebhafter Unterhaltung tut, ein sonderbares oder aufregendes Erlebnis aus der Kindheit. Dann und wann erzählt die eine oder die andere, sie habe einmal den Arm gebrochen oder sich den Fuß verstaucht, aber wo, wann? Immer wieder bemühe ich mich, sie sanft unter gutem Zureden zurückzuführen, wie man ein Pferd in den Stall führt, aber vergeblich. Einzelheiten langweilen sie. Ist es nicht ganz nebensächlich, so fragen sie, wann oder wo das passierte? Gut also, Abteilung kehrt! Ich bringe die Rede auf Rußland oder Rumänien, in der Hoffnung, einen Schimmer oder einen Strahl der Erinnerung zu entdecken. Ich tue das obendrein sehr geschickt, indem ich mit Tasmanien oder Patagonien beginne und nur allmählich und auf Umwegen auf Rußland, Rumänien, Wien und Brooklyn komme. Als wenn sie nicht den leisesten Argwohn über mein Vorgehen hätten, beginnen auch sie plötzlich von fremden Ländern zu sprechen, Rußland und Rumänien eingeschlossen, aber so, als gäben sie etwas wieder, was sie von einem Ausländer gehört oder in einem Reisebuch gelesen hätten. Stasia, die etwas geschickter ist, mag sogar so tun, als gäbe sie mir einen Fingerzeig. Es fällt ihr zum Beispiel ein, mir eine angebliche Begebenheit aus Dostojewski zu erzählen, im Vertrauen auf mein schwaches Gedächtnis oder auch, daß ich selbst bei einem guten unmöglich die Tausende von Ereignissen im Kopf behalten kann, die Dostojewskis dicke Bände füllen. Und wie kann ich wissen, daß sie mir nicht den echten Dostojewski vorsetzt? Weil ich ein ausgezeichnetes Gedächtnis für die Aura gelesener Bücher habe. Ich erkenne sofort, ob eine Stelle für Dostojewski charakteristisch ist oder nicht. Um sie aufs Glatteis zu führen, tue ich jedoch so, als erinnere ich mich an die Begebenheit, die sie berichtet, nicke zustimmend, lache, klatsche in die Hände, alles, was sie will, aber ich lasse mir nie anmerken, daß ich ihre Erfindungen erkenne. Dann und wann jedoch erinnere ich sie in derselben spielerischen Weise an eine Kleinigkeit, über die sie hinweggegangen ist, oder eine Verdrehung des Tatbestandes. Ich streite mich mit ihr sogar lange herum, wenn sie behauptet, daß sie die Begebenheit richtig wiedergegeben hat. Und die ganze Zeit sitzt Mona da und hört aufmerksam zu, ohne eine Ahnung zu haben, was wahr und was falsch ist, aber überglücklich, weil wir von ihrem Idol, ihrem Gott – von Dostojewski sprechen.
Wie reizvoll und wie köstlich kann diese Welt von Lügen und Falschheiten sein, wenn man nichts Besseres zu tun hat und nichts auf dem Spiel steht! Sind wir nicht wundervoll – wir kecken, frechen Lügnerinnen? «Schade, daß Dostojewski nicht selbst bei uns ist!» ruft Mona manchmal aus. Als ob er alle diese verrückten Leute, alle diese närrischen Szenen, die in solcher Fülle in seinen Romanen zu finden sind, erfunden hätte. Ich meine, erfunden zu seinem eigenen Vergnügen, oder weil er ein geborener Narr und Lügner war. Nicht einmal dämmert es ihnen, daß sie die «verrückten» Charaktere in einem Buch sein könnten, das vom Leben mit unsichtbarer Tinte geschrieben wird.
Es ist daher nicht sonderbar, daß fast jeder, Mann oder Weib, den Mona bewundert, «verrückt», oder daß jeder, den sie verabscheut, ein «Narr» ist. Doch wenn es ihr einfällt, mir ein Kompliment zu machen, nennt sie mich immer einen Narren. «Du bist ein so lieber Narr, Val!» Womit sie meint, ich sei erwachsen und kompliziert genug, um, wenigstens ihrer Schätzung nach, zur Welt Dostojewskis zu gehören. Manchmal, wenn sie von meinen ungeschriebenen Büchern schwärmt, versteigt sie sich sogar zu der Behauptung, ich sei ein zweiter Dostojewski. Schade, daß ich nicht dann und wann einen epileptischen Anfall hinlegen kann! Das würde mir erst das richtige Ansehen verschaffen. Leider wird der Zauber meistens dadurch gebrochen, daß ich allzu schnell zu einem «Bürger» entarte. Mit anderen Worten, ich werde zu neugierig, zu kleinlich, zu unduldsam. Dostojewski zeigt nach Mona niemals das geringste Interesse für «Tatsachen». (Eine von den Halbwahrheiten, die mich manchmal zusammenfahren lassen.) Dostojewski war, wenn man ihr glauben will, immer in den Wolken – oder wühlte in den tiefsten Tiefen. Er legte keinen Wert darauf, an der Oberfläche zu schwimmen. Er dachte nicht an Handschuhe, Muffs oder Mäntel. Auch steckte er seine Nase nicht in Handtaschen von Frauen, um nach Namen und Adressen zu suchen. Er lebte nur in der Phantasie.
Stasia hatte indessen ihre eigene Meinung über Dostojewski, seine Lebensweise und seine Arbeitsmethode. Trotz ihrer unberechenbaren Launen kam sie schließlich der Wirklichkeit etwas näher. Sie wußte, daß Puppen aus Holz oder Pappmaché gemacht werden und nicht nur aus «Phantasie». Sie war sich auch nicht ganz sicher, ob nicht auch Dostojewski seine «bürgerliche» Seite gehabt haben könnte. Besonders aber schätzte sie an ihm das dämonische Element. Für sie war der Teufel ein wirklich vorhandenes Wesen. Das Böse war wirklich. Mona andererseits schien von dem Bösen in Dostojewski nicht berührt zu werden. Für sie war das nur eine neue Seite seiner «Phantasie». In Büchern versetzte sie nichts in Schrecken – im Leben allerdings auch nicht. Darum ging sie auch wohl unbeschadet durchs Feuer. Aber wenn Stasia eine ihrer sonderbaren Stimmungen hatte, konnte selbst die Teilnahme an einem Frühstück für sie eine Feuerprobe sein. Sie hatte eine Nase für das Böse, sie konnte sein Vorhandensein selbst in kaltem Haferflockenbrei ausfindig machen. Für Stasia war der Teufel allgegenwärtig, lauerte immer einem Opfer auf. Sie trug Amulette, um die bösen Mächte abzuwehren; sie machte gewisse Zeichen, wenn sie ein fremdes Haus betrat, oder sagte Zaubersprüche in fremden Sprachen vor sich hin. Über dies alles lächelte Mona nachsichtig, fand es «köstlich», daß Stasia so primitiv, so abergläubisch war. «Das ist ihr slawisches Blut», pflegte sie zu sagen.
Jetzt, da die Behörden Stasia in Monas Obhut gegeben hatten, kam es uns zu, die Lage mit größerer Klarheit zu überschauen und für diese komplizierte Natur eine ruhigere, friedvollere Lebensweise zu finden. Nach Monas tränenreichem Bericht hatte man Stasia nur mit dem größten Widerstreben aus der Beobachtung entlassen. Der Teufel allein kann wissen, was sie dort über ihre Freundin – und über sich selbst – erzählt hatte. Erst nach Wochen und nur durch geschickte Manöver gelang es mir, das Puzzlespiel zu entwirren, das sie aus ihrer Unterhaltung mit dem Chefarzt gemacht hatten. Hätte ich mich an nichts anderes halten können, würde ich den Eindruck gewonnen haben, daß sie beide ins Irrenhaus gehörten. Glücklicherweise hatte ich eine andere Lesart der Unterhaltung bekommen, und zwar unerwarteterweise von Kronski. Aus welchem Grunde er sich für den Fall interessierte, weiß ich nicht. Mona hatte den Behörden zweifellos seinen Namen genannt – er sei der Hausarzt. Möglicherweise hatte sie ihn mitten in der Nacht aufgesucht und ihn schluchzend gebeten, etwas für ihre geliebte Freundin zu tun. Sie unterschlug mir jedenfalls, daß Kronski Stasias Freilassung erreicht hatte, daß Stasia keiner Person zur Pflege übergeben war, und daß ein Wort von Kronski an die Behörden die schlimmsten Folgen haben konnte. Dies letztere war Aufschneiderei, und ich nahm es auch als solche. Wahrscheinlich war das Irrenhaus zum Bersten überfüllt. Im Hintergrund meiner Gedanken regte sich der Entschluß, eines schönen Tages selbst der Anstalt einen Besuch abzustatten und herauszufinden, was geschehen war. (Um es genau zu wissen.) Ich hatte es damit nicht eilig. Ich fühlte, daß die jetzige Lage nur ein Vorspiel oder ein Vorzeichen künftiger Ereignisse war.
Inzwischen gewöhnte ich mir an, schnell nach Greenwich Village oder, wie es bei uns hieß, ins «Dorf» hinüberzugehen, wenn ich gerade Lust dazu hatte. Wie ein streunender Hund irrte ich in dem ganzen Bezirk umher. Wenn ich zu einem Laternenpfahl kam, hob ich mein Hinterbein und bepißte ihn. Wuff wuff! Wuff!
So ertappte ich mich oft, wie ich vor dem «Iron Cauldron» stand, an dem Gitter, das den räudigen Rasen, jetzt knietief mit schwarzem Schnee bedeckt, abgrenzte, um das Kommen und Gehen zu beobachten. Die zwei Tische nahe am Fenster gehörten Mona. Ich beobachtete sie, wie sie in dem weichen Kerzenlicht hin und her ging und ihre Gäste bediente, immer hing ihr dabei eine Zigarette an der Lippe. Das Gesicht war in Lächelfältchen gelegt, wenn sie ihre Kunden begrüßte oder ihre Bestellungen entgegennahm. Dann und wann setzte sich Stasia an den Tisch, immer mit dem Rücken zum Fenster, die Ellbogen auf dem Tisch, den Kopf in den Händen. Gewöhnlich blieb sie dort sitzen, bis der letzte Gast gegangen war. Dann nahm Mona neben ihr Platz. Nach dem Ausdruck ihrer Gesichter zu urteilen, führten sie immer eine angeregte Unterhaltung. Manchmal lachten sie so herzlich, daß sie sich krümmten. Wenn sie in einer solchen Stimmung waren und einer ihrer Lieblingsgäste sich zu ihnen setzen wollte, wurde er oder sie hinweggescheucht wie eine Schmeißfliege.
Worüber konnten diese zwei lieben Geschöpfe nur miteinander reden, und was nahm sie so ganz in Anspruch? Und warum mußten sie dabei so anstrengend lachen? Man beantworte mir diese Frage, und ich will die Geschichte Rußlands auf einen Sitz niederschreiben.
Sobald ich vermutete, sie könnten jetzt aufbrechen, machte ich mich auf die Socken. Gemächlich und nachdenklich schlenderte ich hierhin und dorthin, steckte den Kopf in eine Kneipe nach der anderen, bis ich zum Sheridan Square kam. An einer Ecke des Platzes, immer beleuchtet wie eine altmodische Wirtschaft, lag Minnie Douchebags Künstlerkneipe. Hier würden die beiden, wie ich wußte, schließlich landen. Ich wartete nur, um sicherzugehen, daß sie Platz gefunden hatten. Dann ein Blick auf die Uhr. In zwei oder drei Stunden würde wenigstens eine von ihnen in unsere Höhle zurückkehren. Ein letzter Blick sagte mir, daß sie bereits von allen Seiten beachtet und hofiert wurden. Das war tröstlich. Tröstlich – welch ein Wort! – zu wissen, daß sie unter dem Schutz der lieben Geschöpfe standen, die so großes Verständnis für sie hatten und ihnen immer Hilfe leisteten. Als ich zur U-Bahn ging, dachte ich schmunzelnd daran, wie, wenn man die Bekleidung der Gäste etwas anders anordnete, selbst ein Experte des Bertillon-Systems schwer unterscheiden könnte, wer von ihnen Mann oder Weib war. Die jungen Männer waren immer bereit, für die Mädchen zu sterben – und umgekehrt. Waren sie nicht alle in demselben ranzigen Pißpott, dem Bestimmungsort aller reinen und anständigen Seelen? Ah, aus was für lieben Kerlchen doch die ganze Bande bestand! Alles entzückende Lieblinge, wirklich! Und was für einen Schlamm sie mit ihren Gedanken heraufholen konnten! Du lieber Himmel! Jeder und jede von ihnen, besonders aber die Männer, war ein geborener Künstler oder eine Künstlerin, selbst jene kleinen scheuen Wesen, die sich in eine Ecke verkrochen, um an den Nägeln zu kauen.
Kam es durch den Aufenthalt in dieser Atmosphäre, in der Liebe und gegenseitiges Verständnis herrschten, daß Stasia zu der Auffassung gelangte, zwischen Mona und mir stände nicht alles zum Besten? Oder war das eine Folge der wuchtigen Hammerschläge, mit denen ich, wenn mich die Lust nach Wahrheit und Aufrichtigkeit ergriff, die Luft erschütterte?
«Du sollst Mona nicht beschuldigen, daß sie dich betrügt und dich anlügt», sagte Stasia eines Abends zu mir. Wie es kam, daß wir allein waren, begreife ich nicht. Möglicherweise erwartete sie, Mona jeden Augenblick eintreten zu sehen.
«Womit soll ich sie deiner Meinung nach sonst beschuldigen?» erwiderte ich, gespannt, was sie sagen würde.
«Mona ist keine Lügnerin, das weißt du. Sie erfindet, sie verdreht, sie schmiedet sich etwas zurecht … weil das interessanter ist. Sie glaubt, du magst sie lieber, wenn sie die Dinge kompliziert. Sie hat viel zuviel Respekt vor dir, um dich wirklich anzulügen.»
Ich hatte es mit meiner Antwort nicht eilig.
«Weißt du das nicht?» fragte sie mit erhobener Stimme.
«Offen gesagt, nein!»
«Willst du damit sagen, daß du alle diese phantastischen Geschichten schluckst, die sie dir auftischt?»
«Wenn du meinst, ich betrachte das alles als ein harmloses, unschuldiges Spiel, nein.»
«Aber warum sollte sie dich täuschen wollen, wo sie dich doch so zärtlich liebt? Du weißt, du bedeutest alles für sie. Ja, alles.»
«Bist du darum eifersüchtig auf mich?»
«Eifersüchtig? Ich bin empört, daß du sie so behandelst, daß du so blind, so grausam bist, so… »
Ich hob die Hand. «Worauf willst du hinaus?» fragte ich. «Um was handelt es sich?» «Handelt es sich?» Sie richtete sich auf wie eine entrüstete und tieferstaunte Zarin. Sie hatte ganz vergessen, daß ihre Hose nicht zugeknöpft war und ihr Hemdzipfel heraushing.
«Setz dich. Hier, rauch noch eine.»
Sie wollte sich nicht wieder hinsetzen. Sie fing an, im Zimmer auf und ab zu gehen, auf und ab.
«Nun, was glaubst du lieber?» begann ich. «Entweder liebt Mona mich so, daß sie mich Tag und Nacht anlügt, oder sie liebt dich so, daß sie nicht den Mut hat, mir das zu sagen, oder du liebst sie so sehr, daß du sie nicht unglücklich sehen kannst. Oder – laß mich zuerst diese Frage stellen – weißt du überhaupt, was Liebe ist? Sag mir, hast du je einen Mann geliebt? Ich weiß, du hattest einmal einen Hund, den du liebtest, das hast du mir wenigstens erzählt, und du liebst auch Bäume, wie ich weiß. Ich weiß auch, du hast mehr Liebe als Haß in dir – aber – weißt du überhaupt, was Liebe ist? Wenn du zwei Menschen kennenlernst, die sich wahnsinnig lieben, würde deine Zuneigung zu einem von ihnen diese Liebe vermehren oder sie zerstören? Ich will es anders ausdrücken. Vielleicht wird es dann klarer. Wenn du dich nur als Gegenstand des Mitleids ansähest und jemand würde dir wirkliche Zuneigung, echte Liebe zeigen, würde es dir dann etwas ausmachen, ob diese Person ein er oder eine sie, verheiratet oder unverheiratet wäre? Ich meine, würdest du, könntest du dich allein damit begnügen, diese Liebe entgegenzunehmen? Oder würdest du sie ausschließlich für dich selbst beanspruchen?»
Pause. Lastende Pause.
«Und warum glaubst du», fuhr ich fort, «du seiest der Liebe würdig? Oder sogar, daß dich jemand liebt? Oder, wenn du das glaubst, wieso dann auch, daß du fähig bist, diese Liebe zu erwidern? Nun setz dich doch, warum läufst du denn immer hin und her? Die Unterhaltung könnte sehr interessant werden. Wir könnten sogar an ein Ziel kommen, auf die Wahrheit stoßen. Ich bin bereit, den Versuch zu unternehmen.» Sie sah mich sonderbar und verwundert an. «Du sagst, Mona glaubt, ich liebe komplizierte Wesen. Ich sage dir ganz offen und ehrlich, das stimmt nicht. Nimm dich zum Beispiel, du bist eine sehr einfache Natur – ganz aus einem Stück, nicht wahr? In dir selbst beschlossen, wie man so schön sagt. Du bist so vollständig eins mit dir und der ganzen weiten Welt, daß du, um es ganz genau zu wissen, dich zur Beobachtung in ein Irrenhaus begibst. Bin ich zu hart? Tu dir keinen Zwang an, lach nur spöttisch, wenn du willst. Wenn man die Dinge auf den Kopf stellt, gewinnen sie ein sonderbares Aussehen. Überdies bist du nicht aus eigenem Entschluß zur Beobachtung gegangen, nicht wahr? Das ist nur wieder so eine Erfindung von Mona. Ich habe natürlich sofort nach dem Köder geschnappt und ihn mit Angel und Blinker hinuntergeschluckt – weil ich eure Freundschaft nicht zerstören wollte. Jetzt, da du durch meine Bemühungen heraus bist, willst du mir deine Dankbarkeit zeigen. Nicht wahr? Du möchtest mich nicht unglücklich sehen, besonders wenn ich mit einer zusammenlebe, die dir lieb und teuer ist.»
Sie kicherte nun, obwohl sie sehr aufgebracht war.
«Wenn du mich gefragt hättest, ob ich eifersüchtig auf dich bin, würde ich, so ungern ich es zugebe, ja gesagt haben. Ich schäme mich nicht, es zu gestehen : ich fühle mich erniedrigt, wenn ich daran denke, daß eine wie du mich eifersüchtig machen kann. Du bist kaum der Typ, den ich mir als Nebenbuhler gesucht hätte. Ich mag Morphoditen ebensowenig wie Leute mit Daumen, die sich nach rückwärts drehen lassen. Ich habe Vorurteile, bürgerliche, wenn du willst. Ich habe nie einen Hund geliebt, aber auch nie einen gehaßt. Ich habe Tröpfe kennengelernt, die unterhaltsam, gescheit, talentiert und gute Zeitvertreiber waren, aber ich muß sagen, ich möchte nicht mit ihnen leben. Ich spreche hier nicht von Moral, sondern von Vorliebe und Abneigung. Gewisse Dinge gehen mir auf die Nerven. Um es milde auszudrücken, es ist höchst bedauerlich, daß meine Frau sich so stark zu dir hingezogen fühlt. Das klingt lächerlich, nicht wahr? Fast literarisch. Es ist eine Affenschande, will ich sagen, daß sie sich nicht einen richtigen Mann ausgesucht hat, wenn sie mich hintergehen muß, selbst wenn es einer wäre, den ich verachte. Aber dich … verdammte Scheiße … dagegen bin ich vollständig wehrlos. Es schaudert mich, wenn ich nur daran denke, jemand könnte zu mir sagen: Stimmt etwas nicht mit dir? Weil mit einem Mann etwas nicht in Ordnung sein muß – so nimmt man wenigstens an –, wenn eine Frau sich in eine Geschlechtsgenossin verliebt. Ich habe mich nach Kräften bemüht, zu entdecken, was mit mir nicht in Ordnung ist – wenn das überhaupt in Frage kommt –, aber ich kann es nicht feststellen. Wenn übrigens eine Frau eine andere ebenso lieben kann wie einen Mann, an den sie gebunden ist, so ist daran nichts Unrechtes, nicht wahr? Man kann sie nicht tadeln, wenn sie tatsächlich mit einem ungewöhnlichen Vorrat von Liebesfähigkeit ausgestattet ist. Angenommen jedoch, man hat als Gatte eines so außergewöhnlichen Geschöpfes seine Zweifel an der überdurchschnittlichen Liebesfähigkeit seiner Frau, was dann? Wie, wenn der Mann Grund zu der Annahme hat, diese außerordentliche Liebesbegabung sei eine Mischung von Schwindel und wirklicher Zuneigung? Daß sie, um ihren Mann sozusagen in die richtige Verfassung zu bringen, listig und tückisch darauf hinarbeitet, seinen Geist zu vergiften, dazu höchst phantastische Erzählungen, alle natürlich ganz unschuldig, über ihre Erlebnisse mit Freundinnen vor der Hochzeit erfindet und zusammenbraut, ohne offen zuzugeben, daß sie bei ihnen geschlafen hat, obschon sie immer andeutet, daß es so gewesen sein könnte. Und im Augenblick, da der Mann – ich mit anderen Worten – Angst oder Beunruhigung zeigt, leugnet sie alles Derartige heftig ab, behauptet, nur seine schmutzige Phantasie könnte ihm solche Bilder vorgaukeln … Folgst du mir, oder ist das zu kompliziert?»
Sie setzte sich. Ihr Gesicht wurde mit einemmal ernst. Sie saß auf der Bettkante und sah mich forschend an. Plötzlich verzog sich ihr Gesicht zu einem Lächeln, zu einem satanischen Lächeln, und sie rief: «Darauf hast du es also abgesehen! Jetzt willst du meinen Geist vergiften!» Dann stürzten ihr die Tränen aus den Augen, und sie begann zu schluchzen.
Zum guten Glück kam jetzt gerade Mona herein.
«Was hast du ihr getan?» Das waren ihre ersten Worte. Sie legte einen Arm um die arme Stasia, streichelte ihr Haar, tröstete sie mit besänftigenden Worten.
Eine rührende Szene. Sie war jedoch ein bißchen zu echt, als daß ich geziemend gerührt wurde.
Das Ergebnis – Stasia konnte so unmöglich nach Hause gehen, sie mußte bleiben und sich gründlich ausruhen.
Stasia sieht mich fragend an.
«Selbstverständlich, selbstverständlich!» sage ich. «Bei einem solchen Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür.»
Der unheimlichste Teil der Szene war jedoch, wenn ich es jetzt so bedenke, daß Stasia plötzlich in einem weichfließenden durchsichtigen Nachthemd erschien. Es wäre alles vollkommen gewesen, wenn sie nur eine Pfeife im Mund gehabt hätte.
Um zu Fjodor zurückzukehren … Mit dem Unsinn, den sie dauernd über Dostojewski verzapften, machten sie mich jedesmal nervös. Ich habe nie behauptet, Dostojewski zu verstehen. Jedenfalls nicht ganz. (Ich kenne ihn, wie man eine verwandte Seele kennt.) Bis heute habe ich ihn noch nicht ganz gelesen. Es war immer meine Absicht, mir die letzten paar Brocken zur Lektüre auf dem Sterbebett aufzusparen. Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob ich seinen Traum eines lächerlichen Mannes gelesen oder nur von ihm gehört habe. Ich bin mir darüber genausowenig klar, wie ich bestimmt sagen kann, wer Marcion war oder was Marcions Lehre ist. Bei Dostojewski gibt es wie im Leben viele Dinge, die ich gern als Geheimnisse unberührt lasse. Ich stelle mir Dostojewski gern mit einer undurchdringlichen Aura des Geheimnisses vor. Ich kann ihn mir zum Beispiel nicht mit einem Hut ausmalen – mit einem Hut, wie ihn Swedenborg seinen Engeln als Kopfbedeckung gab. Ich bin überdies immer äußerst neugierig darauf, was andere über ihn zu sagen haben, selbst wenn ihre Ansichten für mich keinen Sinn ergeben. Erst neulich bin ich auf eine Bemerkung gestoßen, die ich einmal in mein Notizbuch geschrieben habe. Wahrscheinlich rührt sie von Berdjajew her.
Hier ist sie: «Nach Dostojewski war der Mensch nicht mehr, was er vorher gewesen war.» Ermutigender Gedanke für eine leidende Menschheit.
Das Folgende kann auch nur Berdjajew geschrieben haben: «Dostojewski hat dem Bösen gegenüber nicht immer dieselbe Haltung eingenommen. Zu einem großen Teil mag es so aussehen, als sei er irregegangen. Einerseits ist bei ihm das Böse das Böse, das angeprangert und ausgebrannt gehört. Andererseits ist das Böse eine geistige Erfahrung des Menschen. Es gehört zu ihm. Im Verlauf seines Lebensweges kann der Mensch durch das Böse bereichert werden, aber dies muß man auf die richtige Weise verstehen. Es ist nicht das Böse selbst, das ihn bereichert, er wird durch die in ihm geweckte Kraft zur Überwindung des Bösen bereichert. Der Mensch, welcher sagt: ‹Ich will mich dem Bösen ergeben, weil ich dadurch bereichert werde›, wird nie innerlich reicher werden, er geht zugrunde. Das Böse stellt die Freiheit des Menschen auf die Probe… »
Und nun noch ein Zitat (wieder aus Berdjajew), da es uns dem Himmel einen Schritt näher bringt.
«Die Kirche ist nicht das Reich Gottes. Die Kirche ist eine geschichtliche Erscheinung und hat in der Geschichte gewirkt. Sie bedeutet nicht die Umwandlung der Welt, das Erscheinen einer neuen Welt und einer neuen Erde. Das Reich Gottes ist eine Umgestaltung der Welt, nicht nur die des einzelnen Menschen, sondern auch die der Gesellschaft und des ganzen Kosmos, und das ist das Ende dieser Welt, der Welt des Unrechts und der Häßlichkeit, es ist der Anfang einer neuen Welt, einer Welt des Rechts und der Schönheit. Wenn Dostojewski sagt, die Schönheit würde die Welt erretten, so hat er die Umgestaltung der Welt und das Kommen des Reiches Gottes im Sinn, und dies ist die eschatologische Hoffnung… »
Nur für mich selbst sprechend muß ich sagen: wenn ich je irgendwelche Hoffnungen, eschatologische oder andere, gehegt habe, so hat Dostojewski sie zerstört. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, daß er die durch meine westliche Erziehung erzeugten kulturellen Aspirationen «zunichte machte». Mein asiatischer Teil, mit einem Wort, der Mongole in mir, ist davon unberührt geblieben und wird es immer sein. Diese meine mongolische Seite hat nichts mit Kultur und Persönlichkeit zu tun, sie stellt das Wurzelwerk dar, dessen Saft bis zu einem zeitlosen Vorfahrenast des Stammbaums zurückfließt. In dieses unergründliche Reservoir haben sich alle chaotischen Elemente meiner eigenen Natur und meines amerikanischen Erbes ergossen, so wie der Ozean die Flüsse verschluckt, die in ihn einmünden. Sonderbarerweise habe ich als Amerikaner Dostojewski oder vielmehr seine Charaktere und die Probleme, die sie quälen, besser verstanden, als wenn ich Europäer gewesen wäre. Die englische Sprache, scheint mir, eignet sich besser zur Wiedergabe der Schriften Dostojewskis (wenn man ihn in einer Übersetzung lesen muß) als Französisch, Deutsch, Italienisch oder jede andere nichtslawische Sprache. Und das amerikanische Leben, vom Gangstermilieu bis zu den Intellektuellen hinauf, hat paradoxerweise erschreckende Ähnlichkeiten mit Dostojewskis vielseitigem russischem Alltagsleben. Welche besseren Beweisgründe kann man dafür anführen als die Weltstadt New York, in deren aus allen möglichen Bestandteilen gemischtem Boden jede leichtfertige, gemeine und verrückte Idee emporsprießt wie Unkraut? Man braucht nur an den dortigen Winter zu denken, sich vorzustellen, was es bedeutet, wenn man hungrig, einsam und verzweifelt in dem Labyrinth monotoner Straßen umherirrt, an den monotonen Häusern entlang, in denen monotone Menschen mit monotonen Gedanken wohnen. Alles monoton und gleichzeitig grenzenlos!
Obgleich Millionen unter uns nie Dostojewski gelesen haben, ja selbst mit dem Namen nichts anzufangen wüßten, wenn sie ihn hörten, so kommen sie doch, tatsächlich Millionen, direkt aus Dostojewski, führen hier in Amerika dasselbe unheimliche «Tollhäuslerleben» wie Dostojewskis Gestalten in dem Rußland seiner Phantasie. Wenn man noch gestern annehmen konnte, sie hätten eine menschliche Existenz, so wird morgen ihre Welt einen Charakter und Konturen haben, die verhexter anmuten als irgendeine Schöpfung von Hieronymus Bosch. Heute bewegen sie sich Ellbogen an Ellbogen neben uns und setzen anscheinend durch ihre vorsintflutliche Erscheinung niemanden in Erstaunen. Einige üben in der Tat ihren Beruf weiter aus – predigen das Evangelium, kleiden Leichname zur Beerdigung an, versorgen die Irren –, als wenn nichts von Bedeutung passiert wäre. Sie haben nicht die leiseste Ahnung, daß «der Mensch nicht mehr das ist, was er vorher war».
2
Wie aufregend still und öde ist es doch an einem Wintermorgen auf den Straßen, wenn eiserne Brückenträger bis in den Boden hinein gefroren sind und die Milch in der Flasche hochsteigt wie ein Pilzstengel. Ein Polartag, meine ich, an dem das dümmste Tier nicht wagen würde, die Nase aus seinem Loch zu stecken. Es wäre undenkbar, an einem solchen Tag einen Fremden anzureden und ihn um ein Almosen zu bitten. In dieser beißenden, nagenden Kälte, wenn der eisige Wind durch die düsteren Schluchten der Straßen pfeift, würde niemand, der seine fünf Sinne beisammen hat, genug Zeit finden, in die Tasche zu greifen und nach einem Geldstück zu suchen. An einem Morgen wie diesem, den ein wohlbestallter Bankier «klar und frisch» nennen würde, hat ein Bettler kein Recht, hungrig zu sein oder um ein Almosen zu bitten. Bettler gehören zu warmen, sonnigen Tagen, wenn selbst ein sadistisch veranlagter Spaziergänger stehenbleibt und den Vögeln Brotkrumen hinwirft.
An einem solchen Tag suchte ich absichtlich einige Hefte mit Stoffmustern zusammen und begab mich zu den Kunden meines Vaters, obwohl ich im voraus wußte, daß ich keinen Auftrag bekommen würde. Ich wurde nur von einem verzehrenden Hunger nach Unterhaltung getrieben.
Es war besonders ein Kunde, den ich immer bei solchen Gelegenheiten aufsuchte, weil bei ihm der Tag in höchst ungewöhnlicher Weise enden konnte und gewöhnlich auch endete. Ich sollte noch erwähnen, daß dieser Kunde nur selten einen Anzug bestellte und uns auf die Bezahlung der Rechnung jahrelang warten ließ. Er war aber schließlich doch ein Kunde. Meinem Alten machte ich vor, ich suchte John Stymer auf, um ihn zu veranlassen, den Gehrock zu kaufen, den er, wie wir annahmen, eines Tages benötigen würde. (Dieser Stymer prahlte immer damit, er würde eines Tages Richter werden.)
Nie sagte ich dem Alten aber etwas von der Art der unschneiderlichen Unterhaltung, die ich gewöhnlich mit dem Mann führte.
«Hallo! Aus welchem Grunde kommen Sie zu mir?»
So begrüßte er mich gewöhnlich.
«Sie müssen verrückt sein, wenn Sie glauben, ich brauchte noch mehr Anzüge. Ich habe nicht mal den letzten bezahlt, nicht wahr? Wann habe ich ihn bekommen – vor fünf Jahren?»
Dabei hob er kaum den Kopf aus der Masse Papiere, in die er seine Nase vergraben hatte. Ein übler Geruch herrschte in dem Büro, denn er hatte die Gewohnheit – und sie war kaum mehr auszurotten –, dauernd zu furzen, selbst in Gegenwart seiner Schreibkraft. Er bohrte auch immer in der Nase. Sonst – äußerlich, meine ich – hätte er Herr Jedermann sein können. Ein Rechtsanwalt wie jeder andere.
Den Kopf noch in einem Gewirr Aktenstücke verborgen zirpt er: «Was lesen Sie jetzt so?» Bevor ich antworten kann, setzt er hinzu: «Können Sie draußen ein paar Minuten warten? Ich stecke bis über den Kopf in Arbeit. Aber gehen Sie ja nicht fort – ich möchte gern mit Ihnen plaudern.» Mit diesen Worten greift er in die Tasche und zieht einen Dollarschein heraus. «Hier – trinken Sie einen Kaffee, damit Ihnen die Zeit nicht so lang wird. In einer Stunde kommen Sie zurück … wir werden dann zusammen essen.»
Im Vorzimmer wartete ein halbes Dutzend Klienten, die ihn konsultieren wollten. Jeden bittet er, noch ein bißchen länger zu warten. Manchmal sitzen sie den ganzen Tag da.
Auf dem Weg zum Café wechsle ich den Schein, um mir eine Zeitung zu kaufen. Wenn ich die Nachrichten überfliege, habe ich die ungewöhnliche Sinnesempfindung, auf einem anderen Planeten zu sein. Ich muß mich ja auch auf dem laufenden halten, um es mit John Stymer aufnehmen zu können.
Beim Lesen der Zeitung fällt mir Stymers großes Problem ein. Masturbation. Seit Jahren versucht er nun schon, die lasterhafte Gewohnheit zu überwinden. Ich erinnere mich an Bruchstücke unserer letzten Unterhaltung. Ich weiß noch, daß ich ihm empfahl, ein gutes Hurenhaus zu versuchen. Was machte er da für ein verdrießliches Gesicht! «Was! Ich, ein verheirateter Mann, soll mich mit einer Schar schmutziger Huren einlassen?» Als Antwort fiel mir nur ein: «Sie sind nicht alle schmutzig.»
Zu Herzen aber ging mir die ernste, flehende Art, mit der er mich beim Abschied bat, ihm ja Mitteilung zu machen, wenn mir etwas einfiele, was helfen könnte – was es auch sei. Ich hätte am liebsten gesagt: «Abschneiden!»
Eine Stunde verging. Für ihn war eine Stunde wie fünf Minuten. Schließlich stand ich auf und verließ das Café. Es war so eisig draußen, daß ich mich gern in Galopp gesetzt hätte.
Zu meiner Überraschung wartete er schon auf mich. Seine gefalteten Hände ruhten auf dem Schreibtisch, seine Augen waren auf einen Stecknadelknopf irgendwo in der Ewigkeit gerichtet. Das Päckchen Stoffmuster, das ich auf dem Schreibtisch hatte liegen lassen, war geöffnet. Er habe sich entschlossen, einen Anzug zu bestellen, so teilte er mir mit.
«Aber es eilt nicht damit. Ich brauche keine neuen Anzüge.»
«Dann bestellen Sie keinen. Sie wissen ja, ich bin nicht hergekommen, um Ihnen einen Anzug zu verkaufen.»
«Merkwürdig», sagte er, «Sie sind so ungefähr der einzige Mensch, mit dem ich eine richtige Unterhaltung zustande bringe. Jedesmal, wenn ich Sie sehe, geht mir das Herz auf … Was können Sie mir diesmal empfehlen? Ich meine, in literarischer Hinsicht. Das letzte Mal war es Oblomow, nicht wahr? Das Buch hat aber keinen großen Eindruck auf mich gemacht.»
Er legte eine Pause ein, nicht etwa um zu hören, was ich darauf zu erwidern hätte, sondern um Schwungkraft zu gewinnen.
«Seit Ihrem letzten Besuch habe ich eine Liebesaffäre gehabt. Setzt Sie das in Erstaunen? Ja, ein junges Mädchen, sehr jung und dazu noch eine Nymphomanin. Saugt mir den letzten Tropfen aus. Aber das macht mir keine Sorgen – die macht mir vielmehr meine Frau. Es ist geradezu qualvoll, wie sie mir zusetzt. Ich möchte aus der Haut fahren.»
Als er das Grinsen auf meinem Gesicht sah, setzte er hinzu: «Lächerlich ist das durchaus nicht, das kann ich Ihnen sagen.»
Das Telefon läutete. Er hört aufmerksam zu, sagt aber nichts als ja, nein, glaube wohl, doch plötzlich brüllt er in das Mundstück hinein: «Ich will Ihr schmutziges Geld nicht. Er soll sich einen anderen Verteidiger suchen.
Stellen Sie sich vor, der wollte mich bestechen», wettert er, indem er den Hörer auf die Gabel schmettert. «Und dabei ist er Richter. Ein großes Tier dazu.» Er putzte sich geräuschvoll die Nase. «Nun, wo waren wir stehengeblieben?» Er erhob sich. «Wie wär's, wenn wir einen Happen äßen? Bei Essen und Wein läßt sich's besser reden, meinen Sie nicht?»
Er rief ein Taxi, und wir fuhren zu einem italienischen Restaurant, in dem er oft saß. Es war ein gemütliches Lokal, das stark nach Wein, Sägemehl und Käse roch. Wir waren fast die einzigen Gäste.
Als wir bestellt hatten, sagte er: «Sie haben doch nichts dagegen einzuwenden, wenn ich von mir spreche. Ich denke, das ist meine Schwäche. Selbst wenn ich lese, mag das Buch auch gut sein, muß ich an mich und meine Probleme denken. Nicht, daß ich mich für so wichtig halte, verstehen Sie. Ich bin einfach besessen von mir.
Sie sind ebenfalls besessen», fuhr er fort, «aber auf gesündere Weise. Ich bin ganz von mir in Anspruch genommen und hasse mich deshalb. Es ist ein richtiger Ekel, den ich vor mir habe. Kein anderer Mensch würde mir ein solches Gefühl einflößen. Ich kenne mich durch und durch, und wenn ich daran denke, was ich bin, und wie ich anderen erscheinen muß, bin ich entsetzt. Ich habe nur eine gute Eigenschaft: ich bin ehrlich. Ich tue mir nichts darauf zugute … es ist ein rein instinktiver Zug. Ja, ich bin mit meinen Klienten ehrlich und ehrlich mit mir selbst.»
Ich unterbrach ihn. «Sie mögen mit sich selbst ehrlich sein, wie Sie sagen, aber es wäre besser für Sie, wenn Sie großzügiger wären. Ich meine, gegen Sie selbst. Wenn Sie sich selbst nicht anständig behandeln können, wie können Sie das dann von anderen erwarten?»
«Es liegt nicht in meiner Natur, solche Gedanken zu hegen», antwortete er schnell. «Ich bin Puritaner von meinen Vorfahren her, allerdings ein degenerierter. Das Schlimme ist nur, ich bin nicht degeneriert genug. Sie haben mich einmal gefragt, wenn Sie sich noch erinnern, ob ich je den Marquis de Sade gelesen hätte. Nun, ich habe es versucht, aber er langweilt mich zu Tode. Vielleicht ist er für meinen Geschmack zu französisch. Ich verstehe nicht, warum man ihn den göttlichen Marquis nennt.»
Mittlerweile hatten wir den Chianti gekostet und steckten bis über die Ohren in Spaghetti. Der Wein machte ihn noch redseliger. Er konnte eine Menge trinken, ohne benebelt zu werden. Tatsächlich war dies auch ein Problem, mit dem er nicht fertig werden konnte – selbst unter Alkoholeinfluß konnte er sich nicht verlieren.
Als wenn er meine Gedanken erraten hätte, machte er die Bemerkung, er sei durch und durch Kopfmensch. «Ein Kopfmensch, der selbst seinen Schwengel zum Denken bringen kann. Da lachen Sie wieder, aber es ist tragisch. Das junge Mädchen, von dem ich sprach, hält mich für einen großen Bock. Das bin ich aber nicht. Während sie richtig wütig ist, ficke ich mit dem Gehirn. Es ist, als führte ich ein Kreuzverhör, nur daß ich dabei meinen Schwengel anstatt meinen Geist zu Hilfe nehme. Klingt ulkig, wie? Ist es auch, denn je mehr ich loslege, desto mehr konzentriere ich mich auf mich selbst. Nur dann und wann – bei ihr heißt das – merke ich, daß noch ein anderer da ist. Das muß eine Folge der Wichserei sein. Verstehen Sie, was ich meine? Anstatt es mir selbst zu machen, macht es ein anderer für mich. Es ist besser, weil man noch weniger innerlich daran beteiligt ist. Das Mädchen hat natürlich großen Spaß daran. Sie kann alles mit mir machen, was sie will. Das ist es, was sie reizt, sie aufregt. Aber sie weiß nicht – sie würde wohl erschrecken, wenn ich ihr das sagte –, daß ich nicht da bin. Sie kennen den Ausdruck – ganz Ohr sein. Nun, ich bin ganz Geist. Ein Geist mit einem Schwengel – wenn man es so sagen kann. Irgend einmal möchte ich Sie übrigens fragen, wie das mit Ihnen ist. Was Sie für ein Gefühl haben, wenn Sie das tun … wie Sie darauf reagieren und all das. Mir würde das zwar nicht viel helfen. Ich bin nur neugierig.»
Plötzlich sprang er auf ein anderes Thema über. Er wollte wissen, ob ich schon etwas geschrieben hätte. Als ich es verneinte, sagte er: «Sie sind ja jetzt am Schreiben, nur merken Sie es nicht. Sie schreiben die ganze Zeit, kommt Ihnen das nicht zum Bewußtsein?»
Diese sonderbare Bemerkung setzte mich in Erstaunen, und ich fragte: «Meinen Sie mich – oder jedermann?»
«Natürlich nicht jedermann, Sie, Sie meine ich.»
Seine Stimme wurde schrill und nahm einen gereizten Ton an. «Sie haben mir einmal gesagt, Sie würden gern schreiben. Wann wollen Sie denn damit anfangen?» Er machte eine Pause, um eine gehäufte Gabel Essen in den Mund zu führen. Er schluckte noch, als er fortfuhr: «Warum spreche ich wohl so zu Ihnen? Etwa weil Sie gut zuhören können? Durchaus nicht. Ich kann Ihnen mein Herz ausschütten, weil ich weiß, daß Sie im tiefsten Grunde kein Interesse an mir haben. Nicht ich, John Stymer, interessiert Sie, sondern das, was ich Ihnen sage, oder wie ich es sage. Aber ich interessiere mich bestimmt für Sie. Das ist ein großer Unterschied.»
Schweigend kaute er eine Weile. «Sie sind fast so kompliziert wie ich», fuhr er dann fort. «Das wissen Sie, nicht wahr? Ich erführe gern, was einen Menschen, besonders einen Typ wie Sie, vertrauenswürdig macht. Aber keine Angst, ich werde Ihnen nicht auf den Grund gehen, weil ich im voraus weiß, daß Sie mir nicht die richtigen Antworten geben. Sie können es mit mir nicht aufnehmen. Ich bin Rechtsanwalt. Es ist mein Beruf, Prozesse zu führen. Was Sie aber treiben, kann ich mir nicht vorstellen – außer, Sie tun gar nichts?»
Hier schloß er sich wie eine Muschel und begnügte sich eine Weile mit Kauen und Schlucken. Dann sagte er: «Ich hätte gute Lust, Sie einzuladen, heute nachmittag zu mir zu kommen. Ich gehe nicht in mein Büro zurück. Ich will das Mädchen besuchen, von dem ich Ihnen erzählt habe. Warum sollten Sie nicht mitkommen? Sie ist nicht schüchtern, und man kann sich leicht mit ihr unterhalten. Ich möchte beobachten, wie sie auf Sie wirkt.» Er wartete einen Augenblick, um zu sehen, wie ich den Vorschlag aufnahm. Dann fuhr er fort: «Sie wohnt draußen auf Long Island. Es ist zwar eine ordentliche Strecke Fahrt, aber es lohnt sich vielleicht. Wir nehmen Wein und eine Flasche Strega mit. Sie trinkt gern Liköre. Was meinen Sie?»
Ich stimmte zu. Wir gingen zur Garage, wo er seinen Wagen untergestellt hatte. Es dauerte eine Weile, bis wir ihn in Gang brachten, denn er war eingefroren. Kaum waren wir eine kurze Strecke gefahren, da funktionierte dies und das nicht. Mit dem Aufenthalt in Garagen und Reparaturwerkstätten muß es fast drei Stunden gedauert haben, bis wir über die Stadtgrenze hinaus waren. Mittlerweile waren wir vollständig durchgefroren. Wir mußten noch neunzig Kilometer fahren, und es war bereits stockdunkel.
Sobald wir auf die Autostraße kamen, hielten wir noch mehrmals, um uns aufzuwärmen. Überall schien Herr Stymer bekannt zu sein und wurde immer mit Hochachtung behandelt. Wenn wir weiterfuhren, erklärte er mir, wie er diesen und jenen zum Freund gewonnen hatte. «Ich übernehme nie einen Fall», sagte er, «wenn ich nicht sicher bin, daß ich ihn gewinnen kann.»
Ich versuchte, nähere Einzelheiten über das Mädchen zu erfahren, aber er war mit anderen Dingen beschäftigt. Merkwürdigerweise fesselte ihn jetzt vor allem die Frage der Unsterblichkeit. Was hatte ein Weiterleben für einen Sinn, so wollte er wissen, wenn man beim Tode seine Persönlichkeit verlor? Er war überzeugt, daß eine einzige Lebenszeit nicht hinreichte, um die Probleme, mit denen man sich herumschlug, zu lösen. «Ich habe mein Leben noch kaum begonnen», sagte er, «und ich bin bereits nahe an fünfzig. Man sollte hundertfünfzig oder zweihundert Jahre leben, dann könnte man etwas erreichen. Die wirklichen Probleme beginnen erst, wenn man mit dem Geschlechtlichen und allen materiellen Schwierigkeiten fertig ist. Mit fünfundzwanzig glaubte ich, ich wüßte alle Antworten. Jetzt habe ich das Gefühl, daß ich überhaupt nichts weiß. Da fahren wir nun zu einer jungen Nymphomanin. Was für einen Sinn hat das?» Er zündete eine Zigarette an, machte einige Züge und warf sie dann weg. Im nächsten Augenblick zog er eine dicke Zigarre aus seiner Brusttasche.
«Sie möchten sicher etwas über sie hören. Nun, dann will ich Ihnen gleich dies sagen: wenn ich nur den nötigen Mut hätte, würde ich sie mir schnappen und mit ihr nach Mexiko fahren. Was ich dort tun soll, weiß ich zwar nicht. Ganz von vorn anfangen, nehme ich an. Aber da sitze ich auch schon in der Patsche – ich habe nicht den Mut dazu. Die Wahrheit ist, ich bin ein moralischer Feigling. Übrigens weiß ich, daß sie mich an der Nase herumführt. Jedesmal, wenn ich mich von ihr trenne, frage ich mich: mit wem wird sie ins Bett gehen, sobald ich außer Sicht bin? Nicht daß ich eifersüchtig bin – ich lasse mich nur nicht gern für dumm halten. Ja, ich bin ein Scheißkerl. Außer auf juristischem Gebiet bin ich ein vollendeter Narr.»
In dieser Tonart ging es eine Zeitlang weiter. Es bereitete ihm sichtlich Behagen, sich herabzusetzen. Ich lehnte mich zurück und hörte mir mit ebenso großer Behaglichkeit alles an.
Jetzt war er bei einem neuen Thema angelangt. «Wissen Sie, warum ich kein Schriftsteller geworden bin?»
«Nein», sagte ich, erstaunt, daß er je einen solchen Gedanken gehabt hatte.
«Weil ich fast sogleich herausfand, daß ich nichts zu sagen hatte. Ich habe nie gelebt – das ist der eigentliche Grund. Wer nichts aufs Spiel setzt, gewinnt nichts. Wie heißt doch das orientalische Sprichwort? ‹Furcht ist, wenn man wegen der Vögel nicht aussäet.› Diese verrückten Russen, die Sie mir zu lesen gaben, hatten alle Lebenserfahrung, selbst wenn sie sich von dem Fleck nicht wegrührten, an dem sie geboren wurden. Nur im richtigen Klima kann sich etwas ereignen. Und fehlt das Klima, so schafft man eines, wenn man Genie hat. Ich habe nie etwas geschaffen. Ich beteiligte mich an dem Spiel und spielte es nach den Regeln. Das ist so gut wie Totsein, falls Sie es noch nicht wissen sollten. Ja, ich bin so gut wie tot. Aber knacken Sie diese Nuß mal : wenn ich am totesten bin, ficke ich am besten. Malen Sie sich das aus, wenn Sie können! Nur um Ihnen ein Beispiel zu geben: als ich das letzte Mal bei ihr schlief, zog ich mich erst gar nicht aus. Ich kletterte voll angezogen ins Bett, nicht einmal die Schuhe legte ich ab. Bei dem Geisteszustand, in dem ich mich befand, erschien mir das vollkommen natürlich. Auch sie fand nichts dabei. Wie gesagt, ich stieg voll angezogen ins Bett und erklärte ihr: ‹Warum bleiben wir nicht so liegen und ficken uns zu Tode?› Ein sonderbarer Gedanke, was? Besonders wenn er von einem angesehenen Rechtsanwalt mit Familie und allem Drum und Dran kommt. Aber die Worte waren kaum dem Gehege meiner Zähne entflohen, als ich mir sagte: Du Dummkopf! Du bist ja bereits tot. Warum heuchelst du denn so? Na, was sagen Sie dazu? Damit überließ ich mich … der Fickerei natürlich.»
Hier warf ich ihm einen Köder hin. Ob er sich jemals ausgedacht hätte, fragte ich, er besäße im Jenseits einen Schwengel und benützte ihn.
«Und ob!» rief er. «Gerade diese Vorstellung verfolgt mich ja. Ein unsterbliches Leben mit einem Riesenschwengel, der mir aus dem Gehirn wächst, hat gar keine Reize für mich. Ich möchte zwar auch nicht das Leben eines Engels führen. Ich möchte ich selbst sein, John Stymer, mit all meinen verdammten Problemen. Ich brauche Zeit, um alles auszudenken … tausend Jahre oder mehr. Klingt blöd, was? Aber so bin ich. Der Marquis de Sade hatte eine Menge Zeit für sich. Er hat sich allerlei ausgedacht, muß ich zugeben, aber mit seinen Schlußfolgerungen kann ich nicht übereinstimmen. Was ich sagen wollte, ist dies: sein Leben im Gefängnis zu verbringen, ist nicht so schrecklich … wenn man einen aktiven Geist hat. Schrecklich ist, wenn man sich selbst zum Gefangenen macht. Und das sind die meisten von uns – Selfmade-Gefangene. In einer Generation gibt es kaum ein Dutzend Menschen, die ausbrechen. Wenn man das Leben mit klaren Augen überblickt, ist es ein Hokuspokus, und noch dazu ein großer. Man stelle sich vor, daß ein Mensch sein Leben damit zubringt, andere zu verteidigen oder zu überzeugen! Die ganze Juristerei ist durchaus ungesund. Niemand ist auch nur um ein Haar besser dran, weil wir Gesetze haben. Nein, es ist ein Narrenspiel, dem man einen pompösen Namen gibt, um ihm Würde zu verleihen. Morgen sitze ich vielleicht auf dem Richterstuhl. Ein Richter, stellen Sie sich das vor! Werde ich dann eine bessere Meinung von mir haben, weil ich zum Richteramt berufen worden bin? Werde ich etwas ändern können? Gar nichts. Wie aber werde ich das Spiel spielen … diesmal das Richterspiel. Darum sage ich, wir sind schon von Anfang an die Betrogenen. Ich bin mir der Tatsache bewußt, daß wir alle eine Rolle zu spielen haben, und man kann wohl nichts anderes tun als diese Rolle so gut spielen, wie es einem möglich ist. Nun, meine Rolle gefällt mir nicht. Schon der Gedanke, eine Rolle spielen zu müssen, geht mir wider den Strich. Es hilft mir auch nichts, daß man die verschiedenen Rollen austauschen kann. Verstehen Sie mich? Es ist Zeit, daß wir eine neue Ordnung bekommen, einen neuen Anfang machen. Die Gerichte müssen weg, die Gesetze müssen weg, die Polizei muß weg, die Gefängnisse müssen weg. Was wir treiben, ist Irrsinn. Darum ficke ich mir das Gehirn weg. Wenn Sie alles in demselben Licht sehen könnten wie ich, würden Sie das ebenfalls tun.» Er sprühte knatternd Funken wie ein Feuerwerkskörper und verzischte.
Nach kurzem Schweigen teilte er mir mit, wir wären bald da. «Wie ich Ihnen schon sagte, tun Sie so, als wären Sie zu Hause. Tun und sagen Sie, was Sie wollen. Niemand wird Ihnen in den Weg treten. Wenn Sie einen Gang mit ihr wagen – von mir aus! Okay! Nur dürfen Sie das nicht zur Gewohnheit werden lassen.»
Das Haus war in Dunkelheit gehüllt, als wir in den Zufahrtsweg bogen. Auf den Tisch im Eßzimmer war ein Zettel geheftet. Er war von Belle, der großen Fickerin. Sie habe lange genug gewartet, sie glaube nicht mehr, daß wir kämen, und so weiter.
«Wahrscheinlich in die Stadt gefahren, um dort die Nacht mit einem Freund zu verbringen.»
Er schien sich nicht sehr darüber aufzuregen, muß ich sagen. Er knurrte ein paarmal: «dies Biest» oder «dies Aas» und ging dann zum Kühlschrank, um nachzusehen, ob noch was zu essen da war.
«Wir können ruhig die Nacht hierbleiben», sagte er. «Sie hat uns Bohnengemüse und kalten Schinken dagelassen. Genügt Ihnen das?»
Als wir die Reste wegputzten, erfuhr ich, oben wäre ein gemütliches Zimmer mit zwei Betten. «So, jetzt können wir uns mal richtig ausquatschen.»
Das Bett verlockte mich, weil ich todmüde war. An einer intimen Aussprache lag mir wenig. Bei Stymer schien nichts die Maschine seines Geistes auf langsamere Gangart bringen zu können – weder Frost, noch Alkohol, noch Müdigkeit.
Ich wäre sofort eingeschlafen, sobald mein Kopf das Kissen berührte, hätte Stymer nicht auf so merkwürdige Art das Feuer eröffnet. Ich war plötzlich so hellwach, als hätte ich eine doppelte Dosis Pervitin genommen. Seine ersten Worte sprach er in einem ruhigen, gleichmäßigen Tonfall, aber sie elektrisierten mich.
«Überraschen kann Sie so leicht nichts, wie ich merke. Nun, wollen wir mal sehen, wie dies auf Sie wirkt… »
So begann er.
«Ich bin zum Teil deshalb ein so guter Rechtsanwalt, weil ich gleichzeitig etwas von einem Verbrecher an mir habe. Sie würden mich kaum für fähig halten, den Tod eines anderen Menschen zu planen, nicht wahr? Nun, ich trage mich mit dem Gedanken. Ich habe mich entschlossen, meine Frau aus dem Wege zu räumen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Es ist auch nicht wegen Belle, sondern nur weil sie mich zu Tode ärgert. Ich kann das nicht mehr ertragen. Seit zwanzig Jahren habe ich kein vernünftiges Wort mehr von ihr vernommen. Sie hat mich bis in den letzten Graben getrieben, und sie weiß das. Über Belle weiß sie Bescheid, ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht. Ihr kommt es nur darauf an, daß die Sache nicht bekannt wird. Hol sie der Teufel, sie hat mich zur Masturbation getrieben. Fast von Anfang an war sie mir so zuwider, daß der Gedanke, mit ihr zu schlafen, mir Übelkeit verursachte. Ja, wir hätten uns scheiden lassen können. Aber warum sollte ich mein ganzes Leben lang für einen Erdklumpen zahlen müssen? Seitdem ich mich in Belle verliebt habe, kann ich doch etwas freier atmen, nachdenken und planen. Ich habe nur noch das Ziel, weit über die Grenzen zu kommen und ganz von vorn anzufangen. Womit, das weiß ich nicht. Sicher nicht als Rechtsanwalt. Ich will allein sein und sowenig arbeiten wie möglich.»
Er holte Atem. Ich machte keine Bemerkung. Er erwartete auch keine.
«Um ganz offen mit Ihnen zu sein, mir ist der Gedanke gekommen, ob ich Sie wohl dazu bringen könnte, mit mir zu gehen. Ich würde für Sie sorgen, solange das Geld reicht, das versteht sich von selbst. Ich habe mir das ausgedacht, während wir hierherfuhren. Den Zettel, den Belle geschrieben hat, habe ich ihr diktiert. Glauben Sie mir bitte, als wir losfuhren, habe ich noch nicht an diese Möglichkeit gedacht, aber im Laufe unseres Gesprächs bekam ich das Gefühl, Sie wären, wenn ich den Sprung machte, gerade die Person, die ich bei mir haben möchte.»
Er zögerte eine Weile und fügte dann hinzu: «Was ich mit meiner Frau vorhabe, mußte ich Ihnen sagen, weil … man nicht mit einem Menschen zusammenleben kann, wenn man ein solches Geheimnis mit sich herumschleppt, das wäre eine zu große Anstrengung.»
«Aber ich habe auch eine Frau!» rief ich aus, was mich selbst überraschte. «Obschon ich nicht viel mit ihr anfangen kann, könnte ich mich doch nicht dazu verstehen, sie sitzenzulassen oder gar umzubringen, nur um mit Ihnen irgendwohin auszureißen.»
«Ich verstehe», sagte Stymer ruhig. «Auch daran habe ich gedacht.»
«So?»
«Ich könnte Ihnen leicht ein Scheidungsurteil verschaffen, ohne daß Sie Unterhaltsbeiträge zahlen müßten. Was sagen Sie dazu?»
«Interessiert mich nicht», erwiderte ich. «Nicht einmal, wenn Sie mir eine andere Frau verschaffen könnten. Ich habe meine eigenen Pläne.»
«Sie halten mich sicher für übergeschnappt, wie?»
«Nein, durchaus nicht. Übergeschnappt sind Sie allerdings, aber nicht in dem Sinne. Ich will offen mit Ihnen sein, Sie sind nicht gerade der Mensch, mit dem ich lange zusammen sein möchte. Übrigens ist auch alles viel zu unbestimmt. Es ähnelt alles mehr einem bösen Traum.»