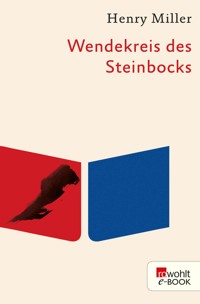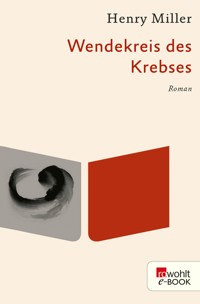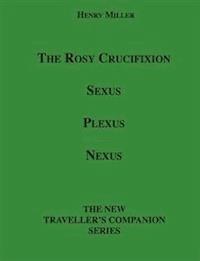9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Einzelne und die Gesellschaft, kreative Freiheit und Konformismus, American way of life und Europa – das sind die großen Themen der Texte, die hier erstmals gesammelt vorgelegt werden: streitbare Aufsätze aus zweieinhalb Jahrzehnten zu Fragen der Zeit, der Gesellschaft, der Literatur, engagiert, leidenschaftlich und beklemmend aktuell.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Henry Miller
Von der Unmoral der Moral
und andere Texte
Über dieses Buch
Der Einzelne und die Gesellschaft, kreative Freiheit und Konformismus, American way of life und Europa – das sind die großen Themen der Texte, die hier erstmals gesammelt vorgelegt werden: streitbare Aufsätze aus zweieinhalb Jahrzehnten zu Fragen der Zeit, der Gesellschaft, der Literatur, engagiert, leidenschaftlich und beklemmend aktuell.
Vita
Henry Miller, der am 26. Dezember 1891 in New York geborene deutschstämmige Außenseiter der modernen amerikanischen Literatur, wuchs in Brooklyn auf. Die Dreißiger Jahre verbrachte Miller im Kreis der «American Exiles» in Paris. Sein erstes größeres Werk, das vielumstrittene «Wendekreis des Krebses», wurde – dank des Wagemuts eines Pariser Verlegers – erstmals 1934 in englischer Sprache herausgegeben. In den USA zog die Veröffentlichung eine Reihe von Prozessen nach sich; erst viel später wurde das Buch in den literarischen Kanon aufgenommen. Henry Miller starb am 7. Juni 1980 in Pacific Palisades, Kalifornien.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2020
Copyright © 1979 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg // Copyright © 1962 by Henry Miller
Covergestaltung Umschlag-Konzept: any.way, Hamburg Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Coverabbildung iStock/Gettyimages/subjob
ISBN 978-3-644-00644-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
Die Stunde des Menschen
Kinder der Erde
Sesam, öffne dich!
Patchen : Mann des Zorns und des Lichts
Ein offener Brief an alle
Erste Liebe
Offener Brief an kleine Zeitschriften
Mein Leben als Echo
Von der Unmoral der Moral
Ionesco
1
2
3
Walt Whitman
Henry David Thoreau
Geld und wie es dazu wird
Vorwort
Lesen oder nicht lesen
Lindenzweige und Verrat
Drei neugeborene Elefanten
Anderson, der Geschichtenerzähler
Die Romane Albert Cosserys
Schweb still wie der Kolibri
Originaltitel und Quellen
Vorwort
Bei der Lektüre der vorliegenden Sammlung von Essays, Vorworten, Besprechungen und anderer Prosa sollte sich der Leser vor Augen halten, daß diese Texte während eines Zeitraums von über fünfundzwanzig Jahren entstanden und daß sie nicht chronologisch geordnet sind. Das Erstaunliche ist, daß sie dennoch ein Ganzes bilden. Es sieht so aus, als verliere man niemals seine Identität, wie oft man sich auch häutet.
Mir fällt beim Wiederlesen dieser Texte auf, daß sich zwar meine Lebensauffassung – meine Philosophie, wenn man so will – seit dem ‹Wendekreis des Krebses› geändert haben mag, meine Einstellung zur Gesellschaft aber dieselbe geblieben ist. Ich vermute, daß diejenigen, die Schwierigkeiten haben, mit dem ‹Wendekreis des Krebses› auch mit dem vorliegenden Buch nichts anfangen können. Die Gedanken, die ich darin äußere, dürften für ein prüdes Gemüt ebenso ungenießbar sein wie meine berüchtigten Erlebnisse aus der frühen Pariser Zeit.
In diesem Fall jedoch müßten neue Formeln herhalten, um meinen schlechten Geschmack zu beschreiben. Die vorliegenden Texte enthalten keine Obszönitäten. Und jedes einzelne Stück ist in sich abgeschlossen, auch wenn das vielleicht nicht immer auffällt. Ich möchte sogar behaupten, daß sich ein roter Faden durch die ganze Sammlung zieht, der sie zusammenhält, so lose miteinander verknüpft die Texte auch sein mögen.
Wie hart ich auch immer mit unserer Lebensweise ins Gericht gehe, der Tenor dieses Buches hat nichts Unerlaubtes. Amerika wird durch die Augen eines Amerikaners betrachtet und nicht durch die eines Hottentotten. Und Europa, das im Vergleich mit Amerika oft günstiger abschneidet, ist ein Europa, wie es nur ein Amerikaner sehen kann.
Nun, meine lieben Landsleute – als was werdet ihr mich diesmal abstempeln? Als unamerikanisch? Ich fürchte, das Epithet paßt nicht. Ich bin amerikanischer als ihr, nur gegen den Strich. Wenn ihr einen Augenblick nachdenkt, werdet ihr feststellen, daß gerade diese Eigenschaft mich in die Tradition einfügt. Alle Kritik, die ich gegen unsere Lebensweise, unsere Institutionen, unsere Fehler vorbringe, findet sich bereits bei Thoreau, Whitman, Emerson sogar in noch schärferer Form. Schon vor der Jahrhundertwende hatte Whitman zu seinen amerikanischen Landsleuten gesagt: «Ihr seid auf dem besten Weg, eine ganze Nation von Irren hervorzubringen.»
Heute kommt es einem vor, als sei bereits die ganze Welt verrückt geworden. Aber ob wir wollen oder nicht, wir marschieren an der Spitze des Zugs. Wir sind doch immer und überall die ersten.
Das beherrschende Thema dieses Buches ist die Misere des Menschen, die natürlich auf die gesellschaftliche Misere verweist, da sich Gesellschaft nur als eine Gesamtheit von Individuen begreifen läßt. Zwei der in diesem Buch vorgestellten Personen symbolisieren die Art des angedeuteten Dilemmas: Kenneth Patchen, unser eigener amerikanischer Poet, und George Dibbern, der erste und einzige «Weltbürger». Der Artikel über Patchen entstand 1947; seine Lage hat sich seitdem kein bißchen geändert, allenfalls zum Schlechteren. Seit ich ihn 1940 kennenlernte, hat er eine schlimme Krankheit nach der anderen durchgemacht. Heute, nach mehreren schweren Operationen, leidet er ständig unter Schmerzen, denn er ist allergisch gegen Medikamente und darf nichts Stärkeres als Aspirin einnehmen. Und obwohl er noch eine ganze Reihe von Gedicht- und Prosabänden veröffentlicht hat, seit ich das erste Mal über ihn schrieb, und dazu Hunderte von Umschlägen für seine Bücher entworfen hat, wird er von dem breiten Publikum noch immer nicht zur Kenntnis genommen. Und George Dibbern steht noch genau da, wo er angefangen hat; mit einundsiebzig arbeitet er heute irgendwo in Neuseeland als Scheuermann. So geht's einem, wenn man sich den Kompromissen verweigert. Wir kennen das Schicksal von Melville, Poe, Hart Crane, um nur die bekanntesten Namen zu nennen. Es ist eine lange Liste, und wenn man die Leidensgeschichte unserer Genies verfolgt, jagt es einem die Schamröte ins Gesicht. Ebenso wie die Indianer, die wir an die Wand gedrückt haben, sind die wahren Individuen, die schöpferischen Geister in unserer Mitte von vornherin zum Untergang verurteilt. Inzwischen floriert eine Vielzahl von Stiftungen, deren Direktoren eine geniale Begabung für die Förderung der Mittelmäßigkeit entfalten.
Nein, die Dinge haben sich kein bißchen geändert seit den Tagen des ‹Wendekreis des Krebses›, es sei denn zum Schlechteren. La vie en rose ist dem Künstler jedenfalls nicht bestimmt. Der Künstler, wenigstens der wirkliche Künstler, wird noch immer als suspekt betrachtet, als eine Bedrohung für die Gesellschaft. Die Konformisten, diejenigen, die das Spiel mitspielen, werden getätschelt und verhätschelt. Nirgendwo sonst auf der Welt, außer in Sowjetrußland, werden diese Konformisten so großzügig belohnt, nirgendwo sonst erhalten sie so breite Anerkennung für ihre Leistungen.
Soviel zu dem wichtigsten Punkt. Grundsätzlich möchte ich jedem raten: Warte nicht darauf, daß sich die Dinge ändern, die Stunde des Menschen ist bereits gekommen, und ob du in dem großen Getriebe unten oder oben arbeitest, wenn du ein schöpferischer Mensch bist, wirst du weiter produktiv sein, was auch immer komme. Was kannst du dir Besseres erhoffen? Man muß immer an sich selbst glauben, ob anerkannt oder nicht, ob beachtet oder nicht. Die Welt mag einem vorkommen wie die ausgemachte Hölle – wir tun ja schließlich alles dazu, nicht wahr? –, aber es gibt immer noch einen Freiraum, und wenn er in der eigenen Seele liegt, wo man sich ein Fleckchen Paradies schaffen kann, so verrückt das klingen mag.
Wenn du siehst, du kannst weder vor noch zurück, wenn du feststellst, daß du nicht mehr stehen noch sitzen oder liegen kannst, wenn deine Kinder an Unterernährung gestorben und deine alten Eltern ins Armenhaus oder in die Gaskammer geschickt worden sind, wenn du merkst, du kannst weder schreiben noch nicht schreiben, wenn du überzeugt bist, daß alle Auswege versperrt sind, dann kannst du nur noch an Wunder glauben oder still in der Luft schweben wie der Kolibri. Das Wunder ist, daß es den Honig gibt, gleich vor deiner Nase, du warst nur zu sehr damit beschäftigt, ihn anderswo zu suchen. Das Schlimmste ist nicht der Tod, sondern Blindsein, blind für die Tatsache, daß alles am Leben im Bereich des Wunderbaren liegt.
Die Gesellschaft drückt sich durch Konformität aus; das schöpferische Individuum durch Freiheit. Das Leben wird weiterhin eine Hölle sein, solange die Menschen, die die Welt ausmachen, die Augen vor der Wirklichkeit verschließen. Von einer Ideologie zur anderen umzuschalten ist sinnlos. Jeder einzelne von uns ist einmalig und muß als solcher anerkannt werden. Daß wir Amerikaner oder Franzosen oder was sonst immer sind, sagt wenig über uns. In erster Linie sind wir alle Menschen, einer vom anderen verschieden, und wir sind gezwungen, miteinander zu leben, in demselben Topf zu schmoren. Die schöpferischen Geister sind die Befruchter: sie sind die Lamed Waw, die die Welt vor dem Auseinanderfallen bewahren. Ignoriert man sie, unterdrückt man sie, wird die Gesellschaft zu einer Ansammlung von Automaten.
Was wir nicht hinnehmen, nicht sehen oder hören wollen, sei es Unsinn, Verrat oder Gotteslästerung, gerade das sind die Dinge, auf die wir achten sollten. Selbst der Idiot könnte eine Botschaft für uns haben. Vielleicht bin ich einer dieser Idioten. Aber ich sage, was ich zu sagen habe.
It's a long, long way to Tipperary und, wie Fritz von Unruh sagt: «Noch ist nicht das Ende.»
Kalifornien, 16. Februar 1962
Henry Miller
Die Stunde des Menschen
Wenn Walker Winslow und ich zu Fuß an der Autostraße entlang von der Arbeit nach Hause gingen, kamen wir oft auf ein Thema zurück – wie wunderbar einfach und wirkungsvoll gegenseitige Hilfe ist. Walker war Mitglied bei den Anonymen Alkoholikern gewesen und hatte dort immer wieder beobachten können, was für verblüffende Ergebnisse allein schon das Solidaritätsgefühl bewirkt. Wenn nun ein Alkoholiker, der sich für hilflos und hoffnungslos hält, allein durch das Zusammensein mit Leidensgefährten Trost findet und gestützt wird, wie steht es dann mit den anderen Hilflosen, den anderen Süchtigen, den anderen Opfern der Gesellschaft? (Das heißt mit der großen Mehrzahl der Menschheit.) Sitzen wir nicht alle in demselben Boot? Wer von uns ist schon Herr seines Schicksals? Von wie vielen unserer Freunde und Bekannten können wir sagen: «Das ist ein freies Individuum!» Oder gar: «Das ist ein Mensch, der sich selbst genügt!»
Die Substanz unserer Überlegungen könnte ich so zusammenfassen: Angenommen, wir alle verstünden uns nicht als Mitglieder in einer Organisation, sondern als Angehörige einer alten, beständigen Gemeinschaft, der einzigen, der wir uns wirklich verpflichtet fühlen können – der Menschheit; angenommen, wir begegneten Abweichungen von der Norm nicht mit Vorwurf und Strafe, sondern mit Verständnis und Mitgefühl, mit dem Verlangen zu helfen, statt mit dem Verlangen, uns zu schützen. Angenommen, wir gründeten unsere Sicherheit allein auf die Gewißheit gegenseitiger Hilfe. Angenommen, wir zerrissen das Netz komplizierter Gesetze, dessen Maschen uns jetzt umfangen, und setzten an seine Stelle das ungeschriebene Gesetz, daß kein Schrei aus der Not, kein Hilferuf ungehört bleiben darf. Ist nicht der Impuls, einander zu helfen, genauso stark, ja, stärker noch als der Impuls, einander zu verdammen? Leiden wir nicht unter dem Mißbrauch dieses Instinkts, unter seiner Usurpation durch den Staat und mildtätige Organisationen aller Art? Kurzum, wenn wir wüßten, daß wir, in welcher Notlage auch immer, nur davon zu sprechen brauchten, damit uns geholfen würde, wären wir dann nicht der meisten Übel, die uns jetzt plagen, schon ledig? Sind wir nicht alle Opfer von Angst und Furcht, eben weil wir kein Vertrauen zueinander, ineinander haben? Und dies um so mehr, als uns die Intelligenz fehlt, eine Macht und Weisheit zu erkennen, die größer ist als die unsere?
Da gibt es ein kurzes Gebet, das von Mitgliedern der Anonymen Alkoholiker oft gesprochen wird: «Gott schenke uns die Gelassenheit, das hinzunehmen, was wir nicht ändern können, den Mut, das zu ändern, was wir ändern können, und die Weisheit, zwischen beiden zu unterscheiden.»
Um zur Crux des Problems zu kommen, das uns verfolgte, hier die Frage, die wir einander stellten: «Kann man einem anderen wirklich helfen, und wenn ja: wie?»
Die Frage ist natürlich schon längst von Jesus beantwortet worden, einfach und direkt – wie im Zen, sind wir heute zu sagen versucht. Jesus hat mehrfach sehr deutlich gesagt, sogar befohlen, daß man nicht erst nachdenken, sondern sofort auf jeden Hilferuf antworten soll. Großmütig antworten: Gib ihm nicht nur deinen Rock, sondern auch den Mantel, geh nicht nur eine Meile, sondern zwei. Und wie wir wissen, gehört zu dieser Forderung eine andere, noch wichtigere – Böses mit Gutem zu vergelten. «Ihr sollt nicht nicht widerstreben dem Bösen!»
Durch die Gleichnisse Jesu geht ein anderer lehrreicher Gedanke: daß wir keine Unruhe stiften, nichts übertünchen und uns nicht anmaßen sollen, andere zu unserer Denkweise zu bekehren, sondern die Wahrheit zeigen sollen, die in uns wohnt, indem wir instinktiv und spontan reagieren, wenn wir mit etwas konfrontiert werden. Mit anderen Worten: wir sollen unser Teil tun und auf den Herrn vertrauen.
Indem wir aufgeschlossen, mit vollem Geist, auf jede Forderung antworten, die an uns gestellt wird, helfen wir unserem Nächsten, sich selbst zu helfen. Für Jesus war das kein Problem. Es war einfach. Indem man das volle Maß seiner selbst gab – mehr, mit anderen Worten, als verlangt war –, versetzte man den, der in Not war, in seine menschliche Würde zurück. Man gab von dem Kelch, der überfloß. Die Not des anderen war sofort gestillt, weil sie aus dem unerschöpflichen Reservoir des Geistes schöpfen konnte. Und Geist antwortet auf Geist.
Die Antwort lautet also: immer bereit sein, sofort das Mögliche tun und geben, ohne zu knausern. Nicht die Motive des anderen oder die eigenen prüfen, nicht lang herumreden, nicht zaudern, sich nicht fragen nach dem Ergebnis der eigenen Handlungsweise – und ganz gewiß nicht nach Billigung, Bestätigung oder Belohnung Ausschau halten. Wenn diese Antwort für den einzelnen gilt, gilt sie auch für die Gesellschaft als Ganzes. Man ist nicht der Gesellschaft, sondern Gott verantwortlich.
Um eine radikale Veränderung herbeizuführen, brauchte man, so sahen wir es, nur die einfache Forderung zu praktizieren: «Alles, was ihr wollt, daß euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch.» Keine Glaubenssätze, keine Anbetung, keine Zehn Gebote, keine Zeremonien, keine Kirchen, keine Organisation irgendwelcher Art. Kein Warten auf eine bessere Regierung, auf bessere Gesetze, bessere Arbeitsbedingungen, besseres dies und besseres das. Fangt an hier und jetzt, wo immer ihr euch befindet, und denkt nicht an morgen. Schaut nicht nach Rußland, China, Indien, nicht nach Washington, nicht nach dem Nachbarland, der Nachbarstadt, schaut nur nach eurer unmittelbaren Umgebung. Vergeßt Buddha, Jesus, Mohammed und alle anderen. Tut, was ihr könnt, so gut ihr es könnt, ohne Rücksicht auf die Folgen. Und vor allem: erwartet nicht, daß euch gleich jemand nachfolgt.
Das erschien uns so absolut klar und einfach. Zu klar, zu einfach vielleicht. Wer immer nach dieser Wahrheit handeln will, braucht den Mut des Löwen, die Hartnäckigkeit des Stiers, die Verschlagenheit der Schlange und die Unschuld der Taube. Dennoch bleibt bestehen – und das ist aufschlußreich –, daß es in jedem Zeitalter nur eine Handvoll Menschen gibt, deren Wirken die Gesellschaft vor der völligen Degeneration bewahrt. Die Tradition will es, daß diese wenigen allzeit anonym bleiben und daß sie es sind, denen die Berühmten die Inspiration verdanken.
In einem kurzen Artikel mit dem Titel ‹The Hour of Man› (Manas, 31. Januar 1951, Los Angeles, Kalifornien) versuchte Walker seine Überlegungen in Worte zu fassen. Hier ist der Anfang:
«In einer großen Nervenklinik saß ich kürzlich mit einem Team von Wissenschaftlern zusammen, die Patienten für eine Leukotomie auswählten – einen drastischen chirurgischen Eingriff, der bisweilen den Erkrankten gegen seine Erkrankung immunisiert, indem das Gehirngewebe beschädigt wird. Bevor die einzelnen Patienten erschienen, wurden ihre Krankengeschichten verlesen. Da erfuhr man von defekten Familien, von Eifersucht, von natürlicher Angst vor wirtschaftlichen oder sozialen Konsequenzen, von Menschen, die von sexuellen Dingen nichts gewußt hatten, und schließlich von Menschen, die den Schrecken des Krieges ausgesetzt waren. Keiner dieser Menschen hatte ein organisch beschädigtes Gehirn, keiner litt an einer körperlichen Krankheit. Die Kluft zwischen dem Leben, das ihre Geburt ihnen versprochen hatte, und dem Leben, das wir als Gesellschaft ihnen aufgezwungen hatten, war zu groß für ihre emotionale Widerstandskraft.
Seltsamerweise war eines der Auswahlkriterien für die Leukotomie, daß der Patient in eine bessere Umgebung zurückkehrte als die, aus der er gekommen war. Erst wenn dies gesichert war, griff der Chirurg zu seinem Messer. An jenem Abend sah ich einen Mann, der mit Tränen in den Augen um eine Operation bat, die ihn für immer ein wenig betäubte. Er wollte seine Sensibilität abstumpfen lassen, bis er die Welt ertragen konnte, in der er lebte. Von wegen bessere Umgebung!»
Er zitiert dann ungeheuerliche statistische Angaben über den jährlichen Konsum von Alkohol und Drogen jeder Art in diesem «Land der unbegrenzten Möglichkeiten» und stellt fest:
«Ich bin in vielen Nervenkliniken in unserem Land ein und aus gegangen, habe mich erkundigt, wie es um die Verhaltenshygiene steht, und habe viele Organisationen nach einer Lösung meiner eigenen Probleme befragt und danach, wie diese Probleme bei anderen verhindert werden können. Innerhalb eines Jahres habe ich 1400 Alkoholiker interviewt. Ich fand zwar viele vortreffliche und problembewußte Männer und Frauen und zahllose Leidende, aber keine fertige Antwort.»
Dann fährt er fort:
«Ich wünsche mir, daß eine Stunde in der Woche Radio und Fernsehen abgeschaltet, Zeitungen und Zeitschriften beiseite gelegt werden, das Auto in der Garage verschlossen, der Bridgetisch zusammengeklappt, die Flasche verkorkt wird, die Beruhigungsmittel in der Packung bleiben. Ich wünsche mir, daß Produktion und Konsum für die Dauer dieser einen Stunde vergessen werden, desgleichen die Politik, auf nationaler wie internationaler Ebene. Und während dieser einen Stunde, die ich Die Stunde des Menschen nennen möchte, könnte der Mensch sich selbst und seinen Nachbarn fragen, zu welchem Zweck er auf der Welt ist, was das Leben ist, was der Mensch vom Leben verlangen kann und was er ihm dafür schuldet. Wenn einer sich müht und nach dem strebt, was er wirklich will, ist es den Preis wert, den er an persönlichem Leiden zahlt? Nachbarn sollten aufmerksam dem zuhören, was Nachbarn zu sagen haben. Nur auf diese Weise wird sich das Auge nach innen kehren. In den Seelen anderer Menschen könnten sie das unverzerrte Bild ihrer eigenen Seele erblicken. So wie sie anderen helfen, würden sie sich selbst helfen.»
Ich muß gestehen, daß diese Vorstellung, wie eine ganze Nation, wenn auch in der Woche nur eine Stunde lang, innehält, um darüber nachzudenken, mir sehr gefällt. Ich glaube, das Ergebnis wäre phantastisch. Und es wäre möglich, so chimärisch es jetzt scheint. Die islamische Welt vereinigt sich täglich im Gebet, wenn der Muezzin vom Minarett herab ruft. Doch wann hat irgendeine Gemeinschaft einmal alles liegen gelassen, um ein paar Minuten den Problemen zu widmen, die die Gemeinschaft beschäftigen? Nachdenken, vereint, über ein gegebenes Problem – welche Möglichkeiten würde das bieten! Ich möchte behaupten, daß wir in einem solchen Falle aus dem Mund unserer Kinder die klügsten, praktikabelsten und fruchtbarsten Beobachtungen und Hinweise empfangen würden. Wie die Dinge heute stehen, wird sogar der intelligente Mensch aus den Ratsversammlungen unserer Führer ausgeschlossen. Es wird viel von Redefreiheit, Pressefreiheit, freien Wahlen gesprochen, aber ich glaube, es wäre für manche ein Schock, wenn sie wüßten, wie der gewöhnliche Mensch über die Probleme denkt, mit denen sich die Welt konfrontiert sieht. Der eine gewöhnliche Mensch wird immer geschickt gegen den anderen ausgespielt, die Kinder sind immer ausgeschaltet, den jungen Leuten wird Konformismus und Gehorsam befohlen, und die Ansichten der Weisen, Heiligmäßigen, der wahren Diener der Menschheit, werden stets als unpraktisch verspottet.
Nein, es wäre schon etwas Großartiges für jede Gemeinschaft, ob groß oder klein, wenn sie nur fünf Minuten am Tag für ernsthafte Kontemplation bereit hielte. Wenn nicht mehr dabei herauskäme als das Bewußtwerden eines solchen Gefühls wie «Gemeinschaft», wäre das schon ein großer Schritt vorwärts. Sollte es wahr sein, daß wir uns noch nicht als Glieder einer «einzigen Welt» oder auch nur Nation begriffen haben, wieviel wahrer ist es dann, daß wir noch nicht einmal Glieder der kleinen Gemeinschaften sind, denen wir angehören. Wir leben immer atomisierter, immer getrennter, immer isolierter. Wir überlassen unsere Probleme den Regierungen und sprechen uns von Pflicht, Gewissen und Initiative frei. Wir glauben nicht an das persönliche Beispiel, obwohl wir vorgeben, das große Vorbild Jesus Christus zu verehren. Wir wollen die Wirklichkeit nicht sehen: sie ist zu schrecklich, glauben wir. Aber wir sind es, und nur wir, die diese gräßliche Welt geschaffen haben. Und wir sind es, die sie verändern werden – indem wir unsere innere Vision verändern.
Das wahrhaft Bejammernswerte an der condition humaine ist, daß neun Zehntel der uns erdrückenden Probleme über Nacht gelöst werden könnten. Es sind keineswegs unüberwindbare Probleme. Alle derzeit für widersinnige, idiotische, herabwürdigende und zerstörerische Zwecke eingespannten Energien könnten nützlichen und guten Zwecken zugeführt werden durch einen bloßen Wandel der Einstellung. Nur ganz wenige Geister hatten und haben im jeweiligen Zeitabschnitt der menschlichen Geschichte das Vorrecht, mit den großen Problemen zu ringen, den Problemen, die des Menschen würdig sind. Wann immer meine Gedanken in diese Richtung gehen, fällt mir der englische Romancier Claude Houghton ein, der meines Wissens einzige Schriftsteller, der in jedem seiner Bücher die Hauptfigur gleich am Anfang von den üblichen weltlichen Problemen befreit, mit denen gewöhnliche Menschen ihr Leben lang vergeblich kämpfen. Kein Wunder, daß er als «metaphysischer» Romancier eingestuft wird! Und doch kann der Autor nur dann die Hoffnung haben, seine Figur als einmalig und der Aufmerksamkeit wert darzustellen, wenn er sie von den üblichen Alltagsproblemen befreit. Man rüste einen Menschen mit seinen gottgegebenen Kräften aus, stelle ihn der Wirklichkeit gegenüber, dann laßt uns sehen, welche Form und Substanz menschliche Probleme wirklich annehmen! Manchmal scheint mir, die einzigen Helden seien die heiligmäßigen. Gutes tun, für das Recht streiten, den Bedürftigen geben, die Schwachen unterstützen, predigen, bekehren, die Jugend erziehen – das läuft doch alles einzig darauf hinaus, uns daran zu erinnern, daß wir nur zum Teil entwickelt, zum Teil verwirklicht sind, nur zum Teil leben! Die Blinden führen die Blinden, die Kranken pflegen die Kranken, die Starken herrschen über die Schwachen.
Der Sinn des Lebens! Nun, welcher könnte das sein, wenn nicht das Leben zu genießen? Wie kann einer aber nur daran denken, das Leben zu genießen, wenn er halb tot ist?
Hier möchte ich einen Absatz aus Eric Gutkinds wenig bekanntem Buch ‹The Absolute Collective› zitieren:
«Die ‹fromme› Einstellung, Askese, Spiritualität, Schuldbewußtsein – sie schrauben die Weißglut Gottes auf ein angenehm wärmendes Feuer herunter. Die Religion macht Gott harmlos. Unsere irdische Existenz rollt vor dem Angesicht dessen ab, den kein Mensch lebendig schauen kann. Und dieses unaussprechliche Paradoxon wird herabgestutzt auf die Dimensionen einer Vision, die sich bequem unseren alltäglichen Erfordernissen anpaßt. Unser glorreiches, unausweichliches Gefühl für diese Welt wurde somit präpariert, hundert Auswege zu eröffnen. Doch indem wir unseren Blick einwärts kehrten, hielten wir Spiritualität für Realität. Die Freude der Begegnung mit Gott verwelkte vor einer verhaßten Theologie. Die Religion hat uns verraten. Sie hat uns um jenes Wunder der Wunder betrogen, das uns, wenn unsere letzte Hoffnung auf Entrinnen erstorben ist, befähigt, uns zu erheben und die absolute Realität zu erreichen, den ewigen Sinn von allem, wo wir, nicht verzehrt, sondern gehärtet in der Weißglut Gottes ausrufen können, daß ‹alle Wege der Erde Wege zum Himmel sind› und die ‹andere Welt›, wie fern und entrückt auch immer, nichts anderes ist als diese manifest gewordene erschaffene Welt. Unter dem Zwang der Religion war das Leben nie vollständig und ungestört. Weder die Welt noch der Mensch hat bis jetzt wirklich existiert.»
So spricht ein Mann Gottes.
Und jetzt machen wir in Gedanken einen Sprung. Nehmen wir an, der Mensch sei seiner untauglichen Leistungen – Wunderdrogen, Leukotomie-Operationen, Atomgespenster – müde geworden und beginne auf einmal, seine psychischen Kräfte zu entwickeln. Nehmen wir an, er konzentriere seine ganze Aufmerksamkeit auf den Erwerb solcher Kräfte und es gelinge ihm, alle Krankheiten auszurotten, die Toten zum Leben zu erwecken und noch erstaunlichere Wunder zu wirken. Gestehen wir ihm jene Herrschaft über die Natur und die Schöpfung zu, die er seit jeher erstrebt. Was dann? Als Antwort hier eine Geschichte, die Ramakrischna einmal seinen Zuhörern erzählte.
«Da war noch ein anderer Siddha, der war sehr stolz auf seine psychischen Kräfte. Er war ein guter Mensch und Asket. Eines Tages kam der Herr zu ihm in der Gestalt eines Heiligen und sagte: ‹Verehrter Meister, ich habe gehört, du besitzest wundersame Kräfte.› Der gute Mensch empfing ihn freundlich und lud ihn ein, Platz zu nehmen. In diesem Augenblick kam ein Elefant vorbei. Der Heilige fragte: ‹Meister, wenn du willst, kannst du diesen Elefanten töten?› Der Siddha erwiderte: ‹Ja, das ist möglich›, und nahm eine Handvoll Staub, sprach einen Spruch darüber und warf den Staub auf den Elefanten. Sogleich brüllte das Tier auf, fiel in Todeskrämpfen zu Boden und starb. Als der Heilige dies sah, rief er aus: ‹Welch wundersame Kräfte du besitzest! Du hast ein so großes Tier im Nu getötet!› Dann drang der Heilige in ihn und sagte: ‹Du mußt auch die Kraft besitzen, ihn wieder zum Leben zu erwecken.› Der Siddha erwiderte: ‹Ja, das ist auch möglich.› Abermals nahm er eine Handvoll Staub und warf sie, nachdem er einen Spruch darüber gesprochen hatte, auf den Elefanten, und siehe! der Elefant wurde wieder lebendig. Der Heilige zeigte sich verblüfft ob dieses Schauspiels und rief erneut aus: ‹Wie wundersam sind in der Tat deine Kräfte! Aber gestatte mir eine Frage. Du hast den Elefanten getötet und wieder ins Leben zurückgerufen. Was hast du damit gewonnen? Hast du Gott verwirklicht?› Mit diesen Worten verschwand der Heilige› (‹The Gospel of Ramakrishna›, New York 1947).
«Immer aufs neue von Gott zu sprechen, dies sollte unsere zentrale Aufgabe sein», sagte Eric Gutkind.
Ich muß ihn noch etwas ausführlicher zitieren, da seine Worte alles in hervorragender Weise zusammenfassen und beantworten, was auf den vorangegangenen Seiten angesprochen wurde.
«Gott, Welt und Mensch. Was ist, was könnte sein, was sollte sein. Gott, die eine und einzige Realität. Welt, die völlig relative und unwirkliche Szene. Mensch, angesprochen und antwortend, aufgefordert, zur Realität zu finden. Gott, der nicht allein sein will. Welt, die nicht allein sein kann. Mensch, der nicht allein sein sollte. Diese drei, vereint in dem ‹Volk›, welches das ‹Absolute Collective› ist.
Die vollendete Einheit der drei in dem «Volk» hat nichts, was nach Flucht schmeckt, nichts Nationales oder Erdgeborenes, nichts Ideologisches. Sie ist durch und durch konkret. In der Sackgasse finden wir den subjektiven Menschen. Er ist völlig mit sich selbst beschäftigt; autistisch, innerlich gebrochen, wenn auch äußerlich sicher – der Bürger. Nichts ist lebendig in seiner Welt. Alles ist abgeschlossen, alles tot. Er verleugnet Gott. Die eine höchste und transzendente Idee, die allein den Menschen einen Sinn verleiht, ist für ihn ein Objekt des Spotts. Nein – wir müssen uns immer wieder an diese höchste Vereinigung wagen, diese Quelle aller anderen Vereinigungen, dieser Begegnung von Gott, Mensch und Welt. An keinem der drei darf herumgebastelt werden. Immer aufs neue von Gott zu sprechen, dies sollte unsere zentrale Aufgabe sein. Doch nur der wird die Kraft dazu haben, der nicht nur über Gott spricht, sondern auch zu Gott selbst sprechen kann. Keinen Augenblick lang darf diese Darlegung in einem theologischen Sinn interpretiert werden, wenn dieser auch im Klang alter, mit der menschlichen Inbrunst vergangener Zeiten beladener Worte mitschwingen mag. Und der ist am besten geeignet, mit Gott zu sprechen, der mit den Menschen zu sprechen weiß und der die Fülle der Herrlichkeit der Welt verkünden kann. Die absolute Einheit aller Wesen, die erreicht wird im Zusammenkommen von Menschen, die in ihrem Menschsein vollendet sind, frei von Angst, Natur und Ideologie – dies ist der wahre ‹Tabernakel der Begegnung mit Gott›, der Tabernakel der Gegenwart. Die Gegenwart ist frei vom Fluß der Zeit und von der ‹Welt jenseits›. Die Welt ist da. Der Mensch wird erhoben. Wer immer sich Gottes bewußt ist, besitzt die Gegenwart.»
Um auf Walker und die «Stunde des Menschen» zurückzukommen – wurde durch diese Gespräche etwas gewonnen? Ja und nein. Gewiß hat die Stunde noch nicht geschlagen, da ein solcher Gedanke ernst genommen wird. Der Mensch formt das Schicksal der Welt noch immer auf eine negative Weise. Er ist noch nicht in der letzten Sackgasse angelangt. Er ist noch nicht verzweifelt genug, um sich den Anonymen Alkoholikern oder ihrem umfassenderen Äquivalent anzuschließen. Er will noch einen Spaß haben, vielleicht auch zwei oder drei, ehe er das Handtuch wirft. Er ist noch immer zufrieden mit Erklärungen, die nichts erklären, mit Experimenten, von denen er im Grunde weiß, daß sie nur halbe Maßnahmen sind und folglich mehr Böses als Gutes bewirken. Er ist noch immer bereit, neuen Göttern, neuen Religionen zu huldigen – mehr aus Unglauben als aus Glauben. Er will nicht wahrhaben, daß er die Quelle der Offenbarung unmittelbar vor Augen hat. In einem Felsen erblickt er nichts mehr als einen Felsen, in einer Blume nichts mehr als eine Blume, im Menschen nichts mehr als den Menschen. Und doch liegt im unbedeutendsten Ding der Schöpfung das Geheimnis der ganzen Schöpfung verborgen.
Scheint es auch bisweilen, als könnte nichts ihn aus der Trägheit reißen, hinter der er sich verschanzt, so ist es durchaus möglich, daß er eines Tages in einen Zustand schärferen Bewußtseins hineingeschockt wird. Gebot und Beispiel scheinen wenig bewirkt zu haben. Im Grunde genommen unterscheidet sich der zivilisierte Mensch wenig vom primitiven Menschen. Er hat weder die Welt akzeptiert noch das geringste Verlangen gezeigt, an ihrer Realität teilzunehmen. Er ist noch immer an Mythos und Tabu gebunden, ist noch immer der Sklave des Opfers der Geschichte, noch immer der Feind des eigenen Bruders. Die simple, offenkundige Wahrheit nämlich, daß die Welt zu akzeptieren heißt, sie zu verändern, scheint über sein Begriffsvermögen zu gehen.
Wenn das Tor nicht nachgibt, muß es mit Gewalt geöffnet werden. Nichts kann die ansteigende Flut eindämmen. Und alles deutet darauf hin, daß die Flut tatsächlich ansteigt. Mag sich der Mensch so gut absichern, wie er glaubt – das Tor wird nachgeben.
Kinder der Erde
Wenn man seit dreizehn Jahren nicht mehr in Frankreich war, kommen einem bestimmte Aspekte vor wie Fragmente aus einem vergessenen Traum. Besonders erfrischend berührt das Verhalten der französischen Kinder, die so offensichtlich zufrieden sind, oft mit wenigem. So frühreif sie auch wirken, sie scheinen deshalb nicht weniger fröhlich zu sein.
In Frankreich spürt man sofort, daß man in einer Welt der Erwachsenen lebt; die Kinder kommen erst an zweiter Stelle. Wie jeder weiß, scheinen bei uns die Kinder an erster Stelle zu kommen. Die Folge ist, daß wir Männer und Frauen haben, die nie richtig erwachsen geworden sind, die ewig unzufrieden sind und die vor nichts wirklich Achtung haben, am wenigsten voreinander. Ist nicht ein großer Teil der morbiden, frenetischen Aktivität des Amerikaners auf die Rastlosigkeit und Unzufriedenheit der Kindheit zurückzuführen? Die unnötige Zerstörung und der Wiederaufbau, vorgeblich im Namen des Fortschritts ständig im Gange, entsprechen dem Verhalten des verwöhnten Kindes, das seiner Bauklötze müde ist und mit einem Handstreich zerstört, was es stundenlang aufzubauen sich bemühte. Die einzige gültige Realität bei uns scheint die des Kindergartens zu sein.
Wir beklagen die Rolle der Mutter in Amerika, ihre Vorherrschaft in allen Bereichen, aber ist das nicht die Folge der Abdankung des Mannes? Wenn der Mann nur noch Arbeiter und Versorger ist, muß dann nicht die Frau die Zügel ergreifen? Für die amerikanische Frau ist der Mann, ob Gatte, Sohn oder Geliebter, ein Wesen, das man einschüchtert, ausbeutet und verleumdet.
Der Frankreich-Besucher ist zwangsläufig beeindruckt von dem lächelnden Anblick des Landes. Liebe zum Boden ist ein Ausdruck, der hier noch eine Bedeutung hat. Überall ist die Hand des Menschen spürbar, weil die Franzosen dem Boden ständig ihre geduldige, liebevolle Aufmerksamkeit widmen. Man könnte fast meinen, die Liebe zum Boden rangiere noch vor der Liebe zum Land oder zum Nachbarn.
Chez nous ist die Hand fast ausgestorben. Wo immer die Maschine zu gebrauchen ist, wird die Hand ersetzt durch dieses Monstrum, das die erstaunlichsten Arbeiten vollbringt, Wunder oft – aber um welchen Preis! Die rücksichtslose Ausbeutung des Bodens in Amerika ist jetzt überall eine bekannte Geschichte, doch ihre Tragik ist noch nicht in das Bewußtsein des Europäers eingedrungen. Auch er möchte die Maschine, wo nur möglich, einsetzen – aber ohne den uns abgeforderten Preis zu zahlen. Er möchte die Früchte des Maschinenzeitalters ernten, ohne seine traditionelle Lebensweise aufzugeben, was natürlich ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Als jemanden, der die positiven Seiten zweier völlig verschiedener Welten genossen hat, verblüfft es mich immer wieder, daß offenbar kein Land dem anderen seine Tugenden mitzuteilen vermag – besser ausgedrückt, daß kein Austausch möglich ist. Zu einer Zeit, da die Kommunikation kein Problem mehr ist, da man in Stunden vom einen Ende der Welt zum anderen reist, sind die Schranken zwischen Völkern, zwischen sogenannten «freien Völkern», höher denn je. Trotz Marshall-Plan, trotz der ständigen Invasion ganzer Horden von Touristen, trotz Rundfunk und Fernsehen, trotz der fortdauernden Kriegsdrohung scheint mir, daß die Franzosen und Amerikaner heute weniger gemein haben als vor 1914. Was, seien wir ehrlich, haben wir von der französischen Kultur aufgenommen oder von der Kunst des Lebens? Fast nichts, möchte ich behaupten. Was durchsickert, bleibt auf der intellektuellen Ebene hängen; die breite Masse wird davon nicht berührt.
Was Frankreich betrifft, was besitzt es an Bequemlichkeiten – so ziemlich das einzige von Wert, was wir zu bieten haben? Ich habe den Eindruck, daß sich seit 1939, als ich fortging, nichts geändert hat. Ich sehe keine radikale Veränderung in der französischen Lebensweise. All die sogenannten Bequemlichkeiten und Vervollkommnungen, hinter denen Amerikaner ständig her sind – wobei sie sich eher unglücklich machen –, fehlen hier. Alles ist noch immer antiquiert und kompliziert. Nichts wird schnell und pünktlich erledigt.
Es muß seltsam klingen, daß jemand, der die amerikanische Lebensweise so von Herzen verabscheut, sich über die unamerikanischen Aspekte des Lebens in Frankreich ausläßt, doch was ich beklage, sind halbe Maßnahmen. Die Franzosen verachten den Komfort nicht, sie beneiden uns darum; sie bewundern die Tüchtigkeit, sind aber, so scheint es, vom Temperament her nicht in der Lage, sie zu praktizieren. Eine unerklärliche Trägheit scheint sie gefangenzuhalten. «Français, encore un tout petit effort!» sage ich manchmal zu meinen guten französischen Freunden. Darauf drängte der göttliche Marquis, als die Bastille gestürmt worden war.
Jedesmal wenn ich mich in die Welt hinausbegebe, frage ich mich, ob die Menschen sich wirklich verändern wollen. Man findet so selten jemanden, der mit seinem Leben zufrieden ist. Selbst die großen Geister scheinen beunruhigt zu sein, wenn nicht wegen ihrer eigenen Mängel, dann wegen des traurigen Loses der Menschheit. Wir kennen die Menschen nicht, die diese Probleme überwunden oder transzendiert haben; denn sie leben schon in der Welt der Zukunft. Interessant ist die Überlegung, daß diese einsamen Geister, diese Magier, Weisen oder Heiligen, könnte man sie befragen, wahrscheinlich antworten würden: «Nehmt die Welt an, wie sie ist!» Nur wer ganz und gar akzeptiert, würden sie betonen, gelangt zur Emanzipation.
Aber Emanzipation ist nicht das, was die große Mehrheit erstrebt. Eindringlich befragt, geben die meisten Menschen zu, daß man nicht viel braucht, um glücklich zu sein. (Nicht daß sie diese Weisheit praktizierten!) Der Mensch strebt nach Glück hier auf Erden, nicht nach Erfüllung, nicht nach Emanzipation. Ist er dann irregeleitet, wenn er das Glück sucht? Nein, Glück ist begehrenswert, aber es ist ein Nebenprodukt, das Ergebnis einer Lebensweise, nicht ein Ziel, das für immer außerhalb unserer Reichweite liegt. Glück wird unterwegs erreicht. Und wenn es vergänglich ist, wie die meisten Menschen glauben, so muß es nicht Angst und Verzweiflung weichen, es kann auch einer Freude Platz machen, die erhaben und von Dauer ist. Das Glück zum Ziel machen heißt, es von vornherein abtöten. Wenn man ein Ziel haben muß, was fraglich ist, warum dann nicht Selbstverwirklichung? Die einmalige und heilende Eigenschaft in dieser Einstellung zum Leben ist, daß im Verlauf des Prozesses Ziel und Erstreben eins werden.
Überlegungen dieser Art werden häufig als mystisch abgetan. Das sind sie natürlich nicht. Sie gehören zum Wesen der Realität. Und es gibt auch keine zehn, zwölf verschiedene Arten von Realität. Es gibt nur eine, die Realität des Lebens, eine Realität, die mit Wahrheit durchwirkt ist. Wenn ich solche strittigen Begriffe wie Realität und Wahrheit gebrauche, so nicht, um mich in den Sumpf von Mystizismus und Metaphysik hinabziehen zu lassen. Es gibt etwas, das Dauer hat, etwas, das dem täglichen Leben zugrunde liegt und ihm Sinn verleiht, und in Verbindung mit diesem stets vorhandenen Schatz der Schöpfung gewinnen solche Begriffe Bedeutung. Daß wir aus ihnen leere Symbole gemacht haben, mit denen Theologen und Metaphysiker spielen können, heißt eingestehen, daß wir das Leben allen Sinns entleert haben.