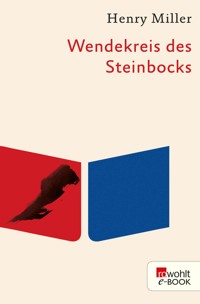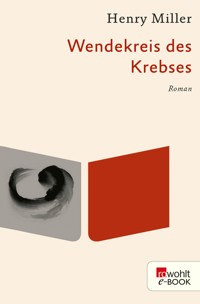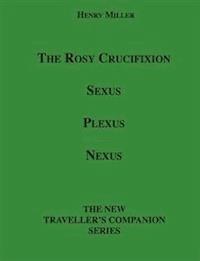5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Schilderung unbürgerlicher Schicksale und grotesker Situationen erweist sich Henry Miller auch hier als Erzähler von hinreißendem Temperament und als Verfechter ungehemmter Daseinsfreude.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Henry Miller
Lachen, Liebe, Nächte
Sechs Erzählungen
Erzählungen
Über dieses Buch
In der Schilderung unbürgerlicher Schicksale und grotesker Situationen erweist sich Henry Miller auch hier als Erzähler von hinreißendem Temperament und als Verfechter ungehemmter Daseinsfreude.
Vita
Henry Miller, der am 26. Dezember 1891 in New York geborene deutschstämmige Außenseiter der modernen amerikanischen Literatur, wuchs in Brooklyn auf. Die Dreißiger Jahre verbrachte Miller im Kreis der «American Exiles» in Paris. Sein erstes größeres Werk, das vielumstrittene «Wendekreis des Krebses», wurde – dank des Wagemuts eines Pariser Verlegers – erstmals 1934 in englischer Sprache herausgegeben. In den USA zog die Veröffentlichung eine Reihe von Prozessen nach sich; erst viel später wurde das Buch in den literarischen Kanon aufgenommen. Henry Miller starb am 7. Juni 1980 in Pacific Palisades, Kalifornien.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg,
Copyright © 1939, 1941, 1947, 1955 by New Directions Publishing Corporation
Copyright © 1941 by Henry Miller
Alle deutschen Rechte vorbehalten vom Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung Umschlag-Konzept: any.way, Hamburg Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Coverabbildung iStock/Gettyimages/subjob
ISBN 978-3-644-00584-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Der versoffene Veteran
Unlängst sah ich in Tulsa einen Kurzfilm mit dem Titel Der glücklichste Mensch auf Erden. Er war im Stil O'Henrys, aber sein tieferer Sinn war niederschmetternd. Wie ein solcher Streifen im Herzen der Ölfelder gezeigt werden konnte, geht über meinen Verstand. Jedenfalls erinnerte er mich an einen Menschen, dem ich vor einigen Wochen in New Orleans begegnet war. Auch er versuchte vorzugeben, der glücklichste aller Sterblichen zu sein.
Es war gegen Mitternacht, und mein Freund Rattner und ich kehrten nach einem Streifzug durch das französische Viertel zu unserem Hotel zurück Als wir am Hotel St. Charles vorüberkamen, schloß sich uns ein Mann ohne Hut oder Mantel an und begann von der Brille zu reden, die er kurz zuvor an der Bar verloren habe.
«Es ist scheußlich, ohne Brille zu sein», sagte er, «besonders wenn man gerade über die Stränge geschlagen hat. Ich beneide euch Jungens. Ein blöder Betrunkener hat mir gerade dort drinnen meine Brille heruntergestoßen und ist darauf getreten. Soeben habe ich ein Telegramm an meinen Augenarzt in Denver aufgegeben – vermutlich werde ich ein paar Tage warten müssen, bis sie ankommt. Ich habe ein wüstes Besäufnis hinter mir: es muß eine Woche oder noch länger gedauert haben. Ich weiß nicht mal, was für einen Tag wir haben oder was in der Welt passiert ist, seitdem ich aus den Pantinen gekippt bin. Ich bin nur auf die Straße gegangen, um ein wenig frische Luft zu schöpfen – und um einen Happen zu essen. Ich esse nie etwas, wenn ich auf Tour bin – der Alkohol hält mich in Gang. Es läßt sich natürlich nichts dagegen machen, ich bin ein chronischer Alkoholiker. Unheilbar. Ich weiß genau über dieses Thema Bescheid, denn ich habe Medizin studiert, bevor ich mich der Juristerei zuwandte. Alle möglichen Heilmittel habe ich schon ausprobiert, alle wissenschaftlichen Abhandlungen darüber gelesen … Sehen Sie her –» dabei griff er in seine Brusttasche und zog eine Menge Papiere zugleich mit einer dicken Brieftasche hervor, die auf den Boden fiel – «sehen Sie sich das an, hier habe ich einen Artikel über das Thema, den ich selbst geschrieben habe. Komisch, was? Er wurde unlängst veröffentlicht in … » (er nannte eine bekannte Zeitschrift mit einer riesigen Auflageziffer).
Ich beugte mich hinunter, um die Brieftasche und die Visitenkarten aufzuheben, die herausgeflattert und in den Rinnstein gefallen waren. Er hielt das lockere Bündel von Briefen und Schriftstücken in der einen Hand und gestikulierte beredt mit der anderen. Es schien ihm völlig gleichgültig, ob er etwas von seinen Papieren oder sogar vom Inhalt der Brieftasche verlor. Er wetterte gegen die Unwissenheit und Dummheit der Ärzte. Sie seien eine Bande von Quacksalbern, von Räubern, Verbrechern und so weiter.
Es war kalt und regnerisch, und wir, in Mäntel gehüllt, drängten ihn weiterzugehen.
«Oh, machen Sie sich darüber keine Sorgen», meinte er, wobei er das Gesicht zu einem gutmütigen Lächeln verzog. «Ich erkälte mich nie. Ich muß meinen Hut und meinen Mantel in der Bar gelassen haben. Die Luft tut gut», und er machte seine Jacke weit auf, als wolle er den unangenehmen, schneidenden Nachtwind durch seine dünne Bekleidung dringen lassen. Er fuhr sich mit den Fingern durch sein Büschel gelockten blonden Haars und wischte sich die Mundwinkel mit einem unsauberen Taschentuch ab. Er war ein Mann von fester Statur mit einem ziemlich wetterharten Gesicht, ein Mensch, der offenbar ein Leben im Freien führte. Das auffallendste an ihm war sein Lächeln – das wärmste, offenste, einnehmendste Lächeln, das ich je auf dem Gesicht eines Menschen gesehen habe. Seine Gesten waren unstet und zitterig, was in Anbetracht seines Nervenzustands nur natürlich war. Er war voller Lebhaftigkeit und Energie, wie ein Mensch, der gerade eine Spritze in den Arm bekommen hat. Er sprach auch gewandt, außerordentlich gewandt sogar, so als hätte er ebensogut Journalist sein können wie Arzt oder Rechtsanwalt. Und offensichtlich war er nicht darauf aus, einen Pump anzulegen.
Als wir ungefähr einen Häuserblock weit gegangen waren, blieb er vor einem billigen Speiselokal stehen und lud uns ein, mit ihm hineinzugehen und etwas zu essen oder zu trinken. Wir sagten ihm, daß wir auf dem Heimweg seien, müde wären und ins Bett gehen wollten.
«Aber doch nur für ein paar Augenblicke», drängte er. «Ich will nur rasch einen Bissen essen.»
Noch einmal versuchten wir abzulehnen. Aber er bestand darauf, ergriff uns am Arm und führte uns zu der Tür des Cafés. Ich wiederholte, ich müßte nach Hause gehen, schlug aber Rattner vor, wenn er Lust habe, solle er bleiben. Ich versuchte, mich von seinem Griff zu befreien.
«Hören Sie», sagte er und setzte plötzlich eine ernste Miene auf, «Sie müssen mir diesen kleinen Gefallen tun. Ich muß mit Ihnen sprechen. Ich könnte sonst etwas Verzweifeltes tun, wenn Sie mich im Stich lassen. Ich bitte Sie darum als um eine menschliche Gefälligkeit – Sie würden sich doch nicht weigern, einem Menschen ein wenig Zeit zu opfern, nicht wahr, wenn Sie wüßten, daß es für ihn so viel bedeutet?»
Daraufhin gaben wir natürlich ohne ein weiteres Wort nach, ‹Jetzt haben wir den Salat›, dachte ich bei mir und war ein wenig ärgerlich auf mich selbst, daß ich mich von einem sentimentalen Trunkenbold hatte übertölpeln lassen.
«Was wollen Sie nehmen?» fragte er und bestellte für sich eine Platte Schinken mit Bohnen, die er, bevor er sie auch nur an den Tisch gebracht hatte, mit Tomaten-Ketchup und Pfefferschotensauce buchstäblich überschüttete. Als er im Begriff war, die Platte vom Büfett wegzunehmen, wandte er sich an die Bedienung und verlangte noch eine weitere Platte Schinken mit Bohnen. «Ich kann drei oder vier davon hintereinander essen», erklärte er, «wenn ich anfange, nüchtern zu werden.» Wir hatten für uns Kaffee bestellt. Rattner wollte gerade die Bons an sich nehmen, als unser Freund nach ihnen griff und sie in die Tasche steckte. «Das geht mich an», sagte er, «ich habe Sie hier eingeladen.»
Wir versuchten Einspruch zu erheben, aber er brachte uns dadurch zum Schweigen, daß er zwischen riesigen Bissen, die er mit schwarzem Kaffee hinunterspülte, erklärte, Geld sei eines der Dinge, an die er keinen Gedanken verschwende.
«Ich weiß nicht, wieviel ich jetzt bei mir habe», setzte er hinzu. «Jedenfalls genug für das da. Ich habe gestern meinen Wagen einem Händler zum Verkauf gegeben. Ich fuhr von Idaho hierher mit einigen alten Bekannten vom Gericht – sie waren auf einer Tagung gewesen. Früher war ich in der gesetzgebenden Körperschaft», und er nannte einen Staat im Westen, in dem er Dienst getan hatte. «Ich kann kostenlos mit der Bahn zurückreisen», erklärte er. «Ich habe einen Ausweis. Ich war einmal jemand Er unterbrach sich, um zum Büfett zu gehen und noch eine Portion zu holen.
Während er sich wieder setzte und die Bohnen mit Tomaten- und Pfefferschotensauce übergoß, griff er mit der linken Hand in seine Brusttasche und leerte ihren ganzen Inhalt auf den Tisch. «Sie sind ein Künstler, nicht wahr?» sagte er zu Rattner. «Und Sie ein Schriftsteller, das kann ich sehen», damit sah er mich an. «Sie brauchen es mir nicht zu sagen, ich habe Sie beide sofort richtig eingeschätzt.» Während er sprach, wühlte er in den Papieren, wobei er noch immer energisch sein Essen in sich hineinschaufelte und offenbar einige Artikel suchte, die er geschrieben hatte und uns zeigen wollte. «Ich schreibe selbst ein wenig», sagte er, «so oft ich ein bißchen Extrageld brauche. Sie verstehen, sobald ich mein Gehalt bekomme, fange ich an zu bummeln. Und wenn ich wieder zur Besinnung komme, setze ich mich hin und schreibe einen Quatsch für -» und hier nannte er einige der führenden Zeitschriften mit großer Auflage. «Auf diese Weise kann ich immer, wenn ich will, ein paar hundert Dollar verdienen. Es ist nichts dabei. Ich behaupte natürlich nicht, daß es Literatur ist. Aber wer will schon Literatur? Wo zum Teufel habe ich diese Geschichte, die ich über einen psychopathischen Fall geschrieben habe … ich wollte Ihnen nur eben zeigen, daß ich Bescheid weiß, worüber ich spreche. Sie verstehen … » Er brach plötzlich ab und streifte uns mit einem schiefen, gewundenen Lächeln, als wäre es hoffnungslos, auch nur versuchen zu wollen, all das in Worte zu kleiden. Er hatte seine Gabel voll Bohnen gehäuft, die er gerade hinunterschlingen wollte. Wie ein Automat ließ er die Gabel sinken, so daß die Bohnen sich über alle seine beschmutzten Briefe und Schriftstücke ergossen, beugte sich über den Tisch und verblüffte mich dadurch, daß er mich am Arm ergriff und meine Hand auf seinen Schädel legte, um sie kräftig hin und her zu reiben. «Fühlen Sie das?» fragte er, mit einem seltsamen Leuchten im Auge. «Ganz wie ein Waschbrett, was?» Ich zog, so rasch ich konnte, meine Hand zurück. Das Befühlen dieser gewellten Gehirnplatte verursachte mir eine Gänsehaut. «Das ist nur eine meiner Errungenschaften», sagte er. Und damit krempelte er die Ärmel auf und zeigte uns eine zackige Wunde, die in großem Bogen vom Handgelenk bis zum Ellenbogen lief. Dann zog er sein Hosenbein hoch. Weitere schreckliche Wunden. Als wäre das noch nicht genug, stand er rasch auf, zog seine Jacke aus und öffnete so, als wäre niemand außer uns drei im Lokal, sein Hemd und stellte sogar noch häßlichere Narben zur Schau. Während er seine Jacke anzog, blickte er herausfordernd um sich und stimmte in klaren, weittragenden Tönen mit bitterem Hohn die Hymne an: «Amerika, ich liebe dich!» Nur eben die Anfangsstrophe. Dann setzte er sich ebenso unvermittelt, wie er aufgestanden war, wieder hin und aß ruhig den Schinken mit Bohnen zu Ende. Ich dachte, es würde eine Empörung in dem Lokal geben, aber nein, die Leute aßen und redeten ganz wie zuvor weiter, nur waren wir jetzt der Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit geworden. Der Mann an der Kasse schien ziemlich nervös und völlig unentschlossen, was er tun sollte. Ich fragte mich, was wohl als nächstes kommen würde.
Ich erwartete so halbwegs, daß unser Freund die Stimme erheben und eine melodramatische Szene machen würde. Abgesehen davon, daß er ein wenig gereizter und beredter geworden war, unterschied sich sein Benehmen nicht merklich gegen früher. Sein Ton hatte sich aber geändert. Er sprach jetzt in abgerissenen Sätzen, die von den lästerlichsten Flüchen unterbrochen und von erschreckend anzusehenden Grimassen begleitet waren. Der Dämon in ihm schien hervorzukommen. Oder vielmehr das verletzte Wesen, das über alle menschliche Dulderkraft hinaus verwundet und gedemütigt worden war.
«Mister Roosevelt!» sagte er mit von Zorn und Verachtung erfüllter Stimme. «Ich habe ihn gerade am Radio gehört. Bringt uns auf Draht, um wieder Englands Kämpfe auszufechten, was? Wehrdienstpflicht. Diesmal ohne mich!» und er zuckte mit dem Daumen böse nach hinten. «Dreimal auf dem Schlachtfeld mit Orden ausgezeichnet. Bei den Argonnen … Château Thierry … der Somme dabeigewesen … dann Gehirnerschütterung … vierzehn Monate im Lazarett vor Paris … zehn Monate auf dieser Seite des großen Teiches. Mörder aus uns zu machen und uns dann bitten, schön stillzuhalten und wieder an die Arbeit zu gehen … Warten Sie mal, ich will Ihnen ein Gedicht vorlesen, das ich unlängst nachts über unseren Führer verfaßte.» Er kramte unter den auf dem Tisch herumliegenden Papieren. Er stand auf, um sich noch eine Tasse Kaffee zu holen, und während er, die Tasse in der Hand, dastand und daran nippte, begann er laut das anstößige Schmähgedicht auf den Präsidenten vorzutragen. Jetzt wird sicherlich, dachte ich, jemand Anstoß nehmen, und es wird eine Schlägerei geben. Ich sah Rattner an, der an Roosevelt glaubt und bei der letzten Wahl 1200 Meilen weit gereist war, um für ihn zu stimmen. Rattner sagte nichts. Vermutlich hielt er es für zwecklos, einem Menschen Vorstellungen zu machen, dessen Verstand offensichtlich durch Granatsplitter gelitten hatte. Dennoch mußte ich die Situation zumindest für etwas ungewöhnlich halten. Mir fiel wieder ein Satz ein, den ich in Georgia gehört hatte. Er kam aus dem Munde einer Frau, die gerade Lincoln in Illinois gesehen hatte : «Was versuchen sie zu tun – einen Helden aus diesem Mann Lincoln zu machen?» Ja, etwas ausgesprochen Vor-Bürgerkriegsmäßiges lag in der Atmosphäre. Ein mit einer großen Stimmenzahl wieder ins Amt gewählter Präsident – und doch war sein Name für Millionen Anathema. Vielleicht ein zweiter Woodrow Wilson? Unser Freund wollte ihm nicht einmal diesen Rang einräumen. Er hatte sich wieder gesetzt und machte sich jetzt mit etwas ruhigerer Stimme über die Politiker, die Mitglieder des Richterkollegiums, die Generale und Admirale, die Generalquartiermeister, das Rote Kreuz, die Heilsarmee und die Christliche Vereinigung Junger Männer lustig. Es war ein zersetzendes Gespött, gespickt mit persönlichen Erlebnissen, grotesken Begegnungen, ausgefallenen Streichen, wie nur ein von Kampfnarben gezeichneter, alter Kriegsteilnehmer den Mut haben konnte, sie zu erzählen.
«Und so», platzte er heraus, «wollte man mich mit meiner Uniform und meinen Orden wie einen Affen paradieren lassen. Man hatte eine Blaskapelle aufgestellt, und der Major hatte alles Nötige veranlaßt, um uns einen glorreichen Empfang zu bereiten. Die Stadt gehört euch, Jungens, und all das Geschwätz. Unsere Helden! Mein Gott, es ist wahrhaftig zum Kotzen, wenn ich daran denke. Ich riß die Orden von meiner Uniform und warf sie fort. Ich verbrannte die verdammte Uniform im Kaminfeuer. Dann holte ich mir eine Flasche Whisky und schloß mich in meinem Zimmer ein. Ich trank und weinte – ganz für mich allein. Draußen spielte die Kapelle, und die Leute schrien hysterisch Hurra. In mir war alles dunkel. Alles, woran ich bisher geglaubt hatte, war dahin. Alle meine Illusionen waren vernichtet. Die Leute brachen mir das Herz – ja, das taten sie. Sie ließen mir auch nicht eine Spur von Trost. Außer natürlich das Saufen. Zwar versuchten sie anfänglich, mir auch das wegzunehmen. Sie wollten, daß ich mich schäme und es aufgäbe. Ich mich schämen, herrjeh! Ich, der Hunderte von Menschen mit dem Bajonett getötet, der wie ein Tier gelebt und jedes Gefühl für Menschenwürde verloren hatte. Es gibt nichts, mit dem man mich beschämen oder erschrecken oder irreführen oder bestechen oder täuschen könnte. Ich kenne sie in- und auswendig, die schmutzigen Brüder. Sie haben mich hungern lassen, mich geschlagen und hinter Gitter gesperrt. Das macht mir nichts aus. Ich kann alles ertragen – Hunger, Kälte, Durst, Läuse, Ungeziefer, Krankheit, Schläge, Beleidigungen, Demütigungen, Betrug, Diebstahl, Schmähung, Verleumdung und Verrat … Ich bin mit Haut und Haaren durch den Wolf gedreht worden … man hat alles mit mir angestellt … und doch kann man mich nicht zermalmen, mir nicht den Mund verschließen, mich nicht dahin bringen zu sagen, alles sei in bester Ordnung. Ich will nichts mit diesem ehrbaren, gottesfürchtigen Volk zu tun haben. Es erregt mir Übelkeit. Lieber lebte ich unter Tieren – oder Kannibalen.»
Er fand ein Notenblatt unter seinen Papieren und Schriftstücken. «Da ist ein Lied, das ich vor drei Jahren verfaßt habe. Es ist sentimental, tut aber niemandem Schaden an. Nur wenn ich betrunken bin, kann ich komponieren. Der Alkohol löscht den Kummer aus. Ich habe noch ein Herz, und sogar ein großes. Meine Welt ist eine Welt der Erinnerungen. Erinnern Sie sich noch an das da?» Er begann eine bekannte Melodie zu summen. «Stammt das von Ihnen?» fragte ich überrascht. «Ja, das stammt von mir – und noch manches andere –» und er begann die Titel seiner Schlager herunterzuleiern.
Ich begann mich gerade zu fragen, ob alle diese Behauptungen wahr seien – Rechtsanwalt, Arzt, Mitglied der gesetzgebenden Körperschaft, , Berufsschriftsteller, Schlagerkomponist –, als er anfing, von seinen Erfindungen zu sprechen. Anscheinend hatte er sich dreimal ein Vermögen erworben, bevor er völlig herunterkam. Es schien mir ein wenig dick aufgetragen – selbst für mich, der ich ein gutgläubiger Mensch bin –, als eine von ihm so nebenbei hingeworfene Bemerkung über einen Freund von ihm, einen berühmten Architekten im Mittleren Westen, jetzt eine überraschende Beantwortung durch Rattner fand. «Er war mit mir in der Armee», bemerkte Rattner ruhig. «Nun», sagte unser Freund, «er heiratete meine Schwester.» Damit begann zwischen den beiden ein lebhafter Erinnerungsaustausch, der bei mir nicht den leisesten Zweifel zurückließ, daß unser Freund, wenigstens was den Architekten betraf, die Wahrheit sprach.
Von dem Architekten zum Bau eines großen Hauses irgendwo im Herzen von Texas war nur ein Schritt. Mit dem letzten Rest des von ihm erworbenen Vermögens hatte er eine Ranch gekauft, geheiratet und sich ein phantastisches Haus mitten in der Wildnis gebaut. Die Trinkerei gab er langsam auf. Er war heftig verliebt in seine Frau und wollte eine Familie gründen. Nun, um auf den Kern der Sache zu kommen, ein Freund von ihm überredete ihn dazu, mit ihm auf Minensuche in Alaska sein Glück zu suchen. Er ließ seine Frau zurück, da er fürchtete, das Klima wäre zu unwirtlich für sie. Er war ungefähr ein Jahr fort. Bei seiner Rückkehr – er war ohne vorherige Benachrichtigung zurückgekommen, im Glauben, ihr eine freudige Überraschung zu bereiten – fand er sie im Bett mit seinem besten Freund. Mit einer Peitsche trieb er die beiden mitten in der Nacht bei einem heftigen Schneesturm aus dem Haus, ohne ihnen auch nur die Möglichkeit zu lassen, ihre Kleider anzuziehen. Dann holte er natürlich die Flasche hervor, und nachdem er ein paar Gläser getrunken hatte, machte er sich daran, die Einrichtung zu zerschlagen. Aber das Haus war so groß, daß er dieses Treibens bald überdrüssig wurde. Es gab nur eine Möglichkeit, das gründlich zu besorgen: nämlich ein Streichholz zu Hilfe zu nehmen – was er denn auch tat. Dann stieg er in seinen Wagen und fuhr fort, ohne sich die Mühe zu machen, auch nur einen Handkoffer zu packen. Ein paar Tage später nahm er in einem anderen Staat die Zeitung zur Hand und erfuhr, daß man seinen Freund erfroren aufgefunden hatte. Über die Frau stand nichts darin. Tatsächlich erfuhr er nie, was von diesem Tag an aus ihr geworden war. Bald nach diesem Vorfall geriet er in einer Bar mit einem Mann in Streit und schlug ihm mit einer zerbrochenen Flasche den Schädel ein. Das trug ihm achtzehn Monate Zwangsarbeit ein, und während dieser Zeit studierte er die Zustände im Gefängnis und schlug dem Gouverneur des Staates einige Reformen vor, die angenommen und in die Praxis umgesetzt wurden.
«Ich war sehr beliebt», setzte er hinzu. «Ich habe keine schlechte Stimme und verstehe mich ein wenig darauf, die Leute zu unterhalten. Ich hielt sie bei guter Laune, solange ich dort im Gefängnis war. Später saß ich noch einmal. Es macht mir aber nichts aus. Ich kann mich so gut wie allen Umständen anpassen. Gewöhnlich gibt es im Gefängnis ein Klavier, ein Billard und Bücher – und wenn man sich auch nichts zu trinken beschaffen kann, so kann man sich doch immer das eine oder andere Betäubungsmittel besorgen. Ich schalte vor und zurück. Was macht es schon aus? Der Mensch will schließlich nur die Gegenwart vergessen … »
«Ja, aber können Sie wirklich vergessen?» warf Rattner ein.
«Ich kann's! Man gebe mir nur ein Klavier, einen Schoppen Whisky und eine gemütliche kleine Kneipe, und ich kann so glücklich sein, wie man sich's nur wünschen kann. Sehen Sie, ich brauche nicht all das Drum und Dran, das ihr Jungens nötig habt. Alles was ich bei mir trage, ist eine Zahnbürste. Wenn ich eine Rasur brauche, lasse ich mich rasieren. Will ich die Wäsche wechseln, dann kaufe ich mir neue. Wenn ich hungrig bin, esse ich. Bin ich müde, dann schlafe ich. Es bedeutet für mich keinen großen Unterschied, ob ich in einem Bett schlafe oder auf dem Fußboden. Wenn ich eine Geschichte schreiben will, gehe ich in eine Zeitungsexpedition und leihe mir eine Schreibmaschine. Wenn ich nach Boston fahren will, brauche ich nur meinen Ausweis vorzuzeigen. Jeder Ort ist für mich ein Zuhause, ein trautes Heim, solange ich ein Lokal zum Trinken finden kann und einem freundlichen Zechkumpanen begegne. Ich zahle keine Steuern und keine Miete. Ich habe keinen Chef und keine Verpflichtungen. Ich beteilige mich nicht an der Wahl und kümmere mich nicht darum, wer Präsident oder Vizepräsident wird. Ich will kein Geld verdienen und strebe nicht nach Ruhm oder Erfolg. Was könnt ihr mir anbieten, das ich nicht schon habe, wie? Ich bin ein freier Mensch – seid ihr das? Und ich bin glücklich. Glücklich, weil ich mich nicht darum kümmere, was morgen sein wird. Ich will nur jeden Tag meinen Schoppen Whisky – eine Flasche voll Vergessen, das ist alles. Meine Gesundheit? Ich mache mir ihretwegen keine Sorgen. Ich bin so stark und gesund wie jeder andere. Wenn mir etwas fehlt, so weiß ich das jedenfalls nicht. Ich kann ohne weiteres hundert Jahre alt werden, während ihr Jungens euch vermutlich Sorgen macht, ob ihr die Sechzig erreicht. Für mich gibt es nur einen Tag: das Heute. Wenn mir gut zumute ist, schreibe ich ein Gedicht und werfe es am nächsten Tag weg. Ich versuche nicht, literarische Preise zu gewinnen – ich drücke mich nur auf meine eigene giftige Art aus … »
Daraufhin kam er auf seine literarischen Fähigkeiten zu sprechen. Seine Eitelkeit kannte keine Grenzen mehr. Als er schließlich darauf bestand, ich sollte einen Blick in die Geschichte werfen, die er für eine beliebte Zeitschrift geschrieben hatte, hielt ich es für angebracht, ihm Einhalt zu gebieten. Viel lieber als von dem Literaten wollte ich von dem Desperado und dem Trunkenbold hören.
«Hören Sie zu», sagte ich, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, «Sie geben doch zu, daß alles das ein Schmarren ist, nicht wahr? Ehrlich gesagt, ich lese nie Schmarren. Wozu wollen Sie mir das Zeug zeigen – ich zweifle nicht, daß Sie ebenso schlecht schreiben können wie alle anderen – dazu braucht man kein Genie zu sein. Mich interessiert nur gute Literatur. Ich bewundere den Genius, nicht den Erfolg. Wenn Sie jetzt etwas haben, auf das Sie stolz sind, so ist das etwas anderes. Ich würde gerne etwas lesen, das Sie selbst für gut halten.»
Er musterte mich von Kopf bis Fuß mit einem langen Blick. Einige Augenblicke lang sah er mich so schweigend und forschend an. «Ich will Ihnen etwas sagen», erklärte er schließlich, «es gibt nur etwas, das ich geschrieben habe und das ich für gut halte – doch das habe ich nie zu Papier gebracht. Aber ich habe es hier drinnen», und er klopfte sich mit dem Zeigefinger an die Stirne. «Wenn Sie es hören wollen, trage ich es Ihnen vor. Es ist ein langes Gedicht, das ich einmal geschrieben habe, als ich in Manila war. Sie haben sicher schon vom Kastell Morro gehört? Schön, gerade vor den Mauern vom Kastell Morro überkam mich die Inspiration. Ich halte es für eine große Dichtung. Ich weiß, daß sie das ist! Ich möchte sie nicht gedruckt sehen. Möchte kein Geld dafür nehmen. Hören Sie … »
Ohne sich zu unterbrechen, um sich zu räuspern oder einen Schluck zu trinken, legte er mit diesem Gedicht über einen Sonnenuntergang in Manila los. Er deklamierte es in raschem Tempo mit einer klaren, wohlklingenden Stimme. Es war, als schieße man Wasserfälle in einem leichten Kanu hinunter. Rings um uns war jedes Gespräch verstummt. Einige Leute standen auf und traten näher heran, um ihn besser hören zu können. Das Gedicht schien weder einen Anfang noch ein Ende zu haben. Wie gesagt, es hatte mit der Schnelligkeit einer Flut begonnen und ging weiter und immer weiter, Bild um Bild, ein Crescendo ums andere, wurde lauter und dann leiser in tönenden Kadenzen. Leider erinnere ich mich an keine einzige Zeile mehr. Ich erinnere mich nur noch an das Gefühl, das ich hatte, auf den Wogen eines großen Stromes durch das Herz einer tropischen Zone getragen zu werden, in der ständig farbenprächtige exotische Vögel hin und her flatterten, an den Glanz naßgrüner Blätter, das Sich-Verneigen und Wiederaufrichten vom Wind bewegter Gräser, das betörende Mitternachtsblau des Himmels, die wie funkelnde Edelsteine leuchtenden Sterne, den Gesang, Gott weiß wovon, trunkener Vögel. Ein Fieber lief durch jede Strophe, das Fieber keines Kranken, sondern eines begeisterten, rasenden Menschen, der plötzlich seine wahre Stimme gefunden hatte und sie im Dunkeln erprobte. Es war eine unmittelbar aus dem Herzen kommende Stimme, eine straffe, vibrierende Blutsäule, die in rhapsodischen, donnernden Wellen ans Ohr schlug. Das Ende war eher ein Verklingen als ein Aufhören, ein Diminuendo, das den trommelnden Rhythmus zu einem Flüstern herabsinken ließ, das weit über die tatsächliche Stille hinaus anhielt, in die es sich schließlich auflöste. Die Stimme war verstummt, aber das Gedicht hallte noch in den Gehirnzellen nach.
Er brach die eingetretene Stille, indem er bescheiden auf die ungewöhnliche Leichtigkeit hinwies, mit der er sich an alles, worauf sein Blick fiel, erinnern konnte. «Ich erinnere mich noch an alles, was ich in der Schule gelesen habe», sagte er, «von Longfellow und Wordsworth bis Ronsard und François Villon. Villon, das ist ein Mann nach meinem Herzen», und er deklamierte einen bekannten Vers mit einer Aussprache, die verriet, daß er mehr als nur eine aus dem Lehrbuch erworbene Kenntnis der französischen Sprache besaß. «Die größten Dichter waren die Chinesen», setzte er hinzu. «Sie ließen die kleinen Dinge die Größe des Weltalls offenbaren. Sie waren an erster Stelle Philosophen und dann erst Dichter. Sie lebten ihre Dichtung. Wir haben keinen Stoff für ein Gedicht, außer Tod und Verzweiflung. Man kann kein Gedicht über ein Automobil oder eine Telefonzelle schreiben. Zuerst einmal muß das Herz intakt sein. Man muß an etwas glauben können. Die Werte, die man uns als Kinder zu achten gelehrt hat, sind alle vernichtet. Wir sind keine Menschen mehr – wir sind nur noch Automaten. Sogar das Töten bringt uns keine Befriedigung. Der letzte Krieg tötete unsere Impulse. Wir sind nicht mehr empfänglich, wir reagieren nur noch. Wir sind die verlorene Schar der besiegten Erzengel. Wir taumeln im Chaos, und unsere Führer, blinder als Fledermäuse, schreien wie die Esel. Sie möchten doch Mr. Roosevelt nicht als großen Führer bezeichnen? Nicht, wenn Sie den Lauf der Geschichte kennen. Ein Führer muß von einer großen Vision inspiriert sein. Er muß sein Volk mit mächtigen Schwingen aus dem Dreck herausheben. Muß die Menschen herausreißen aus der Stumpfheit, in der sie wie Siebenschläfer und Faultiere vegetieren. Die Sache der Freiheit und Menschlichkeit wird nicht dadurch gefördert, daß man arme, schwache Träumer zum Schlachthaus führt. Was will denn dieser Aufpeitscher überhaupt? Hat der Herrgott ihn zum Retter der Zivilisation bestellt? Als ich dort drüben für die Demokratie kämpfte, war ich fast noch ein Kind. Ich hatte keinen großen Ehrgeiz, auch nicht den Wunsch, jemanden zu töten. Ich wurde in dem Glauben erzogen, daß Blutvergießen ein Verbrechen gegen Gott und die Menschen ist. Nun ja, ich tat, was von mir verlangt wurde – wie ein guter Soldat. Ich legte jeden Hundesohn um, der mich umzulegen versuchte. Was blieb mir anderes übrig? Natürlich drehte es sich nicht immer um Töten. Dann und wann hatte ich auch schöne Zeiten – es war eine Art von Genuß, wie ich sie niemals erwartet hatte. Tatsächlich war nichts so, wie ich es mir vorgestellt hatte, ehe ich hinüberging. Sie wissen ja, was diese Kerle aus einem machen. Großer Gott, die eigene Mutter würde einen nicht wiedererkennen, wenn sie sehen würde, woran man sein Vergnügen findet – oder wie man durch den Dreck kriecht und einem Menschen das Bajonett in den Leib stößt, der einem nie etwas zuleide getan hat. Ich versichere Ihnen, ich wurde so gemein und abstoßend, daß ich mich selbst nicht mehr kannte. Ich war nur noch eine Nummer, die aufleuchtete wie auf einem Schaltbrett, wenn der Befehl kam, dies oder jenes oder sonstwas zu tun. Man konnte mich nicht mehr Mensch nennen – in mir war kein verdammter Rest von Gefühl mehr. Aber ich war kein Tier, denn wäre ich ein Tier gewesen, so hätte ich mehr Vernunft gehabt, als mich in eine solche Schweinerei einzumischen. Tiere töten einander nur, wenn sie Hunger haben. Wir töten, weil wir vor unserem eigenen Schatten Angst haben und uns scheuen, zugeben zu müssen – falls wir nur einen Funken gesunden Menschenverstand hätten –, daß unsere glorreichen Grundsätze falsch sind. Heute habe ich keine Grundsätze mehr: ich bin ein Verfemter. Ich habe nur noch ein Bestreben: Jeden Tag genug Alkohol hinter die Binde zu gießen, um zu vergessen, wie die Welt aussieht. Ich habe dieses Verfahren nie gutgeheißen. Sie können mir nicht einreden, daß ich alle diese Deutschen umbrachte, um dieser ruchlosen Schweinerei zum Sieg zu verhelfen. Nein, mein Lieber, ich weigere mich, etwas damit zu tun zu haben. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Trete aus diesem Verein aus. Wenn ich dadurch ein schlechter Bürger werde, nun gut, dann bin ich eben ein schlechter Bürger. Wenn schon. Glauben Sie, wenn ich wie ein tollwütiger Hund umherlaufen und um eine Keule oder ein Gewehr bitten würde, um noch einmal mit dem Töten zu beginnen – glauben Sie wirklich, daß mich das zu einem guten Bürger machen würde, gut genug, meine ich, um für die Demokratie zu stimmen? Vermutlich könnte ich, wenn ich das täte, den Leuten bequem aus der Hand fressen, was? Ich will aber niemandem aus der Hand fressen. Ich will in Ruhe gelassen werden. Meinen Träumen nachhängen, an das glauben, was ich einmal glaubte – nämlich, daß das Leben gut und schön ist und die Menschen in Frieden und Wohlergehen miteinander leben können. Kein Hurensohn dieser Erde kann mir weismachen, man müsse zuerst eine Million oder zehn Millionen Menschen kaltblütig umbringen, um das Leben besser zu machen. Nein, mein Herr, diese Kerle haben kein Herz. Ich weiß, daß die Deutschen nicht schlechter sind als wir, und ich weiß bei Gott aus Erfahrung, daß zumindest einige von ihnen verdammt viel besser sind als die Franzosen oder die Engländer.
Dieser Schullehrer, den wir zum Präsidenten machten, glaubte wohl, alles recht ins Gleis gebracht zu haben, nicht wahr? Können Sie sich ihn vorstellen, wie er in Versailles gleich einem alten Ziegenbock auf dem Fußboden herumkriecht, um mit einem Blaustift imaginäre Grenzen zu ziehen? Was ist der Sinn, neue Grenzen aufzurichten, können Sie mir das sagen? Wozu überhaupt Zölle und Besteuerungen, Schilderhäuser und Bunker? Warum gibt England nicht einige seiner unrechtmäßigen Besitzungen auf? Wenn die armen Leute in England sich nicht die Lebensnotdurft verdienen können, solange ihre Regierung das größte Weltreich besitzt, das es je gegeben hat, wie sollen sie dann ihren Lebensunterhalt verdienen, wenn das Empire in Stücke fällt? Warum wandern sie nicht aus nach Kanada, Afrika oder Australien?
Noch andere Dinge verstehe ich nicht. Wir behaupten immer, alles sei in bester Ordnung, wir hätten die beste Regierung unter der Sonne. Woher wissen wir das – haben wir die anderen ausprobiert? Läuft hier alles so wundervoll, daß wir den Gedanken an eine Änderung nicht ertragen könnten? Angenommen, ich glaubte ehrlich an den Faschismus oder den Kommunismus, an die Polygamie oder den Mohammedanismus, an den Pazifismus oder sonst eines der Dinge, die jetzt tabu in diesem Lande sind? Was würde mit mir geschehen, wenn ich meine Klappe aufmachen würde, he? Warum wagt ihr nicht einmal, gegen das Impfen zu protestieren, obschon genügend Beweise vorhanden sind, daß es mehr Schaden als Nutzen anrichtet? Wo ist diese Freiheit und Unabhängigkeit, deren wir uns rühmen? Man ist nur frei, wenn man bei seinem Nachbarn in gutem Geruch steht, und selbst dann läßt man einem verteufelt wenig Spielraum. Ist man aber ganz abgebrannt und arbeitslos, dann ist eure Freiheit keinen Pfifferling wert. Und wenn man dazu noch alt ist, dann bedeutet sie das nackte Elend. Die Menschen sind viel gütiger zu Tieren, Blumen und Geisteskranken. Die Zivilisation ist ein Segen für die Untüchtigen und Degenerierten – die anderen zerbricht oder demoralisiert sie. Was die Bequemlichkeiten des Lebens betrifft, so bin ich im Gefängnis besser dran als draußen. Im einen Falle nimmt man einem die Freiheit, im anderen die Mannhaftigkeit. Wenn man mitmacht, kann man Autos, Stadthäuser, Mätressen, Gänseleberpastete und den ganzen dazugehörigen Plunder haben. Aber wer will schon mitmachen? Lohnt es die Mühe? Haben Sie jemals einen Millionär gesehen, der glücklich war oder seine Selbstachtung bewahrte? Sind Sie jemals in Washington gewesen und haben unsere Gesetzesbrecher – Verzeihung, ich meine Gesetzgeber – bei einer Sitzung gesehen? Das müssen Sie gesehen haben! Wenn man ihnen gestreifte Sträflingskittel anzöge und sie mit Pickel und Schaufel hinter Gitter steckte, könnte kein Mensch auf der Welt etwas anderes sagen, als daß sie hier am rechten Platz seien. Oder nehmen Sie dieses Verbrecheralbum von Vizepräsidenten. Erst unlängst stand ich vor einem Drugstore und studierte ihre Physiognomien. Noch nie hat es eine gemeinere, ausgekochtere, häßlichere und fanatischere Kollektion menschlicher Gesichter zu einer Gruppe vereint gegeben. Und das ist das Menschenmaterial, aus dem man den Präsidenten wählt, wenn es zu einem Mord kommt. Ja, zu einem Mord … Ich saß am Tag nach der Wahl in einem Restaurant – es war in Maine –, und der Mann neben mir versuchte mit einem anderen eine Wette abzuschließen, daß Roosevelt nicht seine ganze Amtszeit überleben würde. Er bot fünf zu eins – aber niemand wollte dagegen wetten. Am meisten betroffen war ich über die Kellnerin, auf die niemand geachtet hatte und die plötzlich in ruhigem Ton bemerkte, daß ‹bei uns wohl wieder mal ein Mord fällig sei›. Morde scheinen eine häßliche Sache, wenn es sich um den Präsidenten der Vereinigten Staaten handelt, aber ständig wird viel gemordet, und niemand scheint sich groß darüber aufzuregen. Dort wo ich aufgewachsen bin, pflegten wir einen Neger totzupeitschen, nur eben um einem Besucher zu zeigen, wie's gemacht wird. Es geschieht noch immer, aber vermutlich nicht mehr so öffentlich. Wir wollen die Dinge besser machen, indem wir sie heimlich tun.
Wir essen das, was man uns zuteilt … Freilich habe ich keinen Geschmackssinn mehr, durch all den Alkohol, den ich in mich hineingieße. Aber für einen Menschen, der noch einige Geschmacksnerven hat, muß es höllisch schwer sein, das Spülwasser hinunterzubringen, das man einem in öffentlichen Lokalen vorsetzt. Sie entdecken jetzt, daß die Vitamine fehlen. Was tun sie also? Ändern sie die Kost, wechseln sie den Küchenchef? Nein, sie geben einem das gleiche ausgelaugte Zeug, nur fügen sie die nötigen Vitamine hinzu. Das nennt sich Zivilisation – immer eselsdumm an die Dinge herangehen. Ich versichere Ihnen, ich bin jetzt so gottverdammt zivilisiert, daß ich es vorziehe, mein Gift direkt zu nehmen. Hätte ich ein sogenanntes ‹normales Lebern geführt, so läge ich mit fünfzig ohnehin auf dem Misthaufen. Ich bin jetzt achtundvierzig und kerngesund, indem ich immer genau das Gegenteil von dem tue, was einem empfohlen wird. Würden Sie nur vierzehn Tage so leben wie ich, lägen Sie bereits im Krankenhaus. Was kommt also dabei heraus, wollen Sie mir das sagen? Würde ich nicht trinken, dann hätte ich ein anderes Laster – wäre vielleicht ein Kinderdieb oder ein verfeinerter Jack-der-Bauchaufschlitzer – wer weiß? Und wenn ich keine Laster hätte, wäre ich nur eben ein armer Streber, ein Schmarotzer wie tausend andere – und was hätte ich damit erreicht? Sie glauben doch nicht, daß es mir eine Befriedigung gewähren würde, im Geschirr zu sterben, wie man so sagt? Nein, bestimmt nicht! Lieber stürbe ich in der Trinkerheilanstalt unter den Hoffnungslosen und Verkommenen. Wenigstens werde ich, wenn es dazu kommt, die Befriedigung haben, daß ich nur einen Herrn und Meister hatte – nämlich die Whiskybuddel. Sie haben tausend Meister, falsche, heimtückische, die Sie sogar im Schlaf quälen. Ich habe nur einen, und um die Wahrheit zu sagen, ist er für mich mehr ein Freund als ein Zuchtmeister. Er bringt mich oft in schlimme Lagen, aber er belügt mich nie. Nie spricht er von ‹Freiheit, Unabhängigkeit und Gleichheit› oder dergleichen Quatsch. Er sagt einfach: ‹Ich mache dich so sternhagelbesoffen, daß du nicht mehr weißt, wer du bist›, und das ist alles, wonach ich verlange. Wenn nun Mr. Roosevelt oder ein anderer Politiker ein mir gegebenes Versprechen halten könnte, so hätte ich ein wenig Respekt vor ihm. Aber wer hat jemals von einem Diplomaten oder Politiker gehört, der sein Wort gehalten hat? Es ist, als erwarte man von einem Millionär, er solle sein Vermögen den Männern und Frauen geben, denen er es abgegaunert hat. So was gibt es einfach nicht.»