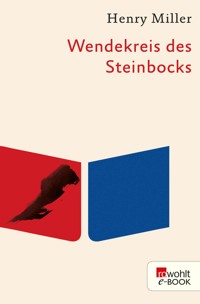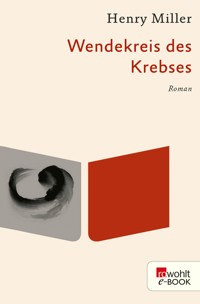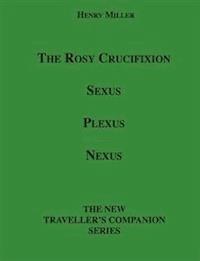9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch, Autobiographie, Tagebuch intimsten Erlebens, leidenschaftlicher Selbsterkenntnis, erzählt von Millers Jugend in New York. Unter Außenseitern und kleinbürgerlichen Existenzen lebt er mit seiner Gefährtin Mona ein Leben, das auf nichts gestellt ist, nur auf die einzige kühne Sicherheit: die Gewißheit seiner Berufung. Die aufregende Chronik der Selbstbefreiung einer dynamischen Individualität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1114
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Henry Miller
Plexus
Roman
Über dieses Buch
Dieses Buch, Autobiographie, Tagebuch intimsten Erlebens, leidenschaftlicher Selbsterkenntnis, erzählt von Millers Jugend in New York. Unter Außenseitern und kleinbürgerlichen Existenzen lebt er mit seiner Gefährtin Mona ein Leben, das auf nichts gestellt ist, nur auf die einzige kühne Sicherheit: die Gewißheit seiner Berufung. Die aufregende Chronik der Selbstbefreiung einer dynamischen Individualität.
Vita
Henry Miller, der am 26. Dezember 1891 in New York geborene deutschstämmige Außenseiter der modernen amerikanischen Literatur, wuchs in Brooklyn auf. Die dreißiger Jahre verbrachte Miller im Kreis der «American Exiles» in Paris. Sein erstes größeres Werk, das vielumstrittene «Wendekreis des Krebses», wurde – dank des Wagemuts eines Pariser Verlegers – erstmals 1934 in englischer Sprache herausgegeben. In den USA zog die Veröffentlichung eine Reihe von Prozessen nach sich; erst viel später wurde das Buch in den literarischen Kanon aufgenommen. Henry Miller starb am 7. Juni 1980 in Pacific Palisades, Kalifornien.
Impressum
Die Originalausgabe erschien bei The Olympia Press, Paris, unter demselben Titel.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2020
Copyright © 1955 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
All rights reserved in all countries: Henry Miller, Big Sur, Cal., USA
Covergestaltung Konzept any.way, Hamburg Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Coverabbildung Gettyimages/Thoth_Adan
ISBN 978-3-644-00626-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Zu diesem Buch
Das leidenschaftliche Bekenntnis eines großen Schriftstellers zu einer schonungslosen Ausdrucksform. Autobiographie, Tagebuch intimster Erlebnisse und kühnes Bekenntnis ohne den künstlichen Filter literarischer Rücksichten, erzählt dieses Buch von Millers Jugend in New York, von der Not, der Anfechtung, den Ekstasen und Wonnen eines jungen Mannes, der in jedem Augenblick von einem dämonischen Drang zum Schreiben besessen ist. Inmitten der kleinbürgerlichen Existenzen Manhattans, Brooklyns, Staten Islands und Floridas lebt er mit seiner herrlichen Gefährtin Mona ein Leben, das auf nichts anderes gestellt ist als auf eine einzige kühne Gewißheit : die Gewißheit seiner Berufung. Die Abenteuer, die diesen ungewöhnlichen Menschen prägen, die außerordentlichen Gestalten, deren Begegnung ihm stets zum steigenden Erlebnis wird, fügen sich zur erregenden Chronik einer dynamischen Individualität.
Henry Miller, der am 26. Dezember 1891 in New York geborene deutschstämmige Außenseiter der modernen amerikanischen Literatur, wuchs in den Großstadtstraßen Brooklyns auf. Neun Jahre gehörte er dann den Pariser Kreisen der «American Exiles» an. In der von Peter Neagoe herausgegebenen avantgardistischen Anthologie «Americans Abroad» (1932) erregte er erstmals mit der Erzählung «Mademoiselle Claude» Aufsehen, die in dem rororo-Band Millerscher Meistererzählungen «Lachen, Liebe, Nächte» (Nr. 10227) enthalten ist. Ein Jahr vorher hatte er sein vielumstrittenes erstes größeres Werk «Wendekreis des Krebses» (rororo Nr. 14361) abgeschlossen, ohne Hoffnung, dieses alle moralischen und formalen Maßstäbe zertrümmernde Werk jemals gedruckt zu sehen. Dem Wagemut eines Pariser Verlegers verdanken wir diese erste Buchveröffentlichung in englischer Sprache, der später ein weiteres romanhaft-autobiographisches Werk, «Wendekreis des Steinbocks» (rororo Nr. 14510), folgte. Henry Miller starb am 7. Juni 1980 in Pacific Palisades, Kalifornien.
Weitere Informationen zum Werk des Autors finden sich im Anhang dieses Buches.
1
In ihrem enganliegenden Kleid mit dem dazu passenden Turban sah sie entzückend aus. Der Frühling war gekommen, und sie hatte ein Paar lange Handschuhe übergestreift und einen schönen Maulwurfspelz lässig um ihren vollen runden Hals geschlungen. Wir hatten Brooklyn Heights gewählt, um dort eine Wohnung zu suchen, da wir uns von allen unseren Bekannten, insbesondere von Kronski und Arthur Raymond, möglichst fernhalten wollten. Wir hatten vor, nur Ulric unsere neue Adresse zu geben. Es sollte für uns eine richtige Vita nuova werden, frei von den Zudringlichkeiten der Außenwelt.
An dem Tage, an dem wir uns auf die Suche nach unserem kleinen Liebesnest machten, waren wir strahlend glücklich. Jedesmal, wenn wir in einer Vorhalle ankamen und auf die Klingel drückten, nahm ich sie in die Arme und küßte sie wieder und wieder. Ihr Kleid umschloß sie wie ein Futteral. Sie hatte nie verführerischer ausgesehen. Es kam vor, daß die Tür sich vor uns öffnete, ehe wir uns voneinander loslösen konnten. Manchmal wurden wir gebeten, den Ehering oder sogar den Trauschein vorzuweisen.
Gegen Abend gerieten wir an eine nicht spießige, warmherzige Frau aus den Südstaaten, die sofort etwas für uns übrig zu haben schien. Es war eine bezaubernde Wohnung, die sie zu vermieten hatte, aber sie ging weit über unsere Mittel. Mona war natürlich entschlossen, sie zu nehmen: es sei genau die Art von Wohnung, die sie sich immer erträumt habe. Die Tatsache, daß die Miete doppelt so hoch war wie das, was wir anlegen wollten, beunruhigte sie nicht weiter. Ich brauchte ihr nur alles zu überlassen, sie würde es schon «schaukeln». In Wahrheit wollte ich die Wohnung ebenso gerne mieten wie sie, doch gab ich mich keinen Illusionen hin, was das «Schaukeln» der Miete betraf. Ich war überzeugt, daß wir, wenn wir sie nahmen, in der Patsche sitzen würden.
Die Frau, mit der wir verhandelten, hatte natürlich keinen Verdacht, daß sie ein höchst unsicheres Risiko einging. Wir saßen gemütlich oben in ihrer Wohnung und tranken Sherry. Bald kam auch ihr Mann. Auch er schien zu finden, daß wir in Ordnung seien. Er stammte aus Virginia und war ein Gentleman. Meine Stellung bei der Telegrafengesellschaft machte offensichtlich Eindruck auf ihn. Sie drückten ihre ehrliche Überraschung darüber aus, daß ein so junger Mensch wie ich eine so verantwortungsvolle Stellung innehabe. Es versteht sich, daß Mona, so gut sie konnte, damit auftrumpfte. Wenn man sie hörte, war ich bereits für den Posten eines Superintendanten und in ein paar Jahren für den eines Vizepräsidenten vorgesehen. «Hat Mr. Twillinger dir das nicht selbst gesagt?» fragte sie und zwang mich zu nicken.
Es endete damit, daß wir eine Anzahlung von nur eben zehn Dollar machten, was ein wenig lächerlich aussah angesichts der Tatsache, daß die Miete neunzig Dollar im Monat betragen sollte. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie wir den Rest für diesen Monat aufbringen sollten, ganz zu schweigen von den Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen, die wir benötigten. Ich betrachtete die angezahlten zehn Dollar als verloren. Eine Geste, um das Gesicht zu wahren, nichts weiter. Ich war sicher, daß Mona, wenn wir erst einmal diesen Sirenengesängen entronnen waren, andern Sinnes würde.
Aber wie gewöhnlich täuschte ich mich. Sie war fest entschlossen, einzuziehen. Die restlichen achtzig Dollar? Die würden wir von einem ihrer ergebenen Verehrer, einem Angestellten im Hotel Brotzell, bekommen.
«Und wer ist er?» wagte ich zu fragen, da sein Name noch nie zuvor von ihr erwähnt worden war.
«Erinnerst du dich denn nicht? Ich habe dich ihm erst vor vierzehn Tagen vorgestellt, als du und Ulric uns auf der Fünften Avenue begegnet seid. Er ist vollständig harmlos.»
Scheinbar waren sie alle «vollständig harmlos». Auf diese Weise wollte sie mir zu verstehen geben, daß diese Männer nie daran dächten, sie mit dem Vorschlag verlegen zu machen, ob sie eine Nacht mit ihnen verbringen möchte. Sie waren alle «Gentlemen» und gewöhnlich Dummköpfe obendrein. Ich mußte mir richtig Mühe geben, mir ins Gedächtnis zurückzurufen, wie dieser besondere Dummkopf aussah. Ich konnte mich nur noch erinnern, daß er ziemlich jung und ziemlich blaß, kurzum unbestimmbar war. Wie sie es anstellte, ihre verliebten Galane davon abzuhalten, ihr auf die Bude zu rücken, feurig und stürmisch, wie einige von ihnen zu sein schienen, war mir ein Rätsel. Ohne Zweifel ließ sie alle in dem Glauben – wie sie es auch mit mir gemacht hatte –, sie wohne bei ihren Eltern, ihre Mutter sei eine böse Hexe und ihr Vater ans Bett gefesselt, an einem Krebsleiden auf den Tod krank. Glücklicherweise interessierten mich ihre galanten Verehrer nur selten. (Besser, man steckt die Nase nicht zu tief hinein, sagte ich mir immer vor.) Wichtig sich vor Augen zu halten war: «Vollständig harmlos».
Man mußte etwas mehr als nur das Geld für die Miete haben, um einen Haushalt zu führen. Ich entdeckte allerdings, daß Mona an alles gedacht hatte. Dreihundert Dollar hatte sie dem armen Kerl abgenommen. Sie hatte fünfhundert verlangt, aber er hatte widersprochen, da sein Bankguthaben beinahe erschöpft sei. Zur Strafe dafür, daß er so wenig vorsorglich war, veranlaßte sie ihn, ihr ein kostspieliges Dirndlkostüm und ein Paar entsprechende Schuhe zu kaufen. Das würde ihn eines Besseren belehren.
Da sie an jenem Nachmittag zu einer Probe gehen mußte, beschloß ich, die Möbel und die anderen Dinge selbst auszuwählen. Der Gedanke, diese Gegenstände in bar zu bezahlen, während Kauf auf Kredit geradezu der Grundsatz unseres Landes war, erschien mir völlig verrückt. Ich dachte sofort an Dolores, die jetzt Einkäuferin für eines der großen Kaufhäuser in der Fulton Street war. Dolores, dessen war ich sicher, würde sich meiner annehmen.
Ich benötigte nicht einmal eine Stunde, um alles Notwendige zur Möblierung unseres Liebesnests auszuwählen. Ich traf meine Wahl mit Geschmack und Umsicht, ohne einen hübschen Schreibtisch mit einer Menge Schubladen zu vergessen. Dolores konnte nur mühsam eine gewisse Besorgnis verbergen, was unsere Zahlungsfähigkeit hinsichtlich der Monatsraten betraf, aber ich besiegte ihre Zweifel, indem ich ihr versicherte, Mona verdiene außerordentlich gut am Theater. Außerdem hätte ich schließlich noch immer meine Stellung bei der Telegrafengesellschaft.
«Ja, aber die Unterhaltskosten für deine geschiedene Frau?» murmelte sie.
«Ach, das! Das zahle ich nicht mehr sehr lange», erwiderte ich lächelnd.
«Du willst damit sagen, daß du sie sitzenläßt?»
«Etwas dergleichen», räumte ich ein. «Man kann doch nicht ewig einen Mühlstein um den Hals mitschleppen.»
Sie fand das bezeichnend für mich, Lump, der ich in ihren Augen war. Sie sagte das jedoch so, als hielte sie Lumpen für liebenswerte Menschen. Als wir uns trennten, fügte sie hinzu: «Ich glaube, ich hätte dir nicht trauen dürfen.»
«Unsinn», sagte ich. «Wenn wir nicht zahlen, wird man die Möbel wieder abholen. Warum also beunruhigst du dich?»
«Ich denke nicht an die Firma, ich denke an mich.»
«Nun, nun! Ich werde dich schon nicht im Stich lassen, das weißt du doch.»
Natürlich ließ ich sie im Stich – aber unabsichtlich. Damals glaubte ich wirklich, trotz meiner ursprünglichen Besorgnisse, daß alles wunderbar in Ordnung kommen würde. Sooft ich dem Zweifel oder der Verzweiflung anheimfiel, konnte ich mich darauf verlassen, daß Mona mir eine Aufmunterungsspritze gab. Mona lebte vollkommen in der Zukunft. Die Vergangenheit war für sie ein sagenhafter Traum, den sie beliebig zurechtrückte. Man durfte nie Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen – das sei eine vollkommen verkehrte Art, die Dinge zu beurteilen. Die Vergangenheit, soweit sie eine Schlappe oder einen Fehlschlag bedeutete, existierte ganz einfach nicht.
Schon bald fühlten wir uns in unserem bezaubernden neuen Nest völlig wie zu Hause. Wir erfuhren, daß das Haus früher einem reichen Richter gehört hatte, der es nach seinen Ideen einrichtete. Er muß ein Mann mit vorzüglichem Geschmack und etwas überschwenglicher Veranlagung gewesen sein. Die Böden waren aus Parkett, die Vertäfelungen aus schönem Nußholz. Es gab Wandbespannungen aus rosa Seide, und die Büchernischen wären groß genug gewesen, um sie in Schlafkojen zu verwandeln. Wir bewohnten nach vorn die Hälfte des ersten Stockwerks, das auf den ruhigsten, aristokratischsten Teil von ganz Brooklyn hinausging. Unsere Nachbarn besaßen alle Limousinen, Haushofmeister, Luxushunde und Katzen, deren Futter uns das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ. Unser Haus war das einzige des ganzen Blocks, das in Wohnungen aufgeteilt war.
Hinter unseren zwei Räumen und durch eine Schiebetür von ihnen getrennt, befand sich ein riesiges Zimmer, dem man eine kleine Küche und ein Bad angeschlossen hatte. Aus diesem oder jenem Grund blieb es ohne Mieter. Vielleicht war es zu mönchisch. Den größten Teil des Tages war es infolge seiner bunten Glasfenster düster oder, besser gesagt, zwielichtig. Aber wenn am späten Nachmittag die Sonne einfiel und auf das spiegelnde Parkett leuchtende Arabesken malte, ging ich gerne hinein und wanderte, besinnlich gestimmt, darin auf und ab. Manchmal streiften wir unsere Kleider ab und tanzten darin, wobei wir uns über die lustigen Muster verwunderten, die die bunten Glasfenster auf unsere nackten Körper warfen. In ausgelassener Stimmung schlüpfte ich in ein Paar Pantoffeln und ahmte den Auftritt einer Kunstschlittschuhläuferin nach. Oder ich ging auf den Händen und sang dabei mit Fistelstimme. Manchmal, nach einigen Gläsern, versuchte ich die Hanswurstereien meiner Lieblingspossenreißer von den Varietés wiederzugeben.
Die ersten Monate, in denen alle unsere Bedürfnisse von der gütigen Vorsehung befriedigt wurden, ging alles einfach großartig. Darüber gibt es kein weiteres Wort zu verlieren. Niemand platzte unverhofft bei uns herein. Wir lebten ausschließlich füreinander in einem mollig warmen Nest. Wir hatten niemanden nötig, nicht einmal Gott den Allmächtigen. Wenigstens glaubten wir das. Die ausgezeichnete Bibliothek der Montague Street, ein Leichenschauhaus von Gebäude, aber mit Schätzen angefüllt, war nur zwei Schritte von uns entfernt. Während Mona im Theater war, widmete ich mich der Lektüre. Ich las alles, was meine Phantasie ansprach, und zwar mit doppelter Aufmerksamkeit. Oft war es mir unmöglich zu lesen: die Wohnung war wirklich zu wundervoll. Ich sehe mich noch das Buch schließen, langsam aus meinem Stuhl aufstehen und heiter und besinnlich, vollkommen zufrieden, von einem Zimmer zum anderen wandern. Ehrlich gesagt, ich wünschte nichts anderes, als daß dieser Zustand in seiner ganzen Reichhaltigkeit fortdauern möge. Alles, was ich besaß, alles, dessen ich mich bediente, alles, was ich an mir trug, war ein Geschenk Monas: der seidene Morgenrock, der eher für einen Kabarettstar als für einen kleinen Angestellten geschaffen war, die prächtigen, saffianledernen Pantoffeln, die Zigarettenspitze, die ich nur in ihrer Gegenwart benützte. Wenn ich die Asche in den Aschenbecher abstreifte, beugte ich mich vor, um die Spitze zu bewundern. Mona hatte drei Stück davon gekauft, die ganz gleich, exotisch und hübsch waren. Sie waren so schön, so kostbar, daß wir fast in Anbetung vor ihnen verharrten.
Die Umgebung des Hauses war bemerkenswert. Ein kurzer Spaziergang in gleichgültig welcher Richtung führte mich in die verschiedensten Viertel: zu dem phantastischen Platz unter dem Eisengebälk der Brooklynbrücke; zu den Landungsstellen der alten Fährboote, in deren Nähe Araber, Türken, Syrer, Griechen und andere levantinische Völkerschaften sich in Scharen niedergelassen hatten; zu den Docks und Kais, wo die Schiffe der ganzen Welt vor Anker lagen; zum Handelszentrum bei der Borough Hall, einem zur Nachtzeit gespentischen Viertel. Im Mittelpunkt dieser Columbia Heights erhoben sich altmajestätische Kirchen, Klubgebäude und Wohnhäuser der Reichen, alle zu einem festen und alten Kernbestand gehörig, in den zusehends nachdrängende Scharen von Ausländern, Gestrandeten und allerhand Gesindel einsickerten.
Als Kind war ich häufig hierhergekommen, um meine Tante zu besuchen, die über einen Stall im Nebengebäude eines Hauses wohnte, das zu den häßlichsten gehörte. Unweit davon, in der Sackett Street, hatte mein alter Freund Al Burger gewohnt, dessen Vater Kapitän eines Schleppdampfers war. Mit etwa fünfzehn Jahren begegnete ich Al Burger zum erstenmal am Steilufer des Neversinkflusses. Er war es, der mich lehrte, wie ein Fisch zu schwimmen, einen Kopfsprung in seichtes Wasser zu machen, im Freistil zu ringen, mit Pfeil und Bogen zu schießen, mich meiner Fäuste zu bedienen, ohne Ermüdung zu laufen und so fort. Seine Eltern waren Dänen, und seltsamerweise hatten alle in seiner Familie einen prächtigen Sinn für Humor, mit Ausnahme seines Bruders Jim, der ein Athlet, ein Geck und eitler Dummkopf war. Im Gegensatz zu ihren Vorfahren wohnten sie jedoch in einem beschämend schlecht gehaltenen Haus. Jeder verfolgte anscheinend seinen eigenen bequemen Weg. Es gab zwei Schwestern in der Familie, beide sehr hübsch, und eine ziemlich schmuddelige, aber ebenfalls schöne und, was mehr ist, sehr lustige, sehr duldsame und großzügige Mutter. Sie war früher Opernsängerin gewesen. Was den Alten, den «Kapitän» anbetrifft, so sah man ihn selten. Wenn er sich zeigte, war er gewöhnlich ein wenig besäuselt. Ich kann mich nicht erinnern, daß die Mutter jemals ein richtiges Essen zubereitet hätte. Wenn wir Hunger hatten, warf sie uns Geld hin und sagte, wir sollten uns etwas kaufen. Wir kauften immer die gleichen langweiligen Dinge: Frankfurter Würstchen, Kartoffelsalat, Essiggurken, Torte und Mürbekuchen. Tomatensauce und Senf wurden reichlich verwandt. Der Kaffee war immer durchsichtig wie Spülwasser, die Milch geronnen, und niemals war im Haus ein Teller, eine Tasse, ein Messer oder eine Gabel vorhanden, die sauber waren. Aber es waren fröhliche Mahlzeiten, und wir schlangen sie hinunter wie die Wölfe.
Am lebhaftesten erinnere ich mich an das Leben auf den Straßen und hatte es am liebsten. Als Freunde schienen einer anderen Gattung von Jungen anzugehören als der, die ich kannte. Mehr Wärme und Freiheit, eine größere Gastfreundschaft herrschten in der Sackett Street. Obwohl sie ungefähr in meinem Alter waren, machten mir seine Freunde den Eindruck, reifer und auch unabhängiger zu sein. Wenn ich mich von ihnen trennte, hatte ich immer das Gefühl, eine Bereicherung erfahren zu haben. Die Tatsache, daß sie zu diesem Viertel gehörten, daß ihre Familie seit Generationen hier wohnten und sie eine gleichartigere Gruppe als wir bildeten, mag etwas mit den Eigenschaften zu tun gehabt haben, die sie mir so lieb und wert machten. Es gab einen unter ihnen, an den ich mich lebhaft erinnere, obwohl er seit langem tot ist: Frank Schofield. Zu der Zeit, als wir uns kannten, war Frank erst siebzehn Jahre alt, hatte aber bereits die Statur eines Mannes. Wir hatten absolut nichts gemein, wenn ich mir unsere seltsame Freundschaft wieder ins Gedächtnis rufe. Das Anziehende an ihm war seine ungezwungene, entspannte und heitere Art, sein offenes Hinnehmen alles dessen, was ihm geboten wurde, ob es sich nun um ein kaltes Frankfurter Würstchen, einen warmen Händedruck, ein altes Federmesser oder das Versprechen eines Wiedersehens in der nächsten Woche handelte. Er wuchs zu einem Hünen von Kerl mit einem riesigen Körpergewicht heran, der in einer merkwürdig instinktiven Art geschickt genug war, die rechte Hand eines sehr bedeutenden Zeitungsmannes zu werden, mit dem er in der ganzen Welt umherreiste und für den er alle möglichen undankbaren Aufgaben erledigte. Ich sah ihn nach den guten alten Zeiten der Sackett Street vermutlich nicht häufiger als im ganzen drei- oder viermal. Aber ich vergaß ihn nie. Es tat mir gut, mir sein Bild wieder vor Augen zu rufen, so warmherzig, ein so guter Kerl, so vollständig arglos und gutgläubig war er. Er schrieb nie etwas anderes als Postkarten. Nur mit Mühe konnte man sein Gekritzel entziffern. Nur eben eine Zeile, um mitzuteilen, daß es ihm gutging, daß die Welt herrlich war, und wie, zum Teufel, ging es einem selbst?
Jedesmal wenn Ulric uns besuchte, was gewöhnlich an einem Samstag oder Sonntag der Fall war, nahm ich ihn auf lange Spaziergänge durch diese alten Viertel mit. Auch ihm waren sie von Kindheit an vertraut. Gewöhnlich hatte er ein Skizzenbuch bei sich, um, wie er sich ausdrückte, «einige Notizen zu machen». Ich verwunderte mich dann über seine Leichtigkeit, den Bleistift und den Pinsel zu handhaben. Mir kam nie der Gedanke, daß ich eines Tages selbst das gleiche tun könnte. Er war Maler und ich Schriftsteller – oder jedenfalls hoffte ich, eines Tages einer zu sein. Die Welt der Malerei schien mir ein Bereich reiner Zauberei, der vollständig außerhalb meiner Möglichkeiten lag.
Obwohl er in den darauffolgenden Jahren nie ein berühmter Maler wurde, war Ulric doch bewundernswert mit der Welt der Kunst vertraut. Niemand hätte mit mehr Einfühlungsvermögen und Verständnis über die Maler sprechen können, die er liebte. Noch heute höre ich den Nachklang seiner langen, begeisterten Auslassungen über Künstler wie Cimabuë, Uccello, Paolo della Francesca, Botticelli, Vermeer und andere. Manchmal saßen wir beisammen, um ein Buch mit Reproduktionen – immer von den großen Meistern, versteht sich – zu betrachten. Wir konnten Stunden damit verbringen – er wenigstens konnte es –, über ein einziges Bild zu sprechen. Zweifellos darum, weil er selbst so restlos bescheiden und ehrerbietig war, konnte Ulric über die «Meister» mit soviel Einsicht und Scharfsinn sprechen. Dem Geiste nach war er selbst ein Meister. Ich danke Gott, daß er nie seine Gabe, zu verehren und zu bewundern, verloren hat. Die geborenen Verehrungsbereiten sind in der Tat selten.
Wie O'Rourke, der Detektiv, neigte er in den unerwartetsten Ausgenblicken zu Begeisterungsausbrüchen. Oft blieb er im Verlauf unserer Spaziergänge auf den Kais stehen, um auf eine besonders baufällige Hausfront oder eine zerfallene Mauer zu deuten und einen Vortrag über ihre Schönheit vor dem Hintergrund der Wolkenkratzer am anderen Ufer zu halten, über die riesigen Rümpfe und Masten der Schiffe, die in ihren Binnenhäfen vor Anker lagen. Das Thermometer konnte auf Null stehen, ein eisiger Wind konnte wehen, er schien sich nichts daraus zu machen. Bei solchen Gelegenheiten zog er mit verlegener Miene einen kleinen, zerknitterten Briefumschlag aus der Tasche und bemühte sich, mit dem Stumpf dessen, was einmal ein Bleistift gewesen war, «einige weitere Notizen» zu machen. Es kam nie etwas besonders Großes bei diesen Aufzeichnungen heraus, wie zugegeben werden muß. Jedenfalls nicht zu jener Zeit.
Zwischen den Arbeiten, die er unternahm, um Geld zu verdienen, veranlaßte er seine Freunde, insbesondere aber seine Freundinnen, ihm Modell zu sitzen. Er arbeitete in diesen Zwischenzeiten wie wild, als ob er sich vorbereiten wolle, im Salon auszustellen. Vor seiner Staffelei hatte er ganz das Gehaben und alle Launen eines «Maestro». Die Raserei seiner Hingabe war beinahe erschreckend anzusehen. Aber seltsamerweise waren die Ergebnisse immer entmutigend.
«Zum Teufel mit alldem», sagte er, «ich bin nur ein Illustrator.»
Ich sehe ihn noch vor einem seiner Fehlwerke stehen, seufzen, schnaufen und sich die Haare raufen. Ich sehe ihn noch eine Monographie über Cézanne ergreifen, sich eines seiner Lieblingsbilder vor Augen halten und dann seine eigene Arbeit mit einem angeekelten Hohnlächeln betrachten.
«Schau dir das an», sagte er dann und zeigte auf ein besonders geglücktes Bild Cézannes. «Warum, zum Teufel, bringe ich so etwas nicht auch fertig – nur einmal? Wo fehlt es bei mir, deiner Meinung nach? Na schön … »
Und er stieß einen tiefen Seufzer aus, manchmal ein richtiges Stöhnen.
«Komm, trinken wir einen Schluck, was meinst du dazu? Wozu ist es gut, ein Cézanne zu sein? Ich weiß, Henry, was nicht geht. Es ist nicht nur dieses Bild da … oder das andere, frühere … mein ganzes Leben hinkt. Die Arbeit eines Menschen spiegelt wider, was er ist, was er den ganzen lieben langen Tag denkt, ist's nicht so? Unter diesem Gesichtspunkt gesehen, bin ich nichts als ein Stück ranziger Käse, stimmt's? Na also! Gießen wir uns einen hinter die Binde!»
Damit hob er sein Glas mit einem seltsamen, schiefen Verziehen des Mundes, das schmerzlich, allzu schmerzlich beredt war.
Wenn Ulric mir deshalb lieb und wert war, weil er den großen Meistern nacheiferte, so glaube ich, daß ich ihn wirklich verehrte um der Art willen, in der er die Rolle des «Versagers» spielte. Er verstand es, aus seinen Schwächen und Fehlschlägen etwas Großes zu machen. In der Tat besaß er den Geist und die Grazie, einem den Glauben beizubringen, gleich nach dem Erfolg sei es das beste im Leben, ein völlig Gescheiterter zu sein.
Vermutlich ist das die Wahrheit. Was an Ulric versöhnte, war sein vollständiger Mangel an Ehrgeiz. Er brannte nicht darauf, anerkannt zu werden: er wollte ein guter Maler sein, einzig um der Freude willen, etwas Großes hervorzubringen. Er liebte alle guten Dinge des Lebens – und zwar nur die guten. Er war ein Sinnenmensch, ganz und gar. Beim Schach zog er es vor, mit schön geschnitzten Figuren zu spielen, wie schlecht auch immer sein Spiel war. Er empfand allein darin das lebhafteste Vergnügen, Elfenbeinfiguren in die Hand zu nehmen. Ich erinnere mich an unsere Museumsbesuche, die wir machten, um alte Schachbretter aufzustöbern. Wenn Ulric auf einem alten Schachbrett, das einst die Zierde eines mittelalterlichen Schlosses gewesen war, hätte spielen können, so wäre er im siebenten Himmel gewesen und hätte sich nichts daraus gemacht, ob er gewann oder verlor. Er verwendete große Sorgfalt auf die Auswahl von Gebrauchsgegenständen, ob es sich nun um Kleider, Koffer, Hausschuhe, Lampen oder sonst was handelte. Wenn er einen Gegenstand in die Hand nahm, streichelte er ihn. Alles noch irgendwie Verwertbare wurde geflickt, ausgebessert oder wieder geleimt. Er sprach von seinen Sachen wie manche Menschen von ihren Katzen sprechen: er widmete ihnen seine ganze Bewunderung, sogar wenn er mit ihnen allein war. Es kam vor, daß ich ihn dabei überraschte, während er sich mit ihnen unterhielt, mit ihnen plauderte wie mit altvertrauten Freunden. Welcher Gegensatz zu Kronski, wenn ich daran denke! Kronski, dieser unglückliche arme Teufel, schien unter dem von seinen Vorfahren ausrangierten Krimskrams zu leben. Nichts war bei ihm kostbar, nichts hatte für ihn Sinn oder Bedeutung. Alles ging in seinen Händen in Stücke oder wurde fadenscheinig, fleckig und schmutzig. Trotzdem schickte sich eines Tages der gleiche Kronski – wie das zuging, wußte ich nie – zu malen an. Er begann übrigens vortrefflich. Ich traute kaum meinen Augen. Er wandte lebhafte und kühne Farben an, als sei er soeben aus Rußland zurückgekommen. Er blieb acht bis zehn Stunden bei der Arbeit und schenkte sich vorher und nachher einen ein, wobei er sang, pfiff, von einem Fuß auf den andern hüpfte und immer wieder sich selbst Beifall spendete. Doch leider war es nur ein Strohfeuer. Es erlosch nach etlichen Monaten. Danach nie mehr ein Wort von Malerei. Es sah aus, als habe er vergessen, daß er jemals einen Pinsel in die Hand genommen hatte.
Während dieser Zeit, als die Dinge für uns noch recht rosig standen, machte ich in der Bibliothek der Montague Street die Bekanntschaft eines komischen Vogels. Man kannte mich dort gut, denn ich bereitete den Angestellten alle erdenklichen Scherereien, indem ich Werke verlangte, die sie nicht hatten, sie drängte, bei anderen Bibliotheken seltene oder kostbare Bücher anzufordern, mich über ihre Armseligkeit und die Unzulänglichkeiten der Auslieferung beschwerte und mich überhaupt unbeliebt machte. Um die Dinge noch zu verschlimmern, mußte ich häufig riesige Geldstrafen für zu lange behaltene oder verlorene Bücher (die ich mir für meinen eigenen Bücherschrank angeeignet hatte) oder für fehlende Seiten bezahlen. Dann und wann erhielt ich einen öffentlichen Verweis, als ob ich ein Schuljunge wäre, weil ich verschiedene Stellen mit roter Tinte unterstrichen oder Randbemerkungen gemacht hatte. Und dann eines Tages, als ich – nur Gott weiß warum – seltene Bücher über den Zirkus suchte, knüpfte ich eine Unterhaltung mit einem gelehrt aussehenden Mann an, der, wie sich herausstellte, zum Personal gehörte: Im Laufe des Gesprächs erfuhr ich, daß er in manchem berühmten europäischen Zirkus gewesen war. Er erwähnte das Wort Medrano. Das war ein böhmisches Dorf für mich, aber es prägte sich meinem Gedächtnis ein. Jedenfalls faßte ich eine solche Zuneigung für den guten Mann, daß ich ihn auf der Stelle einlud, uns am nächsten Abend zu besuchen. Sobald ich aus der Bibliothek kam, rief ich Ulric an und bat ihn, mit von der Partie zu sein. «Hast du jemals etwas von einem Zirkus Medrano gehört?» fragte ich.
Um es kurz zu machen, das Beisammensein am nächsten Abend war fast ausschließlich dem Zirkus Medrano gewidmet. Als der Bibliothekar wegging, war ich wie berauscht.
«So, das ist also Europa!» sagte ich mir immer wieder laut vor. Ich kam nicht davon los. «Und dieser Mann war dort, hat das alles gesehen. Guter Gott!»
Der Bibliothekar kam häufig wieder, immer mit einem seltenen Buch unterm Arm, von dem er glaubte, ich würde gerne einen Blick hineinwerfen. Gewöhnlich brachte er auch eine Flasche mit. Manchmal spielte er mit uns eine Partie Schach, selten ging er vor zwei oder drei Uhr morgens weg. Jedesmal, wenn er kam, bat ich ihn, über Europa zu sprechen: es war sein «Eintritts-Obolus». Tatsächlich berauschte ich mich an dem Thema: ich konnte fast so über Europa sprechen, als ob ich selber dort gewesen wäre. (Mein Vater war wie ich. Obwohl er nie aus New York hinausgekommen war, konnte er doch von London, Berlin, Hamburg, Bremen und Rom sprechen, als ob er sein ganzes Leben im Ausland verbracht hätte.) Eines Abends kam Ulric mit einem großen Plan von Paris an (dem Plan der Métro), und wir hockten uns auf den Fußboden, um auf gut Glück durch die Straßen von Paris zu wandern und die Bibliotheken, Museen, Kathedralen, Blumenmärkte, Schlachthäuser, Friedhöfe, Bordelle, Bahnhöfe, die Bals musettes, die Magasins und alles übrige zu besuchen. Tags darauf war ich so angetan, so erfüllt von Europa, daß ich nicht an meine Arbeit gehen konnte. Es war meine alte Gewohnheit, mir einen freien Tag zu machen, wenn mir der Sinn danach stand. Ich habe immer die gestohlenen freien Tage am meisten genossen. Das bedeutete, um eine beliebige Stunde aufstehen, im Pyjama herumschlurfen, Grammophonplatten anhören, in den Büchern schmökern, einen Spaziergang am Kai machen und nach einem üppigen Frühstück eine Matinee besuchen. Ein gutes Schauspiel am Vormittag, ein Nachmittag, an dem ich mir vor Lachen die Seiten hielt – das war's, was mir am liebsten war. Manchmal fiel es mir nach einem dieser freien Tage noch schwerer, wieder an die Arbeit zu gehen. Ja, es war mir sogar unmöglich. Mona rief den Chef an, um ihm mitzuteilen, daß meine Erkältung sich verschlimmert hätte. Und er erwiderte immer: «Sagen Sie ihm, er soll noch ein paar Tage im Bett bleiben. Pflegen Sie ihn gut!»
«Ich glaube, diesmal werden sie hinter deine Schliche kommen», meinte Mona.
«Das haben sie bereits getan, mein Schatz. Nur bin ich zu wichtig fürs Geschäft. Sie können nicht ohne mich auskommen.»
«Eines Tages werden sie jemanden herschicken, um nachzusehen, ob du wirklich krank bist.»
«Mache nie auf, wenn es an der Tür läutet, das ist das beste. Oder sage einfach, ich bin zum Arzt gegangen.»
Es war wundervoll, solange es dauerte. Ganz einfach großartig. Ich hatte jedes Interesse an meiner Arbeit verloren. Ich dachte an nichts anderes, als daß ich endlich schreiben wollte. Im Büro tat ich immer weniger, immer häufiger ließ ich alle fünfe gerade sein. Die einzigen Bewerber, die ich gerade eben noch empfing, waren die Fragwürdigen. Das übrige besorgte mein Gehilfe. So oft wie möglich verdrückte ich mich unter dem Vorwand, die Zweigstellen zu inspizieren. Ich suchte eine oder zwei im Herzen der Stadt auf – um mir ein Alibi zu verschaffen –, dann verkroch ich mich in ein Kino. Nach dem Kino suchte ich noch einen Filialleiter auf, erstattete ihm anschließend meinen Bericht und verzog mich dann nach Hause. Manchmal verbrachte ich den Vormittag in einer Bildergalerie oder in der Bibliothek in der 42. Straße. Oder ich stattete Ulric einen Besuch ab und ging anschließend in ein Tanzlokal. Immer häufiger legte ich mir eine Krankheit zu, und sie dauerte jedesmal länger. Die Dinge eilten entschieden der Katastrophe entgegen.
Mona ermutigte meine Seitensprünge. Sie hatte mich nie gerne in der Rolle des Personalchefs gesehen. «Du solltest schreiben», riet sie mir.
«Recht gut und schön», antwortete ich, insgeheim befriedigt, aber doch widerstrebend, um mein Gewissen zu erleichtern. «Recht gut und schön! Aber von was sollen wir leben?»
«Laß das nur mich machen!»
«Aber wir können nicht ewig fortfahren, die Leute zu begaunern und zu beschwatzen.»
«Begaunern? Alle, von denen ich Geld pumpe, können es sich sehr wohl leisten, es zu verborgen. Ich erweise ihnen damit eine Gunst.» Ich konnte es nicht so ansehen wie sie, aber ich gab nach. Schließlich hatte ich keine bessere Lösung zu bieten. Um die Diskussion zu beenden, sagte ich immer: «Jedenfalls gebe ich meine Stellung noch nicht auf.»
Dann und wann endete einer dieser blauen Montage damit, daß wir in der Zweiten Avenue von New York strandeten. Es war verblüffend, was für eine Menge Freunde ich in diesem Viertel hatte. Alles natürlich Juden, und die meisten von ihnen aus dem Gleis geworfen. Aber eine Bande voll Leben. Nachdem wir einen Bissen bei Papa Moskowitz gegessen hatten, gingen wir ins Café Royal. Hier war man sicher, alle Gesuchten zu finden.
Eines Abends bummelten wir über die Avenue, ich blieb gerade vor dem Schaufenster einer Buchhandlung stehen, um wieder einmal einen Blick auf Dostojewskij zu werfen – seine Fotografie war dort seit Jahren ausgestellt –, als wir plötzlich einen alten Freund Arthur Raymonds des Weges kommen sahen. Es war kein Geringerer als Nahoum Youd. Nahoum Youd war ein kleiner, leicht in Begeisterung geratender Mann, der auf jiddisch schrieb. Er hatte eine Gestalt wie ein Schmiedehammer, eine Gestalt, die man nie vergaß, wenn man sie einmal gesehen hatte. Wenn er sprach, war es immer ein Durcheinander und eine Lawine; die Worte überstürzten sich buchstäblich. Es prasselte wie ein Feuerwerk aus ihm heraus, gleichzeitig spritzte sein Speichel, und der Geifer stand ihm vor dem Mund. Sein harter östlicher Akzent war greulich. Aber sein Lächeln war heiter, wie das von Jack Johnson. Ein Irrlicht über seinem Gesicht.
Ich habe ihn nie anders als in einem Erregungszustand gesehen. Er hatte gerade etwas Erstaunliches, etwas Wunderbares, etwas Unerhörtes entdeckt. Indem er es sich von der Leber redete, verabreichte er einem jedesmal eine Dusche. Aber es lohnte sich. Dieser feine Strahl, den er zwischen seinen Vorderzähnen ausstieß, hatte die gleiche anregende Wirkung wie ein nadelspitzer Duschregen. Manchmal waren unter die Dusche ein paar Kümmelkörner gemischt.
Indem er mir das Buch, das ich unter dem Arm trug, entriß, rief er: «Was lesen Sie da? Ah, Hamsun. Gut! Ausgezeichneter Schriftsteller.» Er hatte mich noch nicht einmal begrüßt. «Wir müssen uns wo hinsetzen und miteinander reden. Wohin waren Sie unterwegs? Haben Sie schon gegessen? Ich habe Hunger.»
Ich ließ ihn stehen, als er auf Mona mit Händen (und Füßen) erregt einsprach. Ich pflanzte mich vor dem Bildnis Dostojewskijs auf, wie ich es schon viele Male getan hatte, um von neuem seinen vertrauten Gesichtsausdruck zu betrachten. Ich dachte an meinen Freund Lou Jacobs, der jedesmal, wenn er an einem Denkmal Shakespeares vorbeikam, den Hut zog. Es war mehr als ein Neigen des Kopfes oder ein Gruß, was ich an Dostojewskij richtete. Es glich eher einem Gebet – einem Gebet, das Geheimnis der Offenbarung zu enthüllen. Was für ein banales Gesicht hatte er doch! So slawisch, so ganz das Gesicht eines Muschiks. Das Antlitz eines Menschen, der in einer Volksmenge unbemerkt bleibt. (Nahoum Youd sah weit mehr wie ein Schriftsteller aus als der große Dostojewskij.) Wie immer, versuchte ich in das Geheimnis des Menschen einzudringen, der sich hinter der teigigen Masse der Gesichtszüge verbarg. Alles, was ich klar ablesen konnte, war Traurigkeit und Starrsinn. Ich verlor mich in der Betrachtung. Am Schluß sah ich nur den Künstler, den tragischen, einmaligen Künstler, der ein wahrhaftes Pantheon von Gestalten geschaffen hatte, Menschen, wie man sie nie zuvor kannte und nie wieder kennen würde, von denen jeder einzelne wirklicher, überzeugender, geheimnisvoller und undurchdringlicher war als alle verrückten Zaren und alle grausamen, bösen Päpste zusammengenommen.
Plötzlich fühlte ich die Hand Nahoum Youds schwer auf meiner Schulter. Seine Augen flackerten, Speichel umgab seinen Mund. Sein beulenförmiger Melonenhut, den er in und außer Haus auf dem Kopfe trug, war ihm über die Augen gerutscht und ließ ihn komisch, fast wahnsinnig aussehen.
«Mysterien!» schrie er. «Mysterien! Mysterien!»
Ich sah ihn verwirrt an.
«Haben Sie es nicht gesehen?» brüllte er.
Eine kleine Menschenmenge sammelte sich um uns, eine dieser Ansammlungen, die jedesmal, sobald ein Marktschreier seine Ware auszurufen beginnt, zusammenströmt.
«Von was sprechen Sie?» fragte ich höflich.
«Von Ihrem Knut Hamsun. Das größte Buch, das er je geschrieben hat, heißt Mysterien.»
«Er meint Mysteries», erklärte Mona.
«Ja, Mysteries», schrie Nahoum Youd.
«Er hat mir gerade den ganzen Inhalt erzählt», sagte Mona. «Es klingt so, als ob es ausgezeichnet wäre.»
«Ausgezeichneter als Gedämpftes Saitenspiel?»
Nahoum Youd fiel ein: «Nein, das nicht. Für Segen der Erde bekam er den Nobelpreis. Aber Mysterien kennt niemand. Hören Sie mal, lassen Sie mich Ihnen erklären … » Er machte eine kleine Pause, drehte sich halb um und spuckte aus. «Nein, es ist besser, es nicht zu erklären. Gehen Sie in Ihre Carnegie-Kaugummi-Bibliothek und verlangen Sie es. Wie sagen Sie auf englisch? Mysteries? Fast das gleiche – aber Mysterien klingt besser. Mysterischer, finden Sie nicht?»
Er verzog das Gesicht zu einem wie Trambahngleise breiten Lächeln, und dabei fiel ihm der Hutrand über die Augen.
Plötzlich bemerkte er, daß sich eine Zuhörerschaft um ihn versammelt hatte.
«Geht nach Hause!» rief er und hob beide Arme, um die Menge zu verjagen. «Verkaufen wir hier Schnürsenkel? Was fällt euch ein? Muß ich einen Saal mieten, um ein paar Worte privat mit einem Freund reden zu können? Wir sind hier nicht in Rußland. Schaut, daß ihr heimkommt … gscht!» Und von neuem versuchte er, sie mit den Armen zu verscheuchen.
Niemand rührte sich von der Stelle. Man lächelte nur nachsichtig. Offenbar kannten die Leute ihn gut, diesen Nahoum Youd. Einer sagte etwas auf jiddisch. Nahoum Youd ließ ein trauriges, nachgiebiges Lächeln sehen und blickte uns hilflos an. «Sie wollen, daß ich ihnen etwas auf jiddisch vortrage.»
«Schön, warum tun Sie es nicht?» sagte ich.
Er lächelte wieder, diesmal verlegen. «Sie sind wie Kinder», sagte er. «Warten Sie, ich werde ihnen eine Fabel erzählen. Sie wissen doch, was eine Fabel ist, nicht wahr? Diese handelt von einem jungen Pferd mit drei Beinen. Ich kann sie nur auf jiddisch erzählen … Sie werden das entschuldigen.»
Sobald er jiddisch zu sprechen begann, veränderte sich sein ganzer Ausdruck. Er nahm eine so ernste, so trauervolle Miene an, daß ich glaubte, er würde jeden Augenblick in Tränen ausbrechen. Aber als ich seine Zuhörer ansah, bemerkte ich, daß sie leise kicherten. Je ernster und trauriger sein Ausdruck wurde, desto fröhlicher wurden sie. Am Schluß bogen sie sich vor Lachen. Nahoum Youd ließ auch nicht das leiseste Lächeln sehen. Er endete mit unbewegtem Ausdruck unter einem Sturm von Gelächter.
«Jetzt», sagte er, wobei er seiner Zuhörerschaft den Rücken zuwandte und uns beide unterhakte, «gehen wir irgendwohin und hören uns Musik an. Ich kenne ein kleines Lokal in der Hester Street, in einem Keller. Mit rumänischen Zigeunern. Dort trinken wir ein Glas Wein und unterhalten uns über die Mysterien, ja? Haben Sie Geld? Ich habe nur dreiundzwanzig Cents.»
Er lächelte wieder, diesmal wie ein riesiger Blaubeerkuchen. Beim Weitergehen nickte er immer wieder dem einen oder anderen mit gezogenem Hut zu. Manchmal blieb er stehen und knüpfte ein paar Augenblicke ein ernstes Gespräch mit einem Freund an.
«Entschuldigen Sie mich», sagte er dann, indem er atemlos zu uns zurückgerannt kam, «aber ich dachte, ich könnte vielleicht ein wenig Geld pumpen. Es war der Redakteur einer jiddischen Zeitung, aber er ist noch mehr im Druck als ich. Sie haben doch ein wenig Geld, ja? Das nächste Mal bin ich der Zahler.»
In dem rumänischen Lokal traf ich unvermutet einen meiner ehemaligen Telegrammboten, Dave Olinski. Er hatte Nachtdienst im Büro in der Grand Street verrichtet. Ich erinnerte mich gut an ihn, denn in der Nacht, in der das Büro ausgeraubt und der Geldschrank auf den Kopf gestellt wurde, war Olinski um Haaresbreite totgeschlagen worden. (Um ehrlich zu sein, ich war überzeugt gewesen, daß er tot sei.) Ich hatte ihn auf seinen eigenen Wunsch diesem Büro zugeteilt, da es in einem Ausländerviertel gelegen war und er acht Sprachen beherrschte. Olinski glaubte, sich dort eine Menge Trinkgelder verdienen zu können. Er war bei allen verhaßt, auch bei seinen Kollegen, mit denen er zusammenarbeitete. Jedesmal, wenn ich ihn traf, schwätzte er mir die Ohren voll von Tel Aviv. Immer war es Tel Aviv und Boulogne-sur-Mer. (Er trug Ansichtskarten von allen Häfen bei sich, wo sein Schiff angelegt hatte. Aber die meisten waren Ansichten von Tel Aviv.) Jedenfalls sandte ich ihn einmal, vor dem «Unfall», nach Canarsie, wo es eine plage gab. Ich wähle das Wort plage, weil Olinski jedesmal, wenn er von Boulogne-sur-Mer sprach, diese verflixte «plage» zitierte, an der er gebadet hatte.
Nach Aufgabe seiner Stellung bei uns sei er Versicherungsagent geworden, erzählte er mir. Tatsächlich hatten wir noch kaum ein paar Worte gewechselt, als er mich dazu zu überreden versuchte, eine Versicherung abzuschließen.
Trotz meiner Abneigung gegen den guten Mann tat ich nichts, ihn zum Schweigen zu bringen. Ich dachte, es täte ihm gut, sich an mir zu üben. Daher ließ ich ihn, sehr zu Nahoum Youds Verdruß, darauflosschwätzen, indem ich so tat, als beabsichtige ich, auch eine Unfall-, Kranken- und Feuerversicherung einzugehen. Inzwischen hatte Olinski für uns Getränke und Backwerk bestellt. Mona hatte den Tisch verlassen, um mit der Inhaberin des Lokals ein Gespräch anzuknüpfen. Mitten darin kam ein Rechtsanwalt namens Mannie Hirsch herein, gleichfalls ein Freund Arthur Raymonds. Er war ein leidenschaftlicher Musikliebhaber, der besonders für Skriabin schwärmte. Olinski, der gegen seinen Willen ins Gespräch gezogen wurde, brauchte eine gute Weile, um zu begreifen, wer das war, von dem wir sprachen. Als er merkte, daß es sich nur um einen Komponisten handelte, wurde er sehr unwillig. Sollten wir nicht vielleicht besser an einen ruhigeren Ort gehen? fragte er. Ich erklärte ihm, daß das nicht ginge, er möge sich beeilen und mir alles erklären, ehe wir gingen. Mannie Hirsch hatte von dem Augenblick an, als er sich hingesetzt hatte, unaufhörlich geredet. Bald machte Olinski sich erneut daran, seine Versicherungen anzupreisen, indem er von einer Sparte zur anderen überging; er mußte sehr laut sprechen, um die Stimme von Mannie Hirsch zu übertönen. Ich hörte gleichzeitig beide an. Nahoum Youd versuchte mit hinters Ohr gelegter Hand zuzuhören. Schließlich brach er in ein tolles Gelächter aus. Ohne ein weiteres Wort begann er eine seiner Fabeln auf jiddisch zu rezitieren. Olinski sprach trotzdem weiter, diesmal sehr leise, aber noch schneller als zuvor, denn jede Minute schien ihm kostbar. Sogar als das ganze Lokal sich vor Lachen bog, ließ er nicht ab, mir eine Versicherung nach der anderen anzupreisen.
Als ich ihm schließlich sagte, ich müßte es mir noch überlegen, machte er ein tödlich beleidigtes Gesicht. «Aber ich habe Ihnen doch alles deutlich erklärt, Mister Miller», seufzte er.
«Ich bin aber schon zwei Versicherungen eingegangen», log ich.
«Das macht nichts», erwiderte er, «wir werden sie ablösen und in bessere umwandeln.»
«Das eben möchte ich mir überlegen», gab ich rasch zur Antwort.
«Aber es gibt da nichts zu überlegen, Mister Miller.»
«Ich bin nicht sicher, alles verstanden zu haben», sagte ich. «Vielleicht kommen Sie besser morgen abend zu mir.» Damit schrieb ich ihm eine falsche Adresse auf.
«Sind Sie sicher, daß Sie zu Hause sein werden, Mister Miller?»
«Wenn ich nicht da bin, rufe ich Sie an.»
«Aber ich habe kein Telefon, Mister Miller.»
«Dann schicke ich Ihnen ein Telegramm.»
«Aber ich habe schon zwei Verabredungen für morgen abend.»
«Dann sagen wir übermorgen», schlug ich vor, völlig ungerührt von dem ganzen Palaver. «Oder Sie könnten mich auch nach Mitternacht aufsuchen, wenn Ihnen das besser paßt», fügte ich arglistig hinzu. «Wir gehen nie vor zwei oder drei Uhr zu Bett.»
«Ich fürchte, das wird zu spät», sagte Olinski, der ein immer unglücklicheres Gesicht machte.
«Nun gut, schauen wir mal, was sich machen läßt», sagte ich, setzte eine nachdenkliche Miene auf und kratzte mich am Kopf. «Wenn wir uns heute in einer Woche hier treffen würden? Sagen wir Punkt halb zehn.»
«Bitte nicht hier, Mister Miller.»
«Na dann, wo Sie wollen. Schreiben Sie mir in ein paar Tagen eine Postkarte. Und bringen Sie alle Antragsformulare mit, ja?»
Während dieses letzten Geredes war Olinski vom Tisch aufgestanden und hatte abschiednehmend meine Hand ergriffen. Als er sich umwandte, um seine Papiere zusammenzulesen, sah er, daß Mannie Hirsch Tiere darauf zeichnete. Auf ein anderes Blatt schrieb Nahoum Youd ein Gedicht auf jiddisch. Über diese unerwartete Wendung der Dinge geriet er so aus dem Häuschen, daß er die beiden gleichzeitig in verschiedenen Sprachen anzuschreien begann. Er wurde purpurrot vor Wut. Im nächsten Augenblick hatte der Ordnungsmann, der ein Grieche und ehemaliger Ringkämpfer war, Olinski am Hosenbund ergriffen und beförderte ihn zum Lokal hinaus. Die Inhaberin ballte ihm die Faust ins Gesicht, als er, Kopf voran, durch die Tür flog. Auf der Straße durchsuchte ihm der Grieche die Taschen, zog ein paar Geldscheine daraus hervor und brachte sie der Inhaberin, die davon die Rechnung abzog und das restliche Wechselgeld Olinski hinwarf, der jetzt auf allen vieren kroch, als habe er Krämpfe.
«Ich finde es schrecklich, jemanden so zu behandeln», meinte Mona.
«Das ist wahr, aber er scheint dazu herauszufordern», erwiderte ich.
«Du hättest ihn nicht reizen sollen – es war grausam.»
«Das gebe ich zu, aber er ist eine Pestbeule. Es wäre auf jeden Fall passiert.»
Damit begann ich meine Verdrießlichkeit mit Olinski zu erzählen. Ich berichtete, wie ich ihn geduldig von einem Büro ins andere versetzt hatte. Überall war es das gleiche alte Lied. Wenn man ihn hörte, wurde er immer und überall mißachtet und schlecht behandelt – «ohne jeden Grund». «Man mag mich dort nicht», war seine ständige Redensart.
«Man scheint Sie nirgendwo zu mögen», sagte ich schließlich eines Tages zu ihm. «Was wurmt Sie denn so?»
Ich erinnere mich gut an den Blick, den er mir zuwarf, als ich ihm das ins Gesicht sagte.
«Los, sagen Sie es mir», drängte ich ihn, «denn das ist Ihre letzte Chance.»
Seine Antwort verblüffte mich: «Mister Miller, ich besitze zuviel Ehrgeiz, um einen guten Boten abzugeben. Ich müßte einen verantwortungsreichen Posten haben. Bei meiner Bildung gäbe ich einen guten Direktor ab. Ich würde der Gesellschaft Gelder sparen. Ich könnte ihren Umsatz steigern, einen größeren Gewinn erzielen.»
«Warten Sie mal einen Augenblick», unterbrach ich ihn, «wissen Sie nicht, daß Sie nicht die geringste Aussicht von der Welt haben, Direktor einer Filiale zu werden? Bei Ihnen piept es wohl. Sie können nicht einmal richtig Englisch, ganz zu schweigen von den acht anderen Sprachen, von denen Sie immer faseln. Sie verstehen nicht mit Ihren Mitarbeitern auszukommen. Sie sind ein Krebsschaden, begreifen Sie das nicht? Erzählen Sie mir nichts von Ihren großen Zukunftsideen, sagen Sie mir nur eines: wie ging es zu, daß Sie geworden sind, was Sie sind – nämlich solch eine vermaledeite, unausstehliche Pestbeule?»
Olinski blinzelte wie ein Nachtvogel.
«Mister Miller», begann er, «Sie müssen wissen, daß ich ein anständiger Mensch bin, daß ich mir alle Mühe gebe, um … »
«Quatsch!» rief ich. «Jetzt sagen Sie mir ehrlich, warum Sie überhaupt von Tel Aviv weggegangen sind?»
«Weil ich etwas aus mir machen wollte, da haben Sie die Wahrheit.»
«Und das konnten Sie nicht in Tel Aviv – oder in Boulogne-sur-Mer?»
Er setzte ein schiefes Lächeln auf. Ehe er ein Wort einwerfen konnte, fuhr ich fort: «Haben Sie sich mit Ihren Eltern vertragen? Hatten Sie dort irgendwelche gute Freunde? Warten Sie einen Augenblick –» ich hob die Hand, um seine Antwort abzuschneiden – «hat Ihnen je ein Mensch auf der ganzen weiten Welt gesagt, daß er Sie mag? Darauf antworten Sie mir!»
Er blieb stumm. Er war nicht zerschmettert, nur aus der Fassung gebracht.
«Wissen Sie, was Sie sein sollten?» fuhr ich fort. «Ein Polizeispitzel.»
Er kannte die Bedeutung des Wortes nicht.
«Passen Sie auf», erklärte ich, «ein Polizeispitzel verdient sein Brot damit, daß er die anderen ausspioniert, sie denunziert, verstehen Sie?»
«Und ich sollte ein Polizeispitzel werden?» kreischte er, warf sich in die Brust und versuchte, sich ein würdevolles Aussehen zu geben.
«Genau das», sagte ich ohne Wimperzucken. «Und wenn nicht das, dann ein Henker. Sie wissen –» ich fuhr mit der Hand bedeutungsvoll um den Hals – «der Mann, der die anderen aufhängt.»
Olinski setzte seinen Hut auf und machte ein paar Schritte zur Tür hin. Plötzlich kehrte er auf dem Absatz um und kam ruhig zu meinem Schreibtisch zurück. Er nahm seinen Hut ab und hielt ihn in beiden Händen.
«Entschuldigen Sie», sagte er, «aber dürfte ich noch einmal mein Glück in Harlem versuchen?»
Das in einem unveränderten Ton, als sei nichts Peinliches passiert.
«Aber gewiß doch», antwortete ich unbeschwert. «Ich gebe Ihnen noch eine Chance, aber es ist die letzte, denken Sie daran. Sie fangen an, mir sympathisch zu werden, wissen Sie das?»
Das brachte ihn mehr aus der Fassung als alles, was ich bisher gesagt hatte. Ich war erstaunt, daß er mich nicht nach dem Warum fragte.
«Hören Sie zu, Dave», sagte ich und beugte mich zu ihm vor, als hätte ich ihm etwas ganz Vertrauliches mitzuteilen, «ich stecke Sie in das schlimmste Büro, das wir haben. Wenn Sie dort zurechtkommen können, dann kommen Sie überall durch. Vor einem aber möchte ich Sie warnen: fangen Sie in diesem Büro keine Geschichten an oder –» und hier fuhr ich mir mit der Hand über den Hals – «verstanden?»
«Sind dort die Trinkgelder gut, Mister Miller?» fragte er und tat so, als hätte ihn meine letzte Bemerkung nicht berührt.
«In diesem Viertel gibt kein Mensch ein Trinkgeld, mein lieber Freund. Und versuchen Sie ja nicht, eines herauszuquetschen. Danken Sie Gott jeden Abend, wenn Sie heimkommen, daß Sie noch am Leben sind. Wir haben in den letzten drei Jahren acht Boten in diesem Büro verloren. Ziehen Sie selber Ihre Schlußfolgerungen.»
Hier stand ich auf, ergriff ihn am Arm und geleitete ihn zur Treppe.
«Hören Sie zu, Dave», sagte ich, als wir uns die Hände schüttelten, «vielleicht bin ich Ihr Freund, und Sie wissen es nicht. Sie werden mir noch eines Tages dafür danken, daß ich Sie in das schlimmste Büro von New York gesteckt habe. Sie haben noch so viel zu lernen, daß ich nicht weiß, was ich Ihnen zuerst sagen soll. Vor allem, versuchen Sie den Mund zu halten. Lächeln Sie lieber einmal, auch wenn es Ihnen schwerfällt. Sagen Sie danke, auch wenn Sie kein Trinkgeld bekommen. Sprechen Sie nur eine Sprache und die so wenig wie möglich. Denken Sie nicht mehr daran, Direktor werden zu wollen. Seien Sie ein tüchtiger Bote. Und erzählen Sie den Leuten nicht, daß Sie aus Tel Aviv kommen, denn sie werden nicht wissen, von was zum Teufel Sie reden. Sie sind in Bronx geboren, verstanden? Wenn Sie nicht wissen, wie Sie handeln sollen, dann spielen Sie einfach den Dummkopf, den Schlemihl, kapiert? Da haben Sie was, damit Sie ins Kino gehen können. Sehen Sie sich zur Abwechslung mal einen lustigen Film an. Und daß mir nichts über Sie zu Ohren kommt!»
Als ich an diesem Abend mit Nahoum Youd zur Untergrundbahn ging, erwachten in mir lebhafte Erinnerungen an meine nächtlichen Bummelfahrten mit O'Rourke. Ich suchte immer das East End auf, wenn ich bis ins Innerste aufgewühlt sein wollte. Es war wie eine Heimkehr. Alles dort war mir geheimnisvoll vertraut. Es war fast, als hätte ich die Welt des Gettos in einer früheren Inkarnation gekannt. Was mich am meisten gefangennahm, war das Gewimmel. Alles zappelte in einem glorreichen Überfluß, um ans Licht zu kommen. Alles schillerte wie auf den helldunklen Bildern Rembrandts. Man wurde dauernd überrascht, oft durch die einfachsten Kleinigkeiten. Es war die Welt meiner Kindheit, in der mir die gewöhnlichen Alltagsdinge heilig wurden. Diese armen, verachteten Ausländer lebten zwischen Gegenständen, die von einer fortschrittlichen Welt längst in den Winkel geworfen worden waren. Für mich lebten sie in einer jäh erloschenen Vergangenheit weiter. Ihr Brot war noch immer ein gutes Brot, das man auch ohne Butter oder Marmelade essen konnte. Ihre Petroleumlampen gaben ihren Wohnungen einen vertraut-frommen Schimmer. Das Bett war immer breit und einladend, die Möbel waren altmodisch, aber bequem. Es war für mich eine ständige Quelle des Staunens, zu sehen, wie sauber und ordentlich die Häuslichkeiten dieser scheußlichen Gebäude waren, die in Trümmern zu zerfallen schienen. Nichts kann ansprechender sein als ein von allem entblößtes, armes, aber sauberes Heim. Ich habe auf der Suche nach sich herumtreibenden Boten Hunderte solcher Heime gesehen. Viele der unerwarteten Szenen, in die wir mitten in der Nacht hineinplatzten, waren wie bebilderte Seiten des Alten Testaments. Wir traten ein, auf der Suche nach einem jungen Missetäter oder einem kleinen Dieb, und gingen fort mit dem Gefühl, mit den Söhnen Israels das Brot geteilt zu haben. Die Eltern hatten gewöhnlich keine Ahnung von der Welt, in die ihre Kinder eingedrungen waren, als sie sich der Schar der Boten zugesellten. Kaum einer von ihnen hatte jemals den Fuß in ein Büro gesetzt. Sie waren von einem Getto ins andere verpflanzt worden, ohne zwischendurch auch nur einen flüchtigen Blick auf die Welt erhascht zu haben. Manchmal kam mich die Lust an, die Eltern in den Geschäftsraum einer Börse zu führen, damit sie ihren Sohn inmitten des wilden Tohuwabohus der außer Rand und Band geratenen Börsenmakler wie einen Feuerwehrspritzenwagen hin und her sausen sahen, bei diesem erregend-einträglichen Spiel, das einem Jungen manchmal in einer einzigen Woche fünfundsiebzig Dollar zu verdienen erlaubte. Einige dieser «Jungen» blieben «Jungen», obwohl sie schon das Alter von dreißig oder vierzig Jahren erreicht hatten und – manche von ihnen – Besitzer von Grundstücken, Farmen, Mietshäusern oder erstklassigen Wertpapieren geworden waren. Viele von ihnen hatten Bankkonten von über zehntausend Dollar. Trotzdem blieben sie Boten und würden bis ans Ende ihrer Tage Boten bleiben.
Was für eine ungereimte Welt für einen Einwanderer, der plötzlich in sie hineingeriet! Ich konnte mich kaum selbst darin zurechtfinden. War ich nicht mit allen Vorteilen einer amerkanischen Erziehung (in meinem achtundzwanzigsten Lebensjahr) gezwungen gewesen, mich um diesen bescheidensten aller Posten zu bewerben? Und gelang es mir nicht nur mit äußerster Schwierigkeit, sechzehn oder siebzehn Dollar in der Woche zu verdienen? Bald würde ich diese Welt verlassen, um meinen Weg als Schriftsteller zu machen, und dann würde ich noch hilfloser dastehen als der ärmste dieser Einwanderer. Bald würde ich abends heimlich, sogar in nächster Nähe meiner eigenen Wohnung, auf den Straßen betteln. Bald vor den Fenstern der Restaurants stehen, um voll Verlangen und Verzweiflung die köstlichen Sachen zum Essen zu betrachten. Bald den Zeitungsverkäufern dafür danken, daß sie mir einen Groschen für eine Tasse Kaffee oder einen Mürbekuchen gaben.
Ja, lange bevor sie Wirklichkeit wurden, dachte ich an solche Möglichkeiten. Vielleicht war mir unser neues Liebesnest darum so lieb und wert, weil ich wußte, daß es nicht lange Bestand haben konnte. Ich nannte es unser «japanisches» Liebesnest, weil es so luftig möbliert und makellos war, der niedrige Diwan mitten im Zimmer stand, die Beleuchtung genauso war, wie sie sein sollte, es keinen Gegenstand zuviel gab, die Wände in heiter-zartem Licht schimmerten und das Parkett glänzte, als ob es jeden Morgen gewachst und gebohnert würde. Unbewußt taten wir alles in einer rituellen Art. Die Wohnung verlangte das. Ursprünglich für einen reichen Bewohner geschaffen, hausten darin zwei Verliebte, die nur inneren Reichtum besaßen. Jedes der Bücher auf den Stellagen war unter Opfern erworben und mit Genuß verschlungen worden und hatte unser Leben bereichert. Sogar die völlig zerrissene Bibel hatte ihre Geschichte.
Eines Tages, als ich das Bedürfnis empfand, eine Bibel zu besitzen, hatte ich Mona fortgeschickt, um eine zu besorgen. Ich ermahnte sie, sie nicht zu kaufen.
«Bitte jemanden, dir seine zu schenken. Wende dich an die Heilsarmee oder eine Wohltätigkeitsorganisation.»
Sie hatte getan, was ich ihr riet: ohne Erfolg. (Verdammt seltsam! dachte ich bei mir.) Dann, wie als Antwort auf ein Gebet, wer fällt aus heiterem Himmel ins Haus? Der verrückte George! Er sitzt da und erwartet mich, als ich an einem Samstag nachmittag nach Hause komme. Und Mona bewirtet ihn mit Tee und Kuchen. Ich glaubte, ein Gespenst zu sehen.
Mona wußte natürlich nicht, daß er der verrückte George war, eine Gestalt aus meiner Kindheit. Sie hatte einen Mann mit einem Gemüsekarren auf dem Spritzbrett stehen sehen und das Wort Gottes predigen hören. Die Kinder machten sich über ihn lustig, bewarfen ihn mit allem möglichen, und er (die Peitsche in der Hand) segnete sie mit den Worten: «Lasset die Kindlein zu mir kommen. Gesegnet seien die Sanftmütigen und Erniedrigten … »
«George», sagte ich, «erinnern Sie sich nicht mehr an mich? Sie haben immer die Kohlen und das Holz zu uns gebracht. Ich bin aus der Driggs Avenue im 14. Bezirk.»
«Ich erinnere mich an alle Kinder Gottes», versetzte George. «Sogar bis ins dritte und vierte Glied. Sei gesegnet, mein Sohn, möge der Heilige Geist immer in dir wohnen.»
Ehe ich auch nur ein Wort hatte hinzusetzen können, hatte George nach seiner alten Gewohnheit begonnen, feierliche Reden zu halten: «Ich bin der, so für sich selbst zeugt, und mein Vater, der mich gesandt hat, legt Zeugnis für mich ab. Amen! Halleluja! Gelobt sei der Herr!»
Ich stand auf und schloß George in die Arme. Er war jetzt ein Greis, ein geistesverwirrter, friedlicher, liebenswerter Greis geworden; der letzte Mensch, den ich in meinem Haus erwartet hätte. Er war für uns Buben eine furchteinflößende Gestalt gewesen, die immer diese lange Peitsche über uns knallen ließ und uns ewige Verdammnis, Feuer und Schwefel androhte. Er schlug wütend auf sein Pferd ein, wenn es auf dem Glatteis des Pflasters ausglitt, erhob die Faust zum Himmel und flehte Gott an, uns für unsere Bosheiten zu bestrafen. Welche Schikanen taten wir ihm damals an! «Der verrückte George! Der verrückte George!» schrien wir, bis wir blau im Gesicht waren. Dann bewarfen wir ihn mit Schnee, mit fest zusammengepreßten, eisverhärteten Schneebällen, die ihn manchmal zwischen die Augen trafen und vor Wut mit dem Fuß aufstampfen ließen. Und während er wie ein Dämon einen von uns verfolgte, stahl ihm ein anderer sein Gemüse oder seine Früchte oder kippte einen Sack Kartoffeln in den Rinnstein. Kein Mensch wußte, wie er so geworden war. Es schien, als habe er von Kindesbeinen an das Wort Gottes von seinem Karren herab gepredigt. Er war wie einer der Propheten aus alter Zeit und auch ebenso schmuddelig wie manche der großen biblischen Propheten.
Zwanzig Jahre waren vergangen, seitdem ich George Danton zum letztenmal gesehen hatte. Und nun war er wieder da und sprach zu mir von Jesus, dem Licht der Welt.
«Und der mich gesandt hat», sagte er, «ist mit mir. Der Vater hat mich nicht verlassen, weil ich immer tue, was ihm wohlgefällig ist … Ihr werdet die Wahrheit wissen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen, mein Bruder! Möge die Gnade Gottes mit dir sein und dich beschirmen!»
Es hatte wenig Sinn, einen Menschen wie George zu fragen, was er in all diesen Jahren getrieben habe. Seine Tage waren vermutlich wie ein Traum verstrichen. Es war deutlich zu sehen, daß er keinen Gedanken an das Morgen verschwendete. Er zog weiter mit seinem Pferd und seinem Karren durch die Stadt, ganz so, als ob es das Automobil nicht gäbe. Seine Peitsche lag neben ihm auf dem Boden: er trennte sich nie von ihr.
Ich bot ihm eine Zigarette an. Mona hatte eine Flasche Portwein in der Hand.
«Das Königreich Gottes», sagte George und hob zum Zeichen der Ablehnung den Arm, «besteht nicht in Essen oder Trinken; es ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist … Es ist gut, kein Fleisch zu essen, keinen Wein zu trinken, nichts zu tun, was deinen Bruder straucheln lassen, ihn beleidigen oder schwach werden lassen könnte.»
Eine Pause trat ein, während der Mona und ich einen Schluck Portwein tranken.
Als sehe und höre er nichts, fuhr George fort: «Wißt ihr nicht, daß euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott empfangen habt, und daß ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr wurdet teuer erkauft, deshalb verherrlichet Gott in euerem Leib und euerem Geist, denn sie gehören Gott an. Amen! Amen!»
Nicht spöttisch, sondern leise und natürlich begann ich zu lachen – berauscht von der Heiligen Schrift. Das machte George wenig aus. Genau wie ehemals fuhr er fort zu predigen. Er sprach zu uns nicht wie zu Menschen, sondern eher wie zu Gefäßen, in die er die segenbringende Milch der heiligen Jungfrau goß. Er sah nichts von den materiellen Dingen, die ihn umgaben. Ein Zimmer war für ihn wie jedes andere, und keines besser als der Stall, in den er seine Pferde führte. (Er schlief vermutlich bei ihnen.) Nein, er hatte eine Sendung zu erfüllen, und das brachte ihm Freude und Vergessen. Von morgens bis Mitternacht verbreitete er eifrig Gottes Wort. Sogar beim Einkaufen seiner Ware predigte er das Evangelium.
Welch schönes, ungebundenes Leben, dachte ich bei mir. Verrückt? Gewiß war er verrückt, völlig verrückt. Aber in einem schönen Sinne. George tat in Wirklichkeit nie jemandem mit seiner Peitsche weh. Er knallte gerne mit ihr, einzig um den bösen Buben zu zeigen, daß er doch nicht ganz ein alter, schutzloser Dummkopf sei.
«Widersteht dem Teufel», fuhr George fort, «und er wird euch fliehen. Nähert euch Gott, und er wird sich euch nähern. Reiniget euere Hände, ihr Sünder; läutert euere Herzen, ihr Zwiespältigen. Erniedrigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen.»
«George», sagte ich, indem ich das aufsteigende Lachen unterdrückte, «Sie tun mir gut. Es ist so lange her.»
«Lob und Preis sei unserem Gott, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamm. Beleidigt nicht die Erde, das Meer und die Bäume, bis wir die Diener unseres Herrn mit dem Siegel auf der Stirne gezeichnet haben.»
«Schön, schön! Hören Sie, George, erinnern Sie sich … »